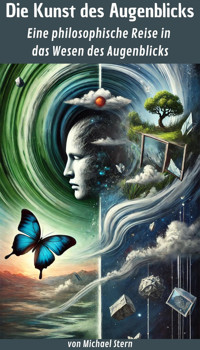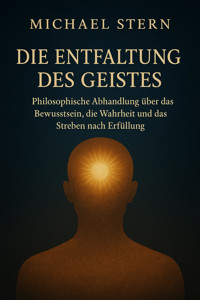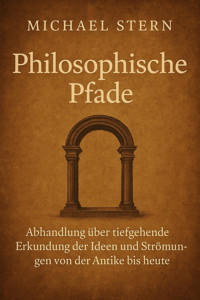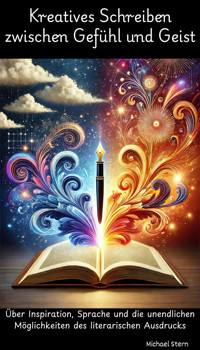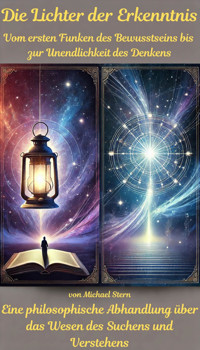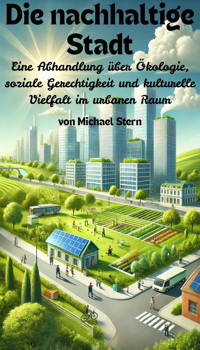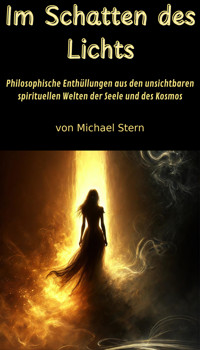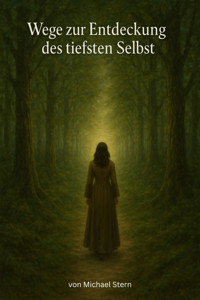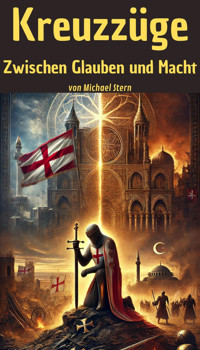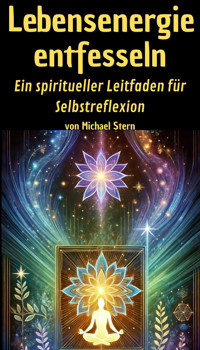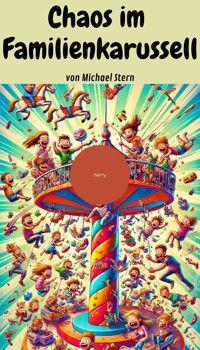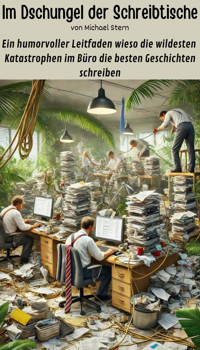24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Abhandlung entführt Sie in die faszinierende Welt Napoleons, eines Mannes, der Europa geprägt hat wie kaum ein anderer. Vom korsischen Außenseiter zum Kaiser Frankreichs – erleben Sie, wie Napoleon die politischen, militärischen und gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit revolutionierte. Die französische Revolution war der Boden, auf dem er aufstieg, doch er formte das Erbe dieser Zeit nach seinen Vorstellungen. Sein Einfluss reichte weit über die Schlachtfelder hinaus: Mit dem Code Civil schuf er ein Rechtswerk, das bis heute gilt, und seine Reformen in Verwaltung, Bildung und Infrastruktur legten den Grundstein für die moderne Gesellschaft. Gleichzeitig war er ein umstrittener Herrscher, der mit eiserner Hand regierte, politische Opposition unterdrückte und Europa in einen nie dagewesenen Kriegszustand versetzte. Die Abhandlung zeichnet Napoleons Leben in all seinen Facetten nach: den glanzvollen Aufstieg, die triumphalen Siege wie bei Austerlitz, seine revolutionären Reformen, aber auch seine verheerenden Niederlagen, etwa beim Russlandfeldzug. Sie erfahren, wie er die europäische Landkarte neu ordnete, Deutschland und Italien auf den Weg zu modernen Nationalstaaten brachte und mit der Kontinentalsperre gegen Großbritannien wirtschaftliche Spannungen auslöste. Doch Napoleon war mehr als nur ein militärisches Genie. Sein Charisma, seine visionären Reformen und sein Hang zur Inszenierung machten ihn zur Ikone. Gleichzeitig zeigt die Abhandlung auch seine Schwächen: den autoritären Führungsstil, die hohen Opfer durch seine Kriege und den Widerspruch zwischen den Idealen der Revolution und der Realität seiner Herrschaft. Die Abhandlung geht über Europa hinaus und beleuchtet Napoleons globalen Einfluss: von Lateinamerika bis Nordafrika. Sie zeigt, wie seine Politik Revolutionen inspirierte und das geopolitische Gleichgewicht verschob. Tauchen Sie ein in die Ära Napoleons, die Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Diese Abhandlung bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, das Leben und Erbe eines der bedeutendsten Menschen der Geschichte zu verstehen. Spannend, tiefgründig und inspirierend – ein Muss für alle Geschichtsbegeisterten! viel Spass beim lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
EINLEITUNG
Im weiten Gewebe der Menschheitsgeschichte finden sich Momente, in denen eine einzige Person unverhältnismäßig viel Einfluss auf das Geschehen nimmt und den Lauf der Ereignisse in eine neue Richtung lenkt. Solche Persönlichkeiten üben eine Faszination aus, weil sie uns begreiflich machen, wie weit individuelle Willenskraft, taktische Überlegenheit und Charisma reichen können. Im europäischen Kontext ist Napoleon Bonaparte eine dieser Leitfiguren, die mit allen Widersprüchen behaftet bleibt: Er war ein Kind der Französischen Revolution, trug das revolutionäre Erbe zunächst weiter und führte es sogleich wieder ad absurdum, indem er sich selbst zum Kaiser der Franzosen krönte. Einst war er der junge General, gefeiert für seine Siege in Italien, dann der mächtige Monarch, der den Kontinent im Griff hatte, später der Gefangene auf einer abgelegenen Atlantikinsel und schließlich die unsterbliche Gestalt in den Köpfen von Generationen. Es ist eine Geschichte, reich an Heldentum und Tragik, mit Höhenflügen und dramatischen Stürzen – ein Stoff, der Romantik, Rationalität, Blut, Tränen, Genie und Despotie in sich vereinigt.
Diese Abhandlung, die in zwanzig Kapiteln die Epoche Napoleons darstellt, will ein Gesamtbild jener Zeit zeichnen, in der Europa nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in Gesetzeswerken, Bildungsreformen, Stadtplanungen und Gesellschaftsstrukturen gewaltige Wandlungen erlebte. Denn die Legende vom allmächtigen Feldherrn, der Schlachten reihenweise gewinnt, greift zu kurz. Napoleon ist auch der Mann, der den Code Civil einführte, ein einheitliches Rechtssystem, das in Teilen bis heute wirkt. Er ist derjenige, der Salons, Theater und Kunst prägen ließ und mit einem ausgeklügelten Schulwesen künftige Beamte formte. Ebenfalls ist er derjenige, der Frauen in vielen Belangen den Zugang zu politischen Rechten verwehrte und die patriarchalische Ordnung zementierte, selbst wenn er in seiner Rhetorik die Ideen von Freiheit und Gleichheit betonte. Gerade diese Widersprüche verleihen ihm jene Strahlkraft, die nie ganz verebbt.
Doch was macht den Kontext so einzigartig, in dem Napoleon wirkte? Die Französische Revolution hatte vor 1789 das alte Ancien Régime in Frage gestellt und den Adel, die Kirche sowie die feudale Ständegesellschaft erschüttert. Als das Blutvergießen der Jakobinerherrschaft abebbte, suchte Frankreich nach einer stabilen Ordnung. Manches sprach dafür, in den Republikanischen Strukturen zu verharren, aber interne Machtkämpfe, Krieg an mehreren Fronten und ein schwaches Direktorium ließen die Lage brüchig erscheinen. Genau in dieser Lücke tauchte Napoleon auf, erst als junger siegreicher General, der dem Land Siege in Italien schenkte, später als politisches Ausnahmetalent, der die Geschicke der Republik in seine Hand legte. Der „Staatsstreich des 18. Brumaire“ machte ihn zum Ersten Konsul, einer Position, die anfänglich scheinbar noch in die Logik einer Republik passte. Tatsächlich folgte jedoch innerhalb weniger Jahre sein Griff nach der Kaiserkrone.
Die Zeitgenossen konnten kaum glauben, wie rasch ein Mann aus korsischem Kleinadel, der einst noch voller Ressentiments gegen das königliche Frankreich gewesen war, zum obersten Hüter des Staates aufstieg. Dabei spielte Napoleons geschickte Propaganda eine maßgebliche Rolle. Von Anfang an verstand er es, Schlachteneindrücke zu bündeln, in Zeitungsartikeln zu zelebrieren und sich als Retter der Nation zu inszenieren. Rundfunksender gab es nicht, das Fernsehen war noch Zukunftsmusik, doch allein mit Druckerzeugnissen, Bildern, Gemälden und Proklamationen erreichte Napoleon eine wirkmächtige Öffentlichkeit. Die Soldaten seiner Armee verehrten ihn, weil er sich nahbar zeigte, ein straffes Disziplinregime pflegte, aber durchaus Talent belohnte und das altmodische Prinzip, wonach der Adel allein Führungspositionen besetzt, aufweichte. Bürgerliche junge Offiziere konnten dank Napoleons meritokratischen Ansatz aufsteigen – eine Erbschaft der Revolution.
Der Alltag der französischen Gesellschaft änderte sich ebenfalls. Bauern, die einst unter der schweren feudalen Last stöhnten, konnten ihre Ländereien behalten oder ausweiten. Zwar blieben Steuern hoch, vor allem, weil die Armee finanziert werden musste, doch die Zentralisierung minderte die Willkür lokaler Fürsten. Wer in städtischen Regionen lebte, spürte den Umbau der Infrastruktur: Neue Straßen, Brücken, Prachtbauten, die nicht allein für militärische Paraden angelegt wurden, sondern auch die Lebensader eines modernen Wirtschaftsraums darstellten. Im Bildungsbereich entstanden Lyzeen, in denen die Elite zur Loyalität und Effizienz geschult wurde. In jenen Schulen pflanzte sich allerdings auch ein gewisser Militarismus ein, denn das Kaiserreich brauchte fähige Offiziere und Beamte, die Gehorsam und Patriotismus als Tugenden verinnerlicht hatten.
Auf der politischen Ebene verschmolz Napoleon revolutionäre Symbole mit monarchischer Pracht. Er krönte sich 1804 in Notre-Dame de Paris selbst, der Papst war zwar anwesend, doch gewissermaßen als Randfigur. Indem Napoleon sich die Krone eigenhändig aufsetzte, demonstrierte er, er selbst stehe über den traditionell kirchlichen Weihen. So skizzierte er ein neues Herrschaftsmodell: Ein Kaiser, der seine Legitimation aus dem Volkswillen bezieht, zumindest formell in Plebisziten bestätigt, zugleich aber nach dem Vorbild römischer Imperatoren regiert. Diese kühne Synthese hatte in Europa noch kein Beispiel. Die Zeitgenossen waren hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und Furcht. War das eine Rettung vor dem Chaos der Revolution, oder ein Verrat an den Errungenschaften der Freiheit?
Militärisch verkörperte Napoleon eine gänzlich neue Art der Kriegsführung. Seine Armee, die Grande Armée, setzte auf Massenheere, Korps-System, schnelle Märsche, geschickte Aufteilung und vereinten Schlag an sensiblen Stellen. Wo einst träge Söldnerheere manövrierte, entfachte er das Feuer einer engagierten Soldaten-Schaft, die zumindest in den ersten Jahren von revolutionärem Eifer und nationalem Stolz erfüllt war. Die Siege bei Marengo, Austerlitz, Jena und Auerstedt schienen die Unbesiegbarkeit des Kaisers zu bestätigen. Europa erschien ihm zu Füßen zu liegen. Ein Flickenteppich deutscher Fürstentümer, zersplitterte italienische Staaten, schwächende Königreiche wie Preußen und Österreich – all das war Napoleons Spielfeld, das er neu ordnete. Er schuf den Rheinbund, machte Teile Italiens zu Vasallenstaaten, setzte Geschwister und Generäle auf ausländische Throne und knüpfte dynastische Verbindungen.
In dieser Phase war sein Mythos auf dem Zenit. Ob in Paris oder Mailand, ob im neu geformten Königreich Westphalen oder in den annektierten Provinzen – Napoleon ließ seine Symbole zurück: Medaillen mit seinem Konterfei, Triumphbögen, Denkmäler. Menschen berichteten von seiner Aura, seiner Gedächtnisleistung für Namen und Zahlen, seiner Detailversessenheit und seiner Willkür, niemandem zu vertrauen, der ihm widersprach. Doch genau in dieser atemlosen Expansionspolitik lauerte auch der Keim seiner Niederlage. Die Kontinentalsperre, die den britischen Handel ruinieren sollte, stürzte die europäischen Wirtschaften teils in tiefe Krisen. Verbündete Staaten wurden unwillig, kleine Untertanenvölker sehnten sich nach Befreiung, und die Kraft der Grande Armée reichte nicht, um in jedem Winkel Europas dauerhafte Präsenz zu zeigen.
Der Russlandfeldzug 1812 erwies sich als Markstein der Hybris. In Moskau, das die Russen in Flammen aufgehen ließen, blieb Napoleon nur Rauch und Schutt. Die furchtbare Kälte und Russlands Strategie der verbrannten Erde fraßen seine Armee auf. Von der Idee, den Zaren zu zwingen, schwenkte Napoleon in eine panikartige Flucht, und der Mythos von der Unbesiegbarkeit zerbrach. Doch selbst da gelang es ihm, in Paris den Schein einer Rückkehr zu erwecken. Er rief neue Rekruten auf, die so genannte „Marie-Louisen“, nach seiner zweiten Frau benannt. Doch die Kraft reichte nicht mehr für einen kompletten Sieg. In der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) wurde sein Imperium grundlegend erschüttert. Gegnerische Mächte – Österreich, Preußen, Russland, Schweden, Großbritannien – sammelten sich zu einer Riesenkraft, die den kränkelnden Riesen zu Boden drückte. 1814 sah die erste Abdankung, 1815 nach Waterloo die endgültige. Was blieb, war ein ruinöses Frankreich und ein Europa, das sich am Wiener Kongress neu formierte. Und doch war Napoleon nicht einfach nur ein gescheiterter Kriegsherr. Seine Verwaltungsreformen, sein Code Civil, seine Bildungsanstalten, die städtische Infrastruktur und die volksnahe Propaganda hinterließen Spuren, die über seinen persönlichen Untergang hinauswirkten.
Die Faszination erklärt sich auch daraus, dass Napoleon die zentrale Figur einer Epoche war, die die Welt veränderte. Die Säkularisation, die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, die Entstehung moderner Nationalstaaten, die Geburtsstunde Lateinamerikas als eigenständige Staatenwelt – all das hängt eng mit dem Sturz alter Mächte und Napoleons Abenteuern zusammen. Seine Niederlagen in Übersee oder im Russlandfeldzug führten zur Umverteilung globaler Macht, gaben Raum, dass Regionen wie die Vereinigten Staaten weiter expandierten, Lateinamerika eigenständige Republiken bildete. In Nordafrika, im Nahen Osten, in Teilen Asiens drangen die Folgen ebenfalls hindurch, sei es in Form orientalischer Modernisierungsversuche oder in der Festigung britischer Kolonialmacht.
Vergessen wir nicht die Kultur und Kunst, die Napoleon in seiner Hofhaltung förderte. Maler wie Jacques-Louis David schufen monumentale Gemälde, die den Kaiser in antiker Pose abbildeten. Schriftsteller und Intellektuelle, ob sie nun Befürworter waren oder zähneknirschende Untertanen, konstruierten ein Porträt des modernen Helden. Das neoklassizistische Zeitalter fand in Napoleon einen mächtigen Mäzen, der Bauwerke wie den Arc de Triomphe anordnete, Paläste umbauen ließ, den städtischen Raum in eine Prachtkulisse verwandelte. Wer durch Paris streift, fühlt noch immer den Geist jener Phase, in der Breite, Symmetrie und Imperatoren Pathos als staatliche Repräsentation zusammenfanden.
Besonders ambivalent erscheint Napoleons Haltung zu Freiheit und Gleichheit. Auf der einen Seite brach er alte Feudalordnungen, verankerte das Prinzip der bürgerlichen Gleichheit im Recht, eröffnete Talenten aus bescheidenen Verhältnissen den Zugang zur militärischen oder administrativen Karriere. Auf der anderen Seite war er unnachgiebig gegen politische Opposition, knebelte die Presse, setzte Zensur ein, überging Volksvertretungen und zeigte keinerlei Skrupel, ganze Landstriche in den Krieg zu reißen. Auch die Rückkehr zur Sklaverei in den französischen Kolonien wirft ein finsteres Licht auf diesen Mann, der sich so gern als Fortschrittsträger darstellte. Die Brutalität, mit der in Spanien das Volk unterdrückt wurde, oder in Ägypten Soldaten als Besatzungsmacht auftraten, offenbart wenig Philanthropie, sondern vielmehr den Willen zur totalen Kontrolle.
Wie kann man das in einem geschichtlichen Kontext fassen? Napoleon verkörpert den „modernen Diktator“, der sich durch revolutionäre Legitimation ausweist, nationale Begeisterung entfacht, die Institutionen zentralisiert und zugleich auf traditionelle Prachtgesten setzt. Seine Querverbindung zur römisch-antiken Symbolik, verbunden mit den Losungen von 1789, ergab jenen unnachahmlichen Stilmix: Er war nicht reiner Reaktionär, nicht reiner Revolutionär. Vielleicht war er die erste Gestalt, die zeigte, dass beides sich verbinden lässt – die revolutionäre Energie des Volkes zu nutzen, um autokratische Herrschaft zu festigen. Die Moderne hat zahlreiche Varianten dieses Modells erlebt.
Darum bleibt Napoleon nicht nur ein Kapitel in der Militärgeschichte, sondern ein Spiegel, in dem wir Grundfragen erblicken: Wie wichtig ist charismatische Persönlichkeit? Welche Rolle spielt Propaganda in der Politik? Können Revolution und Autorität koexistieren? Wann endet Fortschritt und beginnt Zwang? Warum trachtet eine Gesellschaft nach einem Anführer, der scheinbar alle Probleme löst, und nimmt dafür Militarisierung und Opfer in Kauf? Dass wir uns diese Fragen noch heute stellen, belegt, wie sehr die napoleonische Ära uns weiter beschäftigt. Sie ragt aus den Geschichtsbüchern heraus, weil sie einerseits die Gewalt der Kanonen spüren lässt, andererseits die Faszination großer Gesten und Ordnungswerke, die in Krisenzeiten Halt versprechen.
In den zwanzig Kapiteln, die wir uns vorgenommen haben, leuchten wir Napoleons Aufstieg, seine politischen Strukturen, seine Kriegsführung, seine gesellschaftlichen Reformen, seine Kulturpolitik, das Frauenbild, das Verhältnis zur Religion, die Neuordnung Europas, die Auswirkungen auf andere Kontinente und nicht zuletzt die Mythenbildung um seine Person aus. Jeder Abschnitt verdeutlicht einen anderen Ausschnitt jener gewaltigen Umwälzung, in der ein einzelner Mensch, getrieben von unendlichem Ehrgeiz, den Kontinent neu ordnete. Mal stoßen wir auf strahlenden Glanz, mal auf die Düsternis von Schlachtfeldern und politischen Repressionen. Mal sehen wir, wie das Rechtssystem fortschrittlich gestaltet wird, mal, wie die Sklaverei reaktiviert und Opposition brutal zerschlagen wird.
Diese Einleitung soll die Grundlage legen, um zu erfassen, dass Napoleons Epoche kein einfaches „Entweder-Oder“ zwischen heldenhafter Lichtgestalt und verachtenswertem Gewaltherrscher ist, sondern eine Zeit, in der Modernität und Despotie auf unlösbare Weise zusammenfanden. Genau diese Ambivalenz fasziniert Historiker, Schriftsteller, Künstler – und uns alle. Hinter den Schlachtplänen und den Paraden, hinter den Monumenten und den Gesetzeskodizes lauern Fragen nach der Natur von Macht und Freiheit, die bis in unsere Gegenwart reichen. Damit begeben wir uns auf eine Reise, die einen weiten Bogen spannt: vom jungen Artillerieoffizier aus Korsika bis zum Kaiser von Europa, vom Glanz der Krönung in Notre-Dame bis zum Exil in St. Helena, wo Napoleon in der Einsamkeit starb, getrieben von dem Bewusstsein, Geschichte für sich gepachtet zu haben.
Wer die Welt des Jahres 1800 betritt, betritt ein Zeitalter der Extreme, in dem die Kugeln der Geschütze und das Pathos des Nationalgefühls, die Versprechen von Freiheit und die Wirklichkeit des autoritären Zentralstaats, die Euphorie bürgerlicher Aufstiegschancen und die Ernüchterung endloser Kriege eng miteinander verknüpft sind. Es ist ein Weltzustand, in dem sich Europas innere Strukturen – das alte Reich, die Kleinstaaterei, die feudale Hierarchie – unter Napoleons Griff verformen, bis das Bild nach Waterloo neu gemischt wird. Doch auch nach seinem Sturz bleibt ein Europa zurück, das nicht mehr zum Alten zurückkehren kann. Zu vieles hat sich verändert: Feudale Schranken sind geschwächt, Nationalideen erwachen, Rechtseinheit gilt als Prinzip, und die militärische Mobilmachung zirkuliert als Grundmodell. So hinterlässt diese Zeit ein fruchtbares, aber auch bedrohliches Erbe: die Geburt der modernen Welt inmitten von Bajonetten und Kronen.
Dies ist die Ausgangslage für unsere tiefergehende Betrachtung in den nachfolgenden Kapiteln. Durch tausende Facetten hindurch soll ein lebendiges Porträt entstehen, in dem Napoleon nicht nur als Person, sondern als Brennpunkt größerer Kräfte erscheint. Die Einleitung will den Leser darauf einstimmen, dass wir nicht bloß Schlachtengeschichte servieren, sondern ein Mosaik aus Gesellschaft, Kultur, Politik, Recht, Religion, Stadtentwicklung, globaler Strategie, Mythos Bildung und Revolutionsphilosophie. Genau hier liegt die atemberaubende Vielschichtigkeit jener Epoche, die etwa zwanzig Jahre intensiv prägte, aber in ihren Wirkungen jahrhundertelang fortwirkt. Man kann durchaus sagen, mit dem Auftreten Napoleons betrat die Moderne, in all ihren Hoffnungen und Gefahren, die große Bühne.
KAPITEL 1: Die Bühne Europas: Politische und gesellschaftliche Strukturen vor Napoleon
Die Geschichte Europas in der Zeit vor Napoleon Bonaparte kann nicht einfach auf ein einzelnes Königreich oder Herzogtum reduziert werden. Vielmehr muss man das gesamte Gefüge an Fürstentümern, Republiken, Königreichen und kaiserlichen Territorien betrachten, die sich über den Kontinent spannten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts existierte ein komplexes Gleichgewicht der Mächte, das über lange Zeiträume hinweg gewachsen war. Die Herrschaftsformen variierten dabei von absoluten Monarchien bis hin zu konstitutionellen Modellen und kleineren Stadtrepubliken, wobei insbesondere das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als Flickenteppich unterschiedlicher Herrschaftsbereiche galt. Inmitten dieser vielfältigen Gebilde hatte bereits die Aufklärung ihre Spuren hinterlassen und eine Welle neuer Ideen losgetreten, die sich mit traditionellen Glaubenssätzen, aristokratischen Privilegien und feudalen Strukturen auseinandersetzte.
Ursprünge der politischen Vielfalt
Viele der größeren Königreiche in Europa, wie zum Beispiel das Königreich Frankreich, das Vereinigte Königreich oder das Königreich Spanien, waren von erblichen Monarchen regiert, die sich ihre Herrschaftsansprüche zum Teil auf göttliches Recht, zum Teil auf dynastische Legitimation stützten. Zu diesen Monarchien gesellten sich etliche kleinere Territorien in Italien, den deutschen Staaten und im östlichen Mitteleuropa. Auch das Zarenreich im Osten mit seinen weiträumigen Ländereien zählte zu den Großmächten.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war aus heutiger Sicht besonders interessant. In den Jahrhunderten seit seiner Gründung hatte es sich zu einem losen Verband unzähliger kleiner Staaten entwickelt, die nur nominal unter einem Kaiser vereint waren. Gleichzeitig hatte sich der Titel des Kaisers in einer Abfolge der Habsburger Monarchen verfestigt, sodass weite Teile des Reiches von dynastischen Interessen der Habsburger regiert und beeinflusst wurden. Selbst innerhalb dieses Reiches gab es Konfessionsspaltungen, Rivalitäten verschiedener Adelsfamilien und eine Vielzahl an Zersplitterungen in Grafschaften, Fürstentümer und freie Reichsstädte.
Wenn man darüber hinaus nach Osten blickte, konnte man das Königreich Polen-Litauen berücksichtigen, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits durch Teilungen seitens seiner Nachbarn Preußen, Russland und Österreich zu existieren aufhörte oder weitgehend aufgelöst wurde. Diese Ereignisse hatten bereits gezeigt, wie labil das europäische Gleichgewicht war und wie schnell mächtige Nachbarstaaten kleinere Territorien absorbierten.
Gesellschaftsstrukturen: Ständewesen und Privilegien
Bevor Napoleon die europäische Bühne betrat, war die Gesellschaft in den meisten Ländern Europas weitestgehend in Stände gegliedert, die ihren Ursprung in mittelalterlichen Gesellschaftsordnungen hatten. Der Klerus und der Adel genossen umfangreiche Privilegien, während der dritte Stand – die Bürger und Bauern – mit hohen Abgaben und Pflichten belastet war. In Frankreich gab es einen ausgeprägten Absolutismus, der maßgeblich durch die Herrschaft Ludwigs XIV. geprägt worden war. Dieser „Sonnenkönig“ hatte einst gesagt, er selbst sei der Staat, und so war es gängige Praxis, dass königliche Dekrete ohne Abstimmung mit Vertretungen des Volkes oder des Adels erlassen wurden.
Auch in anderen Teilen Europas war die feudale Struktur nicht weniger starr. Bauern waren vielerorts an das Land gebunden, das sie bewirtschafteten, und mussten Abgaben an die Grundherren leisten. Die Adeligen profitierten von feudalen Rechten, die in manchen Regionen Jahrhunderte alt waren und tief in der kulturellen Identität der Gesellschaft verwurzelt. Doch die Aufklärung, die im 18. Jahrhundert immer mehr an Fahrt aufnahm, brachte kritische Fragen zu Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit dieser Zustände auf. Werke philosophischer Denker, die sich für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aussprachen, breiteten sich trotz Zensur und politischer Repression in den Eliten aus.
Außenpolitische Verflechtungen vor der Französischen Revolution
Auch das außenpolitische Gefüge war höchst komplex. Die großen Mächte des Kontinents versuchten sich gegenseitig in Schach zu halten. Allianzen wurden geschmiedet und wieder aufgekündigt. Die Rivalität zwischen dem Königreich Frankreich und dem Königreich Großbritannien etwa reichte bis ins Mittelalter zurück und hatte sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt. Konflikte trugen sich in Europa, aber auch in Kolonialgebieten aus.
Besonders erwähnenswert ist dabei der Siebenjährige Krieg (1756–1763), der gewissermaßen ein globaler Konflikt war, in dem Frankreich und Großbritannien auf verschiedenen Schauplätzen um Einfluss, Kolonien und wirtschaftliche Vormacht kämpften. Während Europa in einigen Regionen zu einem Schlachtfeld wurde, tobten jenseits des Atlantiks ebenfalls Kämpfe um Kolonien in Nordamerika. Dieser Krieg brachte etliche Herrscherhäuser an den Rand des finanziellen Ruins und schuf neue Feindschaften und Bündnisse, die auch nach Ende des Krieges fortwirkten.
Französische Revolution als Initialzündung
Obwohl wir in diesem ersten Kapitel den Fokus auf die Strukturen vor Napoleon legen, ist die Französische Revolution als wichtiger Auslöser für tiefgreifende Umwälzungen zu nennen. Sie brach 1789 aus und fegte binnen kurzer Zeit traditionelle Herrschaftsformen hinweg. Die Institutionen der Monarchie wurden systematisch aufgelöst oder stark beschnitten, das Privilegienwesen abgeschafft, Menschenrechts- und Bürgerrechtserklärungen verfasst. Dieser Prozess veränderte nicht nur Frankreich, sondern auch die Wahrnehmung in anderen Ländern. Die Regierungen europäischer Nachbarn standen vor der Herausforderung, entweder selbst Reformen durchzuführen oder dem revolutionären Gedankengut aktiv entgegenzuwirken.
Während in Frankreich die Monarchie zunehmend schwankte und schließlich in einer radikalen Phase der Revolution endete, richteten sich ausländische Mächte gegen das revolutionäre Frankreich, um die Ausbreitung revolutionärer Ideen zu verhindern. Dieses Europa in Aufruhr war somit ein Schauplatz heftiger Umbrüche: Während Menschen in Paris das Ende der alten Monarchie forderten, besannen sich andere Herrscherhäuser auf repressive Maßnahmen, um ähnliche Aufstände in ihren Ländern zu unterdrücken.
Herrscherpersönlichkeiten und Dynastien
In jenen Jahren vor Napoleon waren es oft die großen Herrscherpersönlichkeiten, die den Lauf der Geschichte prägten. In Österreich war es etwa Joseph II., der versucht hatte, aufklärerisch inspirierte Reformen durchzuführen und gleichzeitig das Reich in alter Tradition zu halten. In Preußen war Friedrich der Große schon einige Jahrzehnte zuvor mit seinen Reformansätzen aufgefallen, die zwar moderat, aber in Teilen durchaus progressiv waren. In Russland kam Katharina die Große an die Macht und eröffnete eine Phase geostrategischer Expansion und Modernisierung, wobei die Leibeigenschaft in ihrem Land aber weiterhin fest verankert blieb.
Viele dieser Monarchen waren trotz aller Reformfreude daran interessiert, ihre absolute Macht zu bewahren oder sogar auszubauen. Dabei nutzten sie die Instrumente der Bürokratie, des stehenden Heeres und der Diplomatie. Europäische Höfe entwickelten sich zu Zentren von Prachtentfaltung, Höflingskultur und kulturellem Austausch, während in den Städten das aufstrebende Bürgertum nach mehr politischer Mitsprache strebte.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und technologische Entwicklungen
In wirtschaftlicher Hinsicht befand sich Europa in einem Übergang: Die Landwirtschaft war noch immer dominierend, doch der Handel gewann an Bedeutung. Insbesondere Großbritannien entwickelte bereits im späten 18. Jahrhundert erste industrielle Kapazitäten, die sich in der Weberei und im Textilbereich widerspiegelten. Auch Frankreich verfügte über Handwerkszentren und internationale Handelsbeziehungen, die zum Wohlstand bestimmter gesellschaftlicher Schichten beitrugen.
Gleichzeitig wuchs in vielen Regionen die Bevölkerung an, was zu einem größeren Bedarf an Nahrungsmitteln und Gütern führte. In den meisten Ländern gab es noch keine ausgeprägte Industrie, wie wir sie später aus der Industrialisierung kennen, doch in einigen Gegenden machten sich erste Modernisierungsprozesse bemerkbar. Kanäle und Straßen wurden gebaut oder verbessert, Häfen erweitert, und wissenschaftliche Erkenntnisse trugen zu ersten Neuerungen bei. Dennoch war das Tempo des Wandels langsam, und die feudalen Strukturen schienen vielerorts unerschütterlich.
Die Macht der Kirche
Ein weiterer zentraler Aspekt vor der napoleonischen Epoche war die Rolle der Kirche. Je nach Land hatte die Kirche unterschiedliche Stellungen inne, doch überall war sie eng mit der politischen Macht verflochten. In katholisch geprägten Staaten wie Frankreich, Spanien, Italien und Teilen des Heiligen Römischen Reiches war der Klerus nicht nur eine religiöse, sondern auch eine bedeutende politische Kraft. Bischöfe und Kardinäle besaßen oft selbst Grundbesitz und übten direkten Einfluss auf die Politik aus.
In protestantischen Regionen, etwa in Preußen, den skandinavischen Ländern oder in einigen Gebieten Norddeutschlands, gab es zwar keine unmittelbare Vormachtstellung der katholischen Kirche, aber stattdessen eine enge Verbindung zwischen Landesfürsten und protestantischen Hierarchien. Auch hier war die Kirche Teil des politischen Systems. Auf diese Weise vermischten sich religiöse Machtansprüche und säkulare Herrschaftsinteressen.
Die Aufklärung hatte zwar begonnen, die Autorität der Kirche zu hinterfragen und säkulare Werte zu propagieren, dennoch war das religiöse Leben in den meisten Landstrichen Europas noch äußerst präsent. Klöster, Kirchenfeste und kirchliche Feiertage prägten das Alltagsleben, und auch staatliche Entscheidungen wurden häufig unter dem Aspekt der göttlichen Billigung betrachtet.
Konflikte und Kriege als dauerhafter Zustand
Krieg war im vorrevolutionären Europa nahezu ein Dauerzustand oder zumindest stets eine im Hintergrund lauernde Gefahr. Das Wettrüsten und die diplomatischen Intrigen zwischen den europäischen Höfen führten zu einer permanenten Spannungsatmosphäre. Mal war es der Streit um Thronfolgefragen, mal um territoriale Interessen und dynastische Heiratsverträge. Das Heilige Römische Reich fungierte in diesem Kontext häufig als Schauplatz, weil das Netzwerk aus Fürstentümern eine Vielzahl an Konfliktlinien und Bündniskonstellationen bot.
Die Kriegsführung selbst hatte im 18. Jahrhundert ihre spezifische Form: Linieninfanterie, große Kolonnen und ausgefeilte Formationstaktiken dominierten die Schlachtfelder. Söldnerheere spielten in vielen Armeen eine Rolle, wenngleich sich mit der Zeit immer stärker stehende Heere etablierten. Die Schlachten waren oft technokratisch geplant, hatten festgelegte Frontlinien und streng geregelte Hierarchien. Diese Art der Kriegsführung würde später durch Napoleon grundlegend verändert werden, denn er brachte eine Dynamik in die Kampftaktiken, welche die starren Muster der Linie aufbrach.
Die Bedeutung der öffentlichen Meinung
Mit dem Aufkommen von Zeitungen, Pamphleten und Debattierclubs in den größeren Städten Westeuropas gewann die öffentliche Meinung immer stärker an Gewicht. Zwar war Pressefreiheit meist eingeschränkt, doch gab es dennoch eine zunehmende Zahl an Publikationen, die politische Ereignisse kommentierten und die Politikerdarstellungen mit beeinflussten. In intellektuellen Zirkeln wurde nicht nur Literatur und Kunst diskutiert, sondern auch die Frage nach der Legitimität der Regierungen, nach Reformen und nach den Rechten des Individuums.
Die Ideen der Aufklärung, verkörpert unter anderem durch Denker, die sich mit Naturrecht, Gesellschaftsvertrag und Volkssouveränität auseinandersetzten, fanden allmählich Verbreitung. Dieses Klima des Nachdenkens und Diskutierens führte dazu, dass die alten Strukturen sowohl verteidigt als auch immer stärker hinterfragt wurden. Da wir uns in diesem Kapitel auf die Zeit vor Napoleon konzentrieren, ist es wichtig, diese Stimmungsaufhellung und zugleich Spannungsanreicherung innerhalb der Gesellschaft zu erfassen: Ein Großteil der Bevölkerung lebte noch in traditionellen Mustern, doch eine immer weiter wachsende, gebildete Elite hinterfragte den Status quo.
Revolutionäre Tendenzen außerhalb Frankreichs
Auch wenn die Französische Revolution den offensichtlichsten Bruch mit dem Ancien Régime darstellte, gab es ähnliche Bewegungen oder zumindest reformorientierte Gruppierungen in anderen Gebieten Europas. In den Niederlanden war bereits eine Phase von Bürgerbewegungen gegen den Stadthalter erlebt worden. In Genf oder in einigen italienischen Stadtstaaten brodelten republikanische Ideen. Doch all diese Bestrebungen, die sich zum Teil in kurzen Aufständen oder Reformversuchen zeigten, blieben meist lokalisierte Ereignisse und wurden vom alten Machtgefüge rasch unterdrückt.
Die Französische Revolution hatte jedoch einen dominoartigen Effekt: Sie war der erste Fall, in dem eine alte Monarchie vollständig demontiert wurde, der König zeitweise floh und später hingerichtet wurde, und eine neue republikanische Ordnung ausgerufen werden konnte. Das entsetzte die konservativen Kräfte, entzündete aber den Tatendrang vieler liberaler oder radikaler Gruppen in anderen Ländern. Auch Napoleons eigene Erzählung würde später an diese revolutionären Ideale anknüpfen, um seine eigene Legitimation als „Sohn der Revolution“ zu untermauern.
Die Lage in der Armee Frankreichs vor Napoleon
Die französische Armee im Vorfeld von Napoleons Aufstieg durchlief einen grundlegenden Wandel. In der Phase der Monarchie war sie ein weitgehend aristokratisch geführtes, klassisch aufgebautes Heer, das von Offizieren adeliger Herkunft dominiert wurde. Die Revolution führte allerdings zu einem gewaltigen Offiziers-Exodus, weil viele Adelige, die früher die Armee geführt hatten, vor den revolutionären Umbrüchen flüchteten. Diese Lücke füllten Bürgerliche und junge Aufsteiger, die sich durch Talent und neue Ideen auszeichneten.
Somit lag in den französischen Streitkräften ein ungeahntes Potenzial: Junge Offiziere, die bisher keine Chance auf eine Karriere gehabt hätten, bekamen nun die Möglichkeit, sich schnell zu beweisen. Neue taktische Ansätze konnten eingeführt werden, ohne dass starre Hierarchien dies verhinderten. Zudem mobilisierte die Revolution eine nationale Begeisterung, die zumindest in den Anfangsjahren die Soldaten aus Überzeugung kämpfen ließ. Diese Faktoren begünstigten den meteorhaften Aufstieg Napoleons, der ursprünglich als Artillerieoffizier in den Wirren der Revolution seine Chance sah.
Kultureller Wandel und Mentalitäten
Die Zeit vor Napoleons Machtergreifung war auch von einem kulturellen Übergang geprägt. Noch waren die großen Barock- und Rokoko-Höfe Einflusszentren pompöser Architektur, Musik und Kunst. Gleichzeitig traf dies jedoch auf eine aufstrebende bürgerliche Kultur, die neue gesellschaftliche Werte propagierte. Salons, Literaturkreise und Kunstakademien bildeten Knotenpunkte des geistigen Austauschs.
Vor allem in den Städten entstand eine Kulturschicht, die sich bewusst vom überkommenen Adel abzugrenzen begann. Literatur und Philosophie galten als probate Mittel, um Autoritäten zu hinterfragen und neue gesellschaftliche Modelle zu skizzieren. In diesen Debatten spielten auch Bürgerrechte und Bildungsbestrebungen eine Rolle, die sehr weitreichend sein konnten.
Die Zeitgeist-Brücke zur Revolution
Man kann zusammenfassen, dass in den Jahrzehnten vor Napoleons Aufstieg in weiten Teilen Europas ein Doppelcharakter der Gesellschaft vorherrschte: Einerseits eine ständische, feudale, von Traditionen durchzogene Ordnung mit Monarchen und Adel an der Spitze. Andererseits eine wachsende Unzufriedenheit, neue Ideen von Freiheit und Gleichheit sowie technische und wirtschaftliche Entwicklungen, die das Fundament der alten Ordnung untergruben.
Das geistige Erbe der Aufklärung in Gestalt von Rationalismus, Naturrecht und Skepsis gegenüber autoritären Strukturen war die kulturelle Basis für den raschen Wechsel, den Europa später erleben sollte. Währenddessen hatten sich die Herrscherhäuser in teils unübersichtlichen Bündnissen verstrickt, die Europa in regelmäßigen Abständen in Kriege führten. Die Bevölkerung litt unter hohen Steuern, Kriegsverpflichtungen und der Willkür mancher Lokalfürsten.
Erste Auswirkungen der Französischen Revolution in Europa
Als die Revolution in Frankreich Fahrt aufnahm, blickte ganz Europa gespannt auf das dortige Geschehen. Die traditionalistischen Fürsten sahen in den revolutionären Ansprüchen eine Bedrohung. Sie wollten die alten monarchischen Strukturen vor dem revolutionären Feuer schützen, das nicht nur den französischen Thron, sondern unter Umständen jede Krone in Europa gefährden konnte. Dies führte zu Koalitionskriegen, in denen Europa versuchte, das revolutionäre Frankreich einzudämmen oder zu zerschlagen.
Anfangs schienen die alten Monarchien Frankreich überlegen, doch das neu geordnete, revolutionäre Heer erwies sich als äußerst widerstandsfähig. Die ehemaligen Eliteverbände des Adels wurden nun durch Massenheere ersetzt, die sich aufgrund patriotischer Begeisterung und revolutionären Eifers behaupteten. Genau in diesem Kontext fand Napoleon seinen Einstieg in die große Bühne der europäischen Politik, zunächst als junger General, der Siege auf dem italienischen Kriegsschauplatz errang.
Zuspitzung und Vorbote Napoleons
Die Zeit vor Napoleon war daher nicht nur eine Phase politischen Stillstands, sondern ein Kessel, in dem Ideen brodelten und Konflikte gärten. Innerhalb weniger Jahre konnte ein ambitionierter, talentierter Offizier wie Napoleon vom einfachen Korsen zu einem der mächtigsten Männer Europas aufsteigen, weil die bestehenden Systeme gerade in einem Umbruch begriffen waren. Die Spannungen zwischen traditioneller Monarchie und revolutionären Prinzipien schufen ein Vakuum, das Napoleon auszufüllen verstand.
Dieses Europa, das wir in diesem Kapitel beleuchtet haben, war also in mehrfacher Hinsicht reif für Veränderung: Politisch labil, gesellschaftlich unter Druck, militärisch in starren Mustern gefangen, wirtschaftlich teilweise im Aufbruch. Auf dieser instabilen Grundlage sollte Napoleon eine neue Ordnung errichten, die sich auf verschiedene Art und Weise manifestierte – sei es im Code Civil, in der Neuordnung Deutschlands und Italiens, oder in der Etablierung einer neuen Militärstrategie.
Jede Großmacht Europas war zu jener Zeit mit eigenen Sorgen beschäftigt. Das Königreich Großbritannien setzte auf seine starke Marine und verfolgte eine globale Handelsstrategie, während Preußen auf sein starkes Heer vertraute, allerdings geografisch begrenzt agierte. Österreich war multiethnisch zusammengesetzt und verwaltete ein riesiges, kaum homogenes Territorium, Russland war im Begriff, seine Grenzen in Richtung Zentralasien und Richtung Westen auszudehnen, und der neue Staat Frankreich experimentierte mit der Republik und anschließend mit verschiedenen Regierungsformen, bis Napoleon sich schließlich zum Ersten Konsul und später zum Kaiser ausrufen ließ.
Ausblick auf die kommenden Kapitel
In den folgenden Kapiteln wird deutlich, wie Napoleon diese aus der Balance geratenen Verhältnisse nutzte, um eine neue Ära einzuläuten. Dabei wird nicht nur die politische Neuordnung im Vordergrund stehen, sondern auch die tiefgreifenden sozialen und kulturellen Veränderungen, die diese Epoche kennzeichneten. Zudem wird sich zeigen, in welchen Bereichen Napoleon dauerhaften Einfluss ausübte und wo seine Reformen nur kurzfristig Bestand hatten.
Damit schließt sich der Vorhang für dieses erste Kapitel, das den Schauplatz Europas vor dem Erscheinen Napoleons skizzierte. Wir haben gesehen, wie Feudalstrukturen, aufstrebendes Bürgertum und revolutionäre Ideen kollidierten und sich vermischten. Die Zeit war reif für einen starken Akteur, der die vorhandenen Spannungen, Lücken und Möglichkeiten in den staatlichen Strukturen zu seinem Vorteil nutzen konnte. Genau in dieses Vakuum trat der korsische Offizier, der bald als Erster Konsul und letztlich als Kaiser die Geschicke Europas für mehr als ein Jahrzehnt massiv prägen sollte.
KAPITEL 2: Napoleon Bonapartes Aufstieg: Vom Korsischen Soldaten zum Kaiser
Der Aufstieg Napoleons zu einer der zentralen Figuren europäischer Geschichte war weder zufällig noch allein auf seine militärische Genialität zurückzuführen. Vielmehr verband er verschiedene Talente: politisches Geschick, organisatorische Fähigkeiten und ein charismatisches Auftreten. Aus bescheidenen Anfängen arbeitete er sich hoch, während Frankreich nach der Revolution im Chaos schwankte. Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie aus dem jungen Korsen Napoleon Bonaparte ein französischer General wurde, der letztlich die Macht im Land ergriff und sich zum Kaiser krönte.
Napoleons frühe Jahre
Napoleon wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf der Insel Korsika geboren, die damals erst kurz zuvor vom Königreich Genua an Frankreich abgetreten worden war. Die Inselbevölkerung fühlte sich vielfach ihrer Selbstbestimmung beraubt, und auch Napoleons Familie war Teil dieser politischen Umbruchssituation. Sein Vater war zeitweise in den Widerstand involviert, arrangierte sich später aber mit den neuen Machthabern.
Napoleon selbst zeigte schon früh Interesse an militärischen und mathematischen Themen. Er erhielt eine Ausbildung an französischen Militärakademien, was ihm aufgrund seines adligen Hintergrunds (wenn auch in Form eines niederen Landadels) ermöglicht wurde. Als Jugendlicher war er ein Außenseiter in den vornehmen Kreisen des Festlandadels, wurde jedoch bald für seine Intelligenz und Zielstrebigkeit anerkannt.
In dieser Zeit entwickelte sich auch sein Ehrgeiz, der später zur Triebfeder für seinen Aufstieg werden sollte. Hinzu kam eine gewisse Abneigung gegenüber den französischen Eliten, die er als arrogant und oberflächlich wahrnahm. Dieses Spannungsfeld zwischen Korsika und dem französischen Kernland prägte ihn und seine Sicht auf Macht und Identität.
Die Französische Revolution als Karrieresprungbrett
Als die Französische Revolution ausbrach, war Napoleon ein junger Offizier in der Artillerie. Zunächst beobachtete er die politischen Entwicklungen eher aus der Distanz. Doch das revolutionäre Geschehen bot plötzlich ungeahnte Aufstiegschancen für Menschen, die nicht aus den obersten Adelsrängen kamen. Zwar war das Militär von Adligen dominiert, doch die Revolution führte dazu, dass viele adelige Offiziere das Land verließen. Dadurch öffneten sich Positionen in der Armee für ambitionierte, talentierte Männer.
Napoleon verstand es, sich in diesem Wirrwarr durchzusetzen. Er profitierte davon, dass er in der Artillerie diente, die in revolutionären Schlachten eine immer größere Rolle spielte. Die neue, massenhaft mobilisierte Armee war auf Offiziere angewiesen, die in der Lage waren, große Geschütze effizient einzusetzen. In den Kämpfen um die südfranzösische Stadt Toulon, wo sich royalistische Kräfte und britische Truppen verschanzt hatten, erregte Napoleon durch seinen taktischen Einfallsreichtum und seine Durchsetzungskraft erstmals nationales Aufsehen.
Dieser Erfolg markierte den Beginn einer einzigartigen Karriere. Die revolutionäre Regierung ernannte ihn zum Brigadegeneral. Zahlreiche politische Wirrnisse im revolutionären Frankreich – die Schreckensherrschaft, die Machtkämpfe zwischen Girondisten und Jakobinern, und später das Direktorium – kamen ihm insofern zugute, als sie einer gefestigten, strukturierten Militärhierarchie entgegenstanden. So war es relativ einfach für einen jungen Aufsteiger, sich weiter nach oben zu arbeiten, wenn er militärische Siege zu verbuchen hatte.
Italienfeldzug und Napoleon als Retter Frankreichs
Einer der wichtigsten Schritte auf Napoleons Weg zur Berühmtheit war sein Kommando im Ersten Koalitionskrieg, insbesondere der Italienfeldzug. Die Armee, die nach Italien geschickt wurde, litt unter schlechter Ausrüstung und geringen Vorräten. Napoleon, kaum älter als Ende zwanzig, übernahm das Kommando und formte aus einer demotivierten Truppe eine schlagkräftige Einheit.
Sein strategisches Vorgehen in Italien war gekennzeichnet durch schnelle Märsche, das Ausnutzen der Geländevorteile und ein geschicktes Taktieren mit kleinen, beweglichen Einheiten. Er schlug mehrfach österreichische und piemontesische Truppen. Zudem verstand er es, seine Siege propagandistisch zu nutzen. Er sandte Siegesmeldungen nach Paris, in denen er seine Erfolge überhöhte und sich als Retter der Nation inszenierte.
Durch diese Siege florierte sein Ruf und wurde zum Mythos. Gleichzeitig hatte Frankreich dringend militärische Erfolge nötig, um die revolutionäre Regierung zu stabilisieren. Somit stieg Napoleon zum Hoffnungsträger auf, zum Mann, der die Republik gegen die europäischen Monarchien verteidigen konnte. Der Italienfeldzug machte ihn zu einem Volkshelden, weil er auch Reichtümer aus den eroberten Ländern einbrachte, Kunstschätze konfiszierte und dem Direktorium in Paris somit half, die Staatskassen wieder aufzufüllen.
Expedition nach Ägypten und orientalische Faszination
Einer der spektakulärsten Züge Napoleons vor seiner Machtergreifung war die Expedition nach Ägypten 1798. Die Idee dahinter war, Großbritannien durch die Kontrolle des Handelswegs nach Indien strategisch zu schaden. Dieses Unterfangen war militärisch und organisatorisch äußerst komplex. Napoleon landete mit seiner Armee in Ägypten, eroberte Kairo und versuchte, sich als Befreier der ägyptischen Bevölkerung darzustellen – ungeachtet dessen, dass diese Propaganda in Wirklichkeit wenig Wirkung zeigte.
Gleichzeitig brachte Napoleon zahlreiche Wissenschaftler mit, die in Ägypten Forschungen betrieben und so den Grundstein für die moderne Ägyptologie legten. Das Projekt war ebenso eine kulturelle Expedition wie eine militärische. Dennoch stieß Napoleon auf erhebliche Widerstände: Die britische Marine zerstörte in der Schlacht bei Abukir weite Teile der französischen Flotte. Die Versorgungssituation war katastrophal, und die lokale Bevölkerung stellte sich größtenteils nicht auf seine Seite.
Trotzdem kehrte Napoleon in einem günstigen Augenblick nach Frankreich zurück, noch bevor sich das Ausmaß der Niederlage in Ägypten in der öffentlichen Meinung durchsetzen konnte. Er verstand es, die französische Bevölkerung mit gezielter Kommunikation glauben zu lassen, dass die Expedition zwar schwierige Umstände hatte, aber insgesamt ein Erfolg gewesen sei. Auch hier setzte er wieder auf Selbstdarstellung: Die Schriften und Abhandlungen der mitgereisten Wissenschaftler, die exotischen Erzählungen aus dem Orient, all das befeuerte seinen Ruf als genialen Visionär.
Der Staatsstreich des 18. Brumaire
Während Napoleon in Ägypten war, hatte sich die politische Lage in Frankreich weiter zugespitzt. Das Direktorium, eine Regierung aus fünf Direktoren, agierte schwach und war intern zerstritten. Nach seiner Rückkehr erkannte Napoleon die Gunst der Stunde und verbündete sich mit einigen Politikern, die nach einem starken Führer lechzten, um die instabilen Verhältnisse zu beenden. So kam es im November 1799 (nach dem damals gültigen Revolutionskalender am 18. Brumaire VIII) zum Staatsstreich.
Napoleon trat nach außen hin als Retter der Republik auf, der lediglich die Machthaber des Direktoriums absetzen wollte, weil sie korrupt seien und die Revolution verraten hätten. In Wahrheit arbeitete er zielstrebig darauf hin, die Macht in seinen eigenen Händen zu konzentrieren. Mit Unterstützung seiner Brüder und Anhänger aus dem Militär gelang es ihm, das Parlament zu beeinflussen und sich zum Ersten Konsul ernennen zu lassen.
Dieser Staatsstreich beendete faktisch die Phase der Revolutionsregierung. Napoleon legte in seiner neuen Funktion zwar Wert auf republikanische Insignien wie die Trikolore und die Devise Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber de facto begann er, eine autoritäre Herrschaft aufzubauen. Er überarbeitete die Verfassung und zementierte seine Stellung als stärkste Autorität im Land.