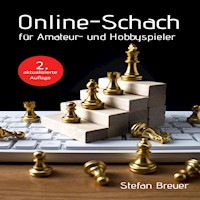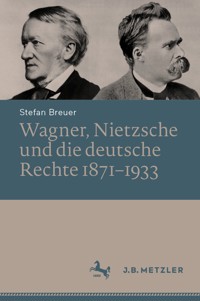Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unter Faschismus versteht man heute in weiten Teilen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft eine politische Ideologie, deren Kern ein populistischer Ultranationalismus sei. Bei dieser Sichtweise bleibt unterbelichtet, dass der historische Faschismus seine Ziele nicht nur mit legalen, sondern wesentlich auch mit illegalen Mitteln verfolgte und dafür umfangreiche Gewaltapparate unterhielt und einsetzte. Sie wird auch dem Aggregatcharakter des Faschismus nicht gerecht, der verschiedene Typen des Rechtsnationalismus umfasste und selbst linksnationalistische Strömungen wie den revolutionären Syndikalismus nicht ausschloss, darüber hinaus auch trans- und supranationalen Orientierungen wie dem Futurismus und diversen Rassenideologien Raum bot. In seiner auf Max Webers Herrschaftssoziologie gestützten Analyse zeigt Stefan Breuer, dass die besonderen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg nur in Italien und Deutschland einen Rahmen für ein zeitweiliges Zusammengehen dieser Bestrebungen in einer charismatisch strukturierten Patronagepartei boten, während in Frankreich und Spanien, Rumänien und Kroatien die radikale Rechte überwiegend auf Nationalismus in der einen oder anderen Form festgelegt blieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Breuer
Nationalismus und Faschismus
Rechtsradikale Bewegungen und Parteien im Europader Zwischenkriegszeit
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Unter Faschismus versteht man heute in weiten Teilen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft eine politische Ideologie, deren Kern ein populistischer Ultranationalismus sei. Bei dieser Sichtweise bleibt unterbelichtet, dass der historische Faschismus seine Ziele nicht nur mit legalen, sondern wesentlich auch mit illegalen Mitteln verfolgte und dafür umfangreiche Gewaltapparate unterhielt und einsetzte. Sie wird auch dem Aggregatcharakter des Faschismus nicht gerecht, der verschiedene Typen des Rechtsnationalismus umfasste und selbst linksnationalistische Strömungen wie den revolutionären Syndikalismus nicht ausschloss, darüber hinaus auch trans- und supranationalen Orientierungen wie dem Futurismus und diversen Rassenideologien Raum bot.In seiner auf Max Webers Herrschaftssoziologie gestützten Analyse zeigt Stefan Breuer, dass die besonderen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg nur in Italien und Deutschland einen Rahmen für ein zeitweiliges Zusammengehen dieser Bestrebungen in einer charismatisch strukturierten Patronagepartei boten, während in Frankreich und Spanien, Rumänien und Kroatien die radikale Rechte überwiegend auf Nationalismus in der einen oder anderen Form festgelegt blieb.
Vita
Stefan Breuer ist Professor i.R. für Soziologie an der Universität Hamburg.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Einleitung
Nationalismus und Faschismus: Definition und Typologie
1.
Nationalismus
2.
Faschismus
2.1
Bewegung – Bund – Partei
2.2
Faschistische Parteien: Mittel, Organisationstrukturen, Ziele
Elemente und Ursprünge des Faschismus: Italien
1.
Vom nationalen Sozialismus zum sozialen Nationalismus: der revolutionäre Syndikalismus
2.
Von D’Annunzio zum Futurismus: Ästhetisierung der Politik und Politisierung der Ästhetik
3.
Zustrom vom Rechtsnationalismus: die Associazione Nazionalista Italiana
Elemente und Ursprünge des Faschismus: Deutschland
1.
Hybrider Nationalismus: Die »völkischen« Wurzeln der NSDAP
2.
Neuer Nationalismus in der NSDAP
3.
Rassenaristokratismus
Trasformismo alla fascista: Nachbemerkungen zu Mussolini und Hitler
Faschismus oder Nationalismus. Vier Fallstudien
1.
Faschismus in Frankreich?
2.
Die Falange Española in Spanien
3.
Die Legion »Erzengel Michael« in Rumänien
4.
Die Ustaša in Kroatien
Abkürzungen
Literatur
Vorwort zur Neuausgabe
Dieses Buch ist die aktualisierte, in Teilen umgearbeitete und erheblich erweiterte Fassung meines 2005 erschienenen Werks, das damals unter dem Titel »Nationalismus und Faschismus. Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich« erschien. Der Aktualisierung waren insofern Grenzen gesetzt, als heute wie damals kein einzelner Wissenschaftler beanspruchen kann, den Forschungsstand auch nur für ein einziges der in diesem Buch behandelten Länder vollständig zu überblicken. Umgearbeitet wurde das Kapitel über Frankreich, das erheblich gekürzt und in die neu hinzu gekommenen Fallstudien integriert wurde. Dort soll es zusammen mit neuen Abschnitten über die Falange Español in Spanien, die Legion »Erzengel Michael« in Rumänien und die Ustaša in Kroatien die beiden Leitideen der Erstfassung weiter erhärten: (1) Der Nationalismus ist schon für sich genommen ein komplexes, in verschiedene Typen zu untergliederndes Phänomen; (2) Der Nationalismus steht zum Faschismus in einem Verhältnis sowohl der Identität als auch der Nichtidentität, haben in diesen letzteren doch nicht nur unterschiedliche Formen des Nationalismus Eingang gefunden, sondern auch ideologische Orientierungen trans- und supranationaler Art, die ihrerseits wiederum unterschiedlich ausgefallen sind. Zusammengehalten und politisch aktionsfähig gemacht wurde dieses ideologische Konglomerat durch die Form einer charismatisch strukturierten Patronagepartei, die ihre Ziele auf legalem wie extralegalem Wege verfolgte und sich für die letzteren mit umfangreichen Gewaltapparaten versah.
Zu der ersten Ausgabe dieses Buches ist mir ein gutes Dutzend von Besprechungen bekannt geworden, in denen sich, wie bei diesem Thema nicht anders zu erwarten, Zustimmung und Kritik die Waage hielten. Soweit die Kritiker sich auf diskutable Gründe stützten (was nicht von allen gesagt werden kann1), bezogen sich diese vor allem auf die zweite Leitidee, die allerdings recht unterschiedlich aufgefasst wurde. Alexander Umland warf dem Buch vor, sich zu wenig für die Ideologie des Faschismus zu interessieren und sich zu sehr an dessen formale und organisatorische Merkmale zu halten.2 Armin Nolzen wandte sich gegen die idealtypische Unterscheidung zwischen Nationalismus und Faschismus und vertrat die Ansicht, dass in der »Radikalisierung des Nationalismus doch geradezu eine notwendige Voraussetzung des Rassenimperialismus« liege.3 Christof Dipper wiederum glaubte einen eklatanten Widerspruch zwischen dem Aufwand an ideengeschichtlicher Rekonstruktion und gleichzeitiger Abwertung der Ideen hinsichtlich der tatsächlichen politischen Praxis zu erkennen und spitzte dies zu der Frage zu: »was soll eine Genealogie der Programme an Erkenntnis bieten, wenn man schon zu Beginn erfährt, dass es sich dabei allenfalls um Weltanschauungen bzw. Rezepturen handelt, die im Widerstreit zueinander lagen und den Faschismus nicht hervorbrachten, geschweige denn seine Praxis erklären können?« Dem wird die These entgegengesetzt, das ›faschistische Minimum‹ enthalte »einen konkreten und unverzichtbaren weltanschaulichen Kernbestand, den man als radikalnationalistisch und deshalb als xenophob bis zum Rassismus bezeichnen kann«.4
Diese Einwände schlagen in meinen Augen nicht durch. Dass ich den ›generischen Faschismus‹ nicht als eine Ideologie sehe, ist nur in dem Maße richtig, wie die Betonung auf dem Beiwort liegt. Als ideologisches Phänomen sehe ich den Faschismus durchaus, nur als ein solches, das nicht durch einen ›Kernbestand‹, sondern durch mehrere, konfligierende Ideologien geprägt ist und darüber hinaus weitere Züge aufweist, die darin nicht aufgehen, allen voran: die charismatische Organisation. Dass der Rassenimperialismus ein Ergebnis der Radikalisierung des Nationalismus sei, übergeht die Spannung zwischen beiden, die in reiner Form vor allem im Nationalsozialismus hervortritt. Damit ist aber nicht gesagt, dass das, was auf der Ebene der Ideologien als unvereinbar erscheint, in der politischen Praxis nicht lange eine Gemengelage bilden kann, aus der je nach aktuellem Bedarf der eine oder der andere Zug stark gemacht werden kann. Aus dem Nachweis von Widersprüchen zwischen den Ideologien folgt keineswegs deren Irrelevanz, ganz im Gegenteil: Vermutlich ist die Attraktivität einer politischen Bewegung bzw. Partei umso stärker, je größer innerhalb eines gewissen Spektrums die Menge der darin zirkulierenden Ideen und je größer die Bereitschaft ist, es mit ihnen zunächst nicht allzu genau zu nehmen und sich mit einer Mixtur zu begnügen, aus der je nach aktueller Lage dieses oder jenes akzentuiert werden kann – bis irgendwann die Konsequenzen nicht mehr zu übersehen sind und neue Justierungen erforderlich werden. Das vorliegende Buch führt nur bis zu diesem Punkt, ohne weit darüber hinaus zu gehen. Wenn es jedoch eine genauere Erkenntnis der Elemente ermöglicht, die in den Faschismus Eingang gefunden und z. T. seinen Zusammenbruch überdauert haben, hat es seinen Zweck erreicht; vielleicht nicht ganz überflüssig in einer Zeit, die wieder dazu neigt, den Begriff im politischen Tageskampf zu verschleißen und von Faschismus schon dann zu reden, wenn, wie gegenwärtig in der westlichen Hemisphäre, die Fälle zunehmen, bei denen ein plebiszitärer Präsident die neoliberale Kritik am Wohlfahrtsstaat und der Massendemokratie radikalisiert und eine Vielzahl von administrativen Substruktionen im zivilen Sektor zerschlägt, ohne die auch ein faschistisches Regime nicht funktionsfähig ist.
Einleitung
Studien über den Faschismus, die sich nicht bloß mit dessen Erscheinung in Italien befassen, sondern darunter ein generelles Phänomen verstehen, haben sich lange Zeit auf gesellschaftstheoretische Annahmen über seine vermeintliche soziale Funktion gestützt.5 Die Ergebnisse waren uneindeutig, um das mindeste zu sagen. Der Faschismus erschien mal als Reaktion des Großbürgertums, mal als Revolte des Kleinbürgertums, mal als Ausdruck des niedergehenden Kapitalismus, mal als Instrument seiner Modernisierung. Die offensichtlichen Widersprüche zwischen diesen Deutungen und der daraus resultierende Mangel an Überzeugungskraft stürzten die Faschismusforschung in den 1970er Jahren in eine Krise, die auch durch die Beiträge von Außenseitern wie Ernst Nolte oder Zeev Sternhell nicht überwunden wurde, zumal diese mit zum Teil idiosynkratischen Deutungen aufwarteten.6
Neue Impulse brachte erst die angelsächsische Forschung mit den vergleichend angelegten Untersuchungen von Stanley Payne, Roger Griffin und Robert O. Paxton,7 die ihrerseits auf den Anregungen von George L. Mosse fußten.8 Vor allem Griffin verstand es, mit seinen eigenen Beiträgen, den von ihm herausgegebenen Sammelbänden und der von ihm initiierten Zeitschrift Fascism (seit 2012) Anhänger für eine Sichtweise zu gewinnen, die auf die vergleichende Forschung stark inspirierend gewirkt hat.9 Auch wenn durchaus keine Einigkeit darüber besteht, dass unter »Nationalismus« vor allem ein Gefühlszustand, eine ›besonders intensive Form der affektiven Bindung an das eigene Heimatland‹ zu verstehen sei,10 entspricht doch der Vorschlag, den Faschismus als eine Art politischer Ideologie aufzufassen, deren in diversen Permutationen auftretender mythischer Kern eine ›palingenetische Form eines populistischen Ultra-Nationalismus’ sei,11 einer verbreiteten Tendenz. Stanley Payne, der sich an Griffin angeschlossen hat, sprach von der ›extremsten Form des modernen europäischen Nationalismus’,12 Roger Eatwell von einer Ideologie, die eine soziale Wiedergeburt über einen holistisch-nationalen ›Dritten Weg‹ anstrebt,13 Aristotle Kallis von einem »›nationalism plus’ phenomenon«.14 Aus der französischen Forschung wäre Philippe Burrin zu nennen, der den Faschismus bestimmt sah durch das Ziel einer »Wiedervereinigung und Erneuerung der Nation, falls nötig durch Gewalt und Terror«,15 aus der italienischen Emilio Gentile, der im Faschismus ›die erste Manifestation eines neuen, revolutionären und totalitären, mystischen und palingenetischen Nationalismus‹ erkannte,16 aus der deutschen Andreas Wirsching, der die »Ideologie der nationalen Gemeinschaft und der nationalen Stärke« zum Wesensmerkmal des Faschismus erklärte, mit dieser Definition allerdings explizit, wie schon Sternhell, den Nationalsozialismus ausschloss.17 Auch in Arbeiten jüngeren Datums begegnet man unverändert der Überzeugung, es mit einer Ideologie und einer darauf basierenden Politik zu tun zu haben, die primär nationalistisch motiviert sei.18
Es überrascht nicht, dass sich dieser Befund mit einer Strömung innerhalb der vorrangig mit dem Nationalismus befassten Forschung deckt. Schon für einen Pionier dieses Feldes wie Carlton Hayes war der Faschismus eine Form des »integralen Nationalismus«.19 Spätere Autoren sind ihm darin gefolgt, wie z.B. Eugen Lemberg, der für das späte 19. Jahrhundert die Ablösung des bis dahin dominierenden, revolutionär-emanzipatorischen »Risorgimento-Nationalismus« durch einen Nationalismus »neuen Typs« behauptete, welcher die Nation absolut setze und den Nationalismus in eine »Erlösungslehre auf nationaler Basis« verwandle: den »integralen Nationalismus«.20 Sehr gern wurde und wird diese Transformation auf den Einfluss der Romantik zurückgeführt, die speziell in Deutschland zu einer Aufladung des Nationsbegriffs mit organizistischen und holistischen Denkfiguren geführt habe.21 Soziopolitische Deutungen brachten dies in Verbindung mit dem Niedergang des Bürgertums und einem damit einhergehenden Funktionswandel des Nationalismus. Mit dem Umschlag in den integralen Nationalismus sei der Nationalismus im politischen Feld von links nach rechts gerückt, aus einem Instrument der Emanzipation und Modernisierung zu einem solchen der »Reaktion« geworden, wie dies bereits am integralen Nationalismus der Action française zu beobachten gewesen sei und in noch gesteigertem Maße den Faschismus bestimmt habe.22
Es wäre abwegig, dies in toto bestreiten zu wollen. Nur zu gut dokumentiert ist die Rolle, die zunächst führende Repräsentanten des Nationalsyndikalismus im fascismo movimento, ab 1923 dann solche der Associazione Nazionalista Italiana im Regime Mussolinis gespielt haben, nur zu genau kennt man das Gewicht, das nationalistischen Forderungen in der Programmatik und Propaganda der NSDAP zukam. Was immer der Faschismus war: Er war stets auch Träger nationalistischer Ideologeme, Motor und Medium nationalistischer Strategien, die den Platz des jeweiligen Nationalstaates in der Welt zu sichern und seine Macht zu erhöhen bestrebt waren. Dennoch wird man sich mit Feststellungen dieser Art nicht begnügen können. Allzu schnell geht der Rekurs auf »Nationalismus« darüber hinweg, dass sich unter diesem Titel höchst Unterschiedliches verbirgt: im 19. Jahrhundert und weit bis in das 20. Jahrhundert vornehmlich eine das Interesse der besitzenden und gebildeten Schichten an wirtschaftlicher, politischer und kultureller Homogenität sowie weltweiter Geltung artikulierende Ideologie; dann, verstärkt durch den Ersten Weltkrieg und die ›Nationalisierung der Massen‹ (George L. Mosse), ein ›neuer Nationalismus‹, der auf Inklusion insbesondere der Arbeiterschaft in die Nation drängte; quer zu beiden Strömungen ein ›völkischer Nationalismus‹, der die einfache Modernisierung bejahte, aber deren Reflexivwerden ablehnte; schließlich ein sogar die einfache Modernisierung noch in vielem verwerfender Fundamentalismus, der die Nation zum Träger der Hoffnungen auf allgemeine Erlösung und Wiedergeburt hypostasierte und insofern über den Nationalismus hinauswies. Die Formel vom ›populistischen Ultranationalismus‹ ist nicht geeignet, diesen Unterschieden gerecht zu werden.
Hinzu kommt, dass jede exklusive Deutung vom Nationalismus her die nicht minder relevanten trans- und supranationalen Züge verfehlt, die in den Faschismus Eingang gefunden haben. Jüngere Forschungen haben dies zu Recht moniert, sich dabei jedoch auf Erscheinungen wie den ubiquitären Paramilitarismus oder grenzüberschreitende Formen der Kooperation kapriziert, ohne viel Aufmerksamkeit auf die ideologischen Tendenzen zu verwenden, die in den faschistischen Bewegungen selbst zum Nationalismus in einem letztlich nicht zu schlichtenden Widerspruch standen.23 Das betrifft im Fall Italiens insbesondere den Futurismus, der in den ersten Jahren der Bewegung eine wichtige Rolle gespielt hat, aufgrund seiner prädominant kosmopolitischen Orientierung aber nicht als »cultural nationalism« oder »modernist nationalism« verbucht werden kann.24 Im Fall Deutschlands ist vor allem auf den Rassenaristokratismus zu verweisen, der schon vor 1933 seinen Repräsentanten in der SS erhielt, um unter dem Regime zur Haupttriebkraft des Holocaust zu werden. Hannah Arendt hat dies zum Anlass genommen, einen scharfen Schnitt zwischen dem (italienischen) Faschismus als einer Form des Nationalismus und dem Nationalsozialismus als einer solchen des Rassismus zu machen, doch ist dies mit Blick auf die von Mussolini in Libyen und Abessinien verfolgte Politik nicht überzeugend, auch wenn ihren Bemühungen, Nationalismus und Rassismus begrifflich auseinanderzuhalten, grundsätzlich zuzustimmen ist.25 Roger Griffin dagegen, bemüht, beides zu verbinden, hat dies nur um den Preis einer Subordination vermocht, bei welcher der Rassismus als Modalität des Nationalismus erscheint, unter ausdrücklicher Herabstufung aller um »eugenics, euthanasia, and attempted genocide« kreisenden biologischen oder sozialdarwinistischen Rassenkonzepte zu kontingenten Merkmalen;26 womit sich der neue Konsensus, nebenbei bemerkt, in Richtung Sternhell bewegt, der eben deshalb den Nationalsozialismus aus dem Faschismusbegriff ausgeschlossen hat.
Die hier angedeuteten Überlegungen sollen nicht dazu dienen, die Rolle ideologischer Faktoren im Faschismus generell zu bestreiten. Der Faschismus war weder bloß opportunistisch oder gar »nihilistisch«, wie manche Interpreten gemeint haben, vielmehr stets durch gewisse Sinnmuster geprägt, an erster Stelle: durch die Neigung, »dem größere Bedeutung [bei] zu messen, was die Menschen ungleich statt gleich macht«.27 Aber diese Präferenz, die die Zugehörigkeit des Faschismus zur politischen Rechten markiert, manifestierte sich auf unterschiedliche Weisen, ohne sich zu einer für die gesamte Bewegung und die auf ihr aufruhenden Organisationen verbindlichen Weltanschauung oder Ideologie zu verdichten, die unter einheitlichen Gesichtspunkten durchsystematisiert wäre. Sie verblieben vielmehr im Modus eines Aggregats,28 das mehr oder weniger disparate Elemente nach äußerlichen Kriterien wie Ähnlichkeit oder Affinität zusammenfügt und sachliche Unverträglichkeiten und Widersprüche bestehen lässt. Wahrscheinlich war es gerade dieser, auch im »wilden« oder »mythischen« Denken zu beobachtende Grundzug, der den Massenerfolg des Faschismus verbürgt hat: ermöglichte er es doch unterschiedlichen Sinnorientierungen mit z.T. erheblicher Bandbreite, an ihn anzudocken und sich in ihm zu installieren, in der steten Erwartung, die intellektuelle Hegemonie erobern zu können.
In diesem Buch geht es darum, den Faschismusbegriff so weit zu öffnen, dass er für die wechselhaften und spannungsreichen Beziehungen zwischen diesen Komponenten Raum hat. Das geschieht zunächst mit einer typologischen Erörterung, die deutlich zu machen versucht, dass Nationalismus und Faschismus auf verschiedenen Ebenen liegen. Der Nationalismus hat seinen Schwerpunkt, mit Bourdieu zu reden, im intellektuellen Feld und strebt danach, sich von hier aus möglichst bruchlos ins politische Feld zu übersetzen, ohne Konzessionen an dessen Eigenheiten zu machen – eine ideologische Politik, die in diesem formalen Sinne durchaus mit dem Sozialismus und Kommunismus vergleichbar ist. Der Faschismus dagegen kann als eine Erscheinung beschrieben werden, die zwar in ideologischer Hinsicht eine bestimmte, Homogenität verbürgende Grundposition besitzt, jedoch unter diesem Dach verschiedene Auslegungen derselben vorerst toleriert und darüber Anhänger rekrutiert, eine definitive Entscheidung zwischen ihnen aber aufschiebt und Einheit vor allem auf ›praxeologischer‹ Ebene erreicht, durch die Akzentuierung der »Erlebnisdimension des Faschismus«, die gewalttätige Praxis, den politischen Stil, die »charismatische Form von Politik«- eine Strategie, die zwar die Widersprüche auf intellektueller Eben zeitweise zu überdecken, nicht aber aufzuheben vermochte.29 Potentielle Bruchpunkte waren in Italien etwa der Konflikt um den patto di pacificazione im Sommer 1921, der Mussolini fast die Führung in der Bewegung gekostet hätte, der Streit um Otto Dickel zur gleichen Zeit in der NSDAP oder der Dissens zwischen Hitler und Straßer im Dezember 1932 über die Frage der Regierungsbeteiligung der NSDAP.
Die hieran anschließenden Kapitel nehmen die Herausforderung der ideologiezentrierten Deutung des Faschismus auf ihrem eigenen Terrain an. Sie präparieren in einer überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich auf den fascismo movimento bezogenen Analyse die unterschiedlichen Deutungsmuster heraus, die in die faschistischen Parteien Italiens und Deutschlands Eingang gefunden haben und ermöglichen auf diese Weise auch einen Vorblick auf mögliche Spannungen im fascismo regime. Dieser selbst ist dann allerdings nicht mehr Gegenstand, operiert ein Regime doch unter neuen Bedingungen, die vor allem durch die außenpolitische Lage bestimmt sind. Das abschließende Kapitel widmet sich stattdessen der Aufgabe, die These von der ideologischen Heterogenität der faschistischen Bewegungen im Wege einer Kontrastierung mit zeitgleichen Erscheinungen in anderen Ländern zu erhärten, die von der neueren Forschung, zumal der vom »neuen Konsensus« inspirierten, als faschistisch gedeutet werden. Gezeigt wird, dass sie sich im Unterschied zu Italien und Deutschland ohne Rest von der Typologie des Nationalismus her erschließen lassen, die sich damit als unentbehrliches Analyseinstrument erweist, auch und gerade deshalb, weil sich mit ihr auch Teilaspekte des Faschismus erschließen lassen, ohne freilich dessen Typus als solchen zu bestimmen.
Nationalismus und Faschismus: Definition und Typologie
1.Nationalismus
Faschismus, will es der ›neue Konsensus‹, sei am besten zu fassen, wenn man ihn als »an ideal type (and hence an intrinsically anti-essentialist explanatory model)« verstehe.30 Das ist zunächst eine begrüßenswerte Entscheidung: für die idealtypische Methode Max Webers und gegen herkömmliche Deutungen, die den Schlüssel zum Faschismus in der Kapitalismustheorie suchen, aber auch gegen Verfahren, die sich ihm rein phänomenologisch genähert und zu fragwürdigen Reduktionen, etwa auf ›Antimarxismus‹ (Ernst Nolte), geführt haben. Reduktionistisch ist aber auch der Vorschlag, den Faschismus wie eine der in Russland beliebten Matrjoschkas zu behandeln: als eine Puppe, in der sich eine andere Puppe verbirgt. Darauf läuft die Empfehlung hinaus, den Faschismus als Ultranationalismus zu deuten und die Erklärung damit auf den Nationalismus zu verlagern, eine genuin moderne politische Ideologie, deren affektive Triebkraft das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft sowie das Bestreben sei, aus dieser einen auf dem Prinzip der Volkssouveränität beruhenden Staat zu machen.31
Griffin hat zwar darauf beharrt, dass die Reduktion auf ›Ultranationalismus‹ nicht mit derjenigen auf Nationalismus identisch sei.32 Dies trifft aber nur auf eine der beiden Varianten zu, in die er den Nationalismus zuvor untergliedert hat. Historisch zum ersten Mal gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Erscheinung getreten, habe der Nationalismus von Anfang an eine ›janusköpfige Qualität‹, ja eine ›schizoide Natur‹ besessen. Nach der einen Seite liberal, ›eine Kraft, gewidmet der Emanzipation der Völker und Individuen von allen Formen der Tyrannei‹, sei er nach der anderen Seite als ›Rechtfertigung des Hasses auf Fremde (Xenophobie)‹ und als ›Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit (Rassismus)‹ aufgetreten und habe dem liberalen Nationalismus ein Gegenbild entgegengestellt: dasjenige eines ›illiberalen Nationalismus‹. Als dessen Vertreter figurieren Fichte und Arndt, Barrès und Maurras, Mussolini und Hitler, Pol Pot und Saddam Hussein; als Repräsentanten des ersteren Rousseau, Kant, Bentham, J.S. Mill und andere. Daneben begegnen Kippfiguren wie Herder und Mazzini, deren Denken in der Gefahr eines Umschlags vom liberalen in den illiberalen Nationalismus gestanden habe.33
Während die allgemeine Charakterisierung sich mit den Ausführungen deckt, die sich bei Max Weber zum thema probandum finden,34 geht die hieran anschließende Typenbildung in eine deutlich andere Richtung, die von einer um Werturteilsfreiheit bemühten Sozialwissenschaft abführt. Auch wenn sie nicht gänzlich damit deckungsgleich ist, ist sie doch nicht allzu weit entfernt von der auf Hans Kohn zurückgehenden Unterscheidung zwischen einem ›guten‹ Nationalismus, wie er sich seit dem 18. Jahrhundert im ›Westen‹, d.h. in den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz entwickelt haben soll, und einem ›schlechten‹ Nationalismus, zu dem das übrige, vor allem aber das östliche Europa zu rechnen sei:35 eine Dichotomie, die weder der überaus langsamen Durchsetzung von Bürgerrechten im Westen noch dem Spannungsverhältnis zwischen politischen und ethnischen Begründungsmustern im Osten und im Westen gerecht zu werden vermag und deshalb seit längerem in die Kritik geraten ist.36
Hält man sich dagegen an Webers Forderung nach einer »prinzipielle[n] Scheidung von Erkenntnis des ›Seienden‹ und des ›Seinsollenden‹«,37 nach einer »Erfahrungswissenschaft«, von der »der Gedanke des Seinsollenden, ›Vorbildlichen‹ […] zunächst sorgsam fernzuhalten ist«,38 dann wird man anders vorgehen müssen. Basierend auf einer weit ausholenden, an Webers Ausführungen zu den ethnischen und politischen Gemeinschaften in Wirtschaft und Gesellschaft anknüpfenden Kasuistik, hat Bernd Estel den Nationalismus auf die Grundannahme zurückgeführt, »dass Gesellschaft und Geschichte in ihren jeweiligen Ausprägungen und längerfristigen Entwicklungen primär durch die Existenz, durch das Mit- und Gegeneinander von Nationen, in die die Menschheit von Natur aus gegliedert sei, bestimmt würden, und dass die Nation bzw. die nationale Zugehörigkeit auch für die Prägung der Person, d.h. ihrer Mentalität, ihres Charakters oder Habitus ausschlaggebend sei.« Eng damit verknüpft sei eine Reihe weiterer Annahmen, unter deren historisch folgenreichsten der Glaube sei, »dass die Nation ein sehr hohes ontisches und sittliches Gewicht, ja ein Dignitätsübergewicht gegenüber allen anderen sozialen Gebilden zumindest innerweltlicher Zielsetzung besitze«, ja mehr noch: »dass die eigene Nation in der umfassenden, gottgewollten oder natürlichen Dignitätshierarchie , nach der alles Seiende gegliedert sei, zumindest an sich einen sehr hohen, wenn nicht den obersten Rang einnehme, und demzufolge die anderen Nationen, obwohl grundsätzlich ebenfalls wertvoll, überwiegend oder gar allesamt auf nachgeordneten Rangplätzen zu finden seien.«39 Hartmann Tyrell hat mit Blick auf derartige Konstellationen von »Höchstrelevanz« gesprochen und damit ein Phänomen bezeichnet, das sich auch in anderen Handlungssphären findet, etwa der Religion, und darüber hinaus zur Rechtfertigung von Hierarchisierungen zwischen den verschiedenen Sphären herangezogen zu werden pflegt.40
Historisch hat sich diese Höchstrelevanz erst spät herausgebildet, als ein Effekt äußerer und innerer Staatsbildung, wachsender wirtschaftlicher Verflechtung, kommunikativer Verdichtung, Ausweitung von Schul- und Wehrpflicht und anderer Faktoren, die von der einschlägigen Forschung hinreichend dokumentiert sind.41 Für einen längeren Zeitraum ist dabei mit einer Gemengelage zu rechnen, in der sich nationalistische Zielsetzungen in wechselnden Prioritätsverhältnissen mit anderen Präferenzen mischten, zunächst mit solchen liberaler und demokratischer, ja selbst konservativer und, im Zuge der industriellen Revolution, auch sozialistischer Art. In Frankreich konnte sich ein Frühliberaler wie Benjamin Constant gleichzeitig für die Freiheitsrechte des Individuums und der Nation stark machen und die ruhmreichen Schlachten Napoleons feiern, die die Unterdrückung eben dieser Rechte bei anderen Nationen sicherstellen sollten;42 konnte ein Jakobiner wie Barère für sein Land die Volkssouveränität verkünden und für andere Völker den kolonialen Status oder gar die Vernichtung fordern.43 In den USA waren die Protagonisten der Jacksonian democracy für die Demokratisierung von Gesellschaft und Wirtschaft, fanden damit aber die Aufrechterhaltung der Sklaverei im Inneren ebenso vereinbar wie die territoriale Expansion auf Kosten Mexikos.44 In Deutschland spaltete sich der Konservatismus schon im Vormärz in zwei Richtungen, von denen die eine, mit den Brüdern Gerlach verbundene, im Staat das nationsbildende Prinzip sah, während die andere umgekehrt die Nation zum staatsbildenden Prinzip erklärte. In der Reichsgründungszeit musste die erstere das Feld räumen und es einem ›neuen Konservatismus‹ überlassen, der sich seit 1867 explizit als ›nationalconservativ‹ definierte und darunter »das Bekenntnis zur preussisch-monarchischen Expansionspolitik« verstand, damit aber auch zu deren Ergebnissen im Gefolge der napoleonischen Kriege.45 Selbst ein Sozialist wie Lassalle hielt es für selbstverständlich, die angestrebte Lösung der sozialen Frage durch die Einrichtung von Produktivgenossenschaften mit dem Wunsch zu verbinden, »noch die Zeit zu erleben, wo die türkische Erbschaft an Deutschland gefallen sein wird und deutsche Soldaten- oder Arbeiterregimenter am Bosporus stehen«.46
Derart widersprüchliche Vorstellungskomplexe behielten lange ihre Wirkungskraft, sahen sich aber im Fortgang des 19. Jahrhunderts zunehmend im Sog von Bestrebungen, dem nationalen Kollektiv und seinen vermeintlichen Interessen den Vorrang vor allen anderen Handlungssphären zuzusprechen. Im Frankreich der Dritten Republik gewann ein »Nationalprotektionismus« die Oberhand, der die aus dem Schutzzollsystem erwachsenden Spannungen durch eine überseeische Expansionspolitik auszugleichen versuchte, welche dem Land innerhalb weniger Jahre eines der größten Kolonialimperien neben dem British Empire bescherte.47 In Deutschland war der Protektionismus vor allem bei den Konservativen verbreitet, freilich weniger in Form eines National- als eines reinen Interessenprotektionismus der Agrarier Ostelbiens, die zwar für sich in Anspruch nahmen, »am tatkräftigsten für den Erwerb und den Ausbau der deutschen überseeischen Besitzungen eingetreten zu sein«, jedoch zugleich mit Nachdruck den »immer stärker werdenden Strömungen« entgegentraten, »welche die Kolonien benutzen wollen, um den Schwerpunkt der politischen und wirtschaftlichen Macht des Deutschen Reiches von der Heimaterde zu entfernen«.48 Das hinderte sie freilich nicht, seit der Marokkokrise im Tausch gegen wirtschaftspolitische Zugeständnisse die vom liberalen Mainstream forcierte ›Weltpolitik‹ zu unterstützen.49 Politiker wie Friedrich Naumann, die den Liberalismus zugleich mit nationalistischen und sozialen Zielen verbinden wollten, forderten seit den 1890er Jahren eine Erweiterung des deutschen Kolonialbestandes »in gemäßigtem Klima« und zu dessen Schutz einen Ausbau der »Kriegsflotte«.50 Sogar bei der politischen Linken, die im Mainstream Distanz zum Nationalismus hielt, kam es zu Bestrebungen, diese zu lockern. Im Lager der revolutionären Syndikalisten Italiens fanden sich Stimmen, die ihre Forderungen zunehmend lauter mit ›national-populistischen Akzenten‹ versahen und eine auf Expansion zielende Kolonialpolitik befürworteten: eine Form des Linksnationalismus, die sich bald darauf als mit dem Faschismus vereinbar erwies.51 In dem aus der Oktoberrevolution hervorgegangenen Staat wollte man sich bald nicht mehr damit begnügen, ›Sozialismus in einem Lande‹ zu sein und strebte nach einer Ordnung, die sich als Union sozialistischer Sowjetrepubliken bezeichnen mochte, de facto aber das Imperium eines Nationalstaates war.52
Mit besonderer Verve aber warf sich die radikale, aus der Verschmelzung konservativer und liberaler Positionen seit Mitte des 19. Jahrhunderts hervorgegangene Rechte auf den Nationalismus.53 Drei Typen, die in der Einstellung zu Exklusion und Inklusion sowie zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt differierten, lassen sich hier unterscheiden. Ein Rechtsnationalismus, der zwar ein gewisses Maß an bürgerlichen Freiheiten anerkannte, bei den politischen Rechten aber klassen-, ethno- oder geschlechterpolitisch motivierte Abstufungen oder gar Exklusionen vornahm, wurde vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, von den im Fin de Siècle aufkommenden nationalistischen Agitationsverbänden propagiert, etwa dem 1891 gegründeten Alldeutschen Verband, der in vielem an Vorgaben des Historikers Heinrich von Treitschke anknüpfte, oder der Action française von 1899; das italienische Pendant, die Associazione Nazionalista Italiana, folgte erst 1910.54 Nach innen setzte man hier mit unterschiedlichen Akzenten auf Änderungen des Wahlrechts oder die Einführung zweiter Kammern, um das politische Gewicht der Ober- und Mittelschichten zu vergrößern und dasjenige der Unterschichten zu verkleinern,55 auf eine Umstellung von Assimilation auf Dissimilation, durch die ethnische Minderheiten dauerhaft unter Fremdenrecht gestellt und politischem wie wirtschaftlichem Druck ausgesetzt werden sollten sowie auf bevölkerungspolitische Maßnahmen, um die Fertilität der Unterschichten zu begrenzen, diejenige der Bessergestellten zu erhöhen; nach außen auf eine zwischen überseeischem und kontinentalem Imperialismus schwankende Expansion, die vor allem während des Ersten Weltkriegs, etwa im Lager der sogenannten Vaterlandspartei, jeglichen Bezug zur Realität einbüßte.56 Ich habe diesen Typus, um des Kontrasts zum folgenden willen, als »alten Nationalismus« bezeichnet, doch könnte man auch von oligarchischem Nationalismus oder Rechtsnationalismus erster Stufe reden.57
Um Rechtsnationalismus zweiter Stufe oder »neuen Nationalismus« handelt es sich dagegen dort, wo in Bezug auf die politischen und sozialen Rechte eine Umstellung auf mehr Inklusion erfolgt oder doch wenigstens eine deutliche Bewegung in dieser Richtung erkennbar ist. Das dabei angestrebte Maß an Inklusion mag nicht so groß sein wie im Falle des demokratischen oder sozialen Nationalismus; wie auch die Lockerung schichtspezifischer Ausschließungsmechanismen oft von einer gegenläufigen Bewegung in geschlechter- oder ethnopolitischer Hinsicht begleitet ist. Im Unterschied zum alten Nationalismus aber, und nur darauf kommt es an, verhielt sich der neue Nationalismus gegenüber der ›aktiven Massendemokratisierung‹ (Max Weber) nicht bloß abwehrend und eindämmend, sondern responsiv, indem er sich explizit auf die Interessen und Bedürfnisse der Massen als Legitimitätsquelle einstellte. Ein gewisses Maß an demokratischer Partizipation, und sei es nur in Form der plebiszitären Legitimität oder der Forderung nach sozialer Sicherung, war deshalb dem neuen Nationalismus wesentlich.58 Es erscheint mir sinnvoll, den Terminus allein auf diese (im Übrigen dem historischen Sinn am meisten entsprechende) Entwicklung innerhalb des Rechtsnationalismus zu beziehen und ihn nicht zu verschleißen, indem man mit ihm das angebliche Gleiten des Nationalismus von links nach rechts belegt59 – mit der unausweichlichen Folge, dass dann die Entwicklung des Rechtsnationalismus nur mehr mit Steigerungsbegriffen wie »Radikalnationalismus« oder »Ultranationalismus« ausgedrückt werden kann.60 Natürlich lässt sich das in die Nation investierte Gefühlsquantum steigern oder vermindern. Nationalismus aber im weltanschaulichen Sinne ist per definitionem bereits durch die Höchstrelevanz der Nation bestimmt und kann deshalb nicht weiter gesteigert werden, schon gar nicht, wie häufig behauptet, durch die Verbindung mit dem Rassismus, der eine Präferenz für Rasse, nicht für Nation beinhaltet. Von ihm, der in ähnlicher Weise einer zunehmend schärferen Profilierung unterliegt, wird an gesonderter Stelle die Rede sein.61
Eine weitere Variante, die ihrerseits in einer mehr exklusiven oder mehr inklusiven Form auftreten kann, ergibt sich, wenn man den Rechtsnationalismus zu den nicht im engeren Sinne politischen und sozialen Dimensionen des Modernisierungsprozesses in Beziehung setzt, zu dem, was in der Sprache des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wie immer auch vage »Fortschritt« heißt, also: der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, arbeitsteiliger Produktion und formaler Organisation. Während alter und neuer Nationalismus unterschiedliche Optionen hinsichtlich des Umgangs mit den politischen und sozialen Begleiterscheinungen dieses »Fortschritts« vertraten, pflegten sie letzteren doch im Allgemeinen zu bejahen, auch wenn dies im Falle des alten Nationalismus darauf hinauslief, genau jene Triebkräfte zu affirmieren, die ihm auf lange Sicht den Boden entziehen mussten.
Denkbar ist jedoch ein in dieser Beziehung mit Vorbehalten verbundener Nationalismus – nicht im Sinne einer totalen Negation, die es kaum erlauben würde, unter den Bedingungen nationalstaatlicher Konkurrenz mit einigem Erfolg nationalistische Politik zu betreiben, wohl aber im Sinne einer Eindämmung und Zähmung des »Fortschritts«. Im Anschluss an die von Historikern und Soziologen herausgearbeitete Unterscheidung von »erster« und »zweiter Moderne« (Nipperdey, Beck), von »einfacher« und »reflexiver Modernisierung« (Beck) bzw. von »liberaler Moderne« und »massendemokratischer Postmoderne« (Kondylis),62 ließe sich dieser nicht schlechterdings antimoderne oder gegenmoderne, wohl aber begrenzt »fortschrittskritische« Rechtsnationalismus als ein solcher charakterisieren, der den Übergang von einem Stadium der Moderne zum anderen skandalisiert und die Nation als erstrebte Gemeinschaft gleichsam mit dem Rücken zur »zweiten Moderne« verwirklichen will. Ich habe diese intermediäre, in einem gedachten Spektrum zwischen den Polen Progression und Regression angesiedelte Position »völkischen Nationalismus« genannt, weil sie innerhalb der deutschen Rechten bei jenen Gruppen gut nachweisbar ist, für die sich die Bezeichnung »völkische Bewegung« eingebürgert hat.63 Da der Begriff »völkisch« in der Forschung jedoch überwiegend auf ein ethnisch-genealogisches Nationsverständnis bezogen wird,64 mithin auf ein Merkmal, das keineswegs nur diesem Typus eigen ist, mag es sinnvoller sein, eine neutralere Bezeichnung wie »intermediärer« oder »hybrider Nationalismus« zu wählen, um Missverständnisse auszuschließen. Das entscheidende Kriterium ist jedenfalls nicht die Auffassung von der Nation als ethnischer Abstammungsgemeinschaft oder gar die Verwendung des ius sanguinis, wie es oft in Verkennung der juristischen Bedeutung dieses Terminus heißt,65 sondern die Verbindung von Rechtsnationalismus und Kritik der reflexiven Modernisierung.-
Völkischen Nationalismus hat es auch außerhalb Deutschlands gegeben, wie später genauer zu zeigen ist. Aber nur in Deutschland begegnet er als Element des Faschismus. Das hat Versuche nicht gehindert, ihn zu einem allgemeinen Element des Faschismus zu erklären, wenn auch zumeist auf dem Umweg einer Gleichsetzung von »völkisch« und »populistisch«.66 Dem wird hier nicht gefolgt. Soweit sich für den Populismus überhaupt ein Begriff bilden lässt,67 deckt sich dessen Inhalt allenfalls punktuell mit den für den völkischen Nationalismus benannten Merkmalen. Populismus macht ›das Volk‹ gegen ›die da oben‹ mobil68 und erweist sich darin als eine Variante der plebiszitären Führerdemokratie, die nach Max Weber aus der antiautoritären Wendung des Charisma hervorgeht, freilich auch die Möglichkeit eines Umschlags in eine autoritäre Richtung mitführt.69 Entsprechend groß ist die Bandbreite populistischer Bewegungen und Parteien, die von terroristischen Gruppen wie dem russischen narodničestvo über die radikaldemokratische Bewegung der Farmer im mittleren Westen der USA bis hin zu den Anhängern einer radikalliberalen Austeritätspolitik reicht, wie sie in jüngster Zeit mit Bolsonaro in Brasilien und Mileis in Argentinien zur Macht gelangten. Der Nationalismus mag zwar eine ähnliche Bandbreite aufweisen, doch unterscheidet er sich vom Populismus durch eine stärkere Ausrichtung auf die Außenbezüge des politischen Verbandes bzw. Staates, ging und geht es ihm doch stets darum, den Platz der eigenen Nation in einer Welt konkurrierender Nationalstaaten sicherzustellen. Das schloss im Europa der Zwischenkriegszeit bei den ›haves‹ mindestens die Behauptung des kolonialen Besitzstandes, bei den ›have nots‹ die Erweiterung bzw. den (Wieder-)Gewinn eines solchen ein und motivierte insbesondere in Italien und Deutschland den Rechtsnationalismus dazu, die Innen-, Wirtschafts-, Sozial- und selbst die Erziehungspolitik rüstungspolitischen, auf die Erweiterung des eigenen Machtpotentials ausgerichteten Direktiven zu unterwerfen: im Falle des ›alten‹ Nationalismus allerdings in Korrelation mit einer entschieden oligarchischen Ausrichtung und selbst beim ›neuen‹ Nationalismus, ungeachtet der auf stärkere Inklusion gerichteten Bestrebungen, durchaus mit elitärer Tendenz. Das schloss Bündnisse mit dem Faschismus nicht aus, macht aber deutlich, dass dieser nicht einfach als »populist ultra-nationalism« verstanden werden kann. Womit, nebenbei bemerkt, auch den Bemühungen eine Grenze gesetzt ist, in aktuellen Manifestationen des Populismus eine Wiederkehr des Faschismus aufzuspüren.70
2.Faschismus
Nähert man sich, wie oft vorgeschlagen, vom Nationalismus her dem Faschismus, wie er 1919/20 in München und Mailand erste Gestalt annahm, so überrascht prima facie die Differenz. Hier eine Partei, die sich in kaum einem Punkt von den Organisationen des völkischen Nationalismus unterschied, die sich bis in die Anfänge des Zweiten Kaiserreichs zurückverfolgen lassen; dort ein Ensemble von Fasci, bloßen Aktionsgemeinschaften von ehemaligen Sozialisten, revolutionären Syndikalisten, Elitesoldaten und Futuristen. Hier ein Programm, das in zahlreichen Punkten auf Ausschluss und Abwehr ausgerichtet war, sich um »das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse« sorgte, das »positive Christentum« schützen wollte und den »gesetzlichen Kampf gegen gegen eine Kunst- und Literaturrichtung« forderte, »die einen zersetzenden Einfluss auf unser Volksleben ausübt«;71 dort das Verlangen nach einer progressiven Kapitalbesteuerung im Wege einer »echten Teilexpropriierung aller Güter«, nach »Beteiligung der Arbeitervertreter an der technischen Führung der Betriebe«, ja nach »Übertragung der Führung von Industrien oder öffentlichen Betrieben an die proletarischen Organisationen, die sich in moralischer und technischer Hinsicht solchen Vertrauens würdig erweisen«, ergänzt einige Monate später um einige gegen die katholische Kirche gerichtete Forderungen.72 Weiter entfernt voneinander konnte man kaum sein, und so nimmt es denn auch nicht Wunder, in diesen ersten Jahren des Faschismus beiderseits der Alpen auf zahlreiche abwertende Äußerungen über die angeblichen Verwandten zu stoßen.73 Zumindest für die Anfänge beider Bewegungen tut man deshalb gut daran, dem Rat von Hans Woller zu folgen und die Bedeutung ideologischer Gesichtspunkte für den generischen Faschismusbegriff »doch etwas geringer zu veranschlagen, als das im wissenschaftlichen Schrifttum bisher der Fall ist.«74 Das muss nicht bedeuten, sie außer Acht zu lassen. Wohl aber: sich zunächst des Rahmens zu versichern, in dem sie wirksam werden konnten, ohne einander zu torpedieren.
2.1Bewegung – Bund – Partei
Eine der ersten Formeln, mit denen der eben entstandene Faschismus sich selbst zu erklären versuchte, stammt, wie anders, von Mussolini. »Der Faschismus ist keine Kirche; er ist viel eher ein Trainingsplatz. Er ist keine Partei; er ist eine Bewegung«.75 Der dies schrieb, hatte allerdings noch wenige Jahre zuvor selbst einer Partei angehört und von 1912 bis 1914 deren wichtigste Zeitung, den Avanti, geleitet. Seit seinem Eintritt in den Partito Socialista Italiano (PSI) hatte er diese Organisationsform gegen ihre Kritiker von links, die revolutionären Syndikalisten, verteidigt, auch wenn er selbst als Sohn eines Anarchisten große Sympathien für diese Strömung hatte und bisweilen in ihren Organen schrieb.76 Pflegten die Syndikalisten in der Partei eine Organisationsform zu sehen, die die Bestrebungen des Proletariats in eine falsche Richtung lenkte und daher zu vermeiden bzw. zugunsten der Gewerkschaften zu vernachlässigen war, so stieß sich Mussolini nur am Einfluss der Kleinbürger und Reformisten in der Partei, nicht an der Organisation als solcher, die ihm als unentbehrliches Instrument der Revolution galt. Worauf es aus seiner Sicht ankam, war, sie von opportunistischen Elementen zu reinigen, damit sich eine ›Aristokratie der Intelligenz und der Willenskraft‹ bilden konnte – ein Konzept, das mit gewissem Recht als blanquistisch bzw. protobolschewistisch eingestuft wurde,77 auch wenn es Mussolini am theoretischen Fundament eines Lenin durchaus mangelte.
Als er sich im Spätsommer 1914 auf die Seite derjenigen schlug, die sich für einen Kriegseintritt Italiens einsetzten, bedeutete dies auch den vorläufigen Abschied von der Organisationsform Partei. An deren Stelle trat, wie es fortan in seinen Artikeln im Popolo d’Italia hieß, »nostro movimento«, »il movimento interventista e fascista« bzw. »il movimento di ›Fasci d’Azione Rivoluzionaria‹«.78 Das knüpfte an ältere, spontan gebildete und lockere Formen an, wie sie etwa während der Bauernrebellion von 1893/94 mit den Fasci Siciliani ihren Auftritt gehabt hatten,79 meinte aber weniger eine soziale Bewegung im Sinne Rudolf Heberles als ein Ensemble von pressure groups für ein eng umgrenztes Ziel (Italiens Kriegseintritt), das ebenso von Republikanern wie von monarchistischen Nationalisten und Exsozialisten angestrebt wurde.80 Dem elitären Charakter dieser Verbände kam Mussolini durchaus nahe, wenn er im Dezember 1917 von einer trincerocrazia träumte, einer ›Aristokratie des Schützengrabens‹, die in die Fußstapfen der revolutionären Bourgeoisie von 1789 treten und wie diese mit den ›Parasiten‹ Schluss machen werde.81
Die im März 1919 in Mailand gegründeten Fasci di combattimento schlossen zwar an diese Vorgaben an, zeigten aber zugleich weitergehende Ambitionen, die deutlich in Richtung einer politischen Partei tendierten. Drei Monate später veröffentlichten sie ein Programm, das eine Fülle von Forderungen zur Gestaltung des Wahlrechts und der staatlichen Institutionen, zur Außen-, Sozial-, Finanz- und Steuerpolitik sowie zum Militärwesen enthielt und darin dem Programm einer politischen Partei gleichkam.82 In dieselbe Richtung wies die Entscheidung, sich im November 1919 an den Parlamentswahlen zu beteiligen und dafür eine Liste von Kandidaten aufzustellen, gehört doch »im formal legalen Verband«, der Italien damals war, das Streben nach einer Besetzung der Regierung »durch (formal) freie Wahl« zu den Essentials, die eine Partei von einer Bewegung unterscheiden.83 Dass der Erfolg in diesem Fall äußerst gering ausfiel – in Mailand gewannen sie nur 4796 von 270.000 Stimmen –, spricht nicht dagegen, die Fasci wenn nicht bereits als Partei, so doch wenigstens als Protopartei einzustufen, auch wenn Mussolini seit November 1918 die Rede von einer »Antipartei« pflegte, teils in der Absicht, Distanz zu seiner sozialistischen Vergangenheit zu markieren, teils um eine Brücke zu den Futuristen und den Veteranen zu schlagen, die es ablehnten, sich am herkömmlichen Politikbetrieb zu beteiligen.84 Ende 1920 gab es landesweit über 88 Fasci mit etwas über 20.000 Mitgliedern.85
Zu diesem Zeitpunkt wurde diese Protopartei bereits durch eine weitgehend unabhängig von ihr entstandene, sich im Laufe des folgenden Jahres gleichwohl mit ihr assoziierende soziale Bewegung ergänzt, worunter im Sinne der neueren Forschung ein Ensemble verstanden werden kann, das seine Agenda außerhalb der etablierten Institutionen »by contention via ›street politics‹ and disruption« verfolgte.86 Ohne von der Zentrale der Fasci in Mailand in irgend einer Weise stimuliert oder gar koordiniert worden zu sein, brach damals in der Emilia Romagna und einigen angrenzenden Regionen ein Sturm auf die Bastionen des Sozialismus auf dem Land los, getragen von demobilisierten Offizieren, Studenten, Arbeitslosen und Jugendlichen. Subventioniert von den Verbänden der Agrarier, aber auch von staatlichen Stellen,87 entwickelte sich eine an lateinamerikanische Zustände erinnernde »agglomerierte Gewaltkultur« im Sinne eines sich hegemonial über das soziale Gefüge legenden Netzwerks »mit eigenen Arrangements der Gewaltakteure, Interessenlagen, Geldeintreibungssystemen etc.«,88 dem die bestehenden Netzwerke aus genossenschaftlichen Volksheimen, Kooperativen, sozialistischen Kommunalverwaltungen und camere di lavoro nicht standzuhalten vermochten. Schon im März 1921 hatte sich die Zahl der Fasci verdreifacht, die der Mitglieder vervierfacht, um zwei Monate später noch einmal auf 1001 Fasci mit 187.098 Mitgliedern zu steigen. Und wie die Wahlen vom 15. Mai 1921 zeigten, beschränkte sich diese Welle nicht auf das Land, konnte Mussolini doch in Mailand fast 200.000 Stimmen für sich verbuchen.89 Auch wenn rein zahlenmäßig die Bewegung auf dem Land 1921/22 überwog, rechtfertigt die fortbestehende Präsenz urbaner Fasci di combattimento und die Koordination der lokalen Bewegungen durch deren Zentrale es nicht, für diese Phase nur den Bewegungscharakter zu betonen, wie dies in der geläufigen Gegenüberstellung von fascismo movimento und fascismo regime geschieht. Der Faschismus vor der Machtübernahme war nicht bloß eine soziale Bewegung pur et simple, wie manche meinen,90 und auch nicht eine solche im Sinne eines genus proximum, das neben informellen und halbformellen Verbänden auch »fest strukturierte Organisationen, darunter auch Parteien« enthielte.91 Vielmehr handelte es sich um eine temporäre Vereinigung von Unvereinbarem, die früher oder später nach der einen oder der anderen Seite ausschlagen musste: ein Mixtum compositum aus Bewegung und Partei, eine ›movement-party‹,92 die die Merkmale einer sozialen Bewegung – das Streben eines aus unorganisierten Gruppen zusammengesetzten kollektiven Akteurs nach grundlegendem sozialen Wandel – mit dem für Parteien typischen Streben nach politischer Macht verband.93
Es entsprach dieser spannungsträchtigen Lage, dass die lokalen Verbände sich vielfach den Bestrebungen widersetzten, vom fascismo milanese dominiert und instrumentalisiert zu werden, wie Mussolini dies im Sommer 1921 mit dem sogenannten Befriedungspakt beabsichtigte, der darauf zielte, »die Gewerkschaft (CGL) von der sozialistischen Partei [zu] lösen, dann die CGL und die überall aus dem Boden schießenden ›nationalen‹ Syndikate als Koalition an der Basis zu einer Art Labour Party zusammen[zu]führen«; die Opposition von lokalen Führern wie Grandi, Balbo und Marsich erwies sich als so stark, dass Mussolini sich genötigt sah, auf dieses Vorhaben zu verzichten.94 Da es andererseits den Führern der Opposition nicht gelang, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen und auch der Versuch scheiterte, Mussolini durch D’Annunzio zu ersetzen, verständigten sich beide Seiten im Spätsommer/Herbst 1921 auf einen Kompromiss, der die Fortsetzung der gewalttätigen Praxis erlaubte, zugleich aber einen Weg eröffnete, die auseinanderstrebenden lokalen Gruppen zusammenzuhalten und Einfluss auf die politischen Entscheidungen zu gewinnen. Der Faschismus, so die im August 1921 von Mussolini ausgegebene Formel, müsse sich in eine Partei verwandeln, die zugleich felsenfest und diszipliniert genug sein sollte, um notfalls auch ›auf der Ebene der Gewalt‹ erfolgreich zu agieren. Auf dem Kongress in Rom vom 7. bis 10. November 1921 wurde diesem Vorschlag mit der Gründung des Partito Nazionale Fascista (PNF) Rechnung getragen.95
Der Doppelcharakter einer ›movement-party‹ verschwand indessen auch mit Eintritt in die Regimephase im Oktober 1922 nicht völlig. Wohl kam es zu einer Institutionalisierung und Disziplinierung vor allem der squadre, auf die im nächsten Abschnitt näher einzugehen sein wird. Institutionalisierung und Disziplinierung sind jedoch nicht gleichzusetzen mit Aufhebung oder Beseitigung der vorgegebenen Strukturen. Auch wenn viele Schwarzhemden in den Jahren ab 1922 und besonders ab 1925/26 zum Objekt häufiger Bestrafung und sogar kurzfristiger Internierung wurden, spielten sie doch bis zum Ende des Regimes eine unentbehrliche Rolle für die Sicherung der Diktatur,96 weshalb es sich empfiehlt, die letztere nicht zu scharf von der Bewegung abzusetzen, wie dies in Deutungen geschieht, die Italien nach 1922 unter der Herrschaft eines ›politischen Ordens‹ sehen, in Nachbarschaft nicht nur zum NS-Regime, sondern auch zum bolschewistischen Russland.97Fascismo movimento und fascismo regime sollten nicht als abstrakte Gattungsbegriffe behandelt werden, die für einander ausschließende Phasen stehen, sondern als Idealtypen, mit deren Hilfe verschiedene ›Seiten der Bedeutsamkeit‹ an einer historischen Erscheinung beleuchtet werden können, um so stets von neuem zu gewichten, welche Seite gerade dominiert.98 In den Rollkommandos des »›Kriegsfaschismus‹ von Salò« schob sich für kurze Zeit der fascismo movimento wieder in den Vordergrund, nun freilich in aggressiver Wendung vor allem gegen die ehemaligen, abtrünnig gewordenen Parteigenossen.99
In Deutschland war die Lage insofern anders, als der Faschismus dort von Anfang an als Partei auftrat, in Gestalt der im Januar 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, die sich ein Jahr später in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannte. Zwar gehörte sie, nach eigenem wie nach fremdem Verständnis, zu einem Ensemble von Verbänden, das neben Parteien auch Orden wie den Germanen-Orden, Vereine bzw. Sekten wie die Thule-Gesellschaft und Bünde wie den Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund einschloss und damit dem Typus einer sozialen Bewegung entsprach, wie sie auch selbst sich gern weniger als Partei denn als Bewegung inszenierte: teils in Fortführung einer starken Strömung schon unter den Völkischen des Kaiserreichs,100 teils in Abgrenzung vom verhassten Parlamentarismus der Weimarer Republik.101 Aber wenn etwa die Deutschsozialisten mit Alfred Brunner zwischen einer ›lehrenden und lernenden‹ Bewegung und einer ›kämpfenden und fordernden‹ Partei unterschieden und die Rolle der letzteren ganz im Stil der Honoratiorenpolitik des vergangenen Jahrhunderts auf Wahlzeiten beschränkt sehen wollten, wenn die Deutschvölkischen mit Artur Dinter ihre Bewegung vor allem als »Geistesrevolution« definierten, die das Werk der von Luther begonnenen Reformation fortsetzen und dazu vor allem auf Gesinnungsveränderung hinarbeiten sollte,102 dann konnten sie vielleicht bei einigen Redakteuren des Völkischen Beobachters auf Beifall rechnen, nicht aber bei Hitler, der dem Blatt schon im Juli 1920 »Mangel an Mut« vorwarf, sich parteipolitisch festzulegen.103 Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt kaum klare Vorstellungen über die Art der Parteiorganisation sowie über seine eigene Position in ihr besaß – noch im Dezember 1920 drohte er mit dem Rückzug aus dem Parteiausschuss, ein weiteres Mal im März 1921 – war er doch mit wachsender Sicherheit bestrebt, der NSDAP eine Sonderrolle in der völkischen Bewegung zuzuweisen und dies mit bestimmten organisatorischen Vorstellungen zu verbinden, die in der Führungskrise vom Juli 1921 Gestalt annahmen und zur Übertragung diktatorischer Befugnisse auf den Parteivorsitzenden führten.104
In späteren Auslassungen sah er die entscheidende Schwäche des völkischen Lagers darin, dass es außerstande gewesen sei, »der von einer einheitlichen Spitzenorganisation geführten marxistischen Weltauffassung« eine adäquate Gegenmacht entgegenzustellen, worunter er keineswegs bloß eine andere Weltauffassung mit rechtem Vorzeichen verstand, sondern eine primär auf Kampf, Machtgewinn und Herrschaft ausgerichtete Organisation. Der Satz aus Mein Kampf, in dem manche ein Bekenntnis zur reinen Bewegung sehen wollen, ist in Wahrheit ein Plädoyer für die von einer Partei – der Partei – geführte Bewegung: »Jede Weltanschauung, sie mag tausendmal richtig und von höchstem Nutzen für die Menschheit sein, wird solange für die praktische Ausgestaltung eines Völkerlebens ohne Bedeutung bleiben, als ihre Grundsätze nicht zum Panier einer Kampfbewegung geworden sind, die ihrerseits wieder solange Partei sein wird, als sich ihr Wirken nicht im Siege ihrer Ideen vollendet hat, und ihre Parteidogmen die neuen Staatsgrundgesetze der Gemeinschaft eines Volkes bilden«.105 Es war denn auch nicht die Deutschvölkische Freiheitsbewegung Großdeutschlands, die schließlich die Hegemonie im Lager der Rechten gewann, sondern die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Die Unterschiede in der Entstehungsphase machen deutlich, dass das Merkmal ›Bewegung‹ nur für Italien, und auch hier rein nur im Sinne einer kurzen Phase, in Anspruch genommen kann, damit aber nicht zu den Kriterien des generischen Faschismus gehört. Für dessen Bestimmung hat man deshalb schon früh nach anderen, ein höheres Maß an Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit indizierenden Merkmalen gesucht und ist dabei auf den Begriff des ›Bundes‹ als einer Form verfallen, die von ihren Mitgliedern oder doch wenigstens von einem Teil derselben ein umfassenderes, die ganze Person einbeziehendes Engagement verlangt. So meinte etwa Fritz Schotthöfer in einer der frühesten Annäherungen an den Gegenstand, die Bezeichnung Faschismus sage nichts über den Geist und die Ziele dieser Erscheinung aus, sondern nur über die Art der Verbindung: »Ein Fascio ist ein Verein, ein Bund, Fascisten sind Bündler und Fascismus wäre etwa Bündlertum«.106 Auch J.W. Mannhardt sah die deutsche Entsprechung zum italienischen fascio im Wort Bund und definierte den Faschismus als »ein System von ausgesprochenen Männerbünden«, das vertikal gegliedert sei und im Duce seine Spitze habe.107 Eine Denkschrift des Preußischen Innenministeriums attestierte im August 1930 der NSDAP einen »Doppelcharakter als politische Partei und als politischen Bund« – ein Befund, der auch von der bedeutendsten parteisoziologischen Studie am Ausgang der Weimarer Republik bestätigt wurde.108
Noch weiter zugespitzt wurde dies von Maurice Duverger, der in seinem Werk über die politischen Parteien die spezifische Differenz der faschistischen Parteien an ihrer Eigenschaft als Bund festmachte. Duverger schloss sich seinerseits an Herman Schmalenbachs Bestimmung des Bundes als einer zwischen »Gemeinschaft« und »Gesellschaft« angesiedelten Kategorie an, die wie die letztere auf freiwilliger Zugehörigkeit beruhe, zugleich aber wie die erstere die ganze Persönlichkeit, und hier speziell das Gefühlsleben, ergreife. Während normale Parteien stets eine Mischung aus gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen und bündischen Elementen darstellten, seien Parteien wie die faschistischen (und übrigens auch: die kommunistischen) durch das Übergewicht der bündischen Komponente bestimmt und eben dadurch totalitär. »So entsprechen schließlich die kommunistischen und faschistischen Parteien dem Begriff des Bundes, wie ihn Schmalenbach beschrieben hat. Die Nationalsozialisten haben dies ausdrücklich bestätigt, und die meisten faschistischen Parteien sind diesem Beispiel gefolgt«.109
Dass ein so stark personalistisch und emotional geprägtes Phänomen wie der Bund wenig taugt, der Eigenart kommunistischer Parteien gerecht zu werden, die ihren Zusammenhalt überwiegend über die Ideologie herstellen, kann hier nur angedeutet werden. Es ist jedoch auch nicht zureichend, um die spezifische Differenz des Faschismus zu markieren. Gewiss schöpfte der Faschismus in erheblichem Umfang aus den bündischen Vergemeinschaftungen der Nachkriegszeit: dem breiten Fundus der Kriegsheimkehrer, der entwurzelten Existenzen, der Dissidenten der herkömmlichen Parteien, die sich als Gefolgschaften um die Warlords der Freikorps scharten oder in Krieger- und Jugendbünden zusammenschlossen; und gewiss auch waren ganze Segmente des Faschismus hier verankert: in Nord- und Mittelitalien die squadre, die von einem kollektiven Enthusiasmus beseelt waren und sich an der Gewalt berauschten; in Deutschland vor allem die SA, die sich ebenfalls durch »eine eigentümliche Mischung aus bündischer, militärischer und Parteistruktur« auszeichnete.110
Gleichwohl: Mit dem Begriff des Bundes ist ein Spektrum angesprochen, das zugleich weiter und enger ist als der Faschismus. Bünde sind nicht notwendig auf die Gewinnung politischer Macht ausgerichtet, wie es der Faschismus zweifellos war. Viele Verbände der bündischen Jugend in Deutschland zielten lediglich auf ein neues ›Jugendreich‹, verfolgten also eher subkulturelle als politisch-staatliche Ambitionen. Wenn sie, was vorkam, das politische Feld betraten, platzierten sie sich durchaus nicht notwendig am rechten Pol, wie die Existenz von Kampfbünden der Linken belegt.111 Selbst die rechten Kampfbünde waren beträchtlicher Oszillationen fähig, wie das Beispiel des Bundes Oberland zeigt, der zeitweise Fühler in Richtung der Kommunisten ausstreckte.112 Zur NSDAP dagegen gehörte mit der SS ein Verband, der von seinem Leiter strikt von der Form des Männerbundes abgegrenzt wurde und für die Anfangszeit am ehesten noch als geheime Gesellschaft im Sinne Georg Simmels zu klassifizieren ist.113 Ebenso wenig bündisch war das ab 1928 entstehende Netzwerk von mehr oder weniger bürokratisch strukturierten NS-Organisationen für Angehörige bestimmter Berufe und Statusgruppen, vom Ärztebund über die Verbände für Lehrer und Juristen bis hin zu Spezialorganisationen wie der NS-Frauenschaft, der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation, dem Agrarpolitischen Apparat oder dem nur locker angegliederten ›Kampfbund für deutsche Kultur‹.114 Je größer die Erfolge der NSDAP wie des PNF an den Wahlurnen wurden, desto weniger lassen sie sich als Bünde verstehen, auch wenn die für diesen Sozialtypus charakteristische Form der persönlichen Gefolgschaft und affektuellen Verbindung häufig beschworen wurde.
Eine Begriffsbestimmung des Faschismus setzt deshalb am besten nicht hier und auch nicht am Typus der sozialen Bewegung an, sondern an seiner Erscheinung als politischer Verband: als Partei. Tatsächlich war der Faschismus, sieht man von seiner chaotischen Anfangsphase in Italien als antipartito ab, in der längsten Zeit seines Bestehens eine Partei, und zwar eine solche neuen Typs, die sich durch zwei Merkmale von den älteren »Honoratiorenparteien« liberaler oder konservativer Provenienz unterschied: durch die enge Koppelung mit paramilitärischen Verbänden und durch den Status einer »Massenpartei«, die erfolgreich daran arbeitete, nicht nur ein Maximum von Wählern anzusprechen, sondern auch einen festen Stamm von zahlenden Mitgliedern zu gewinnen.115 Vom ersten Merkmal wird im nächsten Abschnitt zu sprechen sein. Für das zweite Merkmal muss hier der Hinweis auf das rapide Wachstum genügen, durch das die faschistischen Parteien ihre Mitbewerber um die politische Macht ausstachen. Schon ein halbes Jahr nach seiner Gründung verfügte der PNF über 250.000 bis 300.00 Mitglieder und war damit die größte Partei Italiens, noch dazu diejenige mit der größten Schlagkraft, gehörte doch ein Drittel bis die Hälfte davon zugleich zu den squadre.116 In Deutschland zählte die DAP/NSDAP zwar ein Jahr nach ihrer Gründung erst 214 Mitglieder und noch Ende 1920 nur 2350, doch änderte sich dies rasch: Im Herbst 1923 war sie mit rund 55.000 Mitgliedern bereits eine der größeren Parteien Bayerns. Nach ihrer Neugründung 1925 erreichte sie dieses Niveau bis zum Dezember 1928 für das ganze Reich, um danach ein explosionsartiges Wachstum zu erleben: von 247.000 Mitgliedern im Dezember 1930 auf 920.000 Ende Januar 1933.117 Wie bei ihrem Pendant jenseits der Alpen handelte es sich um eine überwiegend männlich geprägte Partei, in der der Anteil an weiblichen Mitgliedern bis zum 30.1.1933 nur 5 bis 8 Prozent betrug.118
Parteien lassen sich mit Max Weber definieren als »auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden«.119 Und sie lassen sich zugleich, genetisch gesehen, dem modernen »legalen Staat mit Repräsentativverfassung« zuordnen, genauer gesagt, jener Ausprägung desselben, in der sich die politische Willensbildung über Parteien vollzieht, die ihrerseits unter den Bedingungen der »aktiven Massendemokratisierung« operieren.120 Obzwar ihrer Eigenart nach universell auftretende Vergemeinschaftungen und Vergesellschaftungen, sind »Parteien im modernen Sinn« in der Regel rational organisierte Verbände, gekennzeichnet durch einen Apparat von »Parteileitern und Parteistäben«, finanziert durch meist verborgen bleibende »Parteimäzenaten« und zusammengesetzt aus aktiven Parteimitgliedern in Gestalt von »Akklamanten« sowie »nicht aktiv mit vergesellschafteten Massen« die für die Führung »nur Werbeobjekt für die Zeiten der Wahl oder Abstimmung sind (passive ›Mitläufer‹), deren Stimmung nur in Frage kommt als Orientierungsmittel für die Werbearbeit des Parteistabes in Fällen aktuellen Machtkampfes.«121 Als Herrschaftsverbände lassen sie sich nach drei Dimensionen klassifizieren – nach den Zielen, für die sie politische Macht anstreben, nach der Organisation, die sie sich dafür geben, und nach den bevorzugten Mitteln. Nach der ersten Dimension können sie mehr Klassen- bzw. Stände-, mehr Weltanschauungs- oder mehr Patronagepartei sein; nach der zweiten mehr charismatisch, mehr traditional oder mehr formal-legal. Bei der dritten Dimension reicht die Spannweite »von nackter Gewalt jeder Art bis zum Werben um Wahlstimmen mit groben oder feinen Mitteln: Geld, sozialem Einfluß, Macht der Rede, Suggestion und plumper Übertölpelung, und bis zur mehr groben oder mehr kunstvollen Taktik der Obstruktion innerhalb parlamentarischer Körperschaften«,122 wobei das häufig verwendete Wort »mehr« indiziert, dass es sich nicht um einander ausschließende Bestimmungen handelt. Welche Kombination ist für faschistische Parteien typisch?
2.2Faschistische Parteien: Mittel, Organisationstrukturen, Ziele
Am einfachsten zu beantworten ist diese Frage für die bevorzugten Mittel. Fand bis zum Ende des Ersten Weltkriegs Politik überwiegend im Schatten des Leviathan statt, in Gestalt der Werbung von Stimmen unter Respektierung des im Staat institutionalisierten Monopols der legitimen physischen Gewaltsamkeit, so schloss dies doch die Existenz von Bewegungen und Parteien an den Rändern des politischen Systems nicht aus, die dieses Monopol offen bestritten. Dazu rechnete Max Weber auf der Linken »Gewaltsamkeitsorganisationen« wie die Bolschewiki oder die Syndikalisten, die in unterschiedlichen Graden der Militanz ihre Ziele verfolgten und dabei Mittel benutzten wie Massenstreiks und Attentate, Fabrik- und Landbesetzungen, unter Umständen auch Schutzgelderpressungen und Banküberfälle;123 auf der Rechten Verbände wie die in der ersten russischen Revolution auftretenden ›Schwarzhunderter‹ (Sojuz russkogo naroda), die sich im Oktober 1905 als Partei konstituierten, in der Duma fast so stark wie die gemäßigte Rechte vertreten waren und vor den Mitteln der antisemitischen Hetze und des politischen Mordes nicht zurückschreckten.124
Erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begann jedoch jene massive innenpolitische »Mobilmachung der Gewalt« (Wolfgang Sauer) in Form von Einwohnerwehren, Selbsthilfeorganisationen und Freikorps, die die politische Ordnung in den folgenden Jahren bis in die Grundfeste erschütterte.125 Das galt für Deutschland, wo die von den staatlichen Autoritäten mangels Alternative zunächst lizensierten Verbände unter dem Druck der Siegermächte jedoch bald wieder aufgelöst werden mussten.126 Es galt ebenso, ja noch verstärkt für Italien, wo sich die Regierung dauerhaft unfähig zeigte, die eskalierenden Sozialkonflikte unter Kontrolle zu bringen, die sich in Fabrik- und Landbesetzungen, also: permanenten Rechtsbrüchen, äußerten. Ebenso ohnmächtig erschien sie gegenüber den Gewaltakten der Futuristen, etwa dem Überfall auf den Avanti im April 1919, den Desperados, die im September 1919 unter der Führung D’Annunzios Fiume eroberten und es über ein Jahr lang behaupteten sowie ein Jahr später gegenüber den faschistischen squadre, als diese das Hotel Balkan in Triest überfielen, in dem sie einen Vorposten der ›niederen und barbarischen slawischen Rasse‹ vermuteten.127 Hinsichtlich der Gewaltwelle, die im Herbst 1920 gegen die Einrichtungen der sozialistischen Bewegung losbrach, muss man geradezu von einer Auflösung des Staates sprechen, an der auch die Tatsache nichts ändert, dass staatliche Behörden von der Polizei über die Armee bis hin zur Justiz sich als Mittäter am Terror beteiligten, sei es in Form der gezielten Abwesenheit vom Kampfplatz, der Schaffung günstiger Aktionsbedingungen für die Täter oder gar der direkten Schützenhilfe.128
Ein exaktes Datum, ab dem in Italien von einer spezifisch faschistischen Gewaltpraxis zu sprechen wäre, lässt sich allerdings nicht ausmachen. Das hat kategorische Urteile nicht verhindert, die das Startsignal in Mussolinis Artikel Trincerocrazia vom 15.12.1917 sehen wollen und daraus folgern, 1917 müsse als Geburtsjahr der faschistischen Idee angesehen werden, dem 15 Monate später die faschistische Tat: die Bildung einer neuen rechtsextremistischen Organisation, gefolgt sei.129 Steile Thesen dieser Art überzeichnen den Grad an politischer Bestimmtheit, der Mussolinis Kriegspublizistik auszeichnet,130 wie sie auch den oben erwähnten demokratischen Forderungen nicht gerecht werden, die in das im Juni 1919 veröffentlichte Programm der Fasci di combattimento Eingang gefunden haben. Erst die Relativierung dieses Programms durch Mussolini im Oktober 1919 – »Wir Faschisten haben keine vorgefaßte Doktrin, unsere Doktrin ist die Tat«131 – stellte die Weichen für eine Entwicklung, in deren Verlauf sich die Fasci unzweideutig am rechten Pol des politischen Spektrums platzierten und diesem Bekenntnis entsprechend agierten. Im Frühjahr 1920 richteten sie squadre d’azione ein, paramilitärische Einheiten, die über Waffen verfügten, Strafexpeditionen gegen den politischen Gegner unternahmen und dessen Infrastruktur zerstörten. Ihr Anteil an der faschistischen Gesamtbewegung betrug, wie bereits bemerkt, zwischen einem Drittel und der Hälfte, in absoluten Zahlen zwischen 73.000 bis 110.000, bei einem Gesamtbestand von 220.000 (Mai 1922).132 Wie er sie einzusetzen gedachte, ließ Mussolini bewusst offen. Noch im Mai 1921 versuchte er es mit einer Beteiligung an den Wahlen im Rahmen eines nationalen Blocks, der jedoch nur 45 Sitze erhielt, ihm persönlich allerdings in Mailand fast 200.000 Stimmen einbrachte.133 Ein Jahr später verkündete er, der Faschismus könne die Tür zur Macht sowohl mit dem Schlüssel der Legalität öffnen, aber auch gezwungen sein, sie mit dem ›Schulterstoß des Aufstandes‹ einzuschlagen (col colpo di spalla dell’insurrezione).134 Vier Monate später versuchte er bekanntlich beides zur gleichen Zeit.
Obwohl in diesen Verbänden inhaltliche Stellungnahmen zu Einzelfragen meist wenig substantiell ausfielen, sollte man daraus doch nicht auf eine völlige Beliebigkeit der politischen Ansichten schließen. Vielmehr war die »Ausdrucksseite des faschistischen Habitus« aufs engste mit einer »Inhaltsseite« verbunden, die von der »Vorstellung von einer nicht an soziale Interessen gebundenen Art von entökonomisierter Volksgemeinschaft« geprägt war.135 Als damit unvereinbar galt neben den katholischen Popolari vor allem die sozialistische Arbeiterbewegung im weitesten Sinne, gegen deren Einrichtungen sich eine rasch eskalierende Gewalt richtete. Zählten die sozialistischen Ligen in und um Ferrara noch im Herbst 1920 mehr als 70.000 Mitglieder, so existierten sie im folgenden Frühjahr kaum noch. Die Zahl der Todesopfer insgesamt wird für die Zeit zwischen 1919 und 1922 auf 3.000 bis 4.000 veranschlagt, unter denen sich nur 600 Faschisten befanden.136
Nach der Ernennung Mussolinis zum Ministerpräsidenten erging zwar ein Befehl zur Demobilisierung der squadre, zur Rückgabe der Waffen und zur Wiedereinsetzung von Verwaltungen, die zum Rücktritt gezwungen worden waren, doch führte dies zu keinem signifikanten Rückgang der Gewalt. Noch einige Wochen nach dem Marsch auf Rom, dessen gewalttätige Aspekte oft unterschätzt werden, veranstalteten die Squadristi in Turin ein Massaker.137 Allein die fünf Monate vom 1.11.1922 bis 31.3.1923 verzeichneten 118 Tote durch faschistische Gewalt, verübt nicht selten durch Täter, die das 16. Lebensjahr nicht überschritten hatten.138 Die im Januar 1923 vorgenommene Umwandlung der squadre in eine reguläre, unter der Kontrolle des Duce stehende Miliz (M.V.S.N.) näherte diese zwar dem klassischen Modell eines bürokratischen Heeres an, brachte aber kein prinzipielles Ende des squadrismo.139 Näher kam dem die zwischen 1926 und 1930 vom Parteisekretär Angelo Turati durchgeführte Säuberungswelle, die zum Ausschluss von mehr als 100.000 Parteimitgliedern und squadristi führte, doch zeigt schon die Entscheidung, eine solche durchzuführen, dass der squadrismo auch vier Jahre nach Beginn des Regimes noch eine ernstzunehmende Kraft darstellte. Was mit den Säuberungen erreicht wurde, war, wie neuere Untersuchungen gezeigt haben, allenfalls eine Entpolitisierung des squadrismo, hinter der sich ein nach wie vor bestehendes, sehr ausgedehntes Netzwerk von wechselseitiger Unterstützung und Komplizenschaft zwischen der nationalen und der lokalen Ebene des Faschismus verbarg.140 Salvatorelli und Mira übertrieben deshalb nur leicht, als sie die »eigentliche Substanz des Faschismus« in der Gewalt ausmachten.141
Ein etwas anderes Muster zeigt die Entwicklung in Deutschland, das in den Jahren von 1919 bis 1921 ebenfalls einen Abbau des staatlichen Gewaltmonopols und eine Konjunktur paramilitärischer Verbände in Gestalt nicht nur von Freikorps, sondern auch von Einwohnerwehren erlebte, die allein in München im Juli 1921 30.000 Mann zählten, in Bayern bis zu 400.000 Mann mit zweieinhalb Millionen Waffen.142