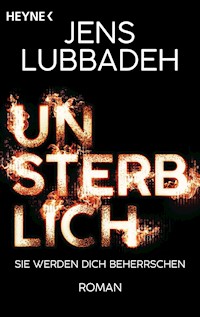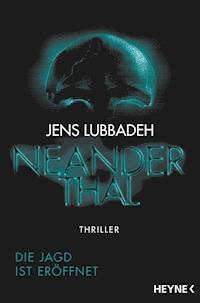
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Waren sie die besseren Menschen?
Deutschland in der Zukunft. Krankheiten, Schönheitsfehler und Suchtprobleme sind abgeschafft, Gesundheit ist das höchste Ideal. Eine Welt, in der sich Kommissar Philipp Nix nur schwer zurecht findet. Als er eines Tages auf eine seltsam aussehende Leiche stößt, führt ihn das zu einem grausigen Massengrab in einem Tal bei Düsseldorf. Sind es Neandertaler? Aber warum sind die Überreste nur dreißig Jahre alt? Nix' Ermittlungen enthüllen einen Skandal, der die Gesellschaft der Zukunft in ihren Grundfesten erschüttert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jens Lubbadeh
NEANDER
THAL
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung
sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter
enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 12/2017
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2017 by Jens Lubbadeh
Copyright © 2017 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,
unter Verwendung einer Lithografie
von Johann Carl Fuhlrott (1859)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20073-2V001
www.diezukunft.de
I, I will be king
And you, you will be queen
David Bowie, »Heroes«
INHALTSVERZEICHNIS
Teil Eins
1Eine rätselhafte Leiche
2Ein Knochenjob
3Der Jäger
4Die Große Depression
5Ein Grab im Neandertal
6Eva-Marie Mercure übernimmt
7Brief von Angélique an Eva-Marie
8Die Obduktion
9Urudims Abschied
10Rätselhafte Knochen
11Ausnahmezustand
12Das Verhör I
13Brief von Sarah an ihre Mutter
Teil Zwei
14Das Verhör II
15Die Flucht
16Projekt Neanderthal
17Die Dunklen
18Auf Safari
19Die Genprime Clinic
20Zuflucht im Paradies
21Die Unperfekten
22Geheimprojekte
23Verlorener Sohn, gefundene Tochter
24And the guns shot above our heads
25Der Stamm der Dunklen
Teil Drei
26Protokollausschnitt der Talkshow »Gesunde Einstellung«
27Brief an den Bundeskanzler
28Ein neues Zuhause
29Jesus Neanderthalensis
30Brief von Valerie an ihre Mutter
31Schützende Gene
32Erblasten
33Wiedersehen nach langer Zeit
34Eine alte Feindin
35Das Jesus-Gen
36Die Zukunft der Menschheit
37Helden
TEIL EINS
1
EINE RÄTSELHAFTE LEICHE
Das Gesicht sah aus wie ein Puzzle, dessen Teile nicht zusammenpassten. Es war unverletzt, trotz des tiefen Falls. Aber dennoch sah es sonderbar aus. Als Philipp Nix sich wieder erhob, wusste er: Diese Leiche würde Arbeit bedeuten. Und Ärger.
Die Pfeiler der Autobahnbrücke ragten in den Himmel wie die Säulen eines Tempels, zwischen denen der Tote wie eine Opfergabe lag. Nur dass es so gut wie keine Götter mehr gab, höchstens für die Unverbesserlichen. Der überwiegende Rest der Deutschen huldigte nur noch einem Gott – dem eigenen Körper.
Aber dieser Körper hier war nicht mehr zu retten.
Beide Beine waren mehrfach gebrochen. Der rechte Unterschenkel – es tat weh, ihn anzuschauen – war … wie abgebrochen, anders konnte man es nicht beschreiben. Noch hing er zwar an ein paar Fleischfetzen, allerdings in einem Winkel über 90 Grad abgespreizt. Weiße Knochenspitzen stachen in Kniehöhe aus dem Bein heraus. Der Hinterkopf des Mannes war aufgeplatzt. Herausgequollenes Blut und Hirn malten eine Art Heiligenschein um den Schädel. Die Kapuze des Hoodies war halb vom Kopf gerutscht und lag in der rotweißen Masse. Gierig sog der Stoff die farbige Flüssigkeit auf. Lange rotbraune Haare hingen an den Seiten des Kopfes herab. Ein Blutfaden rann aus dem linken Mundwinkel. Abgesehen davon war das Gesicht merkwürdigerweise unverletzt. Nix schätzte den Mann auf Ende zwanzig, höchstens Anfang dreißig.
»Sowas schon mal gesehen, Kramer?«
Der Polizeiarzt stand neben ihm. Genauer: Er hielt sich wie ein Fähnlein im Wind. Sein dunkelgrauer und wie gewohnt bis obenhin zugeknöpfter Zweireiher schlotterte um den versteckten Leib. Auch sein Hut hatte Mühe, sich auf dem mageren Schädel zu halten. Wann verdammt nochmal kauft er sich endlich einen kleineren Fedora?, dachte Nix. Dieser hier drohte jeden Moment von dem Stück Knochen, das seinen Kopf darstellte, wegzuwehen. Wahrscheinlich war der Hut ein Geschenk seiner Frau, anders war es kaum zu erklären. Lisa war bei Kramers der Boss, eine Domina und Furie. Nix hasste sie.
Kramer war noch immer über die Leiche gebeugt, den Fedora hielt er fest, damit er nicht in die Hirnmasse fiel.
»So einen noch nicht. Tippe auf behindert«, sagte Kramer mit seiner spröden Stimme und erhob sich wieder. Dabei knackten seine Kniegelenke leise. Nix bemerkte, dass es Kramer unangenehm war, weshalb Nix so tat, als hätte er nichts gehört.
»Hab’s befürchtet.«
Man bekam Behinderte nicht mehr oft zu sehen. In der Tat gab es kaum noch welche. Falls doch, sah Nix sie in der Regel tot. Was in einer Gesellschaft, deren zwei Fetische Glück und Gesundheit hießen, auch kein Wunder war. Als Behinderter aufzuwachsen musste sich wie eine Strafe anfühlen.
»Er sieht aber nicht aus wie ein Downie oder dergleichen«, sagte Kramer. Nix zuckte innerlich zusammen. »Downie«, so wurden die immer seltener werdenden Menschen mit Down-Syndrom bezeichnet. Eine alte Erinnerung blitzte für Sekundenbruchteile in Nix’ Geist auf. Timmys rundes, fröhliches Gesicht, seine breite Zunge, die er beim Lachen immer ein wenig herausstreckte, seine mandelförmigen Augen, die, wenn er sich freute, noch schmaler waren als sonst. Ein Stich in Nix’ Herz. Noch immer, nach all den Jahren.
Ja, das Gesicht des Toten war rund wie das eines Downies, aber es war nicht so flach. Ganz im Gegenteil. Wie ein Berg ragte es auf. Die schmale Stirn und das kaum vorhandene Kinn waren die Täler; die Augenbrauen, die große Nase und der riesige Mund bildeten die Spitzen.
Die Nase war geradezu riesig, breit, fleischig – wie von einem übereifrigen Maskenbildner mit dem Auftrag geformt, einen Schauspieler in ein Monster zu verwandeln. Und die Augen, über denen sich gewaltige Brauenwülste wölbten, waren groß und braun wie Kastanien.
Sie blickten aus ihren tiefen Höhlen flehend in den Himmel, an der Brücke vorbei, auf der die Auto-Autos unbeeindruckt weitersummten wie Körner durch den Hals einer gigantischen Sanduhr.
Nix blickte in den Himmel über der Autobahnbrücke, den Himmel über Düsseldorf, sah das Blau dieses Sommertags, über das nur wenige einsame Wolken wie verunsicherte Schäfchen irrten. Hatte der Mann, als sein Körper nach fünfzig Meter freiem Fall auf den Boden aufgeschlagen war, diesen Ausschnitt dieser Welt noch gesehen? Oder war das zerrupfte Stückchen Gras das Letzte gewesen, was in den Synapsen seines Gehirns kursiert war? Aber die spannendere Frage war: Was hatten sie kurz davor gesehen? Einen Mörder? Einen »Ehrenmörder«?
Die Polizeibeamten hatten die Fundstelle abgesperrt und schwirrten auf dem mit gelb-schwarzem Absperrband gesicherten Areal umher. Insektendrohnen würden später kommen und die 3D-Kartierung erledigen, um ein virtuelles Modell des Tatorts zu generieren.
Es war Vormittag und sehr warm an diesem Juli-Tag. Zum Glück wehte ein starker Wind, denn Nix schwitzte ohnehin schon wie ein Schwein. Und gut, dass er heute Morgen nicht den Fedora genommen hatte, sondern den Panama, seinen bevorzugten Sommerhut. Trotzdem hatte er sich ihn vom Kopf gezogen. Auch das Jackett trug er längst nicht mehr.
»Was mich irritiert, ist sein Körperbau«, murmelte Kramer.
Nix sah noch einmal genauer hin. Tatsächlich, auf den ersten Blick fiel einem nicht auf, wie enorm muskulös der Mann war. Der grobe dunkelgraue Hoodie verbarg die wuchtige Brust des Toten. Die zerschlissene weite Cordhose hatte auf den ersten Blick weder die breiten Schenkel noch den untersetzten Körper vermuten lassen.
Kramer zog die Gummihandschuhe aus. »Okay, Philipp, ich benachrichtige das Labor. Soll ich gleich mit der Obduktion loslegen oder warten, bis die Ergebnisse da sind?«
Er sah Nix aus seinen müden Augen an. Nix wusste, dass Kramer in Dauertherapie war, aber das hieß nichts. Viele waren in Dauertherapie. Es konnte alles Mögliche bedeuten. In Therapie zu sein war nichts Anstößiges; die Pflege der seelischen Gesundheit war die Pflicht eines jeden Mitglieds des Solidarsystems. Er hoffte nur, dass es nicht die Große Depression war, an der Kramer litt, sondern nur eine »normale«. Aber auch das würde zusätzlichen Aufwand sowie den möglichen Verlust Kramers als Polizei-Mediziner bedeuten. Und Kramer war ein verdammt guter Mediziner.
»Ich fürchte, wir können das nicht so lange liegen lassen«, sagte Nix.
Weder er noch Kramer waren scharf auf ein behindertes Opfer. Es bedeutete nervtötenden Papierkram und eine obligatorische Genanalyse. Vorschrift war Vorschrift. Die sammelwütigen Krankenkassen wollten alles immer ganz genau wissen. Neu entdeckte Behinderten-Gene waren für die Solidargemeinschaft Gold wert. Und der hier war sicher ein interessanter Fall. Aber das hieß auch: warten, warten, warten, denn die Labore waren völlig überlaufen. Eine Genanalyse konnte mindestens eine Woche dauern, im Zweifel länger. Außerdem waren jetzt Schulferien. Am Ende würde die Genanalyse, darauf wettete Nix, ihren Verdacht bestätigen, dass der Mann behindert war. Und dann würde eine Spezialabteilung des Ministeriums für Gesundheit und Glück die Hoheit über den Fall übernehmen, und die hatten ihre eigenen Vorstellungen. Das wiederum bedeutete, dass Nix und seine Leute umsonst gearbeitet hatten, weil sie den Fall abgeben mussten. Aber er hatte keine Wahl. Sein Chef, Engelbert, war bei allem, was das Ministerium anging, extrem vorsichtig. Er war ein verdammter Schisser und vor allem: ein Arschkriecher. Rumtrödelei bei einer behinderten Leiche konnte unangenehme Fragen nach sich ziehen. Und das bedeutete noch mehr Stress – mit Engelbert. Und darauf hatte Nix keine Lust.
»Glaubst du, er hat sich umgebracht?«
Kramer zuckte mit den Schultern. »Hoffen wir’s. Oder hast du Lust auf einen weiteren Ehrenmord?«
Ehrenmord. Was für ein abscheuliches Wort, dachte Nix. Es bedeutete die Ermordung eines Behinderten, um die Familienehre wiederherzustellen. Mord war Mord. Ja. Eigentlich.
»Wenn’s einer ist, dann wird es das Übliche. Zehn Jahre, fünf im Bau, fünf auf Bewährung.«
Die Richter erkannten bei einem Ehrenmord mildernde Umstände an. Die Belastung für alle, inklusive des Opfers, war schließlich offensichtlich, die Umstände tragisch, die Tat also irgendwie verständlich.
Nix dachte an Timmy. Damals wäre noch niemand auf die Idee gekommen, ihn zu ermorden. Wie sich die Zeiten änderten.
»Aber damit sollen sich die Ministeriellen rumschlagen«, sagte Nix.
Ehrenmorde waren ein sensibles Thema. Und ein verdammt undankbares. Jeder fühlte sich auf diesem Terrain unwohl – Mitleid traf auf Scham und klammheimliche Erleichterung. Fand man den Täter, war man das Arschloch. Fand man ihn nicht, auch. Eigentlich wollte niemand etwas damit zu tun haben. Daher war es im Grunde besser, das Ganze den Ministeriellen zu überlassen. Deren Presseabteilung war, wie Nix neidlos anerkennen musste, bezüglich solcherlei extrem auf Zack.
»Mach die Obduktion, Kramer. Wir wollen den Bürokraten doch zeigen, dass wir auch was draufhaben, oder?« Er klopfte dem Arzt auf den Rücken. Es war, als würde man ein Skelett tätscheln. Kramer brach unter dem Klaps leicht zusammen. Mann, Mann, Mann, Kramer, dachte Nix. Er würde mit ihm reden müssen. Als sein Vorgesetzter war er für seine Gesundheit mit verantwortlich und musste bei jeglichem Verdacht auf Krankheit oder gesundheitliche Einschränkungen aktiv werden.
»Essen?«
Er wusste, was Kramer sagen würde, aber er versuchte es trotzdem.
»Heute nicht, Philipp, sorry. Hab ’ne Sitzung.«
»Kein Problem«, sagte Nix. Vielleicht hatte er im Rahmen seiner Dauertherapie tatsächlich eine Sitzung vor sich. Aß er deswegen kaum noch etwas? Oder gab es einen anderen Grund? Hatte Lisa ihm untersagt, in der Kantine zu essen? Diese verdammte Furie mit ihrem Ernährungswahn. Sie würde noch dafür sorgen, dass Kramer sich zu Tode hungerte.
Nix setzte seinen Panama auf und zog zum Abschied an der Hutkrempe.
Schwanger und schwer hatten sich Wolken auf Düsseldorf gelegt, als warteten sie darauf, endlich über der Stadt platzen und sie von all den Krankheitserregern reinwaschen zu können. Nach der lang andauernden Hitze wurde es Zeit.
Nix saß in seinem Büro im Kommissariat. Er war schlecht gelaunt. Er hasste das Kantinenessen, insofern hatte Kramer vielleicht die bessere Wahl getroffen, ganz darauf zu verzichten. Tofubällchen mit Mangold-Salat. Immer noch besser als Rohkost, die es freitags gab. Trotzdem ging ihm das Essen auf die Nerven. Er aß nun mal sehr gern Fleisch, scheiß drauf, dass es erwiesenermaßen krebserregend war. Oh, es wurde durchaus Fleisch serviert, richtig gutes sogar, alles Bio, alles Cholesterol- und LDL-zertifiziert. Nur wählte es kaum einer an der Theke aus, aus Angst vor dem stillen sozialen Tadel der Kollegen. Ein Steak in der Kantine zu essen war fast so, wie ein Glas Whiskey zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen. Das Ministerium für Gesundheit und Glück brauchte dergleichen nicht mehr zu verordnen. Die Leute verordneten es sich selbst.
Nix fühlte diese soziale Kontrolle genauso, er noch mehr als andere, weil er Vorgesetzter war. Und er wollte vor allem nicht, dass Engelbert ihn Ungesundes essen sah. Der erwartete von Führungspersönlichkeiten vorbildliches Verhalten.
So blieben Nix nur seine heimlichen Ausflüge zu Gino’s, wo er einfach mal eine Pizza essen konnte, sogar mit Salami. Dafür nahm er die weite Fahrt in die Vorstadt in Kauf. In der Innenstadt Düsseldorfs gab es kaum noch italienische Restaurants, stattdessen Rohkostläden- und Basen-Asia-Einerlei. Außerdem konnte er nur auf diesem Weg einigermaßen sicher sein, nicht von Kollegen dabei erwischt zu werden.
Und manchmal, wenngleich selten, gönnte er sich zusätzlich einen Abstecher in den Speakeasy in der Nähe. Sie kannten ihn dort schon – er gehörte zum inneren Zirkel derjenigen, die auf den Klopfcode an der unscheinbaren Wohnungstür verzichten konnten. Einfach mal ein Bier nach einem guten italienischen Essen! Herrlich. Dazu eine Zigarette oder eine Shisha. Ein schlechtes Gewissen überkam ihn dabei nicht. Leben und leben lassen, so lautete Nix’ Motto. Und er brauchte das als Ventil. Seit Elsa von der Depression erfasst war, war sein Leben nur noch bedrückend.
Nix wusste genau, wie die Alkoholfahne zu kaschieren war. Knoblauch funktionierte da immer ziemlich zuverlässig.
Der zehnte Stock gewährte einen phänomenalen Blick über die Stadt. Für einen Moment verlor sich Nix in den Bewegungen der dunklen Wolken. Diese Langsamkeit, diese nie enden wollende Transformation. In einer Wolke glaubte er fast die Gesichtszüge des toten Mannes zu erkennen. Die riesige Nase.
Nix’ eigene Nase war alles andere als klein; sein ganzes Leben lang hatte ihm der Spitzname Kartoffelnase angehängt. Was noch freundlich formuliert war, denn wenn man ehrlich war, sah seine Nase wie ein Hodensack aus. Dementsprechend war er mit Kartoffelnase noch gut bedient. Allerdings hatte er auch dafür gesorgt, dass jegliche Ambitionen, ihn Sacknase zu nennen, im Keim erstickt wurden, notfalls mit nonverbalen Argumenten. Jetzt, mit Mitte vierzig, hatte er sich längst mit seiner Nase versöhnt, und auch seine Freunde hatten es aufgegeben, mit ihm darüber zu diskutieren, warum er einen derart vermeidbaren körperlichen Malus akzeptierte. Nur Arztbesuche blieben nervig. »Herr Nix, unterziehen Sie sich doch endlich einer Rhinoplastik. Sie wissen, dass sie nicht nur umsonst ist – Sie bekommen sogar Bonuspunkte dafür.«
Seine Gedanken schweiften weiter. Er liebte es, in diesen herrlich gedämpften Modus zu gleiten. Früher galt Tagträumen als etwas Positives, allenfalls dezent Spleeniges. Heute war es für Eltern eine Prädisposition, die man von einem Kinderpsychologen therapieren ließ. Wie so vieles andere auch. Tat man es nicht, gab es Punktabzug.
Nix’ Büro gehörte zur Kategorie klein, aber fein. Eigentlich eines der besten im Kommissariat, hell, vorteilhaft geschnitten. Er jedoch hatte alles dafür getan, es gleichermaßen ins unordentlichste zu verwandeln. Die Stechpalme in der Ecke war die einzige Überlebende seiner gnadenlosen jahrelangen Selektion mit dem Ziel, die härteste, anspruchsloseste Pflanze der Gegenwart zu züchten. Die Regale waren Friedhöfe, in denen Aktenordner in jeder Himmelsrichtung ruhten, manche beschriftet, manche nicht. Daneben ein abgewetzter Sessel, in den sich manchmal Kollegen verirrten. Aber die meisten nahmen auf dem unbequemen knarzenden Plastikstuhl Platz, gegenüber seinem ebenso unbequemen Schreibtisch, der höhenverstellbar war. Normale, nicht verstellbare Schreibtische gab es nicht mehr – betriebliches Gesundheitsmanagement. Die offizielle Empfehlung lautete, ihn mindestens fünfmal am Tag für eine halbe Stunde hochzufahren und im Stehen daran zu arbeiten. Nix kannte jedoch keinen Kollegen, der sich dabei erwischen ließ, wie er den Tisch herunterfuhr, das galt als peinlich. Er als Führungsperson tat es durchaus, aber meist dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kollege anklopfte, minimal war – also vormittags.
Jetzt saß er. Mit vollem Bauch stand sich’s schlecht.
Am Kleiderständer in der Ecke hing sein dunkles Jackett. Ganz oben, auf der Hutkugel, thronte der beige Panama. Wie jeder Mann besaß Nix mehrere Modelle, für alle Gelegenheiten und Jahreszeiten. Der schwarze Trilby war eine gute Wahl für offizielle Termine, schnittig, scharf, ein Statement von Eleganz und Coolness. Die Melone war eher etwas für Abendveranstaltungen und Beerdigungen. Er hatte Hüte in sämtlichen Formen und Farben.
Sein Smart auf dem Schreibtisch vibrierte und riss ihn aus seinen Tagträumen. Mit einer Fingergeste nahm er das Gespräch an.
Es war Alban, sein Kollege.
»Philipp, das musst du dir anschauen.«
Mit dem Fußweg zur Beweisaufnahme hätte Nix eigentlich etwas für sein Tagessoll tun können. Er hatte es auf 15.000 Schritte hochgesetzt, was er mittlerweile bereute.
Die Beweisaufnahme befand sich im Keller, aber er verspürte nach dem schlechten Essen nicht die geringste Lust, über zehn Stockwerke Treppen zu laufen. Also ging er zum Aufzug und hoffte, dass ihn niemand dort erwischen würde, denn Aufzugfahren war eigentlich nur für Ältere oder Kranke in Ordnung.
So schneidig sich der Polizei-Tower von außen architektonisch ausnahm, so trostlos und trist sah es in seinem Inneren aus. Lange ungemütliche Flure, Linoleum-Böden, ein Behörden-Mikrokosmos mit der immergleichen Monokultur. Der absurde Kontrast dazu waren die Pflanzen, die überall herumstanden und die niemand beachtete, geschweige denn pflegte. Ein weiteres Beispiel von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Pflanzen hoben die Laune, verbesserten die Luft und sollten »Oasen« im Büroalltag darstellen. Weil zu Oasen Wasser gehörte, fanden sich entsprechend zahlreiche Wasserspender. Damit man auch ja genug trank. Dehydratation – die unterschätzte Gefahr, vor allem im Sommer.
Der Scanner im Fitnesstracker an seinem Handgelenk – ein altmodisches Gerät, aber Nix hasste die Hearables, und gegen ein Implantat hatte er sich bislang erfolgreich gewehrt, trotz der Beitragserhöhungen für Non-Implantierte – maß unter anderem, wie viele Becher man täglich trank. Die Zielmarke lag bei zehn. Was er nicht maß, war das Wasser, das vom Becher nicht im Magen, sondern in der Grünlilie auf dem Flur landete. Ein echter Vorteil dieser altmodischen Handgelenkstracker, fand Nix. Derartigen Quatsch konnte man mit Implantat natürlich nicht anstellen.
Die meisten Türen auf Nix’ Flur standen offen. Im Vorübergehen wanderte er durch ein Stimmengewirr aus Telefonaten und Besprechungen.
»Ist mir scheißegal! Mach es einfach!«, brüllte sein Kollege Wolfert in seinem Büro. Wolfert war ein hypertoner Choleriker. Und seine Prädisposition machte ihn noch launischer, denn er musste abspecken. Nix hörte ein Piepen. Wolferts Tracker schlug Bluthochdruck-Alarm.
»Scheiße, ja!! Ich weiß! Nicht aufregen!«, brüllte Wolfert, diesmal an seinen Tracker gerichtet. Das Piepen wurde daraufhin noch lauter. Nix grinste.
Beiläufig erhaschte er Blicke in die anderen Büros. Die meisten Kollegen standen an ihren Tischen. Brav, dachte Nix, ihr seid alle sehr brav.
Vor dem Aufzug warteten zwei Frauen. Scheiße, jetzt musste er sich was einfallen lassen. Da war Christina, eine schwangere Kollegin aus der Dokumentation. Ihr Bauch wölbte sich unter ihrer Uniform wie ein Ball hervor, die untersten zwei Knöpfe hatte sie offengelassen. Sie unterhielt sich mit Franziska aus der Spurensicherung, die Nix von einigen Einsätzen her kannte. Franziska hatte lange braune Haare, die zu mehreren großen Haarrollen arrangiert waren, ein 1940er-Frisurenstil, der Nix eher weniger gefiel. Auch sie war schwanger, aber noch nicht so fortgeschritten wie Christina. Er nickte beiden zu und versuchte, sich seine Verlegenheit nicht anmerken zu lassen.
Christina sah ihn belustigt an. Unter ihren roten Locken funkelten blaue Augen. Man sagte, angehende Mütter hätten hormonbedingt eine besondere Ausstrahlung. Bei ihr war das offensichtlich.
»Na, Philipp, heute mal gemütlich?«
»Muskelkater.« Er griff sich an seinen rechten Oberschenkel und simulierte Schmerzen. »War ’ne harte Yogastunde gestern«, log er. Nix praktizierte tatsächlich Yoga, obwohl er es hasste. Und er tat es längst nicht so oft, wie sein Tracker ihm empfahl. Schon gar nicht gestern, als stattdessen eine VR-Quest mit seinem Sohn Marc auf dem Programm gestanden hatte: Mammuts jagen auf dem Eisplaneten Kelvin. Hatte Spaß gemacht. Vor allem, weil er endlich mal wieder, was selten geworden war, etwas mit Marc zusammen unternommen hatte. Marc hatte sich zurückgezogen. Er würde bald gar nicht mehr zugänglich sein, wenn die Krankheit voll ausbrach.
Christina grinste. »Du Armer.«
Franziska warf ihr einen wissenden Blick zu, der Nix nicht entging. Er war ein schlechter Lügner.
»Wird langsam eng da unten, was?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
Christina blickte an sich herab. »Ja, zum Glück zahlt mir die Krankenkasse meine stetig wechselnde Umstandsgarderobe.«
»Wirklich?«, fragte Franziska. »Meine hat das abgelehnt. Das ist ja unfair. Bei welcher bist du?«
»Sanitas.«
»Ich bin bei der CorporeSano. Eigentlich dachte ich, die sei die beste?«
»Nee, auf keinen Fall. Besonders nicht, wenn es um die Editing-Pakete geht. Da hat die Sanitas gerade bei den Verbrauchertests alles abgeräumt.«
»Wann ist es soweit?«, fragte Nix.
»In drei Monaten.« Christina streichelte ihren Bauch. »Hat uns ganz schön Nerven gekostet, die Kleine.«
»Wirklich?«
»Ach, wir mussten in die zweite und dann sogar noch in die dritte Runde. Die Standardtests waren nicht eindeutig.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte er. »Aber sie haben doch beim Gen-Scan hoffentlich nichts gefunden?«
Christinas Lächeln verschwand. Die Frage war ihr ganz offensichtlich unangenehm. Zunächst dachte er, es wäre seinetwegen, aber als sie Franziska einen raschen Seitenblick zuwarf, begriff er, dass es an der Anwesenheit der anderen Schwangeren lag.
Christina wiegte den Kopf hin und her, wobei ihre langen rotbraunen Locken wippten.
»Katharina hatte drei Risikogene: Autismus, Arteriosklerose und …« Sie überlegte einen Moment. »Das dritte weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendeine Allergie.«
»Oh Gott, du Arme«, sagte Franziska und streichelte ihren Arm.
»Es waren zum Glück Klasse-C-Gene, also nur eine geringe Ausbruchswahrscheinlichkeit, unter fünf Prozent oder so … wobei das für die Allergie, glaube ich, sogar nur Klasse D, also noch geringer war.«
»Das tut mir so leid, Christina«, sagte Franziska. »Wie seid ihr damit umgegangen?«
»Wir haben alles korrigieren lassen.«
Franziska nickte. »Besser so. Wenn’s dann doch ausbricht, macht euch Katharina am Ende in zwanzig Jahren Vorwürfe. Das wollt ihr bestimmt nicht.«
Christina schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Aber wir hatten ja auch das Babysafe-Paket.«
»Das haben wir auch! Ist einfach das Beste, was man kriegen kann.«
»Arteriosklerose hätten sie so oder so gemacht, weil das auf der Negativliste steht«, sagte Christina. »Und zum Glück hatten wir einen Health-Berater. Der hat uns empfohlen, die Allergie auch mitmachen zu lassen. Denn ab drei Korrekturen gibt es einen Bonus-Edit. Dafür konnten wir uns dann ihre Haarfarbe aussuchen.«
»Warum habt ihr nicht Zahnstellung genommen?«
»Oh. Das gibt es auch im Bonus?«
»Na klar!«
»Das hat unser Health-Berater uns gar nicht gesagt.«
Einen Moment lang herrschte eine unangenehme Stille. Christina hegte den Verdacht, eine schlechte Entscheidung getroffen zu haben, und ihr war bewusst, dass Franziska das auch so sah und aus Rücksicht schwieg. Es war ihr peinlich, weniger gut informiert zu sein.
»Und? Welche Haarfarbe habt ihr genommen?«, fragte Franziska, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen.
»Sie wäre ursprünglich straßenköterblond gewesen. Jetzt wird Katharina genauso ein Rotschopf wie ich.«
»Wie schön!«
»Dann wird sie die Männer mal genauso verrückt machen wie ihre Mutter«, sagte Nix.
Christina lachte und sah ihn leicht verwundert an. Er war eigentlich nicht dafür bekannt, oft und gern und kompetent zu flirten.
»Ah ja, Philipp. So siehst du das also.« Sie wandte sich schnell wieder Franziska zu: »Und wie läuft’s bei dir?«
Nix entging der leicht fordernde Unterton in Christinas Frage nicht. Sie hatte sich entblößt, nun erwartete sie im Gegenzug Offenheit von Franziska. Es war immer eine heikle Sache, über genetische Schwächen zu sprechen. Keiner wollte zugeben, nicht genetisch perfekt zu sein. Und jeder hatte eigentlich Probleme mit Offenheit, traute sich aber nicht, die Antwort zu verweigern. Es war ein wenig so, wie über sein Gehalt zu reden.
»Wir hatten total Glück. Anton hat nur eine Auffälligkeit, ein Gen für Rot-Grün-Sehschwäche. Ist ja häufig bei Männern. Sehr geringe Penetranz, hat die Architektin gesagt, wahrscheinlich kaum spürbar. Aber sie hat uns trotzdem eine Korrektur-Empfehlung ausgestellt. Und sie meinte, vielleicht bekämen wir für ihn auch androgenetische Haarausfall-Prävention on top.«
»Wie nett von ihr«, sagte Christina. »Sonst hättet ihr das womöglich selbst zahlen müssen.«
»Peter und ich waren superfroh. Wenn ich ehrlich bin, war es auch nicht ganz zufällig – wir sind gezielt zu ihr gegangen, weil wir sie vom Basen-Kochclub kannten.«
»Verstehe.« Christina lächelte. »Aber ist doch in Ordnung, wenn man seine Beziehungen nutzt.«
»Denke ich auch, zumal wir ja den Höchstsatz zahlen und die CorporeSano ihn in den letzten Jahren ständig erhöht hat.«
»Aber wäre das nicht ohnehin über das Babysafe-Paket abgedeckt gewesen?«
»Nein, das hat die Gen-Architektin uns Gott sei Dank erklärt, bevor wir es eingereicht haben. Die haften nicht für Edits bei Genen, die nicht mindestens in Klasse D fallen. Und Rot-Grün-Schwäche ist geringer gelistet. Dann ist die Penetranzwahrscheinlichkeit entscheidend. Und die kann nur ein Architekt beurteilen. Ist total verzwickt, muss man echt höllisch aufpassen.«
»Ich hasse das, sich mit Kleingedrucktem befassen zu müssen. Als wenn eine Schwangerschaft nicht schon belastend genug wäre«, sagte Christina. »Deswegen haben Wolfgang und ich gleich gesagt: Health-Berater und fertig.«
»Gut, aber die sind immerhin richtig teuer.«
»Wir hatten überhaupt keine Lust, uns mit diesem ganzen Kram zu befassen, Franzi. Den bezahlen wir, dafür holt er uns das Optimum raus. Das muss einem das eigene Kind schon wert sein.«
Aus den Augenwinkeln bemerkte Nix, dass Christina ihn beobachtete. Da war ständig eine leichte Spannung zwischen ihnen, die ihn unruhig machte. Sie gefiel ihm. Und er ihr? Diese Ungewissheit, verdammt.
»Sag mal, Philipp, wir reden hier über unsere albernen kleinen Probleme, aber bei euch war das doch damals richtig ernst?«, fragte Christina. »Marc hatte was, wenn ich mich recht erinnere?«
Sie merkte an seiner Mimik, dass sie ein schwieriges Thema angesprochen hatte.
»Oh, habe ich was Falsches gesagt?«
Nun war er es, der sich unangenehm berührt fühlte. Woher wusste sie das? Er hatte nie öffentlich darüber gesprochen, sondern es allenfalls mal Alban gegenüber erwähnt, als der sein erstes Kind erwartet hatte. Jetzt gab es nur die Flucht nach vorne. Alles andere wäre unsouverän.
»Nun, ich, nein, ist schon o. k. Ich habe das fast verdrängt«, log er und er merkte, dass es ihr unangenehm war, dass sie überhaupt gefragt hatte. »Marc litt am Menkes-Syndrom.«
Christina sah ihn fragend an.
»Nie gehört«, sagte Franziska.
»Ist sehr selten«, sagte Nix. »Eine Stoffwechselkrankheit. Der Körper kann nicht mehr ausreichend Kupfer aus der Nahrung aufnehmen.«
»Kupfer?«
»Uns war das ebenfalls alles völlig unbekannt. Aber der Körper benötigt Kupfer für viele Organe. Jedenfalls ist es eine wirklich üble Sache. Die betroffenen Kinder leiden an Muskelstörungen, epileptischen Anfällen und Wachstumsstörungen, und die Haare werden schon in den ersten Lebensjahren grau.«
»Mein Gott, wie furchtbar.«
»Die Ärzte meinten, mit dieser Erbkrankheit würde Marc die ersten drei Jahre nicht überleben.«
Christina hielt vor Schreck eine Hand vor den Mund. Ihre andere streichelte immer wieder über ihren großen Bauch.
»Oh Philipp, das habe ich gar nicht gewusst. Es tut mir so leid.«
Nix erinnerte sich an die schrecklichen Stunden mit seiner schwangeren Frau, an die Sorge um das ungeborene Kind, das sie in sich getragen hatte, und daran, dass es für das Kind das sichere Todesurteil bedeuten würde, wenn sie nichts unternahmen.
»Ist schon lange her«, sagte er.
»Und dann?«, fragte Franziska.
»Menkes ist zum Glück eine monogenetische Krankheit, war also selbst für die damalige Zeit leicht zu editieren, und wir hatten seinerzeit das große Pränataldiagnostik-Paket abgeschlossen.«
Dieses Paket beinhaltete, dass die Ärzte Zellen des Embryos aus einer Blutprobe der schwangeren Mutter fischten und das Erbgut untersuchten – inklusive des Gen-Edits, falls einer nötig und machbar war. Dieser vorgeburtliche Test war zwar nicht Pflicht, doch schon damals hatte es nicht lange gedauert, bis so gut wie jede schwangere Frau sich ihm unterzogen hatte.
»Stimmt, das gab es ja damals noch«, sagte Franziska. »Ein Traum, Christina. Stell dir vor, jeder Edit deiner Wahl, alles inklusive, ohne Papierkrieg, ohne Diskussionen, ohne Streit.«
»Wirklich? Das klingt ja paradiesisch.«
»Leider haben sie das große Pränataldiagnostik-Paket vor einigen Jahren abgeschafft. War angeblich zu teuer. Und BabySafe ist in Wahrheit deutlich schlechter, auch wenn sie alle das Gegenteil behaupten.«
Christina schüttelte den Kopf. »Kein Wunder, dass die Leute in die Türkei oder in den Ostblock fahren. Wer hat schon Lust auf diese ganze Bürokratie?«
»Na, dort kann man ja auch noch ganz andere Edits bekommen«, sagte Franziska. »Ich habe gehört, die machen sogar Intelligenz.«
»Hey, nicht so laut. Wir sind hier immerhin bei der Polizei«, sagte Christina und lachte.
Nix verzog leicht den Mund, sagte aber nichts. Solche Edits waren in Deutschland illegal. Aber er hatte auch keine Lust, mit zwei schwangeren Frauen eine ethische Grundsatzdiskussion anzufangen.
»Wer war denn der Überträger des Krankheits-Gens?«, fragte Franziska.
Nix zuckte innerlich zusammen und schämte sich zugleich, dass er Erleichterung empfand, nicht der Schuldige am kranken Gen seines Sohnes gewesen zu sein. Es war Elsas X-Chromosom gewesen, auf dem das kaputte Gen gelegen hatte. Bei Elsa war die Erbkrankheit nicht zum Ausbruch gekommen, weil sie als Frau zwei X-Chromosomen besaß. Ihr zweites hatte die funktionierende Variante des Gens getragen. Bei der genetischen Lotterie hatte Marc ihr schlechtes X-Chromosom erwischt. Und er als Mann hatte nur eines davon.
»Das konnten die Architekten nicht rekonstruieren«, log er.
Der Befund hatte damals bei ihm an sein altes Kindheitstrauma gerührt, an seinen behinderten Bruder Timmy. Seine Symptome hatten leider einer sehr schlimmen Ausprägung der Krankheit entsprochen, und er war bereits mit Anfang zwanzig gestorben.
»Wir haben den Edit in der zehnten Schwangerschaftswoche gemacht.«
»Das war ja ausreichend früh«, sagte Franziska.
Einen Pränatal-Edit sollte man bis maximal zum fünften Monat durchgeführt haben, danach sank die Erfolgswahrscheinlichkeit rapide ab. Der kritische Zeitpunkt war von Krankheit zu Krankheit verschieden, aber prinzipiell galt: Je früher, desto besser. Die Gen-Architekten injizierten der Mutter ungefährliche Viren, in die man eine molekulare DNA-Schere sowie die korrekte Gen-Vorlage gepackt hatte. Über den Blutkreislauf der Mutter gelangten die Viren dann in den Embryo, wo die Ladung der Viren ihr Flickwerk verrichtete. Weil die Zellen des wachsenden Embryos sich ständig teilten und ihre Zahl exponentiell wuchs, mussten also mit jedem Tag, den man wartete, mehr Zellen repariert werden, was mehr Viren mit Ladung erforderte. Auf der anderen Seite konnte man die Viren-Dosis nicht beliebig steigern, weil das sonst bei der Mutter eine Immunreaktion auslösen konnte. Also war es besser, den Edit möglichst früh in der Schwangerschaft anzusetzen, weil die Zellen-Zahl noch gering war. Anschließende Zellteilungen vervielfältigten dann automatisch die reparierten Varianten.
Es war trotzdem möglich, Edits später durchzuführen, da es bei vielen Erbkrankheiten gar nicht nötig war, sämtliche der Abermilliarden von Zellen zu reparieren, aus denen ein Körper bestand, sondern nur diejenigen im betroffenen Gewebe. Und selbst dort musste man nicht alle reparieren, damit die Funktionsfähigkeit wenigstens einigermaßen wiederhergestellt war. Aber es war nicht ausgeschlossen, dass die Symptome trotzdem auftraten, wenn auch in milderer Ausprägung.
»War es schlimm für euch?«, fragte Christina.
Nix erinnerte sich an die Tränen, die Schuldgefühle, die Elsa geplagt hatten, weil sie die Überträgerin gewesen war. Er war fest davon überzeugt, dass dies einen der wesentlichen Auslöser ihrer Depression bildete, an der sie inzwischen seit zwei Jahren litt. Immerhin war es nicht die Große Depression.
»Elsa und ich haben zusammengehalten und den Ärzten und Architekten vertraut. Ohne sie wäre Marc jetzt wohl nicht mehr am Leben. Es lief alles gut. Marc ist kerngesund.«
Noch, dachte er.
Der Aufzug war endlich da. Nix drückte auf »K«, Christina musste in die 3. Etage. Franziska drückte keine Taste. Sie wollte offenbar auch in den dritten Stock.
Sie standen eine Weile schweigend in der Kabine. Nix beobachtete die Leuchtanzeige der Stockwerke, die sehr langsam wechselte. Immer wieder hielt der Aufzug an, und Kollegen stiegen zu und wieder aus. Es waren ausnahmslos Ältere, die sich nicht schämen mussten, den Aufzug zu nehmen. Nix entgingen ihre abschätzigen Blicke nicht, als sie ihn im Aufzug sahen.
Ja, körperlich war Marc gesund. Aber seelisch nicht. Nix dachte an seinen dunkelbraunen Haarschopf, sein offenes Wesen, das sich zunehmend verschlossen hatte. Er hatte sich von ihm und Elsa entfernt, war immer einsilbiger geworden, machte sein eigenes Ding, war viel allein. Es handelte sich um die ersten Anzeichen der Großen Depression, die vor allem junge Menschen erfasste. Jedenfalls vermutete das der Jugendpsychologe.
Marc hatte sich von den anderen Kindern abgewandt, wurde oft aggressiv. Die Lehrer waren bezüglich der Anzeichen der Großen Depression bei Kindern sensibilisiert. Natürlich war Nix allein gegangen, als die Lehrerin sie einbestellt hatte. Er hatte Elsa verleugnet. (»Es tut mir leid, ihre Mutter ist schwer erkrankt, Sie verstehen.«)
Elsa war aufgrund ihrer – zum Glück normalen – Depression gegenwärtig zu nichts mehr imstande. Nix war mit Marc von Psychologe zu Psychologe gerannt. Sie waren nicht sehr optimistisch, was Marcs Fall anging. Sie gaben ihm noch ein Jahr, dann würde er die Krankheit, an der so viele Kinder bereits litten, voll entwickelt haben, hieß es.
»Wie alt ist Marc jetzt?«, fragte Christina, als sie wieder zu dritt im Aufzug waren.
»Dreizehn.«
»Sicher hat es euch beide stärker gemacht«, sagte Christina und strich Nix über den Arm. Sie tat es ein bisschen zu langsam und zu fest, als dass es lediglich als eine Geste der Anteilnahme zu deuten gewesen wäre. Ein leichter Schauer der Erregung durchflutete ihn. Er wusste, dass sie ihn mochte.
Er nickte langsam. Von Elsas Depression wusste unter seinen Kollegen niemand etwas. Auch nicht von der Diagnose seines Sohnes. Zum Glück. Es hätte seine Autorität beschädigen können.
Sie waren jetzt im dritten Stock. Christina und Franziska stiegen aus.
»Ach, ich tu noch was für meine Credit-Points«, sagte Nix und trat mit ihnen aus der Kabine.
»Na, die paar Stockwerke wirst du doch wohl noch schaffen – trotz deines schlimmen Muskelkaters«, sagte Christina. Sie hatte den letzten Teil des Satzes etwas stärker betont. Franziska grinste. Er wurde rot angesichts seiner Schwindelei, die sie offenbar durchschaut hatten.
»Wie viele Schritte hast du als Soll?«
»15.000. War wohl doch etwas zu ehrgeizig, wie ich jetzt merke.«
»Wolfgang hat 20.000. Der hat das aber auch nötig – im Gegensatz zu dir«, sagte Christina und klopfte leicht auf seinen Bauch. Wieder fühlte er Erregung.
»Danke. Aber du hast mich noch nicht nackt gesehen.«
»Philipp. Hast du etwa die letzte Weihnachtsfeier vergessen?« Sie lachte wieder ihr angenehmes Lachen. Bei der letzten Weihnachtsfeier waren sie alle gemeinsam in die Sauna gegangen. Anordnung von Engelbert. War das Verlegenheit in Christinas Gesicht? Oder wünschte er sich nur, dass sie verlegen war?
»Oh …«, sagte er. Das hatte er tatsächlich vergessen. Hatte sie ihn damals etwa beobachtet?
»Nun sammle deine Schritte, bevor ich noch Ärger mit Elsa bekomme.«
Als sie seine Frau erwähnte, traf es ihn wie einen Stich. Sie ahnte ja nicht, was los war. Welches Leben er mittlerweile führte. Der unendlich bedrückende Alltag zu Hause. Vor allem den Aufwand an Heimlichtuerei, den er veranstaltete, um ihre Krankheit zu verbergen, um sie zu schützen vor all dem Klatsch und Tratsch und dem gesellschaftlichen Stigma. Oder schützte er eher sich selbst? Aus Scham? So wie damals, als er Timmy verleugnet hatte?
Christina runzelte kurz die Stirn. »Elsa habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.«
»Sie arbeitet viel«, log er. Elsa war nun seit einem Jahr krankgeschrieben. Als bei Marc die beginnende Große Depression diagnostiziert worden war, hatte sie das wie ein Schlag getroffen. Antidepressiva bewirkten bei ihm natürlich nichts. Bei Elsa schon, da sie »nur« an einer normalen Depression litt. Das Problem war eher, dass sie sie nicht regelmäßig einnahm – was er eigentlich hätte melden müssen. Aber er brachte es nicht übers Herz, sie bei der Kasse zu denunzieren.
»Die erleben gerade in ihrer Firma große Umstrukturierungen, wegen KI-Automatisierung.«
»Oh. Ich hoffe, es trifft sie nicht auch noch?«
»Nein, zum Glück ist sie in Human Ressources. Sie hat bloß viel zu tun, die vielen Entlassungen müssen schließlich abgewickelt werden. Kein angenehmer Job.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Die KIs nehmen uns vielleicht die Jobs weg. Aber wenigstens entlassen uns noch Menschen.« Christina und Franziska lachten ein gequältes Lachen.
Nix verabschiedete sich mit gemischten Gefühlen und ging ins Treppenhaus. Er stieg bewusst langsam die letzten vier Stockwerke hinab, damit der Tracker alle Schritte auch sauber zählte. Welcher Teufel hatte ihn eigentlich geritten, sich für dieses Quartal 15.000 Schritte als Tagessoll zu setzen? Er war einfach nur auf den Bonus scharf gewesen, der bei freiwilliger Steigerung winkte. Dabei war er als originaler alter Sesselfurzer doch schon mit 10.000 immer leicht im Verzug gewesen. Naja, es wurde ja erst am Monatsende abgerechnet. Nur wollte er auf jeden Fall vermeiden, dass er am 31. dann plötzlich 50.000 Schritte im Rückstand war. Das konnte ziemlich widerlich werden, wenn man dann sein komplettes Monatsdefizit an einem Tag ablaufen musste. Und Schritt-Defizit bedeutete Krankenkassen-Malus-Punkte. Und zu viele Malus-Punkte bedeuteten Beitragserhöhung. Und irgendwann Rauswurf.
Die Beweissicherung war eine riesige Lagerhalle mit endlosen Metallregalen, in denen sich Kartons stapelten, fein säuberlich mit Tracking-Chips versehen. Eine Lagerhalle voller abgepackter Verbrechen – bis zurück in die 2030er. Die noch älteren Fälle wurden im Keller gelagert.
In der Mitte des Raums war ein großer Metalltisch aufgebaut, über dem eine lange Tageslicht-Lampe hing. Solche Lampen störten den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers nicht so sehr wie alte LEDs.
Mehrere Beamte mit Gummihandschuhen standen am Tisch und untersuchten Kleidungsstücke. Alban hielt gerade eine braune Cordhose in die Höhe. Es war die Hose, die der Tote getragen hatte. Einer der anderen Beamten untersuchte den Hoodie mit der blutverschmierten Kapuze.
Als Nix eintrat, blickten alle kurz zu ihm auf. Alban lächelte schwach. Mit einer knappen Kopfbewegung bedeutete er ihm, näherzukommen.
»Und, was habt ihr gefunden?«, fragte Nix.
Alban war klein und hatte eine Halbglatze, für die er sich ziemlich schämte und weswegen er einer der eifrigsten Hutträger war, die Nix kannte. Eine Transplantation war sinnlos, hatte Alban ihm einmal anvertraut. Würden wieder ausfallen, hätte sein Arzt gesagt. Und eine topische Gentherapie der Haarwurzeln würde bei ihm nichts mehr ausrichten, denn er hatte keine Haarwurzeln mehr. Die einzige Möglichkeit war eine Kur mit DHT-insensitiven Stammzellen, aber das war viel zu teuer für ihn.
Seine Halbglatze war jedoch das einzige von Albans äußeren Merkmalen, dem es an Perfektion mangelte. Seinen Körper hatte er zu einer antiken griechischen Statue gestählt. Nix wusste, dass er täglich zwei Stunden Workout absolvierte, eine morgens, eine abends. Wie er das schaffte, war ihm schleierhaft, bei all der Arbeit. Außerdem hatte Alban noch zwei kleine Kinder. Manche Leute waren einfach Organisations-Genies.
»Seine Klamotten sind unauffällig. Papiere hat er nicht dabeigehabt. Wir wissen also noch nicht, mit wem wir das Vergnügen haben.«
»Habt ihr die Zähne abgehakt?«, fragte Nix.
»Läuft. Gene auch, Kramer ist dran. Philipp, schau mal. Das hier wollte ich dir zeigen.«
Alban hielt ihm mit seiner gummibehandschuhten Hand ein Smart entgegen. Es war ausgeschaltet. Das Display aus angeblich unzerbrechlichem, flexiblem Glas war zersplittert. Weiß und halbtransparent schimmerten die Bruchlinien im Licht der Lampe wie ein Spinnennetz.
Nix zögerte, es anzufassen.
»Keine Sorge, wir sind mit allen Untersuchungen durch.«
»Funktioniert es?«
Alban nickte.
Nix schaltete das Smart am Sensor ein. Es war nicht einfach, unter dem Spinnennetz die Anzeige zu erkennen. Aber der Bootscreen war anders als sonst; er zeigte nicht das übliche Amazon-A, sondern eine Art Stein. Er war dreieckig, mit lang zulaufender Spitze, wies Dellen sowie scharfe Kanten auf und rotierte um sich selbst, während das Smart bootete. Er sah aus wie einer dieser Faustkeile, die Urmenschen benutzten. Dann kam schon die Login-Abfrage. Nix sah zu Alban.
»Geht gleich weg.«
Smarts waren entweder auf das individuelle Muster des elektrischen Hautwiderstands der Finger kalibriert – oder auf die Stimme. Übervorsichtige aktivierten natürlich beides. Aber die Polizei-IT-Leute hatten den Verschluss offenbar bereits geknackt. Schließlich hatte der Tote keinen Hautwiderstand und keine Stimme mehr, um es zu entsperren.
»Wir haben übrigens spaßeshalber anhand seiner Login-Matrix eine Stimm-Rekonstruktion erstellt.«
»Aha«, sagte Nix, auf das Display blickend, wo sich soeben das Menü aufbaute.
»Unser Freund hatte eine ziemlich ungewöhnliche Stimme. Sehr tief.«
»Höre ich mir nachher mal an«, murmelte Nix und beobachtete, wie sich das Smart-Menü öffnete. Die Diorama-Anzeige sprang an, und über dem Smart poppten die Apps langsam wie kleine Luftballons auf.
Ein paar Applikationen erschienen. Er öffnete den Postkasten: leer. Auch das Adressbuch: leer.
»Unser Freund war vorsichtig«, sagte Alban. »Keine persönlichen Daten. Nichts, was auf ihn oder andere Personen schließen lässt. Wir haben die Daten-Archäologen drangesetzt, aber sie konnten nichts finden. Er muss ein frisches Smart benutzt und einfach nichts darauf abgelegt haben. Aber eine Sache hat er uns doch hinterlassen … Mach den Locator auf.«
Nix tippte auf das Kartensymbol. Automatisch leuchtete die Diorama-Anzeige wieder auf. Für einen Sekundenbruchteil sah er ein Bild über dem Smart schweben. Viel Grün. Ein kleiner Wald. Holzstämme. Eine Lichtung an einem Hang. Dann verschwand alles. Die Diorama-Wolke verschwamm, als das Smart eine Peilung vollzog. Dann beruhigte sich die Wolke, und Nix sah einen grauen Block. Den Stellvertreter für seinen momentanen Aufenthaltsort, der von Amazons Drohnen nicht erfasst worden war. Selbstverständlich war das Kommissariat vom Worldscan ausgenommen. Sonst hätte er jetzt ein Indoor-Rendering des Archivs gesehen, perspektivisch exakt so dargestellt wie von seinem gegenwärtigen Standpunkt aus betrachtet. Allerdings ohne Möbel. So weit war die Technik noch nicht.
»Das, was du eben kurz gesehen hast, war der Ort, den er zuletzt aufgerufen hatte«, sagte Alban. »Wir haben ihn in der History rekonstruieren können. Ich habe ein Lesezeichen für dich erstellt.«
Nix deaktivierte die Sprachführung, die ihn ständig zu Eingaben aufforderte. Dann wischte er das Locator-Diorama mit einer Handbewegung weg und navigierte mit schnellen Fingergesten durchs Menü. Er rief die Bookmarks auf. Es war nur ein Eintrag gelistet, angezeigt mit Raumkoordinaten, was seltsam war, denn normalerweise nutzte Locator Ortsnamen.
Alban sah Nix’ Verwunderung: »Er muss die Koordinaten händisch eingegeben haben.«
Nix sah kurz auf, dann aktivierte er das Lesezeichen. Wieder verschwamm die Diorama-Wolke, während der Locator zu dem gewünschten Ort sprang. Dann sah er erneut den bewaldeten Hang und die kleine Lichtung davor. Jetzt erkannte er mehr Details. Ein paar größere Steine lagen auf dem Boden herum, ein Holzstamm quer davor. Irgendwie kam ihm das Ganze bekannt vor.
»Wo ist das?«
»Zwischen Mettmann und Hochdahl. Mitten im Neandertal. Und weißt du was, Philipp? Es ist nicht irgendeine Stelle. Es ist exakt dort, wo im 19. Jahrhundert der erste Neandertaler ausgegraben wurde.«
Nix zuckte mit den Schultern.
»Also war der Typ ein Tourist?«
»Keine Ahnung«, sagte Alban. »Aber falls er einer war, findest du es dann nicht komisch, dass er sonst keine weiteren Lesezeichen gespeichert hat? Und dass er dann auch noch die Koordinaten manuell eingegeben hat?«
»Vielleicht interessierte er sich eben für Urmenschen? Und komm, Alban, so viel hat Düsseldorf sonst auch nicht zu bieten, oder?«
Alban lachte sein unverwechselbares Lachen, bei dem Nix immer dachte, dass sich so eine Ratte anhören musste, wenn sie lachen könnte.
»Wir haben jedenfalls ein paar Leute hingeschickt, die sich die Fundstelle ansehen.« Alban war auf Zack, das musste man ihm lassen.
»Gute Arbeit«, sagte Nix und gab ihm das Smart zurück. »Halte mich auf dem Laufenden, was die Zahn-Analyse angeht. Kramer erledigt die Obduktion. Und dann hoffe ich, dass diese Scheiß-Gen-Daten bald kommen und wir den Fall übergeben können.«
»Philipp …«
Nix hielt inne. »Was?«
Albans Miene war unentschlossen. »Ach, schon gut.« Er machte eine abwinkende Handbewegung.
»Was ist los?«
Alban zog die Handschuhe aus und lief um den Tisch herum. Er beugte sich zu ihm und sagte mit gesenkter Stimme: »Ich will nicht indiskret sein, und möglicherweise liege ich auch falsch. Aber neulich hab ich meinen Mediscan aktiviert. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen, als ich die Ergebnisse sah. 18,6 BMI. 18,6! Ich hab erst gar nicht bemerkt, dass Kramer in meiner Nähe stand. Dann habe ich begriffen, dass der Scanner aus Versehen ihn erfasst hat.«
Nix dachte an die knochige Schulter, die er vorhin berührt hatte.
»Bitte nicht falsch verstehen, Philipp. Nicht, dass das jetzt aussieht, als hätte ich spioniert oder so. Ich stand einfach zufällig in seiner Nähe. Kramer hat seinen Scanner offenbar deaktiviert, sonst hätte der garantiert schon Alarm bei seiner Kasse geschlagen. Und normalerweise hätte ich dir das auch gar nicht erzählt, aber ich mache mir Sorgen. Philipp, 18,6! Kramer hat Untergewicht.«
»Hmm.« Nix nickte. »Du kennst ja seine Frau.«
Alban sah ihn skeptisch an. »Das glaubst du doch selbst nicht. Was, wenn er einer von den Depressiven ist?«
Nix’ Magen zog sich zusammen, als er die Worte vernahm. Er dachte an Elsa. Sie war eine der Depressiven. Aber das wusste Alban nicht. Oder etwa doch?
»Ich mache mir Sorgen, okay? Und ich bin verpflichtet, dir das zu sagen. Du kennst die Vorschriften.« Alban flüsterte jetzt. »Und du weißt, dass du es melden musst.«
Timmys Gesicht erschien vor seinem inneren Auge.
»So sind nun mal die Vorschriften – ›Bei Verdacht auf Erkrankung ist der Erkrankte auf seinen Zustand hinzuweisen und anzuhalten …«
»… umgehend einen Arzt aufzusuchen‹, ich weiß.«
Timmys Lachen in seinem Ohr.
»Philipp. Nicht falsch verstehen. Ich meine es nur gut.«
»Schon klar.«
Du meinst es vor allem gut mit dir.
Er blickte in Albans rundliches Gesicht, auf der Suche nach einer Emotion. Fühlte er sich wenigstens unwohl, seinen Kollegen zu denunzieren? Oder war so etwas mittlerweile zur Normalität geworden in der Solidargemeinschaft, die nicht nur den Schwachen half, sondern auch gleich noch ihre Probleme für sie löste? Aber alles, was er in Albans Gesicht sah, war die unverbindliche, professionelle Andeutung eines Lächelns mit diesen – wie hätte es auch anders sein können? – strahlend weißen und grundgesunden Zähnen.
»Ich kümmere mich darum.«
Kümmern? So, wie er sich um Timmy hätte kümmern sollen? Oder um Elsa?
2
EIN KNOCHENJOB
Langsam, sehr langsam drehte er den Beinknochen unter dem Stereoskop. Drei Linien zogen sich um das obere Ende des Knochens. Die Abstände waren sauber eingehalten, er konnte kaum Unregelmäßigkeiten feststellen. Wunderschöne Arbeit. Das gleiche Arrangement am unteren Ende. Das waren ganz eindeutig keine Schabe-Spuren. Dieses Neandertaler-Bein war vor 50.000 Jahren nicht das Mittagessen eines Kannibalen oder einer Hyäne oder eines Bären gewesen – sonst hätten sich die Reißzähne in die Knochen gegraben und Spuren gänzlich anderer Art hinterlassen. Alles war deutlich zu regelmäßig eingekratzt. Wahrscheinlich mit einem Steinmesser.
Und was war das? Max hielt den Knochen schräg. Hier war noch etwas. Aber er konnte es nicht genau ausmachen. Ohne die Augen von den Okularen zu lösen, justierte er den Spot der Lampe. Jetzt erkannte er es. Ein Zickzack-Muster. Es verlief quer über dem Knochen, verband die beiden seitlichen Kratzmuster und war ziemlich abgenutzt, aber eindeutig ein Zickzack. Gut. Bei diesem Knochen handelte es sich also um Kunst. Aber was bedeutete diese Kunst? Hatte jemand den Knochen als Identifikations-Symbol getragen? War das Werk ein Stammescode?
Natürlich musste er noch eine Protein-Spektroskopie erstellen lassen, obwohl er sich sicher war, dass der Knochen von einem Menschen stammte. Von einem Neandertaler. Doch das Prozedere war eben einfach Standard; Irrtümer lagen schließlich immer im Bereich des Möglichen. Wesentlich spannender war hingegen die Frage, welche Menschen oder menschenverwandte Art diese Kratzer in den Neandertaler-Knochen geritzt hatten. Neandertaler? Denisova? Oder Homo sapiens?
Idealerweise würden sich noch Steinreste in den Kratzlinien finden. In diesem Fall würde man feststellen, welche Steinart für das Kratzen genutzt worden war – und daraus vielleicht mehr ableiten können. Und wenn er ganz großes Glück hatte, waren vielleicht auch noch DNA-Spuren des Künstlers am Stein und in den Rillen aufzuspüren. Das wäre der Jackpot.
Max löste die Augen vom Stereoskop und legte den Knochen vorsichtig neben den Armknochen und die Finger desselben Individuums. Sein Tisch war mit gelbbraunen Knochen übersät. Er rieb sich die Augen. Es war anstrengend, lange durch die Linsen zu schauen. Und er tat das schon seit Stunden. Aber er stand unter Zeitdruck.
Er war müde, hatte wenig und schlecht geschlafen, die ganze Woche ging das schon so. Der bevorstehende Kongress in Philadelphia bereitete ihm Sorgen. Seine Arbeitsgruppe arbeitete mit Hochdruck daran, die ersten Ergebnisse der Ausgrabung in Kroatien aufzubereiten. Diese neu entdeckte Höhle in Vindija war eine wahre Schatzkammer. Aber die Zeit lief ihnen davon. Sie bräuchten eigentlich Monate, um all die sensationellen Funde zu erfassen und zu kategorisieren. Noch herrschte ziemliches Chaos. Es nervte ihn, dass alles immer so langsam ging. Und dann musste er das komplette Zeug auch noch auf Englisch ausformulieren. Davor graute ihm besonders. Seine Syntax war, wie für einen Gehörlosen typisch, ziemlich mies. Sarah würde das überarbeiten müssen. Aber eigentlich brauchte er sie für die Stratigraphie.
Max sah auf die Uhr. Schon nach acht. Es würde eine lange Nacht werden. Er wollte heute noch mit Neandertaler-Individuum KLM11 durchkommen.
Er nahm den Armknochen auf und hielt ihn erneut unter das Stereoskop. Die Kratzer waren so regelmäßig wie am Oberschenkel. Vindija war zweifellos eine echte Schatzkammer.
Er spürte ein Tippen an seiner Schulter, zuckte zusammen und ließ vor Schreck den Knochen fallen, der mit einem lauten, wenn auch für Max unhörbaren Geräusch auf den Tisch fiel. Scheiße! Er blickte auf und sah in Sarahs Gesicht.
Mit der flachen Hand klopfte er sich zweimal auf die Brust. Es war die Gebärde für »erschrecken«. Dazu eine vorwurfsvolle Mimik, was zu der Aussage »Du hast mich erschreckt!« führte.
Sarah konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie rieb kurz mit der rechten Hand über den Rücken ihrer linken: »Entschuldigung.« Dann wurde ihr Ausdruck fragend. Sie zog die Wangen leicht ein und fuhr sich mit der rechten Handinnenkante schräg nach unten über ihren Bauch. Das war die Gebärde für Hunger. Kombiniert mit ihrer Mimik hieß es: »Hast du auch Hunger?«
Er nickte. Den hatte er tatsächlich. Seit dem Mittagessen hatte er nichts mehr zu sich genommen.
Sarah setzte Zeige- und Mittelfinger neben ihren Mund und führte sie schnell davon weg. »Soll ich was bestellen?«
Max schnippte mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. »O. k.«
»Und was? Low-Carb-Pizza?« Die Gebärde für Pizza war unverwechselbar ikonisch – mit Daumen und Zeigefinger beider Hände deutete sie eine imaginäre Scheibe an, die auf einen Teller geschoben wurde; abgesehen davon, dass Low-Carb-Pizza anders gemacht wurde als die ungesunde normale. Low-Carb buchstabierte sie mit dem Fingeralphabet, aber sie zeigte nur schnell die Buchstaben L und C.
Max lächelte. Er beobachtete sie gerne beim Benutzen der Gebärdensprache. Ihr Stil war grazil und leicht. Mit ihren langen Fingern und Armen besaß sie die perfekte Anatomie für seine Sprache. Es war einfach eine Wonne, ihr dabei zuzusehen, auch wenn er wusste, dass Sarah sich selbst gar nicht so empfand. Sie mochte ihren großen Körper nicht, weil sie damit ständig auffiel. Und sie fiel nicht gerne auf. Er konnte darüber nur den Kopf schütteln, denn Max Stiller war eine einzige Provokation seiner Umwelt, von der ersten Minute seines Lebens an. Als Gehörloser in einer Welt, die kaum noch Behinderte kannte, war sein Leben ein täglicher Kampf. Aufzufallen war ein Teil seiner Persönlichkeit geworden, so sehr, dass er den Wunsch nach Unauffälligkeit nicht mehr nachvollziehen konnte.
Sarah beim Gebärden zuzuschauen war für ihn das Gleiche wie das genussvolle Lauschen einer schönen Stimme für einen Hörenden. Ihr Gesicht verfügte über eine facettenreiche Mimik, die allerdings weitaus schwächer ausfiel als seine, denn so emotional wie er war sie nicht. Ihre wachen braunen Augen mit den flott geschwungenen Brauen und die leichten Falten um ihre Mundwinkel verliehen ihrer Miene selbst im neutralen Modus, wenn sie eigentlich völlig ernst war, immer einen leicht belustigt-neugierigen Ausdruck.
Plötzlich hielt Sarah inne und gebärdete: »I, I will be King.« Sie benutzte dafür nicht die deutsche, sondern die amerikanische Gebärdensprache und bewegte dazu sanft ihren Körper, als würde sie tanzen. Er begriff. Sie sang – in Gebärdensprache. Er wusste auch, was sie sang. David Bowies Klassiker »Heroes«. Obwohl er den Song noch nie gehört hatte und niemals würde hören können.
Aber er hatte ihn dennoch als Klingelton seines Smarts gewählt. Und er verstand, dass sie darauf jetzt Bezug nahm. Sein Smart klingelte.
»And you, you will be queen.«
Sie lächelte, als sie auf ihn zeigte und ihn als ihre Königin titulierte. Max lachte. Normalerweise gebärdeten sie die Liedzeilen einander andersherum. Denn beide wussten ganz genau, dass Max sich als König empfand und auch so verhielt.
Ein Tippen mit der Zeigefingerspitze an der Wange. »Moment«, sagte Max und ergriff das Gerät, das nun zwischen den Knochen Musik machte, blitzte und darüber hinaus vibrierte. Jeder andere Gehörlose hätte den akustischen Alarm ausgeschaltet, um in der Welt der Hörenden weniger aufzufallen – einer Welt, in der das Normale regierte und das Andersartige zum Feind erklärt worden war. Aber nicht Max Stiller. Er hatte keine Lust, sich zu verstecken. Im Gegenteil. Er wollte der Welt zeigen, dass er da war, dass sie ihn nicht kleinkriegen würde.
Auf dem leuchtenden Display blitzte das Porträt von David Bowie in seiner Ziggy-Stardust-Phase auf. Ein rotblau geschminkter Blitz verlief über das schmale Gesicht des vor Jahrzehnten verstorbenen Sängers, den Max so sehr verehrte. Diese Verehrung stürzte ihn aber auch in einen Gewissenskonflikt. Ein Gehörloser, der für einen Musiker schwärmte? Das vertrug sich schlecht mit seinem Ego des selbstbewussten Gehörlosen, der sich nicht als behindert, sondern als Teil einer unterdrückten kulturellen Minderheit betrachtete. Doch Max scheute auch nicht den Konflikt mit der Gehörlosen-Community, die er oft als viel zu duckmäuserisch empfand. Es gab ja auch nur noch sehr wenige von ihnen.
Max gebärdete mit der linken Hand. »Welcher Idiot ruft einen Gehörlosen an? Noch dazu um diese Uhrzeit?«
Über Bowies roter Irokesenfrisur stand: »Unbekannter Anrufer«.
Dann vollführte Max eine seiner Lieblingsgesten – die Schiebebewegung mit der gekrümmten Handfläche auf das Smart zu; dazu zischte er ein »Schsch«. Die Gebärde sah aus, als würde er ein Glas Wasser auf eine Flamme schütten. In diesem Fall war es metaphorisch für das Löschen des ach so dringlichen Klingelns, doch grundsätzlich bedeutete es schlicht: »Du kannst mich mal.« Max benutzte die Geste meistens, wenn es um Kollegen ging, die in irgendwelchen Veröffentlichungen seine Arbeit kritisierten. Dann schsch-te er mit der Hand Richtung Paper oder bei einer Konferenz heimlich unter dem Tisch zum Redner hin, was Sarah jedes Mal zum Lachen brachte. Seine die Gebärde begleitende Miene war einmalig – ein solch demonstratives und vernichtendes »Du bist mir sowas von egal« bekam nur er hin.
»Ich kann rangehen, wenn du willst«, gebärdete Sarah. Die Gebärde für Telefonabnahme rührte noch aus archaischen Zeiten, als Telefone große Apparate mit schwerem Hörer, der auf eine Gabel aufgelegt wurde, gewesen waren. Sie gestikulierte wie desinteressiert, was Max nicht entging. Er kannte den Grund dafür. Sie wollte vermeiden, dass es wie ein Hilfsangebot rüberkam. Sie wusste, dass er es hasste, wenn ihm jemand Hilfe anbot.
Er seufzte. In seiner stillen Welt war das Gefühl, lautstark Luft auszuatmen, dennoch eine Wohltat. Es bestätigte ihn darin, mit Recht genervt zu sein.
Fingerschnippen: »O. k.« Schien jemand Unbekanntes zu sein – vielleicht war es ja wirklich wichtig. Er reichte Sarah das Smart.
Sie nahm zum Telefonieren immer das linke Ohr, da am anderen ein großer Clip hing, der ihr deformiertes Ohrläppchen verbarg. Er wusste das, und sie wusste, dass er es wusste.
Dann bewegten sich ihre Lippen, und das Hörenden-Theater, das er so oft ohne gültige Eintrittskarte beobachten musste, begann. Wie oft hatte er sich schon über dieses Theater gewundert und amüsiert. Wie Hörende manchmal wie vom Blitz getroffen innehielten, wenn jemand sie rief, wenn es krachte, wenn ein Auto hupte, etwas rumpelte, kratzte, polterte. Nicht, dass ihm diese Begriffe etwas bedeuteten; er wusste nur, dass sie eine unterschiedliche Qualität für Hörende aufwiesen. Oder wie sie wie Marionetten durch die Straßen stapften, ihre Smarts am Ohr, von denen sie permanent Befehle empfingen. Ein bisschen bewegte Luft im Gehörgang konnte sie steuern. Armselig. Er war froh, dass er davor geschützt war. Vor all dem Schrott, den viele Menschen daherredeten. Vor dem ganzen Krach, den sie mit ihren Mündern, ihren Auto-Autos und ihren Smarts veranstalteten.
Normalerweise blendete er es aus, sah weg. Sarah hingegen schaute er gerne an. Nicht wegen des Lippenlesens. Dafür war er jetzt zu müde, und sie würde ihm außerdem ohnehin gleich erzählen, worum es ging. Er mochte es einfach, ihr feines Gesicht mit den altmodisch zurückgebundenen, langen braunen Haaren zu studieren. Man konnte sie nicht schön nennen, aber sie war auf besondere Art attraktiv. Und weil sie so unglaublich groß war, über zwei Meter, zog sie unweigerlich die Blicke der Männer auf sich. Mit Stiefeln versuchte sie, ihre Beine ein Stückchen kürzer wirken zu lassen, was ihr nur leidlich gelang, wie die Reaktionen der Männer auf der Straße ihm immer wieder bestätigten. Sarah selbst bemerkte das oft nicht. Aber ihm entging derlei aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber Visuellem und Bewegungen natürlich nicht. Und er merkte, wie es ihm immer noch einen Stich versetzte. Dabei waren sie nur ein einziges Mal miteinander intim geworden. Es war ein seltsamer Abend und sie sehr unglücklich gewesen, Valerie gerade geboren, ihr Leben zerrieben zwischen Karriere und Mutterrolle, der Druck auf ihre Beziehung mit Robert enorm. Max hatte ihre Trauer gespürt, und er hatte sie trösten wollen. Eines Abends, nach einem Frustdrink zuviel an der Bar eines abgelegenen Hotels in Georgia, wohin sie zum Annual Meeting der Paleoanthropology Society gefahren waren, hatte sie ihrem Schmerz nachgegeben. Und er seiner Begierde. Sie hatten darüber nie gesprochen, aber seitdem war etwas von dieser Anziehung geblieben.
Nun stoppte der Tanz ihrer Lippen. Sie nahm das Smart vom Ohr und legte auf. In ihrem Gesicht stand Erstaunen. Und Ernst.
»Was ist los?«, gebärdete er. »Wer war das?«
»Ein Kommissar aus Düsseldorf.«
»Was?«
»Er möchte, dass du nach Düsseldorf kommst.«
Max’ Müdigkeit war mit einem Schlag verflogen.
»Wieso? Was habe ich mit der Polizei in Düsseldorf zu tun?«
»Völlig verrückte Geschichte. Sie haben bei einer Ermittlung im Neandertal Knochen gefunden. Aber sie sehen ungewöhnlich aus. Jetzt ist die Polizei unsicher, ob sie von Missgebildeten stammen oder von Urmenschen.«
»Im Neandertal? Die haben da doch schon alles geborgen?«
Sie nickte. »Ich weiß, aber anscheinend haben sie doch was Neues gefunden. Sie bitten dich, es dir mal anzusehen.«
Er haute mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Knochen wackelten.
»Spinnen die? Wieso ich? Wir haben genug zu tun! In Düsseldorf ist Termann. Kann der das nicht machen?«
Max gebärdete Termann als Kombination der Gebärden von »Teer« und »Mann«, ein Behelfsname, da er an Termann noch keine Namensgeste vergeben hatte und sich die Verbindung von Teer und Mann schneller gebärden ließ als das Ausbuchstabieren des Namens mit dem Fingeralphabet.
»Tja. Wahrscheinlich wollen sie einfach den Besten«, gebärdete Sarah.
Sie gebärdete überzeichnet und mit entsprechender Mimik: den Besten! Der Daumen erhob sich zur einsamen Spitze. Sie fügte der Bewegung eine leicht dramatische Verzögerung und ein kurzes Nachvibrieren der Hand bei. Der Allerbeste!
Max musste grinsen. Er wusste, dass sie ihn für leicht eingebildet hielt, und er mochte, wie sie ihn zuweilen damit aufzog. Aber er war schließlich auch der Beste, nicht nur in Deutschland. Er war, was Neandertaler anging, die weltweite Spitzenkoryphäe.
»Und wir sollen jetzt nach Düsseldorf kommen?«, fragte er. »Das ist eine weite Fahrt von Berlin.«
»Nicht wir. Du«, sagte sie. Kurze Pause. »Oder möchtest du gerne, dass ich mitkomme?« Ein Anflug von Koketterie in ihren Gebärden. Etwas zu kokett, wie er fand. Sie spielte die Unschuld vom Lande, dabei wusste sie genau, dass es für alle leichter war, wenn sie mitkam. Aber sie wollte sich ihm nicht aufdrängen. Sarah balancierte diesbezüglich immer auf einem feinen Grat. Sie musste es schaffen, einem Menschen, der sich nicht als Behinderter betrachtete, aber vom Rest der Welt als solcher gesehen wurde, Hilfe anzubieten, die sich aber nicht wie Hilfe anfühlen durfte. Max war eigentlich nicht glücklich darüber; er hatte ein permanent schlechtes Gewissen, wenn sie für ihn übersetzte oder ihm auf andere Weise bei seiner Reise durch die Welt der Hörenden assistierte. Er fürchtete, dass Sarah nach und nach in die gleiche Rolle schlüpfen würde wie Anna, seine hörende Schwester. Sie hatte es sich nicht aussuchen können, in eine gehörlose Familie hineingeboren zu werden. Von klein auf hatte sie immer die Helferin spielen müssen. Er hatte das als Kind nicht so recht begriffen. Erst viel später war ihm klargeworden, wie belastend das für Anna gewesen sein musste. Obwohl sie ein sehr enges Verhältnis zueinander gepflegt hatten – er liebte Anna über alles –, war sie irgendwann aus diesem Leben geflüchtet und reiste seit Jahren um die Welt. Es war ein wunder Punkt für Max, denn er vermisste sie schrecklich. Und er hatte nur noch sie. Seine Eltern waren beide tot. Er wollte nicht, dass etwas Ähnliches sich mit Sarah wiederholte. Dass sie ihn auch verlassen würde, weil sie sich wie seine Dolmetscherin und Amme vorkam.
»Hast du überhaupt Zeit?«, fragte er.
»Ich müsste mit Robert sprechen, ob er Valerie übernimmt. Wird ihm nicht gefallen, weil er seine Vernissage vorbereitet … Aber das wird schon irgendwie gehen. Wir sind ja wahrscheinlich nur für zwei Tage weg, das kann er ruhig mal machen.«