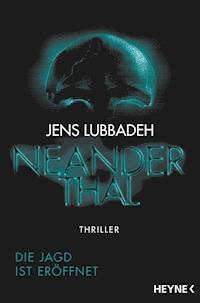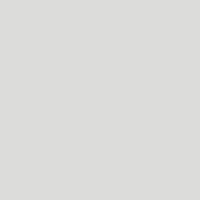
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rubikon Audioverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Diese Zukunft ist nur einen Klick entfernt
Der Traum der Menschheit vom ewigen Leben ist Wirklichkeit geworden: Dank Virtual-Reality-Implantaten können die Menschen als perfekte Kopien für immer weiterleben. Stars der Popkultur sind inzwischen wieder auferstanden und werden weltweit gefeiert – bis einer von ihnen eines Tages spurlos verschwindet. Eigentlich unmöglich! Für den Versicherungsagenten Benjamin Kari wird aus der Suche nach einem digitalen Klon ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D,as Buch
Der Tod ist überwunden, die Verstorbenen leben weiter: John F. Kennedy ist 2044 wieder Präsident der USA, Michael Jackson beherrscht die Charts und in Deutschland regiert Helmut Schmidt. In einer Welt, in der echte und virtuelle Realität längst miteinander verschmolzen sind, kann jeder ewig leben – als perfekte digitale Simulation. Bis eines Tages plötzlich Marlene Dietrich verschwindet. Der Traum der Menschen von der Unsterblichkeit, für die das letzte Hemd geopfert wurde, ist bedroht, und es kommt weltweit zu Protesten gegen den amerikanischen Hersteller Immortal. Dieser hat ganz andere Sorgen: Auf Marlene Dietrichs Klon hatten Hollywoodstudios eine hohe Summe abgeschlossen. Immortal bezichtigt die Verewigungsgegner von Thanatos, die Diva entführt zu haben. Oder handelt es sich gar um einen Mord? Als der Versicherungsangestellte Benjamin Kari den Fall aufklären soll und dafür nach Deutschland geschickt wird, entdeckt er immer mehr Hinweise auf ein inoffizielles Projekt von Immortal – und gerät ins Visier ihres größenwahnsinnigen Programmierers Reuben Mars, der, wie sich herausstellt, längst eigene Pläne verfolgt.
Der Autor
Jens Lubbadeh ist freier Journalist und hat bereits für Technology Review, Greenpeace Magazin, Spiegel Online und viele weitere Print- und Digitalmedien geschrieben. Für seine Arbeit wurde er mit dem Herbert Quandt Medienpreis ausgezeichnet. »Unsterblich« ist sein erster Roman. Jens Lubbadeh lebt in Hamburg.
Jens Lubbadeh
Unsterblich
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2016
Copyright © 2016 by Jens Lubbadeh
Copyright © 2016 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Phichai, Ink Drop)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-18072-0V002
www.diezukunft.de
Für Claudia
There’s no chance for us
It’s all decided for us
This world has only one sweet moment set aside for us
Queen, »Who wants to live forever«
Prolog
Der Regen sah aus, als würde er niemals aufhören. Noch vierzehn Minuten bis Mitternacht, dann hatte Benjamin Kari Geburtstag. Er würde ihn allein verbringen, wie schon die letzten sechs Geburtstage zuvor. Doch dieses Mal wollte er sich ein besonderes Geschenk machen: Er wollte Hannah wiedersehen. Hannah, die seit sechs Jahren tot war.
Die Regentropfen fielen auf ihn herab. Der Asphalt war vollgesogen mit der Wärme des Tages. Es roch nach feuchter Erde. Kari stand gegenüber von Hannahs Haus unter den großen alten Kastanien. Wie oft war er nachts hierhergekommen. Er war ein Gefangener der Vergangenheit. Genau wie sie.
Das Haus war ein gutbürgerlicher Bau in Echo Park, mehr als einhundert Jahre alt. Die Spitzen des Eisenzaunes, der das Haus einschloss wie ein Fort, wirkten wie die Speere von Urmenschen. Im Fort gab es nur eine Gefangene.
In Hannahs Zimmer brannte Licht. Dann erschien sie auf ihrem Balkon, aus dem Nichts. Sie hatte nicht einmal die Tür geöffnet.
Hannah sah genauso aus, wie sie kurz vor ihrem Tod ausgesehen hatte. Sie trug eine dunkelgraue Wolljacke, die ihr ein bisschen zu groß war. Ihre langen braunen Locken fielen ihr über die Schultern. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und schaute in den Himmel. Eine typische Haltung für sie.
»Hannah«, rief er.
Sie senkte den Blick und sah ihn. Ihre Arme lösten sich, aber ihr Gesicht blieb ausdruckslos.
Sie erkannte ihn nicht.
Ein Stich in seiner Brust. Er wusste, warum sie so reagierte.
Dann war sie verschwunden. Kari drehte sich um und ging.
1
Im Sommer 2044 ruhte die Vergangenheit nicht länger. Die Menschen hatten sie wiederbelebt wie einen Zombie. Der Tod war eine überwindbare Grenze geworden. Menschen konnten als virtuelle Klone wiederauferstehen. Diese Ewigen waren unsterblich.
Als Karis Bürotelefon an diesem wolkenfreien, makellosen Tag in Downtown Los Angeles zum ersten Mal klingelte, hörte er es nicht, denn er war noch nicht an seinem Platz.
Er lag immer noch auf der Couch, wo er nach seinem Ausflug letzte Nacht eingeschlafen war. Sein Kater Fellini lag am Fußende zusammengerollt. Er schreckte hoch, als das Mobiltelefon auf dem Wohnzimmertisch zu vibrieren begann. Es war auf lautlos gestellt, berührte jedoch die halbleere Thunfischdose auf dem Tisch und brachte sie zum Klappern.
Kari schlug die Augen auf. Sein Schädel brummte. Das Sonnenlicht fiel auf die leere Whiskeyflasche auf dem Tisch und blendete ihn. Die Flasche stand neben dem kleinen Buchstapel, auf dem zuoberst die Biografie einer längst vergessenen Hollywooddiva lag: »Jean Arthur – The Actress Nobody Knew«. Ein paar Tropfen Whiskey waren auf dem Buch gelandet, ein Schluck der bernsteinfarbenen Flüssigkeit befand sich noch im Glas.
Kari griff nach dem Telefon und blickte auf das Display. Es war Gibson, sein Chef. Er hatte verschlafen. »Scheiße«, murmelte er und nahm ab.
Er hoffte, Wesley würde nicht sofort hören, dass er völlig am Arsch war.
»Ben. Wo bist du?«
»Zu Hause«, sagte Kari. »Ist länger geworden, gestern.«
»Ach ja, stimmt«, sagte Gibson. »Herzlichen Glückwunsch. Hast du gefeiert?«
»Ein bisschen.«
Gibson brannte etwas auf der Seele.
»Du musst sofort reinkommen. Direkt zu mir. Es ist dringend.«
Seine Stimme klang seltsam. Diese Tonart hatte Kari noch nie zuvor bei ihm gehört. Eine Mischung aus Ernst und Besorgnis. Ungewöhnlich. Bei Fidelity war niemand besorgt. Man verkaufte Sicherheit.
»Ich komme«, sagte Kari. Aber am anderen Ende der Leitung war schon niemand mehr, der seine Worte hören konnte. Gibson hatte aufgelegt.
Kari warf das Telefon zurück auf den Tisch. Es knallte gegen die Thunfischdose. Sie fiel runter und verspritzte dabei ihren Inhalt. Das meiste landete auf dem Boden, aber etwas Fleisch und Öl waren auf sein weißes Hemd geflogen, das über der Couchlehne hing. Auf der Brust des Hemdes prangte nun ein olivfarbener Fettfleck. Nicht groß, aber sichtbar.
»Happy Birthday«, sagte er.
Fidelity residierte im dritthöchsten Gebäude von Los Angeles. In der Bevölkerung wurde es immer noch das Aeon Center genannt, obwohl Fidelity Aeon schon vor mehr als dreißig Jahren geschluckt hatte. Nun ruhte der einstige Versicherungskonzern, der in den 1920er-Jahren groß geworden war, in den Eingeweiden dieses viel mächtigeren Gebildes.
Aeon. Ein Name voller Hybris, der nach der Ewigkeit von Äonen gegriffen hatte. Es hatte nicht sein sollen. Aber der Name des Gebäudes passte, fand Kari. Das sah auch das Management so und hatte das rote Logo mit den leicht nach rechts geneigten Buchstaben absichtlich an der Spitze des schwarzen Glasphallus hängen lassen. Fidelity bewahrte jetzt Aeons Erbe – wie das von so vielen anderen auch.
Bevor er zu Gibson in den Olymp ging – so wurde die Chefetage im zweiundsechzigsten Stock genannt –, suchte Kari sein Büro auf. Er hoffte, dort noch ein Wechselhemd zu finden.
Auf dem Tisch lag die geöffnete Akte, an der er gerade arbeitete.
Ein nervtötender Fall: Es ging um die Immortalisierung des ehemaligen Managers eines Automobilkonzerns, dessen Firma Fidelity mit der Zertifizierung beauftragt hatte. Der Mann war verheiratet gewesen, mit zwei erwachsenen Kindern, aber eigentlich hatte die Familie in seinem Leben keine Rolle gespielt, wie so oft bei diesen Managertypen, dachte Kari. Es war ein Leben nur für die Arbeit. Und nach seiner Immortalisierung würde es das auch weiterhin sein. Spannend wurde es nun bei dem einzigen Makel im Leben des Managers: seiner Untreue. Er hatte seine Frau jahrzehntelang mit wechselnden Geliebten betrogen. Seine Familie wusste davon nichts und würde es auch nicht erfahren – die Daten seines Lebenstrackers wurden natürlich streng vertraulich behandelt. Und die Akte, die jetzt auf Karis Tisch lag, würden nur ganz wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Doch der Mann hatte in seinem Testament seine Firma als offiziellen Rechteinhaber seines virtuellen Klons bestimmt. Die waren jetzt über seine Seitensprünge im Bild – und not amused.
Die Firma hatte unmissverständlich den Wunsch geäußert, diesen Charakterzug bei der Immortalisierung außen vor zu lassen. Kari sollte, so lautete die Anweisung, bei der Echtheitsprüfung großzügig darüber hinwegsehen. Eigentlich unvereinbar mit den Prinzipien von Immortal und vor allem von Fidelity. Karis Firma war dafür da, die Echtheit und Authentizität eines Ewigen zu prüfen, zu zertifizieren und gegen juristische Klagen abzusichern. Aber der Konzern des Managers war eine Tochterfirma von Immortal. Und gegen Immortal ließ sich schlecht argumentieren.
Kari gingen diese Schönungen gegen den Strich, aber sie kamen vor. Er würde mit Gibson noch einmal darüber sprechen müssen. Der Fall nervte ihn. Viel lieber würde er sich voll und ganz seinem anderen Projekt widmen: der Zertifizierung von Federico Fellini, dem Regisseur, der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wunderbar skurrile Filme geschaffen hatte. Film war Karis Steckenpferd. Und wenn er an Regisseuren und Schauspielern arbeiten konnte, blühte er auf. Wirtschaftsleute fand er sterbenslangweilig.
Aber jetzt stand offenbar erst einmal Wichtigeres an.
In der Garderobe seines Büros hing kein Wechselhemd mehr. Er würde mit Fettfleck gehen müssen. Kari betrachtete sich im Spiegel. Er zupfte an der Krawatte herum, um das Schlimmste zu verbergen, aber es gelang ihm nur halbwegs. Außerdem hatte er Augenringe. Er hoffte, dass Gibson niemanden sonst zu dem Meeting geladen hatte. »Schöner Geburtstag«, sagte er zu sich selbst. Dann machte er sich auf den Weg in die Chefetage, den Olymp. Auf dem Weg zum Aufzug schnappte er sich die Zeitung.
Die New York Times machte mit den Abrüstungsverhandlungen zwischen China und den USA auf. Ein durchgestrichenes Radioaktivzeichen war das Bild, die Headline nur ein Wort: »Peace?« Und daneben irgendwas Chinesisches, das wahrscheinlich auch Frieden hieß. Kari hatte sein bisschen Schulchinesisch längst vergessen. Die Verhandlungen über die Vernichtung des kompletten Atomwaffenarsenals zogen sich seit Monaten hin. Nun war es offenbar so weit. Die Journalisten spekulierten, ob JFK und Deng Xiaoping dafür wohl den Friedensnobelpreis bekommen würden. Weitere Schlagzeilen und Nachrichten: Kein Durchbruch bei der Klimakonferenz in Reykjavik. Immortal schluckt Microsoft, oder das, was davon noch übrig war. Michael Jacksons Ranch und Hades wurde von Neverland in Foreverland umbenannt. Der virtuelle Ewige des King of Pop wolle damit ein Zeichen für die Unsterblichkeit setzen, hieß es. Dazu passte auch der Titel seines neuen Albums »Immortal«. Ein bisschen plump, die Werbung für Immortal, aber sicher ein lukrativer Deal für Jackson. Und Steve Jobs kündigte das iCar 6 an, das bei normaler Nutzung nur einmal die Woche aufgeladen werden musste. Kari gähnte.
Als sich die Aufzugtüren öffneten, blickte er direkt in das Gesicht von Vermeers »Mädchen mit dem Perlenohrgehänge«. Der zweiundsechzigste Stock war ein Museum im Kleinformat. Eines für die Werke alter Meister. Die kompletten Flurwände waren über und über von Gemälden bedeckt, eine Marotte der ersten Vorstandsvorsitzenden, die den Olymp hatten vollhängen lassen. Vermeer war gleich mehrfach vertreten. Daneben Werke von Dürer, Rubens und einigen anderen Giganten der Kunstgeschichte. Man sprach niemals darüber, ob sie echt waren. Aber Kari ging davon aus. Alles andere hätte nicht zu seiner Firma gepasst.
Die schweren, dunklen Farben, die ernsten Gesichter, all das Obst … Kari war mit anderen Bildern aufgewachsen. Seine Mutter hatte Kunstgeschichte studiert und für ihre Abschlussarbeit über Edward Hopper fast schon im Art Institute in Chicago gewohnt. Tag für Tag hatte sie dort verbracht, wochenlang. Dort hatte sie tatsächlich vor Hoppers berühmtestem Werk »Nighthawks« seinen Vater kennengelernt. Eine nette Anekdote, die seine Mutter gerne so erzählte, dass sein Vater, notorisch schüchtern, wie er war, stundenlang im Raum mit dem Bild gestanden hatte, ohne sie anzusprechen. Er hatte wohl geglaubt, sie würde ihn nicht bemerken. Nachdem das Spielchen ein paar Tage gegangen war, hatte sie sich ein Herz gefasst und ihn angesprochen. So romantisch das Ganze begonnen haben mochte – letzten Endes waren seine Eltern selbst zu den Nighthawks in dem Bild geworden: Fremde am selben Ort, die nebeneinander her lebten.
Jedenfalls hatte Karis Mutter die Wohnung immer mit Kunst vollgehängt, alter und neuer. Obwohl er nicht unbedingt ein Fan der alten Meister war, konnte er sich dem Reiz mancher Bilder hier nicht entziehen.
Eigentlich musste er sich beeilen, Gibson wartete. Aber die dunklen Augen des Mädchens mit den Perlenohrringen sahen ihn über ihre linke Schulter hinweg an. Er konnte nicht anders, als stehen zu bleiben. Kari trat auf Vermeers Gemälde zu; seine Füße machten keinen Laut auf dem zentimeterdicken Teppich. Dann blieb er dicht vor dem Porträt stehen. Dieses Gesicht schlug ihn immer wieder in seinen Bann. Er sah dem Mädchen direkt in die Augen. Ein Moment im Strom der Zeit, vor vierhundert Jahren vom Auge Jan Vermeers eingefroren – für immer, immortalisiert mit den Mitteln seiner Zeit. Er betrachtete ihren leicht geöffneten Mund. Sie sah neugierig, traurig, belustigt und ängstlich zugleich aus. Jedes Mal, wenn er das Bild sah, überwog eine andere Emotion.
Er hob seine rechte Hand und verbarg die linke Hälfte des Gesichts. Jetzt sah sie traurig und ein wenig ängstlich aus. Dann wechselte er die Seite. Nun blickte sie neugierig. Welche dieser Empfindungen hatte sie wohl wirklich gefühlt, in diesem Moment vor vierhundert Jahren? Ein Gemälde konnte nicht antworten. Es war kein digitaler Klon. Kein Ewiger.
Er ließ von dem Bild ab und ging den Flur entlang, vorbei an Dürers »Selbstbildnis im Pelzrock«, Rubens’ »Kopf eines Kindes«. Links und rechts waren Büros, die Türen standen offen. Im Vorbeigehen warf Kari einen schnellen Blick hinein. In allen saßen Mitarbeiter; ob sie selbst physisch präsent waren oder nur ihre Avatare, konnte er natürlich nicht sehen. Die Simulationen waren längst so gut, dass man den Unterschied nicht erkannte. Zumindest nicht auf den ersten Blick.
Dann stand er vor einer Tür, an der ein bronzenes Schild hing: »Wesley Gibson. Zertifizierung«. Kari klopfte. Niemand rief »Herein«. Er wartete einen Augenblick, räusperte sich kurz, schob seine Krawatte noch einmal vor den Fettfleck und trat ein.
Es würde keine Unterredung zu zweit werden – der große ovale Glastisch in der Mitte von Gibsons Büro war voll besetzt. Und wie Kari sofort sah, war der gesamte Fidelity-Vorstand anwesend. Ein unwohles Gefühl machte sich in ihm breit. Darauf war er nicht vorbereitet gewesen. Und das ausgerechnet heute, wo er aussah wie durch den Fleischwolf gedreht.
Gibson saß rechts neben dem unteren Kopfplatz. Derjenige, der dort saß, drehte sich nicht um, als Kari eintrat. Auch Gibson rührte sich nicht. Er hatte die Hände gefaltet wie ein Betender, der Mund war hinter seinen Händen verborgen. Die anderen blickten nur kurz zu Kari auf.
Gibsons Büro war groß und langgezogen. Das Panoramafenster am Ende des Raumes zeigte die Skyline von Los Angeles. Ein Meer von Skyscrapern, rechteckig, dreieckig, schräg, gewunden – wie Spielfiguren auf einem gewaltigen Schachbrett.
Gibson hatte die Jalousien herabgelassen und aufgestellt, was das Büro in ein Zwielicht tauchte. Vor dem Fenster stand sein schwerer Schreibtisch aus massivem Eichenholz, als wäre die Eiche nie gefällt worden und hätte lediglich eine andere Form angenommen. Sonst: Standard-Chef-Einrichtung. Keine alten Meister. Gibson hatte es nicht so mit Kunst, aber weil er irgendwas an die Wände hatte hängen müssen – so waren die Firmenvorschriften; »Scheiß-Corporate-Identity, Ben« –, hing dort jetzt das große gerahmte Cover der Rolling-Stones-LP »Let It Bleed«, die 1960er-Anti-Torte aus Pizza und Gummireifen, auf einem Plattenteller serviert, gekrönt von der Band als Zuckerfigürchen. Gibson hatte ein Faible für Old-School-Rock und sich dementsprechend darüber gefreut, dass die immortalisierten Stones anlässlich des 75-jährigen Erscheinens der Platte gerade auf der Let-It-Bleed-Tour unterwegs waren.
»Setz dich, Ben«, sagte Gibson. Kari nahm den einzigen freien Platz, ihm schräg gegenüber. Gibson legte normalerweise großen Wert auf eine lässige Erscheinung. Kari erinnerte er immer ein wenig an den jungen Brad Pitt, aber im Moment sah Gibson angespannt und müde aus.
Kari kannte fast alle der Anwesenden mit Namen. Auf dem Platz gegenüber saß Jeff Dalton, der mit seiner Hakennase aussah wie ein Mäusebussard und nach allem, was Kari gehört hatte, seine Mitarbeiter auch wie Mäuse behandelte. Dalton musterte ihn skeptisch, als er sich setzte. Zwischen Dalton und Gibson saß Timothy Warren, dessen Rechtsscheitel auch heute so perfekt zementiert lag wie an jedem anderen Tag. Man hätte meinen können, dass er ein Avatar war, wenn nicht Warrens Stirnfalten gewesen wären, die ein Eigenleben zu besitzen schienen und unregelmäßig zuckten. Die Avatar-Software hätte das herausgefiltert. Ein nervöser Tick, der ziemlich irritierte, wenn man versuchte, mit ihm zu sprechen. Jetzt jedoch starrte er stumpf vor sich hin. Neben Warren saß die einzige Frau, Jessica Huber, Mitte fünfzig, Typ Oberlehrerin, sehr aufrecht sitzend; wahrscheinlich achtete sie permanent auf eine akkurate Haltung. Neben Kari saß ein kleiner dicklicher Mann, der einzige, den er nicht kannte. Niemand nahm Notiz von ihm.
Und der Mann am Kopfende des Tisches, der ihm beim Eintreten den Rücken zugewandt hatte, war Robert Dabney, seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender von Fidelity. Gerade mal Mitte vierzig und eine Maschine von Mensch. Er hatte Augen wie Bergkristalle, die einen Laserzielfernrohren gleich ins Visier nahmen. Vor Dabney auf dem Tisch lag eine Akte. Seine Hände hatte er darauf abgelegt, die Finger ineinander verschränkt. Nun ruhten die Laseraugen auf Kari. Er fragte sich, ob Dabney persönlich hier war oder nur sein Avatar. Virtuell am Arbeitsplatz zu erscheinen war ein Privileg der Leitungsebene. Einfache Angestellte, die ihren Avatar ins Büro schickten, brauchten einen triftigen Grund, zum Beispiel eine Krankschreibung.
Aber offenbar gab es einen besonderen Anlass; gut möglich also, dass Dabney leibhaftig am Tisch saß. Niemand sagte etwas. Kari blickte von Gibson zu Dalton, zu Warren, zu Dabney und zurück zu Gibson.
»Es ist eine außergewöhnliche Situation eingetreten«, ergriff Gibson schließlich das Wort und blickte zu Dabney. Der ignorierte den Blick und stierte wieder auf die Akte vor sich. Dann sah Gibson zu Kari und sagte: »Marlene Dietrich ist verschwunden.«
Kari hielt die Luft an. »Wie bitte?«, fragte er.
»Wir haben es erst vor wenigen Stunden erfahren«, sagte Gibson.
Vor Karis innerem Auge erschien die schöne deutsche Schauspielerin so, wie sie sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hatte. Seltsamerweise waren es Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die er vor sich sah, obwohl er Marlene Dietrichs virtuellem Ewigen persönlich gegenüber gesessen und mit ihr gesprochen hatte. Er hatte sie zertifiziert. Ihre hohe Stirn, die halb geschlossenen Augenlider, die hohen Wangenknochen hatten sich ihm eingeprägt. Das Bild in seinem Kopf zeigte sie mit Zylinder, in einen Smoking gekleidet, und sie zog an einer Zigarette. Auf dem Bild war sie etwa dreißig Jahre alt, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ihrer ersten Karriere.
Natürlich war Marlene Dietrich seit Jahren überall in Farbe zu sehen. Sie drehte schließlich dauernd neue Filme.
Kari schüttelte den Kopf. »Das ist unmöglich. Ewige können nicht verschwinden.« Seine Stimme war eine Nuance höher als sonst, was ihn ärgerte. Ein Zeichen der Verunsicherung. Die Anwesenheit all dieser wichtigen Leute schüchterte ihn ein.
Dabney beugte sich vor, die Laser lagen erneut auf Kari. »Sie ist weg.«
Er sagte es in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
»Alles, was wir wissen, ist, dass sie vorgestern das letzte Mal gesehen wurde, in einem Restaurant in Berlin. Sie war dort mit Lars von Trier.«
»Der Regisseur?«, fragte Kari.
»Ja, natürlich der Regisseur«, sagte er genervt. »Er will offenbar einen Film mit ihr drehen, wie wir von Paramount erfahren haben. Worüber, wissen wir nicht. Immortal hat von Trier selbstverständlich kontaktiert. Er sagt, dass Dietrich sich kurz vor Mitternacht von ihm verabschiedet hat und nach Hause wollte. Aber dort ist sie nie aufgetaucht, wie die Haushälterin bestätigt hat. Sie ist einfach verschwunden. Einfach so – zack!« Dabneys Hand klatschte auf die Akte.
»Kann Immortal sie nicht orten?«, fragte Kari.
»Das haben sie natürlich versucht, Ben«, sagte Gibson. »Aber wie es aussieht, ist ihr Signal komplett ausgefallen.«
Immortal konnte zu jeder Zeit den genauen Aufenthaltsort jedes Ewigen bestimmen. Ein verschwundener Ewiger. Das hatte es noch nie gegeben.
Kari blickte auf seine gefalteten Hände – so hielt er sie immer, wenn er nicht wusste, was er mit ihnen machen sollte. Sein Blick blieb an dem Ehering an seinem linken Ringfinger hängen. Ein ungutes Gefühl breitete sich in seiner Magengegend aus.
Hannah erschien vor seinem inneren Auge. Wie sie auf dem Balkon ihres Elternhauses gestanden hatte. Digital und doch so real. Dann war sie weg. Ein anderes Bild schob sich davor. Hannahs Gesicht, die Augen geschlossen. Blut auf den Wangen. Er riss den Blick von seinem Ehering, seinen Händen.
»Wir müssen wissen, was hier los ist. Wir können uns einfach keine Peinlichkeiten erlauben«, sagte Dabney.
»Wäre ja nicht das erste Mal«, murmelte Jessica Huber.
Dabneys Kopf fuhr herum. »Wie bitte?«
Jessica Huber hielt seinem Blick nicht stand. Sie schwieg.
»Ich glaube kaum, dass man das hier mit Jagger vergleichen kann«, sagte Dabney. Er blickte sie einen Moment länger an als nötig, dann wandte er sich von ihr ab. Offenbar wollte er seiner Maßregelung durch die theatralische Pause mehr Gewicht verleihen.
In Karis Kopf rauschten die Gedanken. Vor vielen Jahren hatte ein Mick-Jagger-Hack für beträchtlichen Wirbel gesorgt. Saudische Scheichs hatten den virtuellen Ewigen des Rolling-Stone-Sängers für mehrere Konzerte engagiert. Viele Millionen Dollar Gage waren geflossen. Dumm nur, dass es sich bei Jaggers Ewigem um eine Fälschung gehandelt hatte. Das Konzert hatte privat stattfinden sollen; insofern war der Termin nicht bekannt geworden, denn andernfalls wäre er dem echten Ewigen oder den wahren Rechteinhabern aufgefallen. Dass das Ganze aufflog, war einem anwesenden Scheich zu verdanken. Ihm waren das Verhalten und die Aussagen des falschen Jagger reichlich seltsam erschienen. Nicht dass der echte Jagger zu seinen Lebzeiten und natürlich auch noch als Ewiger nicht ständig reichlich seltsames Zeug geredet hätte, aber das hatte eine neue Qualität. Ein erstes Gutachten wurde in Auftrag gegeben, und Fidelity bestätigte die vermeintliche Echtheit des falschen Jagger. Es gab Gerüchte, dass Dabney damals indirekt dafür verantwortlich gewesen sein soll. Aber Kari wusste nicht, ob das stimmte. Jedenfalls endete es sehr peinlich für Fidelity, als die Kopie aufflog. Eine fette Strafzahlung ging nach Saudi-Arabien, Immortal eliminierte den falschen Ewigen, und der Hacker wurde hart bestraft. Zum Glück wurde die Sache nie öffentlich bekannt, Fidelity kam mit einem blauen Auge davon, auch wenn die Geschäftsbeziehung zu Immortal anschließend belastet war. Aber das war lange her; Fidelitys Prüfmechanismen waren seitdem besser geworden. Fälschungen kamen nur noch sehr selten vor und waren bisher immer entdeckt worden, bevor sie publik wurden. Auch dank Kari.
Dabney richtete sich auf. Er zog die Augenbrauen zusammen, eine Spur zu früh, als dass die Geste natürlich hätte wirken können. »Ich weiß nicht, ob Ihnen allen die Brisanz dieses Falles klar ist«, sagte er. »Das hier«, er tippte mit dem Zeigefinger zweimal auf die Akte, »könnte die allererste Entführung eines Ewigen sein.«
Jetzt kam Leben in die Runde. Heftiges Gemurmel. Kopfschütteln. Nur Gibson hatte die Hände wieder verschränkt und den Mund dahinter verborgen.
Eine Ewigen-Entführung? Kari fand diesen Gedanken völlig absurd. Bei all den Sicherheitsvorkehrungen? Und wieso ausgerechnet Marlene Dietrich? Warum nicht Steve Jobs? Apple würde Unsummen für ihn bezahlen. Warum nicht den amtierenden US-Präsidenten John F. Kennedy? Er war gegenwärtig der mächtigste Ewige der Welt. Was wollte ein genialer Hacker, der Immortals Technologie austricksen konnte, mit einem Filmstar? Und warum Marlene Dietrich, wenn er Tom Cruise oder Robert de Niro haben könnte?
»Was, wenn sie tot ist?« Jessica Huber schaute mit großen Augen in die Runde. »Was, wenn diese verrückten Verewigungsgegner sie ermordet haben?«
Dabneys Mundwinkel zuckten für den Bruchteil einer Sekunde. Mehrere Stimmen erklangen gleichzeitig, Warren schüttelte den Kopf. Dalton hustete.
»Dass die Thanatiker dahinterstecken könnten, ist Spekulation, Mrs. Huber. Sonst nichts«, sagte Dabney.
»Eine Entführung anzunehmen ist genauso Spekulation«, sagte sie mit gesenkter Stimme.
Neuerliches Gemurmel.
»Was, wenn es ein Virus ist?«, fragte Warren. Seine Stirnfalten zuckten außer Rand und Band. Er war nervös.
Gibson blickte überrascht. An diese Möglichkeit hatte er anscheinend noch nicht gedacht. Es wurde lauter. Huber nickte heftig. Offenbar fand sie diese Möglichkeit plausibel. Kari schwirrte nur noch der Kopf. Er war müde und verkatert und fühlte sich seltsam entrückt, als wäre er gar nicht körperlich anwesend, als schwebte nur sein Geist über dem Tisch, wie eine Kamera, die alles beobachtete. Dieses Gefühl kannte er von seinen Avatar-Sitzungen. Verstohlen blickte er an seinem Hemd hinunter. Die Krawatte hatte sich leicht verschoben, der Fleck war sichtbar. Mist! Kari zupfte sie unauffällig zurecht.
Dabney hob die Hände. Sofort wurde es still. »Schluss jetzt. Wildes Spekulieren hilft uns nicht weiter«, sagte er. »Wir haben zu diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen, ob es sich bei dem Verschwinden von Marlene Dietrichs Ewigem um einen Angriff von außen handelt oder eine Fehlfunktion oder was auch immer. Und genau das ist unser Problem. Wir brauchen Informationen. Und wir brauchen sie schnell – bevor das Filmstudio von der Sache erfährt!«
»Ach herrje, richtig!«, sagte Dalton. »Wenn wir Paramount verlieren, werden Fox und Sony auch abspringen. Dann können wir einpacken.«
Das konnten sie dann in der Tat, dachte Kari. Diese drei Studiogiganten machten einen Großteil der Umsätze von Fidelity aus.
»Ich will, dass Sie den Fall untersuchen, Kari«, sagte Dabney.
Kari sah auf. Was hatte er da gerade gesagt?
Gibson ergriff das Wort: »Ben, du bist unser bester Mann, was Ewigen-Qualität und Ewigen-Manipulationen angeht. Und du hast damals Dietrichs Zertifizierung erstellt.«
Kari verstand gar nichts. Er hatte angenommen, dass sie seine technische Expertise einholen wollten. Sein Job waren Gutachten, Authentizitätsprüfungen, Zertifizierungen. Er war dafür da, zu beurteilen, ob ein Ewiger echt war, also seinem biologischen Vorbild entsprach. Und ob er die Standards erfüllte, die Immortal an die Ewigen stellte. Nicht mehr, nicht weniger. Und nun sollte er Detektiv spielen? Einen verschwundenen Ewigen suchen?
»Ähm, mit Verlaub, Mr. Dabney …«, setzte Kari an. »Immortal hat die Technologie erfunden, sie haben die besten Programmierer und die besten Rechner der Welt. Glauben Sie nicht, dass in diesem Moment bereits eine riesige Taskforce nach der Dietrich sucht?«
Dabney schnaubte. Er griff in seine Westentasche, holte ein frisches Päckchen Zigaretten heraus, öffnete es und fingerte eine Zigarette heraus. Zigarettenduft, echt oder virtuell, erfüllte den Raum. Dabney hielt die Zigarette nicht eingeklemmt zwischen Zeige- und Mittelfinger. Nicht so, wie Marlene Dietrich es tun würde, dachte Kari und wunderte sich über diesen Gedanken. Dabney hielt die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger, so wie Al Pacino es als Mafiaboss in »Der Pate« getan hatte.
»Immortal schweigt«, sagte Dabney. »Wie immer.« In seiner Stimme schwang Verachtung mit. Immortals Kommunikation war nicht die beste, selbst was enge Geschäftspartner anging.
»Ich glaube ja«, sagte Mäusebussard Dalton mit einem prüfenden Seitenblick zu Dabney, »dass Immortal selbst keinen blassen Schimmer hat, was los ist.«
Dabney blies eine Wolke Zigarettenrauch in die Runde.
»Es ist ziemlich egal, Dalton, was wir glauben. Sagte ich das nicht bereits?«
Dalton zuckte zusammen.
»Es zählt nur das, was wir wissen. Und wir wissen nichts.«
Dabney machte eine Pause. Dann sagte er mit leiser Stimme: »Wenn wir wissen wollen, ob Dietrich gelöscht, entführt oder in ein virtuelles Plüschtier verwandelt wurde, werden wir das bestimmt nicht von Immortal erfahren.«
Plötzlich begann er zu brüllen, so unvermittelt, dass alle zusammenzuckten: »Ich habe keine Lust, das Schicksal unserer Firma von diesen gottverdammten Arschlöchern abhängig zu machen! Schlimm genug, wenn Paramount erfährt, dass einer seiner wichtigsten Ewigen im Arsch ist. Aber haben Sie alle nur den Hauch einer Ahnung, was hier los sein wird, wenn das an die Öffentlichkeit gelangt?«
Dabneys Gesicht war knallrot.
Fidelity wäre blamiert. Aber das wäre gar nicht mal das Schlimmste. Wenn ein Superstar wie Marlene Dietrich verschwinden konnte, war kein Ewiger mehr sicher. Dann wäre der Traum vom ewigen Leben ziemlich schnell beendet. Es könnte eine Massenpanik geben.
Dabneys Zeigefinger streckte sich wie ein Gewehrlauf Kari entgegen. »Kari, setzen Sie Ihren Arsch in Bewegung und finden Sie raus, was los ist. Sofort.«
Dabney schob ihm die Akte rüber und machte Anstalten aufzustehen.
»Mr. Dabney …« Die Worte entfuhren Kari, bevor er überlegen konnte. Wahrscheinlich hätte er sonst den Mund gehalten. Stille im Raum. Dabney sah ihn ausdruckslos an. Zu spät. Er musste es nun aussprechen: »Wieso ausgerechnet ich? Ich bin dafür überhaupt nicht geeignet.«
Einen Moment lang blieb Dabneys Gesicht unbeweglich, und Kari befürchtete schon, dass er ihn gleich wieder anschreien würde. Doch dann wandelte sich der Ausdruck von Dabneys Miene, als hätte er auf einen Knopf gedrückt. Sie verzog sich zu einer Fratze. Im selben Augenblick wurde Kari klar, dass Dabney physisch anwesend war. Eine solch schräge Mimik hätte die Avatar-Korrektur niemals zugelassen. Sie war darauf programmiert, die optimale soziale Reaktion zu erzeugen, um den Avatar sympathischer wirken zu lassen. Kari brauchte einen Moment, um Dabneys Mimik zu deuten: Es war ein Grinsen. Dann sagte Dabney: »Genau deswegen. Und übrigens, Kari: herzlichen Glückwunsch.«
2
Immortal Inc., Immortalisierungsbericht,
File-Nr. 3721-050304-1222112
Dietrich, Marlene (r) Geburtstag: 27. Dezember 1901, Berlin
Dietrich, Marlene (r) Todestag: 6. Mai 1992, Paris
Dietrich, Marlene (v) Immortalisierung: 24. Juli 2036
Ort der Immortalisierung: Immortal Inc. Incubator II
(Lazarus), San Bruno, Kalifornien, USA
Alter des Ewigen: 36 Jahre
Copyright: Paramount Pictures
Hades: Koenigsallee 30, 14193 Berlin, Germany
Marlene Dietrich saß vor ihm. Sie blickte ihn aus ihren blauen Augen an, die Lider leicht gesenkt, wie es typisch für sie war. Die blonden Haare waren aus der hohen Stirn gekämmt und fielen in üppigen Locken über die Schultern. Ihr Mund gab ihrem Gesicht eine Andeutung von … leichter Belustigung? Neugier? Oder war es Langeweile? Man konnte so vieles in dieses außerordentliche Gesicht hineinlesen.
Kari war noch niemals einer so schönen Frau begegnet. Noch niemals einer, die eine solche Präsenz besaß. Er vergaß, dass er »nur« ihrem Ewigen gegenübersaß.
»Mit wem habe ich das Vergnügen?«, fragte sie ihn.
»Mein Name ist Benjamin Kari. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Frau Dietrich«, sagte er.
Er konnte kaum den Blick von ihr abwenden, so schön war sie. Und natürlich wusste sie das.
Marlene Dietrich sprach mit ihm. Ihre Stimme. Unzählige Male hatte er sie gehört, in Interviews, in Konzerten, in Filmen natürlich. Aber das waren alles Konserven gewesen. Jetzt hörte er sie wirklich sprechen. Es war eine Betörung. Optik und Audio waren bei ihr erstklassig gelungen.
»Was möchten Sie essen, Sir?«
Die Stimme der Stewardess riss ihn aus seinen Erinnerungen. Kari öffnete die Augen und sah in ein stark geschminktes Gesicht.
»Ich nehme den Fisch«, sagte er.
Kari war auf dem Weg nach Hamburg, um Lars von Trier zu treffen, der sich dort gerade aufhielt. Danach würde Kari weiter nach Berlin fahren, zu Marlene Dietrichs Hades. Zehn Stunden Flug lagen noch vor ihm. Mehr als genügend Zeit, um sich den Fall Dietrich noch einmal in Erinnerung zu rufen.
Als die Stewardess den Becher mit Wasser und Orangensaft abstellte, sah er kurz ihren Lebenstracker an ihrem rechten Handgelenk funkeln. Ein winziger Diamant, klein wie eine Linse. Erst neulich hatte er gelesen, dass bereits über 95 Prozent der US-Bevölkerung Lebenstracker trugen. Bei den Hirnchips war die Penetranz noch besser: 99,9 Prozent. Aber die waren schließlich auch gesetzlich vorgeschrieben.
Marlene Dietrich war einer der ersten wirklich prominenten Fälle in Karis Laufbahn als Zertifizierer gewesen. Acht Jahre war ihre digitale Wiederauferstehung nun her. Er ließ den Fisch abkühlen und versank wieder in Gedanken.
»Wie fühlen Sie sich, Frau Dietrich?«
»Oh, ganz fantastisch. Ich bin heute so beschwingt. So frisch.«
»Wie … neugeboren?«, sagte er und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
»Ja«, sagte sie. »Das trifft es.«
Natürlich wusste sie nicht, dass sie wirklich neu geboren war.
Kari hatte in seiner Laufbahn viele Hollywooddiven zertifiziert: Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Meryl Streep. Er war eine unangefochtene Autorität auf dem Gebiet und hatte damit sein Hobby zum Beruf gemacht. Kari war schon immer ein Liebhaber alter Filme gewesen. Und Hollywooddiven faszinierten ihn. Insbesondere Marlene Dietrich.
»Fühlen Sie sich wohl in Berlin, Frau Dietrich?«
»Ick bin nen Berliner Mädel, det wissen Se doch«, sagte die Dietrich und lachte.
Marlene, die Humorvolle. Und das trotz ihres ambivalenten Verhältnisses zu ihrer Heimat.
Ja, Marlene Dietrich war ein Berliner Mädel. 1901 war sie in eine privilegierte Familie in Berlin-Schöneberg hineingeboren worden. Dennoch konnte Kari nicht verstehen, warum Paramount Berlin als Hades gewählt hatte. Marlene Dietrich hatte Deutschland Anfang der 1930er-Jahre verlassen. Die deutsche Filmgesellschaft Ufa hatte sie nicht gewollt, trotz ihres überwältigenden Erfolgs mit dem Blauen Engel. Ihr Entdecker, der Regisseur Josef von Sternberg, hatte sie mit in die USA genommen. Dann ergriff Hitler die Macht, der Zweite Weltkrieg begann, und Dietrich reiste sogar freiwillig mit den amerikanischen Soldaten an die Front, um sie zu stärken – im Kampf gegen die Soldaten ihrer Heimat.
Marlene Dietrich war nie wieder zurückgekehrt. Warum sollte ihre Ewige nun also in Berlin wohnen? Für Kari fühlte sich das falsch an. Deutsche Diven hätten so etwas Mondänes, begründete Paramount seine Wahl. Hildegard Knef. Romy Schneider. Diane Kruger. Martina Gedeck. Das liebten die Zuschauer.
Besser hatte Paramount bezüglich des Wiederauferstehungsalters entschieden. Marlene Dietrich war als Sechsunddreißigjährige immortalisiert worden.
Die Altersfrage war eine der schwierigsten Entscheidungen bei der Immortalisierung von Personen. Schließlich würde sich der Ewige nicht mehr verändern.
Bei Prominenten war ausschlaggebend, in welchem Lebensabschnitt der Star am stärksten im kollektiven Gedächtnis verankert war. Bei manchen war das leicht zu beantworten, bei anderen nicht. Marlon Brando etwa gehörte zu den schwierigen Fällen. War der junge wilde Brando in Die Faust im Nacken ikonischer als der allmächtige Mafiapate Vito Corleone? Letztlich war es bei Stars eine ökonomische Entscheidung.
Sechsunddreißig war eine gute Wahl für eine Schauspielerin. Für die echte Marlene Dietrich war das ein schwieriges Lebensalter gewesen. Ihre Karriere hatte damals auf der Kippe gestanden. Sie hatte sich zwar mit mehreren Filmen in Hollywood etabliert, doch 1937, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, galt die »Deutsche« plötzlich als »Kassengift«. Und was tat die Dietrich, die Hitler und die Nazis immer gehasst hatte? Sie wurde Amerikanerin.
»Wie gefällt es Ihnen in den USA?«
Eine harmlose Frage am Anfang der Zertifizierung.
»Ganz ausgezeichnet«, antwortete sie. »Die Amerikaner haben einen herrlich trockenen Humor.«
Er sah auf das Display. Es bestätigte, was er auch so schon bemerkt hatte – keine Mikromimik-Ausschläge. Kari hatte bei dieser Frage auch keine erwartet. Marlene Dietrich hatte nie besonders an den USA gehangen. Aber so etwas würde sie nie öffentlich zugeben, dafür war sie viel zu höflich.
»Ich habe hier mit großartigen Regisseuren arbeiten dürfen. Mr. von Sternberg. Mr. Billy Wilder. Und natürlich Mr. Orson Welles. Er ist ein Genie.«
Marlene, die Bescheidene.
»Mit welchem Regisseur würden Sie noch gerne zusammenarbeiten?«
Sie überlegte einen Moment.
»Mit Ingmar Bergman. Ich liebe seine Filme.«
Eine absehbare Antwort.
»Wie wäre es mit Quentin Tarantino?«, fragte Kari, wohl wissend, was sie von dieser Idee halten würde.
Mikromimik Verachtung. Fünfundvierzig Millisekunden lang.
»Ich glaube, ich würde nicht in sein Konzept passen.«
Marlene, die Diplomatische.
Marlene Dietrichs Ewiger hatte natürlich ein Update bekommen, um sich in der Gegenwart zurechtzufinden. Daher wusste sie, wer Tarantino war. Seit ihrem Tod waren immerhin mehr als fünfzig Jahre vergangen.
Bei allen Ewigen von Prominenten aus der Prä-Immortalisierungszeit bestand das Problem, dass sie keinen Lebenstracker getragen hatten. Der Tracker erfasste alles, was der Mensch zeit seines Lebens getan, gesagt und gefühlt hatte, indem er sämtliche messbaren Signale analysierte und aufzeichnete: Stimme und Sprechweise, Bewegungs- und Verhaltensmuster, Herzschlag, Hautleitfähigkeit, Botenstoff- und Hormonausschüttungen. Daraus ergab sich ein ziemlich umfassendes Profil eines Menschen. Gab es Trackerdaten, war es einfach, eine automatisierte lebensechte Simulation eines Menschen zu erstellen. Sie konnte alles tun, was der Mensch auch hätte tun können. Sie war genauso intelligent, witzig, einfallsreich – oder auch nicht, je nach Persönlichkeit. Aber die Ewigen konnten nicht über das hinaus, was der Mensch gewesen war. Sie waren Computercodes. Sie reagierten immer so, wie die Algorithmen es aus dem Verhalten des jeweiligen Menschen zu Lebzeiten berechneten. Sie waren gefrorene Zeit – wie das Vermeergemälde.
Als Immortal die Technologie der Immortalisierung entwickelt hatte, waren viele Menschen skeptisch gewesen. Der Gedanke, dass sie völlig berechenbar waren, behagte vielen nicht. Was war mit dem freien Willen? Gab es den nicht mehr? Dazu noch all die datenschutzrechtlichen Fragen. Konnte Immortal wirklich versichern und sicherstellen, dass die Trackerdaten absolut vertraulich blieben?
Als die ersten Ewigen dann auftraten, waren viele schnell überzeugt. Der Drang des Menschen, etwas Bleibendes in dieser Welt zu hinterlassen, seien es Kinder, Bücher, eine Formel oder auch nur eine eingeritzte Botschaft in einem Baum oder einer Parkbank, war übermächtig. Die Aussicht, ewig zu leben, wenn auch nur digital, war für viele Menschen einfach zu verlockend gewesen. Es war ein technischer Ausweg aus dem unerträglichen Gedanken an die eigene Endlichkeit.
Zweifler blieben. Die Thanatiker hatten mit den Ewigen und Immortal nie ihren Frieden machen können.
Doch bei den Prominenten des zwanzigsten Jahrhunderts, die in der Prä-Immortalisierungszeit gelebt hatten, war die Verewigung aufwendiger. Sie mussten auf Basis des Mediamaterials rekonstruiert werden. Persönliche Komplexität ging dabei zwangsläufig verloren. Aber bei Stars und Politikern zählte ja überwiegend die öffentliche Person und weniger der Privatmensch. Meistens gab es allerdings genügend private Daten.
Zuerst mussten die Datenspezialisten von Immortal die Lage sichten: Gab es genügend Audio- und Videomaterial? Von welcher Qualität war es? Existierten biografische Dokumente, Briefe, Tagebücher, direkte Angehörige oder Personen, die den Prominenten gekannt hatten? Je mehr Daten, desto besser, weil komplexer der Code, mit dem Immortal diesen Menschen als unsterblichen virtuellen Klon simulieren würde.
Ewige, die auf Rekonstruktionen von Mediamaterial basierten, wie es bei den meisten Schauspielerinnen und Schauspielern aus der Prä-Immortalisierungszeit der Fall war, fielen natürlich schlechter als Rekonstruktionen aus Trackerdaten, aber immer noch besser als jede Hackerkopie aus, die Kari bislang gesehen hatte. Kein Hacker hatte es geschafft, Subtilität in einem Ewigen abzubilden. Deswegen war der Mikromimik-Test auch ein zuverlässiges Mittel, um Fälschungen zu entlarven.
»Hatten Sie in den USA denn nie Heimweh?«, fragte er.
Ihre Miene wurde ernst. Aber nur für einen Moment. Sie war in Gedanken versunken. Dann lächelte sie wieder.
Mikromimik Traurigkeit. Vierzig Millisekunden.
»Ach nein. Es gibt hier so wundervolle Menschen.«
»Aber Sie müssen Deutschland doch vermisst haben? Ihre Familie?«
»Im Herzen bin ich immer noch Deutsche. Ich trage meine Heimat mit mir, egal wo ich bin.«
Mikromimik Traurigkeit. Vierzig Millisekunden.
Marlene Dietrich, die Kühle.
»Fühlen Sie sich als Vaterlandsverräterin?«
Mikromimik Wut. Fünfunddreißig Millisekunden.
»Vaterlandsverräterin? Wer hat mich denn so genannt?«
»Die Deutschen.«
Mikromimik Wut. Fünfunddreißig Millisekunden. War sie sauer auf ihn? Oder war es ihre Erinnerung?
»Nein, das stimmt nicht. Das deutsche Publikum war immer großartig. Es war nur die Presse, die mir nicht wohlgesinnt war.«
Marlene, die Großmütige.
Voight-Kampff. Der Name für diesen Qualitätstest der Ewigen war anfangs ein Insiderwitz der Fidelity-Psychologen gewesen. Aber mittlerweile nannten alle ihn so. Es handelte sich um eine Anspielung auf den Film Blade Runner, ein sechzig Jahre alter Klassiker der Science-Fiction, in dem künstliche Menschen mithilfe dieses Tests entlarvt werden. Im Film werden ihnen sehr emotionale Fragen gestellt und gleichzeitig ihre Körperreaktionen gemessen. Weil den Replikanten jegliche Empathie abgeht, verraten sie sich durch die fehlenden unwillkürlichen Reaktionen.
Der Fidelity-Test funktionierte ähnlich. Mit seiner Mimik verrät ein Mensch seine Gefühle. Die Mimik kann man kontrollieren. Nicht aber Mikromimiken, unbewusste Gesichtsausdrücke, die nur Bruchteile einer Sekunde dauern und als unmittelbare Folge einer Emotion entstehen. Ruft man bei Menschen starke Emotionen hervor, zum Beispiel mit einer Erinnerung an ein bewegendes Erlebnis, zeigen sie solche Mikromimiken, bevor die bewusste Kontrolle des Gesichtsausdrucks einsetzt. Es war schwer, sie mit bloßem Auge wahrzunehmen. In der Regel nutzte man Highspeed-Spezialkameras, um sie zu analysieren. Aber Karis Auge war nach unzähligen Zertifizierungen derart geübt darin, dass er Mikromimiken erkennen konnte.
Die Mikromimik-Stärke war – neben den üblichen Merkmalen wie Intelligenz, Erinnerungen, Verhaltensmuster, Sprechweise, Stimme – ein Qualitätsmerkmal für die Ewigen. Gemessen wurde sie mit Spezialkameras; normale Kameras konnten die Ewigen nicht filmen, weil die digitalen Wesen nicht physisch präsent waren.
Und hier zeigten Ewige auch einen entscheidenden Unterschied. Bei einem Menschen veränderte sich die Stärke der Mikromimik bei jedem erneuten Aufruf der Erinnerung. Der Grund: Bei jedem Erinnerungsprozess wird die Emotion mit dem Inhalt der Erinnerung neu verknüpft. Wenn eine aufwühlende Erinnerung in einem ruhigen Umfeld abgerufen wird, schwächt sie sich ab. Oder umgekehrt. Bei Ewigen, die sich nicht mehr weiterentwickeln können, veränderte sich die Stärke der Mikromimiken beim Erinnern nicht mehr.
Kari hatte den Fisch mittlerweile aufgegessen. Jetzt nervte ihn das Brummen der Flugzeugmotoren. Fliegen war eine unnötige Schinderei geworden in einer Welt, in der Leute mit Avataren überallhin gleiten konnten, egal ob auf den Mount Everest, in den Vatikan, nach Versailles oder auf den Mond. Die Welt stand jedem offen, jederzeit.
Kari flog nicht gerne. Nicht zuletzt wegen der Leute. Diejenigen, die noch flogen, waren entweder sehr reich und taten es – gelangweilt von virtuellen Ausflügen – des Nervenkitzels wegen. Oder es waren Businesshengste, die einem Kunden oder einem Auftraggeber durch physische Präsenz Respekt erweisen wollten oder mussten. Im Avatar zur Arbeit zu erscheinen galt als unhöflich. Eigentlich idiotisch, weil es kaum einen Unterschied machte, ob man im Büro vor dem Rechner saß oder von zu Hause seinen Avatar ins Büro schickte. Avatare und Ewige sahen auch für ihre Kollegen so echt aus wie wirkliche Menschen.
Möglich machte das NeurImplant, ein Minichip, den mittlerweile so gut wie jeder in seinem Kopf trug. Er war so selbstverständlich geworden wie Kontaktlinsen. Kinder bekamen ihn in der Regel schon mit drei Jahren implantiert.
NeurImplant vermengte direkt im Gehirn die echte Realität mit der virtuellen – samt aller dazugehöriger Sinneseindrücke. Die Realität wurde mit einer digitalen Ebene vermischt. Im Gehirn entstand so ein Amalgam aus Wirklichkeit und Virtualität. Heraus kam die Blended Reality. Immortals epochales Werk.
Für die Erzeugung der Blended Reality betrieb die Firma einen enormen Aufwand: Sie musste die gesamte physische Welt in Echtzeit digitalisieren. In dieses Meer von Daten speiste Immortal dann die Avatare und Ewigen ein, ebenfalls in Echtzeit.
Um die Welt zu scannen, hatte Immortal ein weltweites Netz aus Billionen von Nanodrohnen aufgebaut, mikroskopisch kleine Scanner, die ständig überall unterwegs waren und die Erdoberfläche einlasen.
Diese Technologie hatte Immortal 2017 entwickelt, als der Megakonzern noch ein kleines Start-up gewesen war. Es war die Zeit, in der virtuelle Realität nach zahlreichen Flops in den 1990er-Jahren den lange ersehnten Durchbruch gefeiert hatte. Die ersten guten Brillen kamen damals auf den Markt: Oculus Rift, Sony Morpheus. Ihr Problem: Sie schlossen einen in der virtuellen Welt ein und sperrten einen aus der echten aus.
Erst Immortals NeurImplant hatte die Technologie alltagsfähig gemacht und es erlaubt, Avatare ins echte Leben einzubeziehen und sich mit ihnen in der Realität bewegen zu können. Immortal hatte damit eine Menge Geld verdient, denn jede Avatar-Minute kostete.
Aber die wirkliche Killerapplikation, die Immortal wenige Jahre später groß werden ließ, war die Immortalisierung von verstorbenen Menschen zu unsterblichen digitalen Klonen. Die Ewigen waren ebenfalls Teil dieser neuen Realität geworden und lebten nun zusammen mit echten Menschen und Avataren in der Blended Reality.
»Wer heute noch trauert, ist selber schuld.« Anfangs hatte dieses Werbeversprechen von Immortal für viele herzlos geklungen. Doch über die Jahre gab der Erfolg dem Konzern recht. Die Menschen wollten sich nicht mehr mit ihrem eigenen Ende abfinden. Die Technologie versprach Unsterblichkeit und sorgte dafür, dass Stars wie Marlene Dietrich bis in alle Ewigkeit Filme drehen konnten.
»Hatten Sie eine glückliche Kindheit?«
»Ich hatte eine strenge Kindheit. Ich wurde preußisch erzogen. Aber das sehe ich auch als Vorteil.«
Marlene Dietrich hatte ihren Vater bereits als Kind verloren. Ihr Stiefvater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Da war sie ein Teenager.
»Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrer Schwester?«
Zwei Mikromimiken: Überraschung und Angst. Dreißig Millisekunden jede.
»Sie irren sich, Mr. Kari. Ich habe keine Schwester.«
»Sie haben keine Schwester?«
Mikromimik Angst. Fünfzig Millisekunden.
»Nein, wie kommen Sie darauf?«
Marlene Dietrich hatte sehr wohl eine Schwester. Aber sie hatte Elisabeth nach dem Krieg systematisch verleugnet. Warum, war nicht ganz klar. Wahrscheinlich aus Angst um ihre Karriere. Die Schwester hatte neben dem Konzentrationslager Bergen-Belsen eine Kantine und ein Kino für SS-Männer betrieben. Eine Schwester, die KZ-Schergen bediente, passte nicht in das öffentliche Bild einer treuen Amerikanerin. Dennoch hatte Dietrich Elisabeth nach dem Krieg geholfen, wieder auf die Füße zu kommen.
Kari rief ein Foto auf seinem Rechner auf. Es war eine Aufnahme aus dem Jahr 1906. Darauf waren Marlene Dietrich und ihre Schwester im Kindesalter gemeinsam mit ihren Eltern zu sehen. Er zeigte ihr das Foto.
Dietrich warf einen kurzen Blick darauf.
Mikromimik Wut. Fünfzig Millisekunden.
»Sind Sie das hier rechts?«, fragte er.
»Nein.«
»Und das hier links, ist das Ihre Schwester Elisabeth?«, fragte Kari.
Mikromimik Wut. Fünfzig Millisekunden.
»Nein.«
Er hatte ihr diese Frage über mehrere Tage hinweg immer wieder gestellt. Die Mikromimik-Reaktion war in ihrer Heftigkeit gleichgeblieben. So wie er es für einen Ewigen nicht anders erwartet hatte.
Bei seinen Ewigen strebte Kari Perfektion an. Dafür wurde er, falls nötig, zum Detektiv. Er besah die Verstorbenen, sprach mit ihren Angehörigen, Freunden, Kollegen, recherchierte den Fall im Zweifel noch einmal neu.
Auftraggeber waren bei Privatpersonen üblicherweise die Hinterbliebenen. Bei öffentlichen Personen hatten Firmen oder Studios jedoch ein Mitspracherecht, so auch etwa bei seinem untreuen Firmenmanager, da dessen Firma um ihr Ansehen besorgt war. Die Rechtefrage eindeutig zu klären und gegenüber Klagen von Dritten abzusichern war ebenfalls Fidelitys Aufgabe. Gab es keine Hinterbliebenen mehr, fielen die Rechte an einem Ewigen an ehemalige Arbeitgeber; bei Künstlern konnten das auch Studios, Musiklabels oder Museen sein. Bei Politikern waren es meistens Parteien oder sogar Länder.
Im Fall von Marlene Dietrich war die Rechtslage eindeutig: Maria Riva, Dietrichs einzige Tochter, war schon lange verstorben. Rivas sieben Söhne hatten die Rechte an der Immortalisierung ihrer Großmutter versteigert. Mehrere Filmstudios hatten sich beworben. Den Zuschlag erhielt schließlich Paramount, Dietrichs altes Studio – für eine Summe von fünfzehn Milliarden Dollar. Paramount hatte sich damit alle Rechte an den Werken der virtuellen Marlene Dietrich gesichert. Es war eine ungewöhnlich hohe Summe für einen Star ihrer Epoche. Marilyn Monroes Ewiger hielt mit rund zweiundzwanzig Milliarden Dollar den Rekord bei den immortalisierten weiblichen Stars, nur übertroffen von Elvis Presley, für den Facebook achtunddreißig Milliarden bezahlt hatte. Aber selbst fünfzehn Milliarden Dollar lagen weit über dem Marktwert vieler noch lebender Hollywoodstars. Ewige hatten einen Vorteil: Sie alterten nicht.
Die Investition hatte sich für Paramount ausgezahlt. Kari hatte Dietrichs postmortale Karriere interessiert verfolgt. Ihr mit Abstand erfolgreichster kommerzieller Film war Carte Blanche gewesen, ein Teil der James-Bond-Reihe, in dem sie an der Seite von Sean Connery spielte – und mit ihm gegen Bösewicht Klaus Kinski kämpfte. Es war der erfolgreichste Bond aller Zeiten. Aber auch als Charakterdarstellerin in Filmen von Tom Tykwer, Woody Allen und Stanley Kubrick hatte Marlene Dietrich an die Klassiker ihrer ersten Karriere anknüpfen können.
»Was haben Sie getan, nachdem Sie Ihren letzten Film gedreht hatten?«
»Oh, Sie meinen dieses furchtbare Werk …«
Mikromimik Verachtung. Fünfunddreißig Millisekunden.
»Schöner Gigolo, armer Gigolo, ja«, sagte Kari.
»Ich hätte ihn niemals drehen dürfen! Ein fürchterlicher Film.«
Mikromimik Verachtung. Fünfunddreißig Millisekunden.
»Warum haben Sie ihn gemacht?«, fragte Kari.
»Ich brauchte das Geld. Und die Konditionen waren gut.«
»Und Sie konnten in Paris bleiben.«
»Ja, das war praktisch«, sagte Dietrich.
»Sie haben Ihr Pariser Apartment dann jahrelang nicht mehr verlassen«, sagte Kari.
»Ich war immer ein häuslicher Mensch. Ich brauchte meine Ruhe.«
»Sie haben sich bis zu Ihrem Tod in Ihrem Pariser Apartment eingesperrt, Frau Dietrich. Das ist nicht normal.«
Keine Mikromimik.
»Mein lieber Mr. Kari. Wovon reden Sie? Ich bin quicklebendig.«
Die Sperre funktionierte.
Die Ewigen besaßen kein Bewusstsein. Sie hielten sich für den lebenden Menschen. Dass sie niemanden berühren konnten und niemand sie, hinterfragten sie nicht. Genauso wenig wie ihre gesamte Existenz, das Leben, den Tod. Es war ihnen unmöglich, über ihren eigenen Tod nachzudenken, eine einprogrammierte Sperre verhinderte das. Alles, was mit dem Tod des Originalmenschen zu tun hatte, war bei dem Ewigen ausgeblendet. Bei Marlene Dietrich betraf diese Sperre ihre späten Jahre in Paris. Die Diva war im hohen Alter schwierig geworden und laut psychologischem Gutachten höchstwahrscheinlich schwer depressiv gewesen. Sie hatte sich in den letzten vierzehn Jahren ihres Lebens in ihr Pariser Apartment zurückgezogen und niemanden mehr empfangen. Nur per Telefon hatte sie noch mit der Außenwelt kommuniziert. All das war bei ihrem Ewigen herausgestrichen worden.
Kari dachte an Hannahs Ewigen. Wie sie ihn nicht erkannt hatte, als er gestern Nacht vor ihrem Haus gestanden hatte. Bei Hannah fiel er unter den Bann ihrer Sperre. Er war Teil ihres Todes.
Während er das dachte, rieb er mit der rechten Hand über sein linkes Handgelenk. Der kleine Diamant darin kratzte leicht über die Haut seiner Fingerkuppen.
3
Hamburg lag noch im Sonnenschein, als sein Flieger zur Landung ansetzte. Die Wasseroberfläche der Alster reflektierte die Sonnenstrahlen so hell, dass sie aussah wie eine riesige Hand aus Quecksilber, die nach dem Land griff.
Kari war müde. Verdammter Jetlag. Fliegen war so sinnlos.
Es war früher Abend, als er seinen Koffer vom Gepäckband zog und nach draußen schob. Glücklicherweise bekam er sofort ein Taxi. Der Fahrer sprach kaum Englisch. Er war türkischer Abstammung. »Ercan Yilmaz« stand auf seinem Dienstausweis, der unter dem Rückspiegel hing. Das Foto war verblichen. Im Radio lief die neue Single der Beatles, ein poppiges Stück mit dem Titel »Walrus Blues«.
»Where you want to go?«, fragte der Fahrer. Sein Blick war leer. Es war das Gesicht eines Mannes, der schon seit Jahren nicht mehr genügend Schlaf bekommen hatte.
»Dorinth-Hotel, Otzenstraße«, sagte Kari. Beim »tz« von Otzen stockte er kurz ob der ungewohnten Konsonantenfolge, aber der Fahrer verstand ihn sofort. Er nickte und fuhr los.
Es war ein kleines Hotel in einem ruhigen Teil des berühmten Vergnügungsviertels St. Pauli. Die Fahrt über blickte Kari durch das Fenster. Überall hingen Plakate von Politikern. Er erkannte Helmut Schmidt und seinen Herausforderer Helmut Kohl. In wenigen Tagen standen Wahlen in Deutschland an. Er hatte im Flugzeug Zeitung gelesen. Demzufolge war mit einer Überraschung nicht zu rechnen. Alles sah danach aus, dass Helmut Schmidt zum sechsten Mal in Folge zum Bundeskanzler gewählt werden würde. Dann wäre er mit achtundzwanzig Jahren Regierungszeit – inklusive seiner biologischen Amtszeit – der am längsten amtierende deutsche Regierungschef aller Zeiten.
Je weiter sie in die Innenstadt von Hamburg kamen, desto mehr Portale sah er, aus denen sich der unvermeidliche Strom von Avataren ergoss.
Er war noch nie in Hamburg gewesen. Deutschland kannte er von ein paar Besuchen, überwiegend Berlin und München, wo er Recherchen über deutsche Regisseure oder Schauspieler angestellt hatte. Es waren einige große dabei gewesen, auf die er stolz war: Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Werner Herzog, Klaus Kinski, Martina Gedeck. Er hatte bei diesen Gelegenheiten etwas Deutsch gelernt.
»Business?«, fragte der Fahrer und schaute Kari im Rückspiegel in die Augen. »Oder privat?« Er grinste. Seine Zähne hatten das Innere einer Zahnarztpraxis seit bestimmt fünfzehn Jahren nicht gesehen, schätzte Kari. Mindestens.
»Business«, antwortete er.
»Business, business«, wiederholte Yilmaz. »In Sankt Pauli we all have business.« Er lachte kurz und hart. »Special business.« Ha ha ha.
Kari strengte ein Lächeln an. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Eigentlich verspürte er keine große Lust auf eine Unterhaltung, aber er fragte dennoch aus Höflichkeit in holprigem Deutsch: »Wie lange Sie leben schon hier?«
Ercan Yilmaz schaute erneut kurz in den Rückspiegel, prüfend.
»Born here. Hamburg home«, sagte er und klopfte sich mit der rechten Hand zweimal auf die Brust. »Home. Zuhause. Für immer.«
Er grinste und tippte mit dem linken Mittelfinger auf den Lebenstracker an seiner rechten Hand. »Work much«, sagte Yilmaz. Er blies die Backen auf und presste die Luft durch den Mund. »Work, work. Immortalisierung teuer.«
»Life-Contract?«, fragte Kari.
Yilmaz blickte ihn im Rückspiegel an und nickte. »For my kids.«
Das war das Rundum-sorglos-Paket. Jemand wie Yilmaz würde sich die Immortalisierung normalerweise niemals leisten können. Aber Immortal hatte für einkommensschwache Leute das Eternal-Life-Paket im Programm. Man verpflichtete sich, alle überschüssigen Einnahmen an Immortal abzutreten, natürlich abzüglich der Mindesthaltungskosten, Miete, Essen, Unterhalt der Kinder. Alles darüber hinaus wanderte an Immortal. Bis zum Tod. Dafür bekam man den Tracker und die Garantie auf das ewige digitale Leben. Im Gegenzug erhielt der Konzern das Recht, die Trackerdaten für Forschungszwecke zu nutzen und an Marketingfirmen zu verkaufen – und so einiges anderes, was im seitenlangen Kleingedruckten verborgen war und niemand genau wusste.
Das war der Preis für die Unsterblichkeit des kleinen Mannes.
Zuhause. Er dachte an Los Angeles. Die Stadt, in der er geboren war, und ja, für einen Moment fühlte er das Gefühl von Heimat in seiner Brust, ungefähr dort, wohin sich Yilmaz eben unwillkürlich geklopft hatte. Eine Szene aus Kindertagen stieg auf, ein Eichhörnchen, umringt von Nüssen. Er hielt ihm eine Nuss hin, und das Eichhörnchen fixierte ihn. Er fühlte die Spannung, ob das Tier die Nuss nehmen würde. Es nahm sie, und er freute sich. Es war eine seiner frühesten Erinnerungen. Die Szene musste sich im Griffith Park zugetragen haben, diesem Urwald von Park, den er so liebte, schon als Kind.
Mittlerweile lebte Kari in einem der ältesten und berühmtesten Häuser der Stadt, dem Bradbury Building. Es hatte in zahlreichen Filmen als Kulisse gedient; einer der bekanntesten davon war Blade Runner. Was für ein Zufall, hatte er gedacht, als er in diesem Gebäude über gute Beziehungen eine Wohnung ergattert hatte. Er führte regelmäßig einen Test durch, der nach einem Test in diesem Film benannt war. Und dann wohnte er auch noch an einem Ort aus ebendiesem Film. Manchmal fragte er sich, ob es überhaupt noch eine Grenze zwischen Schein und Sein gab.
Kari dachte an seine Wohnung im dritten Stock, in dem Fellini jetzt allein herumstreunerte, aber seine Nachbarin würde auf ihn aufpassen und ihn füttern. Er dachte an den Aufzug, der wie ein wunderschöner Vogelkäfig Menschen emporhob und fallen ließ und mit dem auch die Replikanten im Film hochgefahren waren – um schließlich auf dem Dach des Hauses ihr auf vier Jahre limitiertes Leben zu beenden.
Sein Hotelzimmer war nichts Besonderes, aber gemütlicher als viele andere Hotels, die er bewohnt hatte. Durch das echte Fenster hatte er einen guten Blick auf St. Pauli. Bäume überall. Wie grün Hamburg war, ganz anders als Los Angeles. Keine Skyscraper, die wie außerirdische Wächter über die Stadt und ihre Bewohner schauten. Stattdessen nette Altbauten aus der vorletzten Jahrhundertwende, in denen Generationen von Menschen gelebt hatten und deren Atem über die Wände gestrichen war. Von seinem Fenster konnte er auf eine alte, von Bäumen umringte Kirche aus rotem Backstein blicken. Die Spitze ihres Turms stach aus dem Miniwäldchen heraus wie eine Antenne, bereit, von Gott persönlich Instruktionen zu empfangen. Daran hing ein riesiges weißes Plakat. In großen schwarzen Buchstaben stand darauf: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben«, Johannes 6,47.
Nein, die Kirche hatte es nicht leicht in Zeiten, in denen das ewige Leben eine Aufgabe von Programmierern geworden war.
Der Friedhof Ohlsdorf lag etwa eine halbe Autostunde von seinem Hotel entfernt. Auf einem Flyer hatte Kari gelesen, dass er einer der größten Friedhöfe der Welt war. Das würde er auch bleiben, denn auf Friedhöfen ließen sich eigentlich nur noch Leute begraben, die sich eine Immortalisierung nicht leisten konnten oder sie aus irgendwelchen Gründen nicht wollten. Die sterblichen Überreste aller anderen wurden kompostiert und recycelt. Die Essenz des Menschen lebte als Programmcode weiter. Vielleicht sogar die Seele … Wer wusste das schon.
Das Taxi hielt vor dem Friedhofseingang, einem riesigen schmiedeeisernen Tor. Man konnte mit dem Auto durch den Friedhof fahren, so groß war er. Sonnenlicht blendete seine übermüdeten Augen, als Kari ausstieg.
Er liebte Friedhöfe. Umso erfreuter war er gewesen, dass Lars von Trier sich hier mit ihm treffen wollte. Kari war in der Nähe des berühmten Forest Lawn Memorial Park aufgewachsen, im behüteten Stadtteil Glendale. Zahlreiche Prominente lagen dort: Michael Jackson, Humphrey Bogart, Walt Disney, Clark Gable, Sammy Davis Jr. Neben »Normalsterblichen« natürlich, darunter seine Großeltern, weswegen er als Kind dort viel Zeit zugebracht hatte. Er erinnerte sich an die Hand seiner Mutter, die mit ihm über die saftigen Wiesen stapfte. An die vielen Engelsstatuen. Die Fixierung auf Friedhöfe war geblieben. Als Schüler hatte er sich mit seinen Klassenkameraden eine Zeit lang nachts auf dem Cavalry Cemetery in Los Angeles getroffen, weil Forest Lawn zu streng bewacht war. Der Cavalry Cemetery war ein schöner alter katholischer Friedhof am Whittier Boulevard. Engel unter Palmen und Bäumen. Dort waren sie über den eisernen Zaun geklettert, auf der Suche nach Verbotenem. Nach Abenteuer. Er, Hannah und noch ein paar Schulfreunde.
Und dort hatten sie dann stundenlang gesessen, immer bei Vollmond. Es war ihr Ritual geworden. Im Mondschein zwischen Grabsteinen zu sitzen, die über einhundert Jahre alt waren. Sie hatten die Flasche kreisen lassen. Jack Daniel’s, Southern Comfort, Wodka – was auch immer irgendjemand organisieren konnte als Minderjähriger in Amerika. Sie hatten Schluck für Schluck getrunken, still, verbunden. Manche hatten sich gegruselt, vor allem die Mädchen, was den Jungen gefiel, weil sie sich als stark und furchtlos präsentierten konnten.
Kari musste lächeln, als er jetzt am Eingang von Ohlsdorf an diese kühlen Friedhofsnächte zurückdachte. Es war ein schönes Ritual gewesen, er musste etwa vierzehn gewesen sein damals. Sie hatten noch keinen Gedanken an die Unsterblichkeit verschwendet, während sie den scharfen Alkohol auf der Schleimhaut spürten, so scharf, dass ihm oft ein feiner Flüssigkeitsfaden aus dem rechten Mundwinkel entkam und sein Kinn hinabrann. Es war ihm peinlich gewesen, aber es merkte natürlich niemand in der Dunkelheit.
Hannah hatte es vielleicht gesehen. Er hatte manchmal ihre Blicke aufgefangen, wenn er glaubte, dass ihn niemand beobachten würde, während er sich unauffällig den Alkohol aus dem Mundwinkel wischte. Sie hatte so eine Angewohnheit, einen immer etwas zu lange anzuschauen. So lange, dass es unangenehm werden konnte. Sie wusste das auch, aber sie hatte ihm mal erklärt, dass sie nichts dagegen tun könne. »Gesichter sind wie Hypnose für mich«, hatte Hannah gesagt. »Kennst du das nicht? Wenn deine Augen müde sind und man seinen Blick in etwas hineinbohrt. Bis man anfängt zu schielen.« Sie verdrehte die Augen so sehr, dass sie richtig kräftig schielte. Dann hatte sie gelacht, und er hatte auch gelacht. Lange her. Komisch, er hatte sie nie gefragt, ob sie ihn dabei erwischt hatte, wie er beim Trinken gesabbert hatte. Und jetzt konnte er sie nicht mehr fragen.
Sie hatten einfach nur auf den Mond geschaut. Das Mondlicht auf Hannahs Gesicht, das Licht auf dem feuchten Gras, auf dem sie saßen, während unter ihnen begraben die abgenagten, bleichen, alten Knochen ruhten und noch ein wenig älter wurden.
Ohlsdorf wirkte auf Kari eher wie ein Park. Es war nicht viel los. Eine Schulklasse stieg aus einem Bus und strömte langsam auf den Eingang zu. Kari sah außerdem ein paar Mütter mit Kinderwägen, einige alte Leute und vor allem Touristen mit Rucksäcken. Und einige Avatare, die aus einem nahe gelegenen Portal Richtung Eingangstor plätscherten. Es war früh, erst kurz nach neun. Der Friedhof hatte gerade erst seine Pforten geöffnet. Der Besucherandrang würde noch kommen. Friedhöfe waren beliebte Touristenattraktionen geworden in einer Welt, in der es keinen endgültigen Tod mehr gab.
Er ging ein paar Schritte geradeaus, an den obligatorischen Imbissbuden vorbei, die aber noch geschlossen hatten. Irgendwo hier am Eingang musste es sein. Er blickte sich um, lief ein paar Schritte nach rechts und sah dann zu seiner Linken einen schmalen Kiesweg, an den Seiten von penibel gestutzten Heckenbüschen gesäumt. Sie sahen aus wie grüne Schokoküsse. Es musste die Allee sein, die er suchte.
Es fühlte sich dezent festlich an, die Allee hinunterzulaufen. Er ging an mehreren Gedenksteinen mit Inschriften vorbei. Am Ende der Allee führte eine Treppe hinauf zu einem Rondell, in dessen Mitte eine lebensgroße Jesusfigur stand. Sie hielt den rechten Arm himmelwärts gestreckt, die linke Hand lag auf der Brust. Dieser Jesus hatte nichts gemein mit dem jämmerlich blutenden, ausgehungerten Halbtoten am Kreuz, den er in Kirchen hatte hängen sehen. Dieser Jesus sah aus wie ein Staatsmann der griechischen Antike, der Menschenmassen vor und Legionen hinter sich hatte.
Eine Kerze in einem roten Plastikbecher brannte am Sockel der Jesusfigur. Also gab es sie noch, die Gläubigen. Auch wenn sie immer weniger wurden und die Kunden von Immortal immer mehr.
»Guten Tag, Mr. Kari«, sagte jemand auf Englisch. Kari fuhr herum. Die Stimme war von rechts gekommen. Auf einem kleinen Grashügel neben dem Rondell stand eine Bank. Darauf saß ein betagter Mann.
Kari erkannte ihn nicht sofort, aber als er ein paar Schritte näher an ihn herangetreten war, identifizierte er die runden Gesichtszüge eines gealterten Lars von Trier.