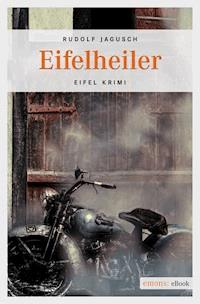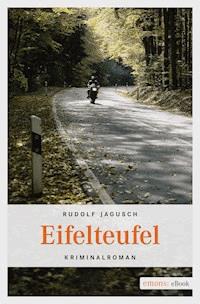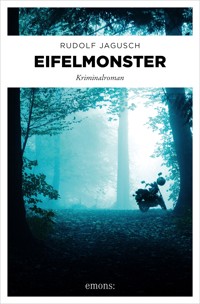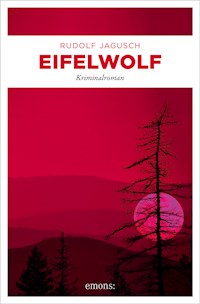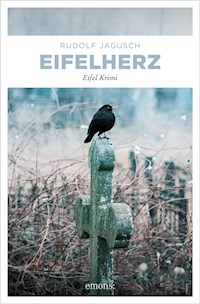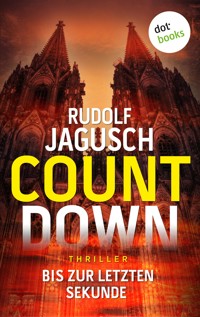Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Stephan Tries
- Sprache: Deutsch
Die im Dunkeln sieht man nicht: Der Kriminalroman "Nebelspur" von Rudolf Jagusch jetzt als eBook bei dotbooks. Hauptkommissar Stephan Tries vom KK11 Köln traut seinen Augen nicht: Er hat beim Renovieren das Tagebuch seiner vermissten Schwester gefunden. Unter einer Bodendiele versteckt lag es jahrelang im Staub. Als Natalie vor zwanzig Jahren plötzlich verschwand, hieß es, sie sei abgehauen. Aber schon als Teenager ahnte Tries, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Sein Verdacht bestätigt sich – denn was in dem schmalen Heft steht, ist brisant. Wurde seine Schwester das Opfer einer Intrige? Tries beginnt auf eigene Faust zu ermitteln – und stößt in der kleinen Dorfgemeinschaft schnell auf eine Mauer aus Schweigen. Bald wird ihm klar: Das Geheimnis, in das seine Schwester vor vielen Jahren verwickelt wurde, hat heute noch tödliche Konsequenzen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Nebelspur" von Rudolf Jagusch. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Hauptkommissar Stephan Tries vom KK11 Köln traut seinen Augen nicht: Er hat beim Renovieren das Tagebuch seiner vermissten Schwester gefunden. Unter einer Bodendiele versteckt lag es jahrelang im Staub. Als Natalie vor zwanzig Jahren plötzlich verschwand, hieß es, sie sei abgehauen. Aber schon als Teenager ahnte Tries, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Sein Verdacht bestätigt sich – denn was in dem schmalen Heft steht, ist brisant. Wurde seine Schwester das Opfer einer Intrige? Tries beginnt auf eigene Faust zu ermitteln – und stößt in der kleinen Dorfgemeinschaft schnell auf eine Mauer aus Schweigen. Bald wird ihm klar: Das Geheimnis, in das seine Schwester vor vielen Jahren verwickelt wurde, hat heute noch tödliche Konsequenzen …
Über den Autor:
Rudolf Jagusch wurde 1967 in Bergisch Gladbach geboren. Seit der studierte Verwaltungswirt 2006 seinen ersten Roman veröffentlichte, ist er eine feste Größe in der deutschen Krimi-Landschaft. Er lebt mit seiner Familie im Vorgebirge am Rand der Eifel, wo auch die meisten seiner Romane spielen.
Die Website des Autors: www.rudijagusch.com
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/rudi_jagusch
Rudolf Jagusch veröffentlicht bei dotbooks seine Ermittlerkrimis um den Kölner Hauptkommissar Stephan Tries:
»Grabesruhe«
»Nebelspur«
»Todesquelle«
Außerdem bei dotbooks erschienen sind seine Thriller »Bis zur letzten Sekunde« und »Mordsommer«.
***
eBook-Neuausgabe September 2017, Januar 2023
Copyright © der Originalausgabe 2009 Hermann-Josef Emons Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/iLight photo, Desnis Belitsky, FotoDuets
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96148-037-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Nebelspur« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rudolf Jagusch
Nebelspur
Kriminalroman
dotbooks.
Für meine Familie
Dana, Timo und Susanne
KAPITEL EINS
Stephan Tries schob die torta al cioccolato in den vorgewärmten Ofen. Für den Nachmittag hatte er seine Freundin Charlotte von Berg zum Kaffee eingeladen. Sie liebte seinen Schokoladenkuchen, und er freute sich darauf, sie damit zu überraschen.
Er spülte ab, ließ sich Zeit. Im Obergeschoss musste er noch eine Holzverkleidung anbringen. Das alte Haus war eine ewige Baustelle. Anfang des Jahres hatte er eine Auszeit von seiner Polizeiarbeit genommen und war hierher nach Sechtem in das alte Bauernhaus seiner verstorbenen Eltern in der Ophofstraße gezogen. Seitdem kam er aus den Renovierungsarbeiten nicht mehr heraus. Er verspürte keine große Lust, sich der Arbeit anzunehmen. Zwar besaß er nicht gerade zwei linke Hände, und das, was er anpackte, sah im Ergebnis annehmbar aus. Doch Spaß machte ihm das Heimwerken nicht.
Er hörte die Elf-Uhr-Nachrichten von Radio Bonn/Rhein-Sieg, trocknete sich dabei gemütlich die Hände an einem Geschirrtuch ab. Der Nachrichtensprecher berichtete über einen Einbruch in der Sparkassenfiliale in Bornheim. Stephan schüttelte den Kopf und murmelte: »Die werden immer dreister. Keine fünfzig Meter von der Polizeiwache entfernt. Wie abgebrüht ist das denn?« Er beneidete seine grün-weißen Kollegen nicht. Man musste kein Prophet sein, um die kommenden Schlagzeilen in der Lokalpresse zu erraten. Als die Verkehrsstaus durchgegeben wurden, schaltete er das Radio ab. Die Uhr am Backofen zeigte ihm, dass der Kuchen noch zwanzig Minuten benötigte, dann würde er außen knusprig und innen weich sein. Genau richtig, um jemanden damit zu verwöhnen.
Stephan seufzte. Länger konnte er guten Gewissens die Arbeit nicht mehr hinausschieben. Es wurde auch langsam Zeit, seine Tochter Christine aus dem Bett zu schmeißen. Christine wohnte seit einiger Zeit bei ihm und führte ein Lotterleben. Schon mehrmals waren sie deshalb aneinandergeraten. Doch so sehr er auch mit Engelszungen auf sie einredete, sich endlich um eine Ausbildung oder eine Arbeit zu kümmern, Christine schien das nicht zu beeindrucken. Sie lebte in den Tag hinein und genoss jede freie Minute.
Stephan zupfte noch mal die Geschirrhandtücher ordentlich auf die Halter, als er ein Auto auf seinen Hof fahren hörte. Er blickte auf und sah hinaus. Charlotte von Bergs silberner Mazda MX 5 kam gerade mit quietschenden Reifen zum Stehen.
»Nanu?«, murmelte Stephan, ging in den Flur und öffnete die Haustür.
Charlotte stürmte heran, ihre langen roten Haare trug sie heute offen. Der leichte Wind wirbelte sie zur Seite und verlieh ihr das Aussehen der Venus von Sandro Botticelli – nur dass Charlotte einen aufregend engen Hosenanzug trug. Seit einem halben Jahr waren sie ein Paar, und jedes Mal, wenn Stephan sie so sah, wusste er auch warum. Ihr Aussehen und ihre Eleganz raubten ihm mitunter den Atem. Sie gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und lief weiter in die Küche.
»Ist was passiert?«, fragte Stephan.
»Kann man wohl sagen.« Sie stellte ihre Handtasche auf den Tisch und fingerte mit zitternden Fingern einen beigefarbenen Umschlag hervor. »Den habe ich eben in der Post gefunden.« Sie strich eine Haarsträhne hinter ihr Ohr und hielt den Umschlag auffordernd in Stephans Richtung.
Stephan nahm ihn, öffnete ihn und las den Brief, der darin steckte.
Du alte Schlampe! Schäm dich! Er könnte dein Sohn sein! Lass ihn sausen, sonst passiert was!
Stephan zog die Augenbrauen nach oben. Er wendete den Umschlag, fand nur Charlottes Adresse. »Kein Absender«, stellte er fest.
»Es ist ja auch ein Drohbrief«, höhnte Charlotte. Sie zündete ein Zigarillo an und inhalierte tief. Dann setzte sie sich auf die Eckbank.
Stephan mochte es nicht, wenn in seinem Haus geraucht wurde. Doch da Charlotte nur dann rauchte, wenn sie sehr aufgeregt war, ließ er sie ausnahmsweise gewähren. Es würde ihr helfen, sich ein wenig zu entspannen. Er setzte sich zu ihr, griff ihre freie Hand und drückte sie. »Schau. Wir wussten von vornherein, dass unsere Beziehung hier in dem konservativ geprägten Dorf auf Ablehnung stoßen würde. Du als Witwe, ich geschieden, der Altersunterschied, die wilde Ehe.« Stephan lächelte. »Also nimm das nicht zu ernst.«
Charlotte blickte ihn an. »Dass ich beim Kirchgang von einigen geschnitten werde, daran habe ich mich gewöhnt. Aber so etwas …« Sie hob den Drohbrief an und ließ ihn auf den Tisch zurückflattern. »So etwas macht mir Angst.«
»Was ist denn hier los?« Christine kam herein. Ihr Nachthemd hing an ihr herab wie ein Bettlaken an einem Kleiderständer.
Viel zu dünn, dachte Stephan. Ein Thema, das hier im Haus regelmäßig zum Streit führte. »Charlotte hat einen Drohbrief erhalten«, informierte er seine Tochter.
Christines Augen blitzten beeindruckt. »Cool«, kommentierte sie. Sie goss sich einen grünen Tee auf und knabberte an einem Knäckebrot.
»Ist auch noch geräucherter Schinken da«, sagte Stephan. Christine runzelte die Stirn, sah ihn böse an. Stephans Fürsorge kam bei ihr offensichtlich nicht an.
»Was ist denn daran cool?«, fragte Charlotte und paffte an ihrem Zigarillo.
Christine hörte auf zu kauen, kam heran und nahm sich den Brief. Dabei wedelte sie einige Male damit in der Luft herum, um den Zigarillorauch zu verteilen. Sie hüstelte übertrieben. »Früh am Morgen schon vergiftet werden«, sagte sie und las. »Na ja«, kommentierte Christine und kaute weiter an ihrem Knäckebrot.
»Na ja?«, hakte Charlotte nach. »Das ist alles, was du dazu zu sagen hast?«
»Die Drohung ist ja nicht besonders konkret«, stellte Christine fest. Sie entsorgte den Teebeutel in der Spüle. »Ach, Charlotte, mach dich doch nicht verrückt«, tröstete sie. »›Sonst passiert was‹ ist doch wirklich eine blöde Drohung, oder? Derjenige, der das geschrieben hat, weiß offensichtlich nicht, womit er drohen soll.«
»Kann ja noch kommen«, sagte Charlotte.
Stephan hörte heraus, dass ihre Stimme weicher geworden war. »Ja«, stimmte er zu. »Aber bis dahin sollten wir das nicht überbewerten. Ich schlage vor, wir warten ab.«
Charlotte zögerte, sah erst Christine an, dann Stephan und überflog noch mal den Brief. »Ein Dummejungenstreich also?«
Die beiden nickten synchron.
»Einverstanden. Wir warten ab.« Charlotte drückte ihren Zigarillo aus und stand auf. »Riecht köstlich«, sagte sie und sah in den Backofen. Stephan stellte sich hinter sie und legte die Arme um ihre Hüfte. »Für nachher«, flüsterte er ihr ins Ohr.
»Oh, oh«, stieß Christine amüsiert hervor. »Ich lass euch Turteltauben besser allein.« Sie kicherte.
Charlotte löste sich aus Stephans Umarmung. »Kannst ruhig bleiben. Ich muss mit meiner Mutter zu einer kleinen Familienfeier. Ihre Cousine wird neunzig und hat uns zum Mittagessen eingeladen. Das kann ich nicht verschieben.«
»An mir soll es aber nicht liegen«, sagte Christine. »Ich bin eh verabredet und in zehn Minuten raus.«
»Du hast doch noch gar nicht richtig …« Gefrühstückt, wollte Stephan sagen, doch er verkniff sich in allerletzter Sekunde das Wort. Christine reagierte auf solche Feststellungen allergisch, und er wollte jetzt keine schlechte Stimmung im Haus.
Christine warf ihm einen bösen Blick zu und lächelte dann Charlotte an. »Mach’s gut. Ich mach mich jetzt frisch und bin dann weg. Ciao.« Sie flog hinaus wie ein zu dünn geratenes Gespenst.
»Der Kuchen kann noch ein paar Minuten«, bemerkte Charlotte. »Gib ihm zehn Minuten mehr als im Rezept angegeben. Ich mag ihn ein wenig brauner.«
Sie küsste Stephan zum Abschied.
Er brachte sie hinaus und winkte ihr nach, bis sie die Einfahrt verlassen hatte.
Christine rannte an ihm vorbei. »Oh, Mist. Sie hätte mich mit zum Bahnhof nehmen können«, fluchte sie.
»Soll ich dich fahren?«, rief Stephan ihr hinterher.
Sie winkte ab. »Du wolltest doch noch renovieren. Mach da lieber weiter. Mein Zimmer sieht ja immer noch aus wie eine Baustelle.« Sie lachte und rannte vom Hof, ohne sich noch mal umzudrehen.
Stephan schloss die Haustür. Seufzend sah er zur Treppe. Jetzt konnte er die unliebsame Tätigkeit wohl nicht mehr weiter hinausschieben. Irgendwann musste er ja schließlich damit fertig werden.
Er ging nach oben in das Zimmer seiner Tochter Christine. Sie nahm die obere Etage in Beschlag wie eine ganze Einsatzstaffel. Es gab kaum eine Stelle, an der sie nicht mindestens ein Kleidungsstück, eine Tasche oder ein Buch achtlos hatte liegen lassen. Stephan regte sich nicht mehr darüber auf. Er hatte sich daran gewöhnt und ignorierte die Unordnung. Seit seinem Aufenthalt im Krankenhaus sah er vieles gelassener. Er setzte sich auf die Bettkante. Wie immer, wenn er dieses Zimmer betrat, hatte er ein mulmiges Gefühl in seiner Magengrube und seine Kehle schnürte sich zu. Es war Natalies Zimmer gewesen, das Christine jetzt bewohnte. Natalie, seine Schwester, war vor über zwanzig Jahren verschwunden. Da es keine Anzeichen für ein Verbrechen gegeben hatte, lag es nahe, dass Natalie abgehauen war.
Stephan dachte an seinen jähzornigen Vater, der ihnen oft das Leben zur Hölle gemacht hatte. Der Streit mit ihm kurz nach Natalies Verschwinden kam ihm in den Sinn. Er hatte einige Tage Sonderurlaub bekommen, leistete gerade seinen Wehrdienst ab. Sein Vater hatte ihn aufgefordert, bei der Suche nach Natalie zu helfen. Eigenmächtig hatte Stephan jedoch beschlossen, bei seiner Mutter zu bleiben, die verstört im Wohnzimmer hockte und die Besuche der Nachbarschaft über sich ergehen ließ.
Kurz vor fünf am Nachmittag bekam Stephan für seine Entscheidung, nicht an der Suche nach seiner Schwester teilzunehmen, die Rechnung präsentiert. Sein Vater stürmte wutentbrannt in die Küche, in der Stephan saß und einen Kaffee trank.
»Wo warst du?«, fragte er und stemmte die Fäuste in die Hüften. Stephans Herz schlug schneller, als er antwortete: »Bei Mama. Sie braucht jetzt jemanden.«
»Soll das ein Vorwurf sein?«
Stephan stutzte. »Vorwurf? Blödsinn!«
»Was ist denn das für ein Ton? Bringen sie dir beim Kommiss so was bei?«
Er schüttelte resignierend den Kopf und schwieg. Wenn sein Vater einen Grund suchte, um seinen Frust abzulassen, dann verdrehte er die Worte so lange, bis es für einen Wutanfall ausreichte. Dazu wollte Stephan ihm keine Gelegenheit bieten. Doch Jupp ließ nicht locker.
»Du glaubst, dass wir unsere Zeit mit der Suche vertrödeln, oder?«
»Nein«, antwortete Stephan so neutral wie möglich. Er spürte Angst und Wut in sich auflodern. Obwohl er seinem Vater körperlich überlegen war, erinnerte ihn das Ganze an seine Kindheit, während der er tatenlos alles über sich ergehen lassen musste. Widerstand hatte seinen Vater nur noch mehr gereizt.
»Ich hatte dir gestern eine klare Anweisung gegeben«, schrie Jupp plötzlich los. Stephan schreckte zusammen. Sein Vater stand keinen Meter entfernt, die Fäuste geballt.
»Mama schläft. Nimm doch ein wenig Rücksicht«, sagte er leise und sah seinen Vater eindringlich an.
Doch der dachte gar nicht daran, sondern holte weit aus.
Rumms!
Stephan fiel seitlich vom Stuhl. Seine rechte Wange brannte von dem Schlag wie Feuer. Jupp machte einen Schritt auf ihn zu, stand jetzt breitbeinig über ihm. »Rücksicht? Ich werde dich Rücksicht lehren!« Er packte Stephan am T-Shirt und zog ihn nach oben. Ein Schlag auf die andere Wange warf Stephans Kopf nach rechts. Den dritten Schlag wehrte Stephan mit dem Unterarm ab, was Jupp noch wütender machte. »Was? Du willst frech werden?«
Schon traf der nächste Hieb Stephans Unterkiefer. Die Zähne prallten aufeinander, der Schmerz fütterte seine Wut. Er war plötzlich hellwach, Adrenalin schoss durch seine Blutbahn. Dem nächsten Schlag wich er aus, indem er einen Schritt zurücktrat, führte dann wie mechanisch eine kurze, schnelle Kombination aus. Die rechte Faust hieb er in Jupps Gesicht, mit der Linken traf er das Ohr. Sein Vater torkelte mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht nach hinten.
»Was …?«, stieß Jupp hervor. Er wischte sich mit dem Handrücken durchs Gesicht und betrachtete das Blut an seiner Hand. Dann sah er zu Stephan, der immer noch mit erhobenen Fäusten in der Küche stand.
Plötzlich grinste er. Stephans Knie wurden weich, als er das irre Funkeln in den Augen seines Vaters sah.
»So, so. Sohnemann hat keinen Respekt mehr vor dem Alten«, zischte Jupp und krempelte seine Hemdsärmel hoch.
»Papa, lass uns reden«, versuchte Stephan, seinen Vater zu beruhigen. Der reagierte nicht darauf, sondern kam mit erhobenen Fäusten näher.
»Willst du deinen Sohn nun auch noch aus dem Haus treiben?«, hörte Stephan die Stimme seiner Mutter. Jupp hielt in der Bewegung inne und drehte sich um. Ingeborg drängte sich wortlos an ihm vorbei und schüttete sich einen Kaffee ein. Erstaunt sah Stephan sie an. Sie stand mit dem Rücken zu Jupp, ihre Hände zitterten. Zum ersten Mal hatte sie etwas unternommen, um ihn zu schützen.
»Dein Sohn hat mich geschlagen! Das kann ich mir nicht bieten lassen!«, rief Jupp.
Ingeborg stellte die Tasse auf die Anrichte. »Du hast es verdient. Ich habe schon lange drauf gewartet.«
»Aber …«, stammelte Jupp. Er ließ die Arme fallen und starrte Ingeborg mit offenem Mund erstaunt an.
Ingeborg nahm die Tasse wieder in die Hand, drehte sich um und sagte: »Vielleicht wäre Natalie noch da, wenn Stephan sich eher gewehrt hätte.«
Sie verließ die Küche. Kurz darauf hörte man, wie sie den Fernseher einschaltete. Jupp murmelte ein paar unverständliche Worte, schüttelte unablässig den Kopf, nahm sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und ging nach draußen. Von Stephan nahm er keine Notiz mehr. Als die Haustür hinter Jupp ins Schloss fiel, setzte Stephan sich wieder auf seinen Stuhl und vergrub das Gesicht in den Händen.
Wäre es wirklich so einfach gewesen? Hätte seine Mutter ihrem Mann früher Paroli geboten, wäre dann seine und Natalies Kindheit ganz anders verlaufen? Wäre Natalie nicht abgehauen? Diese Fragen kreisten ihm heute noch im Kopf herum. Stephan rieb sich die Augen, verdrängte die Vergangenheit und stemmte sich hoch. Das Werkzeug und die Bretter lagen bereit. Er stieg über einen Haufen dreckiger Wäsche und kniete sich hin. Als Erstes schob er sich vier Holzschrauben griffbereit zwischen die Lippen, dann nahm er das erste Brett und den Akkuschrauber. Das Brett setzte er links an und drehte die erste Schraube ins Holz. Rasch folgten die anderen. Er robbte nach hinten und kontrollierte seine Arbeit. Dabei knarrte die Diele unter seinem linken Knie laut und bog sich nach innen.
Stephan stutzte, schaute genauer hin. Die Diele war nur knapp dreißig Zentimeter lang und schloss an der Wand an. Er seufzte. »Das Haus zerfällt schneller als ein Vampir bei Tageslicht«, murmelte er, nahm einen Schraubendreher und hebelte das lose Brett heraus. Als er zur Zange greifen wollte, um die alten Nägel zu entfernen, sah er etwas in dem freigelegten Loch stecken. Er legte die Diele zur Seite, beugte sich vor und zog den Gegenstand vorsichtig heraus. Ein Buch. Stephan drehte es in seinen Händen. Die Seiten wurden von einem schmucklosen braunen Einband ohne Aufschrift zusammengehalten, die Kanten waren abgestoßen, an einer Ecke angenagt. Er blätterte die ersten Seiten auf, das Papier knisterte trocken. Die Handschrift mit den weichen Bögen kam ihm bekannt vor. Er schlug zur ersten Seite zurück.
Tagebuch von Natalie Tries, stand da.
Stephan schluckte schwer. Sein Hals fühlte sich plötzlich trocken und rau an. Ungläubig las er die vier Wörter wieder und wieder. Dann blätterte er hastig durch das Buch. Das Tagebuch seiner Schwester! Stephan kämpfte sich mit weichen Knien in die Höhe und ließ sich auf Christines Bett fallen. Natalie, hämmerte es in seinem Kopf. Er hatte von einem Tagebuch nichts gewusst. Er schwitzte, zog an seinem Kragen, Schweiß perlte von seiner Stirn. Der Raum um ihn herum schien kleiner zu werden. Mit zittrigen Fingern schlug er eine Seite auf, vertiefte sich in die Zeilen.
Ein scharfer Geruch holte Stephan in die Wirklichkeit zurück. »Der Kuchen!«, rief er aus, sprang auf und stürmte die Treppe hinunter in die Küche. Aus dem Backofen quoll dichter Rauch. Hustend öffnete Stephan die Ofentür und riss das Fenster auf.
»Mist«, stieß er hervor. Der Kuchen glich einer verkohlten Frisbeescheibe. Verärgert ging er hinaus und setzte sich auf die Bank neben der Haustür, rang keuchend nach Luft. Aus dem Küchenfenster stieg immer noch feiner Qualm auf; die Glocke der Sechtemer St. Gervasius und Protasius Kirche schlug zwölf Uhr.
Als Stephan wieder frei atmen konnte, stellte er überrascht fest, dass seine Hand immer noch Natalies Tagebuch umklammerte.
Er spürte einen Kloß im Hals, Bilder aus seiner Vergangenheit kamen ihm in den Sinn. Er hatte Natalie das Radfahren beigebracht. Ihr glückliches Jauchzen nach den ersten Metern ohne Hilfe klang immer noch in seinen Ohren. Natalie, wie sie ihm die Schürfwunden verarztete, als er sich wieder mal mit dem Schulrabauken Detlef, genannt Doofbacke, geschlagen hatte.
Stephan verspürte einen Stich in der Brust, der ihm sekundenlang den Atem raubte. Er hatte ihr Leben gerettet, damals, an einem Sommertag. Er erinnerte sich daran, als ob es erst gestern gewesen wäre. Dabei lag es bereits über dreißig Jahre zurück. Fünfundsiebzig war das gewesen, im Sommer.
Sie saßen am Rande eines Ackers und spielten mit seinen Matchboxautos, gruben unzählige Straßen in den Erdboden. Der noch grüne Weizen wogte rauschend im lauwarmen Wind, der über den Rücken des Vorgebirges in die Rheinebene herabfiel.
Stephan hatte Natalie überreden müssen, da sie sich eigentlich nicht viel aus Spielzeugautos machte. Doch da ihre Freundinnen alle in Urlaub waren, hatte sie schließlich zugestimmt. Er versuchte gerade, einen Tunnel durch eine Furche zu graben, als Natalie plötzlich aufsprang und laut kreischte. Wild um sich schlagend rannte sie davon. Stephan sah ihr erstaunt hinterher, konnte sich den Ausbruch nicht erklären. Ein wütendes Summen an seinem Ohr lenkte seine Aufmerksamkeit kurzzeitig von Natalie ab. Er spürte einen schmerzhaften Stich am Unterarm.
»Aua«, schrie er und wischte mit einer hastigen Bewegung die Wespe fort. Plötzlich wurde ihm klar, warum Natalie immer noch mit sich überschlagender Stimme schrie. Sie hatte ein Wespennest angegraben, und die Biester rächten sich nun. Er sprang auf und rannte Natalie nach. Ihren Vorsprung holte er rasch auf, und als sie stolperte und hinfiel, beugte er sich keuchend über sie.
Natalie rang nach Luft, griff sich an den Hals. Mit riesigen Augen, die ihr fast aus den Höhlen quollen, sah sie ihn an. Eins von den Mistviechern hatte sie in die Mundschleimhaut gestochen, das erkannte Stephan sofort. Davor waren sie von allen Seiten gewarnt worden, von den Eltern, in der Schule. Er überlegte nicht lang, zerrte Natalie auf seinen Rücken und rannte, von Panik getrieben, los. Bereits nach wenigen Metern brannte seine Lunge, und die Muskeln seiner Beine schmerzten. Doch der pfeifende Atem seiner Schwester an seinem rechten Ohr trieb ihn an, ebenso seine Schuldgefühle, denn er hatte sie überredet, mit ihm am Feldrand zu spielen. Zu Hause angekommen, setzte der eilig herbeigerufene Arzt beherzt einen Luftröhrenschnitt und rettete Natalie im letzten Moment das Leben.
Stephan sah Natalie vor sich, auf einer Liege in der Ambulanz, von den Wespen zerstochen, ein dankbares Lächeln im Gesicht. Jede Sekunde, die er herausgeholt hatte, war wichtig gewesen.
Zehn Jahre hatte er Natalie damit geschenkt.
Er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Sie fehlte ihm.
Samstag, 13. Juli 1985
Heute Abend will er sich endlich mit mir alleine treffen!!!
Ich liebe ihn so sehr, kann an nichts anderes mehr denken. Papa wird toben, wenn er es erfährt. Er würde nie verstehen, warum ich mich gerade in ihn verliebt habe. Aber was weiß Papa schon über Liebe? Immer nur mit Mama zusammen. Vielleicht früher mal verliebt, aber heute leben beide eher wie Bruder und Schwester. Ob die überhaupt noch miteinander? Igitt! Darüber möchte ich nicht nachdenken.
Und dann noch das Kind. Mein Schatz weiß es noch gar nicht. Bin fest entschlossen, es ihm nachher zu sagen. Bin gespannt, wie er reagieren wird.
Kurz nach sieben. Um acht holt mich mein Hündchen Uwe ab. Muss darum jetzt Schluss machen. Schließlich muss ich mich noch stylen. Verführerisch, hi, hi. Das habe ich in den letzten Wochen gelernt. Da kann er bestimmt nicht mehr Nein sagen. Morgen dazu mehr.
Charlotte blätterte um. Nach diesem Eintrag im Juli folgten nur leere Seiten. Sie blickte zu Stephan, der ihr gegenüber am Terrassentisch saß und sie erwartungsvoll ansah.
»Der letzte Eintrag«, sagte sie bedächtig. »An diesem Wochenende ist deine Schwester verschwunden.«
Stephan nickte. »Ja. Seitdem haben wir nie wieder etwas von ihr gehört oder gesehen. Aber nun sag schon. Was hältst du von ihren Aufzeichnungen?«
Sie drehte das Buch langsam in den Händen. »Schwer zu sagen. Ich habe sie ja nur überflogen. Geschreibsel eines verliebten Teenagers, würde ich sagen.«
Charlotte schob ihren Teller mit dem halb gegessenen Stück Erdbeersahne, die Stephan beim Bäcker besorgt hatte, von sich weg. Sie verspürte keinen Appetit mehr.
Stephan legte entsetzt seine Kuchengabel ab. »Teenagergeschreibsel?«, rief er aus und fuchtelte mit den Händen in der Luft herum. »In dem Tagebuch sind so viele Hinweise zu finden, denen man nachgehen kann, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und Natalies Schwangerschaft! Das haut mich glatt vom Stuhl.«
Charlotte hob beschwichtigend die Hände. »Wie gesagt, ich habe es nur überflogen. Da muss viel interpretiert werden.«
Er lächelte sie an. »Das ist mein Beruf.«
Charlotte nippte an ihrem Kaffee. »Du willst den Fall also aufrollen?«
Stephan nickte. »Ja, auf jeden Fall!«
Sie lehnte sich in ihren Stuhl zurück. Seine Euphorie teilte sie nicht. Sie zweifelte sogar daran, dass nach über zwanzig Jahren noch verwertbare Spuren vorhanden waren, da half auch kein altes Tagebuch. Sie selbst konnte sich kaum an Dinge erinnern, die heute vor einem Jahr geschehen waren, geschweige denn vor Jahrzehnten. Was waren daher Aussagen wert, die Stephan im Laufe der Ermittlung erhalten würde?
»Es ist kaum zu glauben.« Stephan lachte. »Hätte ich nicht die ganze Elektrik im Haus neu installieren müssen, wäre ich vermutlich nie auf das Tagebuch gestoßen. Was habe ich mich über den Lärm, den Dreck und die Kosten geärgert. Das halbe Haus haben mir die Handwerker zerstört. Aber ohne sie hätte ich das Tagebuch vermutlich nie gefunden.«
Charlotte erinnerte sich an die Arbeiten. Kurz nach dem Einzug brannte der Sicherungskasten ab, und Stephan war gezwungen, die komplette Elektroinstallation erneuern zu lassen.
»Warum gehst du nicht einfach zu deinen Kollegen vom Kommissariat und gibst ihnen das Tagebuch?«, schlug sie vor, doch Stephan winkte ab.
»Die arbeiten am Limit. Was glaubst du, mit wie viel Elan sie an diese Sache, die über zwanzig Jahre zurückliegt, herangehen würden? Die könnten, selbst wenn sie wollten, niemals so viel Zeit investieren wie ich.«
»Sie hätten aber andere Möglichkeiten. Spurensicherung zum Beispiel.«
Stephan lachte. »Da wird es nicht mehr viel geben, was man sichern könnte. Vielleicht die Forensik. Aber dazu müsste man erst einmal eine Leiche finden.«
Charlotte schwieg einen Moment, spürte Stephans Ehrgeiz und wusste, dass er sich nicht umstimmen lassen würde. »Forensik, hm, ja«, murmelte sie. Zumindest machte er sich keine Hoffnung, seine Schwester lebend wiederzusehen. »Du gehst also von einem Gewaltverbrechen aus.«
»Ich kann es zumindest nicht mehr ausschließen. Natalie schreibt schließlich selbst, dass sie verfolgt wurde.« Stephans Stimme nahm einen harten Ausdruck an. »Die Hoffnung, Natalie lebend zu finden, habe ich längst aufgegeben. Hätte ich mich mit all dem nicht abgefunden, wäre ich daran zerbrochen. Daran, nicht zu wissen, was genau passiert ist. Sich zu fragen, warum sie weggelaufen ist. Warum sie sich nie gemeldet hat. Oder ob jemand sie auf dem Gewissen hat, der damit davongekommen ist.« Er hielt das Tagebuch in die Höhe. »Dies ist vielleicht der Schlüssel, der bisher gefehlt hat. Ich will wissen, was damals geschehen ist, und werde mir diese einmalige Chance nicht entgehen lassen.«
Stephan nahm die Zeitung »Schaufenster«, rollte sie zusammen und schlug nach einer Wespe, die auf seiner Kuchengabel saß. Die Gabel flog samt Wespe im hohen Bogen davon. »Ich hasse die Biester«, murmelte er.
»Du solltest nicht nach ihnen schlagen. Macht sie nur wütend.« Er legte die Zeitung zurück auf die Bank. »Ich weiß. Aber wenn
ich die Viecher sehe, dann brennt bei mir irgendetwas durch.« Charlotte sah ihn einen Moment lang nachdenklich an, griff dann
das Thema wieder auf. »Dir ist es also Ernst?«
Stephan nickte. Eindringlich sagte er: »Irgendjemand muss mehr wissen, als er damals zu Protokoll gegeben hat. Den will ich finden, nein, den muss ich finden und festnageln.«
Charlotte kombinierte: »Du erhoffst dir, von ihm mehr über Natalies Verschwinden zu erfahren.«
»Na klar«, bestätigte Stephan. »Vielleicht ergibt sich daraus eine Spur, die mich auf Natalies Fährte führt.«
Das Telefon läutete. Stephan erhob sich und ging ins Haus. Charlotte bemerkte sein schmerzverzerrtes Gesicht. Die Stichverletzung im Bauch machte ihm immer noch Probleme. Glaubte man den Ärzten in der Klinik, war das nicht ungewöhnlich. Schließlich war es noch kein halbes Jahr her, dass Stephan mit einem Messer schwer verletzt wurde.
Nach fünf Minuten kam Stephan zurück und setzte sich wieder. »Christine lässt dich grüßen. Sie schläft heute bei einer Freundin. Also? Was hältst du von meinem Vorhaben?«
Charlotte wickelte sich eine Haarsträhne um den Zeigefinger und zögerte mit der Antwort.
»Nun?«, drängte er.
»Ich denke immer noch, es wird nichts bringen. Trotz Tagebuch. Nicht nach all den Jahren.« Charlotte bemerkte, wie seine Miene einen verschlossenen Ausdruck annahm. Sicherlich hätte er eine andere Antwort bevorzugt. Sie lächelte und ergänzte: »Trotzdem werde ich dir helfen, so gut ich kann.«
»Das brauchst du nicht«, sagte Stephan abweisend.
Charlotte blieb hartnäckig. »Jetzt zier dich nicht so.« Sie schob ihren Unterkiefer nach vorne und hoffte, durch einen trotzigen Gesichtsausdruck jeglichen Widerspruch zu unterbinden.
Stephan verdrehte die Augen. »Darum geht es doch gar nicht. Du hast doch selbst genug am Hals, zum Beispiel den Geburtstag deiner Mutter.«
»Lass das mal meine Sorge sein. So viel Arbeit macht das auch nicht. Meine Kinder wohnen zwar in der Zeit bei mir, aber die sind alt genug, sich selbst zu verpflegen. Und überhaupt, die Feier ist am kommenden Samstag. Danach habe ich alle Zeit der Welt.«
Stephan schwieg einige Sekunden, hob dann die Arme, als ob er sich ergeben würde. »Was kann ich dagegen noch sagen.« Er grinste. »Aber wenn ich ehrlich bin, freue ich mich riesig, dass du mir helfen willst.«
Zufrieden lehnte sich Charlotte zurück. Es war mitunter nicht leicht, den kommissarischen Dickkopf zu überzeugen. »Es wäre sicherlich ratsam, wenn ich mehr über deine Pläne wüsste.«
Er nickte. »Ja, klar. Ich werde dir erzählen, was ich von damals noch weiß und wie ich die Sache angehen will. Nur muss ich gleich noch das Grab meiner Mutter pflegen. Ist schon lange überfällig, und wer weiß, wann ich die nächsten Tage Zeit finde. Ich schlage vor, du kommst heute Abend zum Essen.«
»Italienisch?«, fragte Charlotte.
Stephan grinste. »Klar. Was sonst?«
Charlotte stand auf und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Also, bis heute Abend.«
Charlotte nutzte den Hintereingang, um ihre Villa, die Graue Burg, zu betreten. »Ich bin’s«, rief sie laut, damit ihre Mutter Hannelore sich keine Sorgen machte. Die alte Dame litt zwar an Demenz, doch hören konnte sie noch wie eine Katze. Charlotte ging ins Wohnzimmer. Ihre Mutter saß im Rollstuhl und sah fern. Während der letzten Monate hatte sich ihr Gesundheitszustand stetig verbessert. Wenn die Demenz auch nicht zu heilen war, so konnte sie zumindest tagsüber wieder das Bett verlassen.
»Wo ist denn Lukas?«, fragte Charlotte. Lukas war Zivildienstleistender, wohnte mit im Haus und kümmerte sich um die alte Frau. »Lukas?«, fragte Hannelore.
Charlotte kniete sich neben ihre Mutter. Sie streichelte ihr über den Unterarm. »Der nette junge Mann, der uns hier hilft.«
Charlotte bemerkte, wie sich Hannelore entspannte. »Ach der! Netter Mann, das ist er. Wäre schön, wenn ihr mal zusammen ausgehen würdet. Aber ich versteh dich schon. Der Junge muss natürlich dich fragen und nicht umgekehrt.«
Charlotte lächelte. Sie wusste, dass es keinen Zweck hatte, ihre Mutter darauf hinzuweisen, dass der Altersunterschied zwischen dem Zivildienstleistenden und ihr mindestens dreißig Jahre ausmachte. Ihre Beziehung zu Stephan kam ihr in den Sinn. Sie war zehn Jahre älter. Stephan schien das nicht zu stören. »Ich werde darüber nachdenken, Mama. Aber sag schon, wo ist er?«
»Musste mal.«
Charlotte wandte sich um und erblickte den schlaksigen Zivildienstleistenden. »Hallo Lukas«, sagte sie und lächelte. »Würdest du vielleicht so nett sein und mit meiner Mutter einen Spaziergang machen? Das Wetter ist zu schön, um hier im Dunklen zu sitzen.«
»Wie Sie wollen«, antwortete Lukas gleichgültig. Charlotte nahm ihm die laxe Einstellung nicht übel. Der junge Mann zeigte zwar keine überschäumende Motivation, doch sie konnte sich uneingeschränkt auf ihn verlassen.
Im Aufstehen tätschelte sie die Hand ihrer Mutter. »Bis gleich, Mama«, sagte sie und ging in die Bibliothek, die sie als Arbeitszimmer nutzte. Sie setzte sich hinter ihren Schreibtisch und schaltete das Notebook ein. Während der Rechner hochfuhr, dachte sie an Stephans Schwester Natalie. Es war mehr als zwanzig Jahre her, und sie hatte damals weder Natalie noch Stephan persönlich gekannt, aber Charlotte erinnerte sich an eine dunkelhaarige Schönheit, die mit ihrer Körpergröße von einem Meter achtzig fast jedes gleichaltrige Mädchen überragte.
Auf dem Bildschirm des Notebooks erschienen die Icons für die Programme. Charlotte stellte die Internetverbindung her und rief ihre Mails ab. Sie seufzte, als sie sah, dass es über dreißig Stück waren. Sie ging die Mails der Reihe nach durch. Vor einiger Zeit hatte sie ein Forum eröffnet, um mit anderen über Politik zu diskutieren. Seitdem erreichten sie täglich mehrere E-Mails mit Anregungen, Änderungswünschen, Lob und Tadel oder Fragen zu ihrer politischen Einstellung.
Sie überflog die Absender der Mails. Einige kannte sie, andere nicht. Dann fiel ihr Blick auf die Post, die neben dem Computer lag. Der Drohbrief fiel ihr wieder ein. Sie holte ihre Handtasche aus dem Flur, setzte sich und zog den Brief hervor.
Jetzt, nachdem sie mit Stephan darüber gesprochen hatte, erschienen ihr die Worte nicht mehr so bedrohlich. Sie vertraute ihm, er war schließlich Polizeibeamter. Wenn er dazu riet, abzuwarten, dann war das sicherlich richtig. Trotzdem blieb ein unangenehmes Gefühl in ihrer Magengrube zurück. Was waren das nur für Typen, die anderen ihre Liebe nicht gönnten? Sie knüllte den Brief zusammen, warf ihn in den Mülleimer und murmelte: »Arschloch!«
KAPITEL ZWEI
Donnerstag, 2 Mai 1985
Scheiße! Wie kann man sich nur über ein Kleid so aufregen? Dabei ist es noch nicht einmal ein richtiger Mini, hört knapp über den Knien auf. Monika trägt kürzere, ihre sehen aus wie breite Gürtel. Aber meins? Papa hat sie nicht mehr alle!!! Ich hatte mich so gefreut. Da darf ich endlich einmal mit Conny nach Köln, und dann so etwas. Egal, was ich mache, immer muss er meckern. Meckern? Getobt hat er! Ich habe bald keine Lust mehr. Sobald ich kann, haue ich ab und nehme mir eine eigene Bude. Dann wird er ja sehen, was er davon hat.
Scheiße!
Charlotte bog aus der Grauen-Burg-Straße auf die Eupener Straße ein, fuhr geradeaus weiter, die Kaiserstraße an der Weißen Burg vorbei. Sie schmunzelte. Stephan hatte sie mal gefragt, wieso die Burg als weiß bezeichnet wurde, obwohl nur das Hauptgebäude tatsächlich weiß war. Der Rest mit dem markanten Torturm zeigte sich in Ziegelrot. Charlotte hatte ihm erklärt, dass der Name sich nicht von der Farbe ableitete, sondern von ihrem ursprünglichen Namen »Wisseburg«, also Wiesen-Burg.
Sie lenkte den Wagen in die Ophofstraße, beschleunigte ihren Roadster, trat dann heftig auf die Bremse und bog rechts in die Zufahrt zu Stephans kleinem Anwesen ein. Die Reifen quietschten auf dem neuen Teer. Stephan hatte erst vor drei Monaten den Kiesweg durch Asphalt ersetzen lassen, da er es leid war, bei Regen durch den schlammigen Untergrund zu waten.
Er erwartete sie bereits, begrüßte sie mit einem flüchtigen Kuss und sagte: »Komm durch. Die Lasagne ist fertig. Wir können sofort essen.«
Sie folgte ihm in die Küche und setzte sich. Er schenkte Wein für sie, Bier für sich ein. Sein Rasierwasser lag herb in der Luft, seine fülligen schwarzen Haare waren vom Duschen noch leicht feucht, und seinen Bauchansatz versteckte er unter einem weiten Hemd, das er offen über der Hose trug.
»Siehst zum Anbeißen aus«, stellte Charlotte fest. Stephan grinste und blitzte sie aus seinen graublauen Augen an. »Nach dem misslungenen Schokoladenkuchen muss ich ja was gutmachen.«
Kurz darauf stand eine intensiv nach Käse riechende Lasagne auf dem Tisch. Charlotte verspürte kaum Appetit, hielt aber aus Höflichkeit den Teller hin.
»Kein Fleisch, nur Gemüse und Nudeln«, sagte Stephan. »Lass aber noch Platz für die Nachspeise. Ich hab mir was Besonderes einfallen lassen.« Er zwinkerte Charlotte zu.
Die ersten Bissen der Lasagne aßen sie, ohne ein Wort zu sprechen. Das Schweigen dauerte an. Charlotte beobachtete ihn verstohlen mit gesenktem Kopf. Wenn sie sich nicht täuschte, kaute er eher mechanisch als enthusiastisch. Seine gute Laune von eben schien verflogen, den Blick hielt er starr auf den Teller gerichtet. Als er etwa die Hälfte seiner Portion verzehrt hatte, legte er sein Besteck zur Seite und sah auf. »Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.«
Charlotte nippte an ihrem Rotwein. »Das überrascht mich jetzt. Hast du vorhin nicht etwas von einem Plan erwähnt?«
»Plan, nun ja.« Stephan nickte widerstrebend. »Da habe ich den Mund vielleicht zu voll genommen. Mir geht so viel durch den Kopf, was ich erzählen könnte.«
Charlotte hob die Augenbrauen. »Was hindert dich daran? Ich habe Zeit.«
Stephan senkte den Blick. »Durchaus, daran liegt es nicht. Es ist alles so …« Er stockte, trank sein halb volles Bierglas hastig leer. »Also gut. Ich war selbst gerade erst zwanzig, als es passierte. Mama hatte mich am Montag angerufen und mir gesagt, dass Natalie zwei Nächte nicht nach Hause gekommen sei und sie sich schreckliche Sorgen mache. Ich habe Sonderurlaub beantragt, konnte aber erst am Donnerstag nach Hause fahren.«
Er beschrieb die eigenartige Atmosphäre im Haus, als er die Haustür öffnete und eintrat, so gut, dass es Charlotte kalt den Rücken runterlief.
Stephan hatte seinen Kleidersack neben der Flurkommode abgestellt. Im Haus war es so still wie nie zuvor.
»Mama? Papa?«, rief er. Nichts rührte sich. Er warf einen Blick links in die Küche. Ein Trockenkuchen auf der Anrichte, die Vorhänge zugezogen, der Kölner »Express« auf dem Küchentisch. Er ging durch den Flur und blieb erschrocken im Rahmen der Wohnzimmertür stehen. Seine Mutter saß in einem der Sessel und hielt ein Bild gegen ihre Brust gepresst. Mit dem Oberkörper wippte sie wie ein Pendel stetig vor und zurück. Seit seinem letzten Besuch vor drei Wochen schien sie um Jahre gealtert zu sein. Ihr Küchenkittel glitt fast von ihren schmalen Schultern, und die Haare, die sie sonst zu einem Dutt zusammensteckte, hingen strähnig herab. Ihr Gesicht wirkte aufgedunsen, die Augen waren verquollen, die Lippen zu einem dünnen Strich zusammengepresst.
Stephan schluckte schwer. Selbstverständlich hatte er eine getrübte Stimmung erwartet. Aber dass seine Mutter, die Frau, die normalerweise die Familie mit strengem Regiment durch die Unbillen des Alltages manövrierte, wie ein Häufchen Elend dort auf dem Sessel saß, erschütterte ihn bis ins Mark. Noch nie hatte er sie so erlebt.
»Mama«, sagte er leise, um sie nicht zu erschrecken. »Ich bin da.«
Sie reagierte nicht. Stephan setzte sich aufs Sofa und wartete geduldig. Nach einer Weile seufzte sie und legte das Foto auf den Tisch. Wie Stephan vermutet hatte, war es ein Bild von Natalie. Seine Mutter lächelte ihn an, wobei Tränen aus ihren Augenwinkeln quollen.
»Es ist schön, dass du kommen konntest.«
Stephan strengte sich an, seine Angst um Natalie nicht zu zeigen. Mühsam lächelte er zurück, beugte sich nach vorne und ergriff die rechte Hand seiner Mutter. »Ich wäre eher gekommen. Aber mein Feldwebel meinte, ich könne eh nichts unternehmen, und hat rücksichtslos den Urlaubsantrag abgelehnt. Erst als ich beim Bataillonskommandeur vorsprechen durfte, kam Fahrt in die Sache.« Was quatschst du für belanglosen Mist zusammen, wunderte er sich über sich selbst. Verlegen räusperte er sich. »Äh, nicht so wichtig. Gibt es was Neues?«
Seine Mutter schüttelte den Kopf.
»Und die Polizei? Was macht die eigentlich?«, fragte Stephan und spürte Wut in sich aufsteigen. »Die müssen doch mal was finden!«
Ingeborg zog ihre Hände zurück. Mit schwacher Stimme antwortete sie: »Die sagen, sie tun, was sie können.«
Stephan hörte Zweifel in ihrer Stimme. Er lehnte sich zurück, rieb sich die Augen und nahm sich vor, sich selbst umzuhören. Schließlich kannte er Natalies Freundeskreis, wenn er auch das vergangene halbe Jahr kaum mit ihnen zusammengetroffen war. Anfang Januar hatte man ihn eingezogen. Die Grundwehrdienstzeit hatte er in Münster verbracht. Von dort aus hatte man ihn nach Dülmen versetzt. Er hatte keinen Drang verspürt, jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Und wenn ihn das Heimweh doch mal nach Hause spülte, dann traf er sich mit seinen Freunden zum Grillen am Herseler Rheinufer, oder sie fuhren nach Köln in die Bhagwan-Disco.
»Wo ist Papa?«
Ingeborg zog aus ihrer Kitteltasche ein Papiertaschentuch hervor und schnäuzte sich. »Der ist bei Erwin. Sie wollen was machen.«
»Was machen?«
»Das ganze Dorf steht Kopf, alle sind verängstigt. Dein Vater meint, wir sollen selbst suchen.«
Stephan fuhr sich mit der Hand über die Stirn. »Besser als rumsitzen«, kommentierte er und stand auf. »Ich fahr gleich rüber.«
»Aber erst ziehst du dich um«, befahl seine Mutter und sah ihn streng an. Er sah an sich hinunter. Da er sich heute Morgen beeilt hatte, den nächsten D-Zug zu bekommen, hatte er keine Zeit gefunden, sich umzuziehen. Er steckte immer noch in seiner Uniform und den schweren Stiefeln. Scherzhaft wollte Stephan salutieren, senkte den Arm aber nach halber Strecke wieder. Stattdessen nickte er nur knapp und verließ das Wohnzimmer. Solange sie nicht wussten, was mit Natalie war, sollten sie noch nicht mal in Ansätzen in den Alltag zurückkehren und Witze machen. Er schnappte sich seinen Wäschesack und ging nach oben.
Als er kurz darauf zur Haustür hinaus wollte, kam sein Vater Josef, den alle nur Jupp nannten, heim. Zusammen setzten sie sich in die Küche. Ingeborg stellte jedem eine bauchige Giesler-Kölsch-Flasche vor die Nase und ließ sie allein. Auch Jupp konnte man die Strapazen und schlaflosen Nächte der letzten Tage ansehen. Seine Augen saßen tief in den Höhlen und ließen ihn krank erscheinen, seine Hände zitterten kaum merklich. Er hatte abgenommen. Zwar schob er immer noch einen ansehnlichen Bauch vor sich her, aber die Hemdknöpfe spannten nicht mehr. Seine Glatze leuchtete rot, wie auch seine Wangen, Zeichen des hohen Blutdrucks, mit dem er seit einigen Jahren zu kämpfen hatte.
»Was habt ihr vor?«, fragte Stephan neugierig.
Jupp Nebelte den Kronkorken vom Flaschenhals und trank einen großen Schluck, bevor er antwortete: »Die Umgebung absuchen.«
Aufgeregt fingerte Stephan an seiner Flasche herum, rutschte mit dem Öffner dreimal ab, bevor der Kronkorken in einem hohen Bogen davonflog. Die Einsilbigkeit seines Vaters kannte er zur Genüge, sie lag allen Tries’ im Blut, doch in dieser Situation nervte ihn das. Er nahm einen hastigen Schluck und stellte mit einer heftigen Bewegung die Flasche ab.
Das Bier schäumte über und bildete auf dem Tisch eine goldgelbe Lache. »Mist!«, fluchte Stephan und griff sich ein Handtuch. Mitten in der Wischbewegung hielt er inne und starrte seinen Vater an. Erst jetzt wurde ihm klar, welche schreckliche Schlussfolgerung sich hinter der ganzen Suchaktion verbarg. »Ihr denkt, Natalie ist tot? Deswegen ein Suchtrupp?«
Jupp zuckte mit den Schultern, drehte die Flasche in seinen Händen. »Müssen halt alles versuchen.«
Stephan wollte protestieren, ihm ins Gesicht schreien, dass Natalie nicht tot sei, dass ein Gedanke daran schon die falsche Einstellung wäre und somit die Energien in die verkehrte Richtung lenken würde. Doch der verhärmte Gesichtsausdruck seines Vaters ließ ihn schweigen.
»Morgen früh um acht geht’s los«, sagte Jupp. »Ich zähl auf dich.«
Stephan überlegte einen Moment, trank noch einen Schluck, schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Ich will mich umhören. Vielleicht finde ich etwas heraus.« Er lächelte verkrampft. »Aber Mama sagte mir vorhin, dass du ohnehin das halbe Dorf im Rücken hättest.«
Jupps Gesichtsfarbe wechselte ins Dunkelrote. Donnernd schlug er mit der Faust auf den Tisch, dass die Flaschen einige Millimeter nach oben sprangen. »Biste mal wieder schlauer? Der Herr Sohn als Meisterdetektiv? Glaubst du, wir hätten das nicht schon längst getan, uns umgehört?«
Stephan duckte sich. Zwar kannte er die cholerischen Anfälle seines Vaters, doch meistens musste seine Schwester darunter leiden und nicht er. »Ich will nur …«, setzte er zu einer Erklärung an, doch Jupp sprang auf und wischte wütend die Bierflaschen vom Tisch, die klirrend auf den Bodenfliesen zerbrachen. »Morgen um acht!«, entschied er und stürmte aus der Küche.
Stephan hielt einen Moment inne, presste die Lippen aufeinander.
»Dein Vater war ein schwieriger Mensch«, sagte Charlotte in die Stille hinein. »Dominant und herrschsüchtig. Er war ja eine Zeit lang Ortsvorsteher, daher kannte ihn auch jeder. Weißt du, wie wir ihn genannt haben?«
Stephan schüttelte den Kopf. Damals, als Jugendlicher hatte ihn Politik nicht interessiert, geschweige denn die Dinge, die sich in Sechtem abspielten.
»Sheriff.« Charlotte grinste. »Jupp schoss des Öfteren einfach übers Ziel hinaus, fühlte sich für alles verantwortlich, tauchte überall auf, maßregelte jeden. So blieb er nicht lange Ortsvorsteher. Seine Partei konnte sein Verhalten nicht lange gutheißen.«
»Bei uns in der Familie war er nicht anders. Zumindest bis meine Mutter endlich rebellierte.«
Stephan erzählte ihr von der Auseinandersetzung, die sie nach der verpassten Suchaktion gehabt hatten, und von Ingeborgs Reaktion.
»Hat er sich danach geändert?«, fragte Charlotte.
»Ja. Er wurde stiller, grübelte mehr. Nur noch selten brauste er auf. Ich glaube, erst die Worte meiner Mutter haben ihm klargemacht, was unterbewusst schon in ihm gärte: dass er an Natalies Verschwinden nicht unschuldig war.«
Charlotte nippte an ihrem Weinglas. »Wie ging es weiter?«
Stephan wischte sich über die Augen. »Wie gesagt, ich wollte mich ein wenig umhören. Ich schnappte mir also mein Rad, schaltete das Licht an und fuhr los.«
Am Ortseingang von Waldorf fuhr er über die Schienen der Straßenbahnlinie 18. Für die leichte Steigung der Dahlienstraße hoch zur Kreuzung mit der Blumenstraße schaltete er einen Gang zurück. Kurz vor der Kreuzung überquerte er die Straße und bremste vor »Erwins Eck«, der Kneipe seines Onkels. Stephan lehnte das Rad gegen die Ziegelsteinmauer und schloss es ab. Er hörte die dumpfen Bässe der Musik, öffnete die Tür und ging hinein. Der Raum war brechend voll, und das an einem Donnerstagabend. Überwiegend jüngeres Publikum saß auf den Stühlen, tanzte in der Mitte des Raumes und stand um die Musikbox herum. Die Lichtorgel flackerte unruhig, ab und zu blitzte ein Stroboskop auf.
Stephan freute sich stets aufs Neue, dass es sein Onkel und seine Tante geschafft hatten, aus der spießig wirkenden Dorfkneipe ein Szenelokal für junge Leute zu machen. Ein Grund für den Erfolg war sicherlich, dass sein Onkel für die Probleme seiner jungen Kundschaft immer ein offenes Ohr hatte. Er schreckte nicht davor zurück, seine Freizeit zu opfern, wenn mal ein Ratschlag oder gar tatkräftige Unterstützung notwendig war.
Ein Übriges taten wohl Erwins selbst kreierte Drinks, die regelrechten Kultstatus erreicht hatten. Als Grundlage verwendete Erwin Rebellenblut, einen Brombeerwein, dessen Beeren am Hang des Vorgebirges bei Roisdorf geerntet wurden. Auch wenn Erwins Cocktailkarte ursprünglich nicht speziell für ein so junges Publikum gedacht war – wer »in« sein wollte, musste sich in »Erwins Eck« sehen lassen.
Stephan erblickte seinen Onkel, der mit verschlossener Miene hinter der Zapfanlage stand und die Gläser füllte. Trotz der teils diffusen Lichtverhältnisse zeugten die dunklen Ringe unter seinen Augen davon, dass er, wie der Rest der Familie, in den letzten Tagen wenig Schlaf gefunden hatte. Stephan schob sich an der tanzenden Menge vorbei in Richtung Tresen. Sein Onkel bemerkte ihn erst, als Stephan rief: »Kann ich dich mal sprechen?«
Erwin zuckte zusammen und ließ erschrocken das halb gefüllte Bierglas fallen. Es zerbrach am Spülbeckenrand.
»Verflucht!« Erwin winkte Dirk heran, einen Studenten mit gedrungenem Körperbau, der sich hier ein paar Mark als Kellner hinzuverdiente. »Bring das in Ordnung«, forderte er und führte Stephan in die Küche, um durch den Hintereingang in den Garten zu gehen.
»Wo kommst du denn her?«, fragte er mit matter Stimme.
»Hab ein paar Tage freibekommen«, erklärte Stephan. »Hast du etwas gehört?«
»Nichts.«
Hinter ihnen flog die Tür auf. »Ach hier bist du, Erwin.« Tante Elke, Erwins Frau, trat zu ihnen und gab ihrem Mann einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Du musst Dirk helfen. Alleine ist der aufgeschmissen.« Sie lachte hell. »Die Jugend von heute weiß nicht mehr, wie man richtig arbeitet.«
»Jetzt übertreib mal nicht«, sagte Erwin. » Ich bin doch gerade erst zwei Minuten raus.«
Elke ging gar nicht darauf ein, trällerte stattdessen: »Ah! Hallo Stephan.« Sie umarmte ihn, drückte ihn kräftig und hielt ihn dann an den Schultern von sich weg. »Bist richtig erwachsen geworden.«
Stephan öffnete den Mund und wollte seine Tante begrüßen, doch die war bereits wieder in der Kneipe verschwunden. Irritiert schaute er auf die zufallende Tür. »Die ist aber gut drauf.«
»Sieht nur so aus«, erklärte Erwin. »Ist ihre Art, damit umzugehen.«
»Trotzdem.« Stephan blickte ärgerlich zu seinem Onkel, bemerkte dann jedoch dessen wässrige Augen und den verzweifelten Gesichtsausdruck. Augenblicklich verflog sein Ärger. »Okay, okay. Blöder Spruch von mir. Ist nicht leicht für uns alle.«
Erwin nickte schwach, sein Gesichtsausdruck änderte sich nicht. »Ich habe nirgends Natalies Freunde gesehen«, wechselte Stephan das Thema.
»Donnerstags sind die selten da. Morgen bestimmt. Was willst du denn von denen?«
»Aushorchen«, gab Stephan freimütig zu.
»Ich habse gefragt. Die wissen nichts.«
»Und die Polizei?«
»Auch schon. Dito.«
»Trotzdem.«
Erwin fuhr sich mit den Händen durch seine fülligen Haare. »Wenn du meinst. Ich muss jetzt wieder.«
Er ließ Stephan stehen und ging rein. »Shout, Shout …« sangen Tears for Fears, als Erwin die Tür öffnete. Die Musik vermischte sich mit dem Zirpen der Grillen. Stephan blieb noch eine Weile nachdenklich stehen. Die Schatten der Obstbäume glichen auf dem frisch gemähten Rasen Gitterstäben. Ob Natalie gefangen gehalten wurde? Stephan hoffte, dass der Alptraum bald ein Ende haben würde. Dass Natalies Freundeskreis nicht da war, ärgerte ihn. Ungeduldig trat er gegen eine Gießkanne. Sie kippte um, und glucksend lief das Wasser aus. »Dann eben morgen«, murmelte er, ging hinein und bestellte sich an der Theke einen »Titanic’s Nightmare«.
Stephan stand abrupt auf, räumte den Tisch ab und entsorgte die Reste im Müll. »Meine Tante ging einfach drüber weg, tat so, als ob nichts gewesen wäre.«
Das Geschirr klapperte gefährlich in der Spüle.
Charlotte spürte Stephans Ärger. »Nimm es dir nicht so zu Herzen. Dein Onkel hat dir ihr Verhalten doch erklärt.«
Stephan drehte den Wasserhahn mit einer energischen Bewegung auf, schloss ihn dann aber sofort wieder. »Sie benahm sich wie Alice im Wunderland.«
Er kam zum Tisch zurück und setzte sich wieder. »Wir kamen fast um vor Sorge, und sie sprang herum wie eine Elfe auf einer Wiese. Ich bin immer noch sauer darüber, obwohl ich glaube, dass sie damals vielleicht schon krank war.«
»Woran leidet sie denn?«
»Schizophrenie.«
»Das erklärt doch alles«, stellte Charlotte fest. »Soviel ich weiß, kann bei dieser Krankheit alles Mögliche an absonderlichen Verhalten auftreten.«
»Nur dass bei meiner Tante zum damaligen Zeitpunkt die Krankheit noch nicht diagnostiziert war«, rechtfertigte Stephan seinen Ärger. »Mit ihr muss ich ebenfalls sprechen. Sie ist in einer Psychiatrie untergebracht und gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Wird bestimmt nicht einfach. Aber vielleicht kitzel ich doch noch etwas aus ihr heraus.«
Er schwieg eine Weile, schien in Gedanken schon durchzugehen, was er seine Tante alles fragen wollte. Charlotte legte ihre Hand auf seine und drückte sie. »Erzähl bitte weiter. Ich möchte alles wissen.«
Stephan nickte und blinzelte, schien sich so in die Vergangenheit fallen zu lassen. »Am Morgen wurde ich von meiner Mutter geweckt. Sie rüttelte mich an den Schultern.«
»Steh auf, Junge. Der Kommissar will dich sprechen.«
Stephan rappelte sich stöhnend auf die Ellenbogen. Sein Kopf brummte wie ein Trafo. Da er in »Erwins Eck« noch zwei Kumpels getroffen hatte, war es gestern nicht bei einem »Titanic’s Nightmare« geblieben. Er fasste sich an den Kopf. Oh Mann, was mixte sein Onkel da zusammen? Himbeergeist mit Rebellenblut klang harmlos, hatte es aber offensichtlich in sich.
»Welcher Kommissar?«, fragte er langsam. Seine Zunge fühlte sich an, als ob darauf ein pelziges Tier schlief.
»Na der, der deine Schwester sucht«, antwortete Ingeborg und zog ihm die Bettdecke weg. Ohne weitere Worte verließ sie das Zimmer.