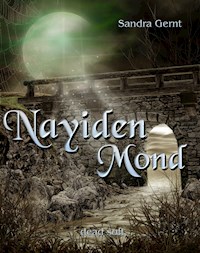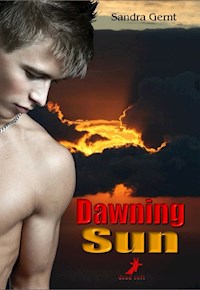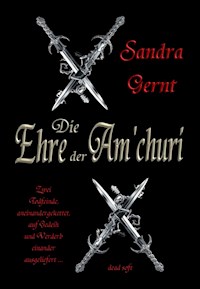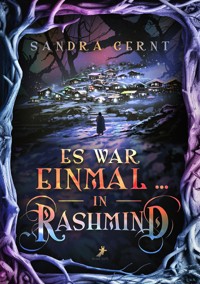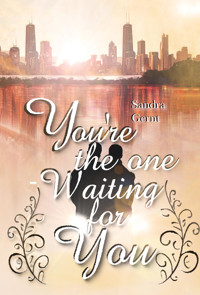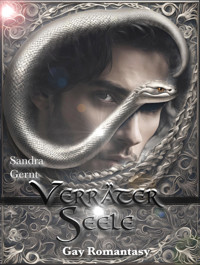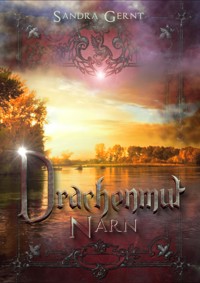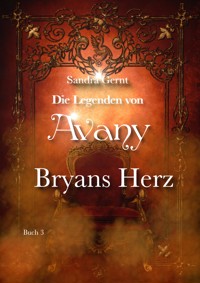5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Tarryn wollte nie etwas anderes vom Leben, als ein Sohn Nennitas zu sein – ein Bewahrer der Schriften, der Göttin der Weisheit geweiht. Doch als überzähliger Spross einer Adelsfamilie wird er gezwungen, eine Bündnisehe einzugehen – mit einem Mann. Einem Krieger in einem fernen Land, für den Tarryn ein wertloses Nichts ist. Ein notwendiges Übel, das eine Lieferung von Waffen, Kriegsrössern und Soldaten garantiert, mehr nicht. Ohne die Möglichkeit der Kommunikation ist er als Gelehrter unter raubeinigen Kriegern verloren. Doch ein wahrer Sohn Nennitas findet seinen Weg … Ca. 72.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ungefähr 360 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tarryn wollte nie etwas anderes vom Leben, als ein Sohn Nennitas zu sein – ein Bewahrer der Schriften, der Göttin der Weisheit geweiht. Doch als überzähliger Spross einer Adelsfamilie wird er gezwungen, eine Bündnisehe einzugehen – mit einem Mann. Einem Krieger in einem fernen Land, für den Tarryn ein wertloses Nichts ist. Ein notwendiges Übel, das eine Lieferung von Waffen, Kriegsrössern und Soldaten garantiert, mehr nicht. Ohne die Möglichkeit der Kommunikation ist er als Gelehrter unter raubeinigen Kriegern verloren. Doch ein wahrer Sohn Nennitas findet seinen Weg …
Ca. 72.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ungefähr 360 Seiten
Für Sanna und Brigitte. Was würde ich nur ohne euch machen? Vor allem, wenn ich mal wieder nur ganz schnell eine kurze Geschichte erzählen will …
B
ruder! Der Großmeister ruft nach dir!“
Tarryn nickte dem älteren Schriftgelehrten zu, der gerade durch die Tür des Schreibsaals getreten war und ihm die Botschaft hauchleise ins Ohr geflüstert hatte. Schließlich sollte niemand bei der Arbeit gestört werden.
Ohne sich hetzen zu lassen, beendete er den Satz, damit der Schwung nicht unterbrochen wurde. Es würde einem Laien nicht weiter auffallen, einem Bewahrer der Schriften hingegen bliebe nicht verborgen, wenn dort mitten in der Zeile neu angesetzt werden würde. Mithilfe der Streusanddose sorgte er dafür, dass die Tinte auf dem kostbaren Pergament abtrocknete und nichts verwischen konnte. Erst danach wusch er den Schreibkiel sorgfältig aus, verschloss das Tintenfass und trat von seinem Schreibpult zurück. Das Pergament ließ er liegen, er rechnete mit sofortiger Rückkehr an seinen Arbeitsplatz. Vermutlich wollte der Großmeister von ihm hören, wie weit er mit dem Auftrag vorangekommen war und ihm neue Wünsche des Kunden mitteilen.
Tarryn gehörte zu einem Konvent der Nennita. Sein Leben war der Herrin der Weisheit, der Heil- und Schriftkunst geweiht. In dieser Bruderschaft diente er als Bewahrer der Schriften. Sie kopierten unbezahlbare Pergamente, die zu verfallen drohten, schrieben Legenden, Erzählungen, wahre Ereignisse als Chronisten nieder, fertigten Verträge an, illuminierten Auftragsarbeiten für Adlige und Reiche, pflegten Bibliotheken und Archive. Die Kinder der Nennita schworen keine Keuschheit und besaßen einen herausragenden Ruf unter den vielfältigen Gottesdienern; darum waren sie ein beliebtes Auffanglager für überzählige Adelssprösslinge.
So war es auch Tarryn ergangen. Seit seinem fünften Lebensjahr war das Konvent seine Heimat. Der früheste Zeitpunkt, zu dem eine reguläre Aufnahme möglich war. Er schritt durch die vertrauten, hell von der Sonne erleuchteten Gänge. Im Frühjahr stießen sie die Holzläden weit auf und ließen Licht und frische Luft durch die ausgedehnten Schreibhallen strömen. Dort arbeiteten Tag für Tag über viele Stunden hinweg dreißig bis fünfzig Bewahrer der Schriften mit ihren Novizen. Im Winter und nach Einbruch der Dunkelheit mussten Laternen und Kerzen für das dringend notwendige Licht sorgen.
Tarryn atmete begeistert den Duft der zahllosen Blüten ein, die im Konventgarten austrieben. Das Summen der Bienen gab Zeugnis vom Fleiß ihrer wichtigen tierischen Helfer – der Konvent besaß dutzende Bienenstöcke, mit denen er sich selbst mit Honig als wichtiges Heilmittel und Wachs für die Kerzen versorgte. Eine Gruppe Frauen kreuzte seinen Weg. Sie stammten aus dem nah gelegenen Schwesternhaus. Die Töchter der Nennita erledigten dieselben Arbeiten wie die Bruderschaft, die Trennung der Geschlechter hatte vordergründig moralische Gründe, in Wahrheit ging es um Effektivität. Bei den vielen Heranwachsenden, die in den Häusern lebten, fürchtete man um Lernbereitschaft und Arbeitseifer der Jugendlichen, wenn sie gemeinsam unter einem Dach leben würden.
Tarryn neigte ehrerbietig den Kopf und grüßte die Schwestern.
„Bruder.“ Erst vor zwei Jahren, an seinem einundzwanzigsten Geburtstag, hatte Tarryn das graue Novizengewand gegen die weiße Robe eines Schriftenbewahrers eingetauscht. Noch immer fühlte er sich seltsam dabei, wenn ihm Respekt gezollt wurde. Noch weitere zwei Jahre, dann würde man ihm einen eigenen Novizen zuweisen. Ein unheimlicher Gedanke …
Zu dieser Stunde hielt sich der Großmeister üblicherweise in seiner privaten Schreibstube im Obergeschoss dieses Gebäudes auf. Es befand sich abseits vom Haupthaus mit den Wohn- und Schlafkammern der Bruderschaft. Auf Schritt und Tritt kam Tarryn an Wasserbecken vorbei, deren hauptsächlicher Nutzen darin bestand, im Fall eines Feuers sofort löschen zu können. Zwei Dinge fürchteten Schriftenbewahrer mehr als alles andere: Feuer und Hochwasser. Die Angst vor letzterem war der Grund, warum das Schreibhaus auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel errichtet worden war und die kostbarsten Schriften licht- und luftgeschützt im obersten Stockwerk untergebracht waren.
Noch einmal kurz die Robe gerichtet und über den glatt geschorenen Kopf gestrichen, dann klopfte Tarryn an der kunstvoll geschnitzten Tür der Schreibstube des Großmeisters.
„Tritt ein!“, erklang die fröhliche Stimme von Bruder Rantwyn, Großmeister des Konvents. Er war noch recht jung für seine hohe Würde, erst Anfang vierzig. Der vorherige Großmeister hatte zurücktreten müssen, als ihn sein Augenlicht im Stich zu lassen begann. Bruder Rantwyn war Tarryns persönlicher Lehrmeister gewesen, er wiederum sein erster Novize. Eine intensive Beziehung zwischen ihnen war weder zu leugnen noch weiter ungewöhnlich. Im Idealfall war der persönliche Lehrmeister wie ein Vater, der die gesamte Novizenzeit begleitete.
Es waren keine Worte notwendig, damit Tarryn erkannte, dass etwas nicht stimmte. Die Haltung, der niedergeschlagene Blick, das nervöse Kratzen über die sorgsam geschorene Glatze, sie verrieten es deutlich.
„Meister, Ihr habt Sorgen?“, stieß Tarryn hervor, noch bevor er die schwere Tür gänzlich geschlossen hatte.
„Oh ja, mein lieber Freund, große Sorgen sogar.“ Rantwyn seufzte laut. „Setz dich. Es sind Briefe gekommen. Sie betreffen dein Schicksal und entscheiden über deine Zukunft.“ Er reichte Tarryn einen Umschlag. Das Wappensiegel der drei Goldkugeln auf weißem Grund über der Pranke eines Hochlandbären sagte ihm, dass die Nachrichten von seiner Familie stammten. Jenen Menschen, die er seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Keinerlei Botschaften von Eltern oder Geschwistern, keine Besuche, nicht einmal Geschenke. Nichts davon, beinahe, als wären sie tot oder hätten vergessen, dass es einen weiteren Sohn gab, der legitim geboren war. Das geschah im Konvent in solcher Konsequenz praktisch nie, wenn Kinder lediglich abgegeben wurden, weil sie überzählig waren. Für gewöhnlich dauerte es einige Jahre, in denen zumeist die Mütter persönlich nach dem Rechten sahen, Präsente und Briefe schickten, bevor diese Fürsorge nach und nach einschlief – und auch das war eher selten.
Tarryn hatte lange darunter gelitten, sofort vergessen worden zu sein. Er hatte kaum Erinnerungen an die Burg oder die Ländereien seiner Familie, die Herrschersippe von Caeruth. Deutlich vor Augen hingegen hatte er das Gesicht seiner Mutter, die ihm beim Abschied die Hand auf den Kopf gelegt und ihm gesagte hatte, er solle ein guter, tapferer Junge sein und nicht heulen. Niemals dürfe er weinen, gleichgültig, was ihm widerfuhr.
Es hatte nicht lange gedauert, bis er gegen dieses Verbot verstoßen hatte. Die zweiwöchige Reise zum Konvent war ein Albtraum gewesen, der ihn bis heute regelmäßig aus dem Schlaf hochschrecken ließ. Tag für Tag hatte Tarryn allein in einer winzigen Kutsche gesessen, war dort elendig durchgeschüttelt worden, hatte sich nicht bewegen können, nichts zu tun gehabt. Keine Amme begleitete ihn, niemand kümmerte sich um ihn, um ihn abzulenken und darauf zu achten, dass es ihm gut ging. Endlose Tage, in denen er sich beständig gefürchtet, gelangweilt, gegen Übelkeit und Tränen gekämpft hatte. Nur wenn die Kutsche zum Halt kam, konnte er sich auf die Sitzbank stellen und aus der kleinen Fensteröffnung hinausblicken, wo er zumeist nichts erkennen konnte. Nach Einbruch der Dunkelheit musste er mit einem halben Dutzend Soldaten dasitzen und essen und erst dann konnte er seine Notdurft erledigen und, wenn er Glück hatte, für einige Zeit an frischer Luft umherlaufen. Wenn das Kommando ertönte, hatte er sofort in die Kutsche zurückzukehren, wo er allein schlafen musste. Niemand beachtete ihn, kümmerte sich um ihn oder richtete das Wort an ihn, außer, um ihm Befehle zu erteilen. Wie gut er sich an diese Nächte erinnerte! Die Angst vor jedem Geräusch, vor der Dunkelheit, der Einsamkeit und am meisten vor den Soldaten! Bereits am ersten Tag hatte er sich eingenässt, weil er beim Frühstück vor der Abfahrt wie gewohnt zwei große Becher Früchtetee getrunken und es danach nicht ohne Pause ausgehalten. Dafür war er verprügelt worden, bis er dachte, dass er sterben musste. Heute vermutete er, dass dies vielleicht sogar das Ziel des Hauptmanns gewesen war, der seinen Transport leiten musste – diese Männer hatten ihn dafür gehasst, dass er ein Kleinkind war, dass sie ihn auf dieser mühseligen Reise bewachen und beschützen mussten, dass er überhaupt lebte. Tarryn hatte ihre nächtlichen Gespräche belauschen können, die sich hauptsächlich darum drehten, welche Verschwendung es war, ein überzähliges Kind durchzufüttern, bis es alt genug war, um in ein Gotteshaus abgeschoben zu werden. Ab wie vielen Kindern man von „überzählig“ sprechen konnte, da gingen die Meinungen recht lebhaft auseinander. Tarryn war der achte Sohn seiner Familie, das zwölfte Kind insgesamt. Es war der hohen Kunst der Hebammen und Heiler zu verdanken, dass es diese Situation überhaupt geben konnte. Früher waren von zehn Kindern mindestens sieben noch vor dem ersten Geburtstag gestorben, heutzutage überlebten im Schnitt sechs bis acht. Die Soldaten waren sich einig, dass so etwas nicht richtig sein konnte, dass die Götter das gar nicht wollten … Mehr als sechs lebende Söhne brauchte kein Herrscherhaus. Weniger war besser, schließlich konnten die nicht alle erben. Dementsprechend waren sie mit ihm umgegangen und hatten nicht einmal seinen blutig zerschlagenen Rücken anständig versorgt oder ihm eine Decke gegen die nächtliche Kälte zur Verfügung gestellt. Weitere Prügel hatte Tarryn nicht erleiden müssen. Er hatte jedem noch so leisen Befehl gehorcht und kein einziges Mal vor den Männern geklagt, aus Angst vor weiteren Schmerzen. Seine Amme, die ihn fünf Jahre lang erzogen hatte, hatte ihm wohl gelegentlich einen Klapps gegeben, doch nie zuvor war Tarryn mit einem Stock geschlagen worden, bis Blut gespritzt war. Nie zuvor und auch nicht danach.
Als er im Konvent angelangt war, hatte es viele Tage gedauert, bis er den Schrecken der Fahrt abgeschüttelt hatte. Bis ihm aufging, wie freundlich die Brüder und Schwestern zu ihm waren, wie bemüht, dass er es gut hatte. Wie schön es war, von Gleichaltrigen umgeben zu sein. Dass niemand ihn schlug, wenn er einen Fehler beging. Wie viel Spaß es machte, etwas Sinnvolles lernen zu dürfen. Niemals hatte er sich seitdem etwas anderes gewünscht, als ein Sohn der Nennita zu sein.
Und nun, nach all den Jahren, wo seine Familie sich kein einziges Mal erkundigt hatte, ob er überhaupt noch lebte, kam dieser Brief:
„An Taralt, jüngster Sohn des Hauses Evingaer, Herrschersippe von Caeruth: Ich, Zar’aryn, Vater und Familienvorstand des zuvor genannten Taralt, bin erfreut verkünden zu dürfen, dass er auserwählt worden ist, zum Bündnisgatten von Ranulf zu werden, dem fünften Sohn der Herrscher von Skomark. Bündnisehen dienen nicht der Sicherung der Stammlinie. Aus diesen Verbindungen gehen keine Ansprüche auf Ländereien oder Titel oder anderweitige Erbschaften und Würden des jeweiligen Gefährten hervor.“
Es folgte eine ellenlange Auflistung, was eine Bündnisehe im Allgemeinen bedeutete, etwas, was Tarryn seit Jahren wusste. Zusammengefasst war das: Die eine Familie erhielt Waren, zum Beispiel Pferde, Waffen, Rohstoffe, Soldaten oder auch Land. Die andere zahlte dafür entweder mit Besitz oder Gold. Als Gewähr, dass bei diesem Geschäft nicht betrogen wurde, war es besonders unter einander fremden oder verfeindeten Sippen üblich, überzählige und damit unwichtige Kinder miteinander zu verheiraten. Ob Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann – das war in diesem Fall gänzlich unwichtig. Es ging ausschließlich um das Ehegelöbnis, das dafür sorgte, dass sich beide Sippen für die Dauer dieser Verbindung unter keinen Umständen bekämpfen durften und das Bündnispaar beschützt werden musste. Üblicherweise lebte einer der beiden solange wie ein echter Gefährte im Haushalt des anderen, bis das Geschäft vollständig abgewickelt war. Ein Vollzug der Ehe war nicht notwendig. Niemand wollte Fre’ynar, die Göttin des Herdfeuers und Schutzherrin des Ehegelöbnisses, verärgern, indem einem Bündnispartner absichtlich Schaden zugefügt wurde. Sollte sie zur Strafe das Herdfeuer verfluchen, konnte das im schlimmsten Fall eine ganze Sippe auslöschen. Eine Auflösung des Gelöbnisses in beiderseitigem Einverständnis war hingegen leicht möglich. Weder Mann noch Frau sollten Herd und Bett mit einem Gefährten teilen, wenn dies nicht wenigstens zu beiderseitigem Nutzen geschah. Aus einer Bündnisehe konnte allerdings auch Liebe erwachsen, sodass sie auch über die Erfüllung des Geschäftsvertrags beibehalten wurde. Das war nicht immer im Interesse der Sippen … Diese Gefahr sah Tarryn in seinem Fall nicht. Auf die Auflösung seiner eigenen Zwangsehe würde er allerdings lange warten müssen, denn die vertragliche Einigung mit den Herrschern von Skomark umfasste einen Zeitraum von fünf Jahren. Fünf! Jährliche Lieferungen von Waffen, Eisenerz, Salz und Streitrössern sollten stattfinden; der Gesamtumfang war viel zu groß, um ihn in kürzeren Abständen zu gewährleisten, da die Waren von Gardisten begleitet und gesichert werden mussten. Caeruth war durch eine Hügelkette von Skomark getrennt, die Pässe waren nur im Sommer gefahrlos zu beschreiten. In dieses Land sollte Tarryn gebracht werden. Dorthin, wo Sümpfe, ausgedehnte Graslande, dichte Nadelwälder, raues Klima und noch rauere Menschen gediehen. Raue Menschen, die zu einem Kriegsgott beteten und für ihre barbarischen Sitten berüchtigt waren.
Von Grauen geschüttelt ließ Tarryn den Brief sinken.
„Er hat nicht einmal meinen Namen richtig geschrieben“, flüsterte er. Das würde ihn nicht retten, wie er wusste. Er war der jüngste Sohn seiner Familie, damit waren alle Verträge rechtsgültig, ob sein Name stimmte oder nicht.
„Es tut mir unglaublich leid, mein lieber Freund“, sagte Großmeister Rantwyn, umfasste Tarryns Hände und drückte sie tröstend. Sein Blick war von Mitgefühl und Kummer erfüllt.
„Könnt Ihr mich nicht für den Konvent beanspruchen?“, fragte Tarryn verzweifelt.
„Es tut mir leid“, wiederholte Rantwyn geduldig. „Du weißt, dass Nennita keine eifersüchtige Göttin ist, sie gibt ihre Kinder jederzeit frei. Genau der Grund, warum Adelskinder bevorzugt in ihre Obhut geschickt werden.“
„Aber wenn ich von meiner Familie ausgeschlossen wurde …“ So dumm würde sein Vater nicht gewesen sein, doch die Hoffnung blieb, um sofort zerschlagen zu werden.
„In vielen Fällen werden Kinder mit einer einmaligen Spende an die Göttin zu uns gegeben. Das hätte mir die Möglichkeit gegeben, die Sache zumindest hinauszuzögern – der unmittelbare Anspruch deiner Familie an dich wäre erloschen und sie müssten mir ein hohes Angebot machen, damit ich dich freigebe. Deine Familie leistet allerdings eine jährliche Zahlung für deinen Unterhalt, du bist stets ein Mitglied dieser Sippe geblieben. Ich bezweifle auch, dass ich eine Forderung hätte stellen können, die für deinen Vater zu hoch gewesen wäre. Er ist zu mächtig, ich darf mir nicht seinen Zorn zuziehen.“
Niemand hatte Tarryn etwas von solchen jährlichen Zahlungen erzählt. Er hatte angenommen, dass seine Familie mit ihm gebrochen hatte. Ohne dieses Wissen war er davon ausgegangen, dass er ein friedvolles, glückliches und erfülltes Leben als Sohn der Nennita entgegenblicken durfte, statt sich um politische Ränke sorgen zu müssen. Hilflos starrte er seinen Großmeister an, von dem er sich verraten fühlte. Eine Vorwarnung, dass er jederzeit mit einem solchen Übergriff rechnen musste, hätte ihm vielleicht die Unbekümmertheit der vergangenen Jahre genommen, doch besser das als diesen Schock, der ihn wie ein jäher Abgrund zu verschlingen drohte.
Es hatte keinen Sinn, seinem Meister zu zürnen. Der hatte ihm Kummer ersparen wollen, vermutlich auf Anweisung des alten Großmeisters Urun. Erneut sah Tarryn auf den Brief hinab, dem jede persönliche Note, jeder Anschein familiärer Vertrautheit fehlte. Diese Leute, die sich nicht einmal an seinen Namen erinnerten, wollten ihn wie ein Stück Holz gebrauchen und sie hatten jedes Recht, genau das zu tun.
„Fünf Jahre“, wisperte er. „Dort steht nicht, ob ich anschließend nach Hause zurückkehren darf. Hierher, meine ich.“
„Ich bin sicher, dass dein Bündnisgefährte nach dieser Zeit das Gelöbnis lösen und dich zurückschicken wird“, erwiderte Rantwyn, noch immer mit diesem unerträglichen Ausdruck von Mitleid in der Stimme. „Deine Familie wird danach keine Verwendung für dich haben. Es ist für sie günstiger und angenehmer, dich zurück in die Obhut des Konvents zu geben. Sicherlich werden sie danach eine endgültige Abschlagszahlung leisten. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass jemand zwei Bündnisehen eingegangen wäre.“
Tarryn nickte. Es wäre möglich, aber die Fre’ynar-Priesterinnen weigerten sich in solchen Fällen üblicherweise. Sie wollten die Gunst der Göttin nicht verlieren, indem sie zwei Mal den Segen für einen Menschen herabbeschworen, der aus reinem Nutzen ein Gelöbnis ablegen wollte.
„Meister …“, begann Tarryn zögerlich. „Ich weiß, dass solche Ehen nicht vollzogen werden müssen, und gerade wenn zwei gleichgeschlechtliche Gefährten beteiligt sind, sieht man davon ab. Aber ich hörte, dass die Bewohner der Skomark andere Ansichten zu vielen Dingen haben und … Könnte mein Gatte mich zwingen?“
Meister Rantwyns gütiges Gesicht verdüsterte sich, bevor er sich von ihm abwandte. „Tarryn, ich will nicht lügen“, sagte er leise. „Der Gefährte, der den Verbündeten in seinem Haus aufnimmt, hat bei den Nordvölkern das Recht, nicht nur den Vollzug, sondern regelmäßige Gunst einzufordern. In ihren Sitten, Moralvorstellungen und Lebensweise unterscheiden sie sich vollkommen von uns, ihre Götter wie auch ihre Sprache sind uns fremd. Es heißt, dass sie mit ihren Frauen darum kämpfen, wer dem Haushalt vorstehen darf und damit dem Ehegefährten untertan ist. Nichts verachten sie mehr als Schwäche und Feigheit und wer nicht mehr länger als Krieger leben kann, begeht oft Selbstmord. Dir stehen schwere Zeiten bevor, Tarryn. Zumindest war es leicht für mich, das richtige Abschiedsgeschenk für dich auszusuchen.“ Er griff nach einem Buch, das auf dem Stapel neben ihm lag. Ein schwerer, ledergebundener Foliant, mit goldener Aufschrift und feiner Prägearbeit. Die Schnittkanten waren vollkommen gleichmäßig und mit Goldlack bestrichen. Ein sehr kostbares Werk, dennoch nicht weiter außergewöhnlich für die Sammlung des Konvents.
„Es ist ein Wörterbuch, von Großmeisterin Ephidrea erstellt, als diese vor etwa dreißig Jahren durch die Skomark gereist ist. Du findest Caeruthrisch in unserer Schrift links, das skomarkische Wort rechts, einmal in unserer, einmal in der fremden Schrift. Dazu reiche Illustrationen von Alltagsszenerien, Satzbeispiele, Hinweise zur Sprachbildung, die sich von unseren Regeln unterscheiden, einige Rezepte der landestypischen Mahlzeiten sowie den Text eines Kriegslieds, das Ephidrea wohl sehr geschätzt hat. Sie hat das Original unserem Haus geschenkt, aus Gründen, die ich nicht kenne. Das macht aus diesem Buch ein noch viel wertvolleres Kleinod, denn es gibt keine Kopie. Du verstehst, wie ungern ich es aus der Hand gebe? Du brauchst es dringender, da du kaum etwas über deine künftige Heimat weißt. Bring es zurück, wenn du wieder heimkehren solltest, Tarryn. Solange ich keine anderweitige Nachricht erhalte, giltst du als vollwertiges Mitglied dieses Hauses. Ich werde deiner Sippe eine Mitteilung senden, dass im Falle deines Todes dieses Buch zurück zum Konvent gebracht werden muss.“
Das klang bereits nach endgültigem Abschied … Tarryns Kehle schnürte sich zusammen.
„Meister!“, stieß er atemlos hervor. „Meister, sicherlich dauert es noch zwei Wochen, bis die Soldaten eintreffen, die mich von hier fortbringen sollen? Zeit, in der ich die fremde Sprache und Schrift und Sitten und Gebräuche von Skomark erlernen kann, zumindest in den ersten anfänglichen Grundzügen?“ Stammelnd umklammerte er die Armlehnen seines Stuhls. Er wollte nicht fort! Er wollte nicht erneut wie ein Sack Mehl in eine Kutsche geworfen und von Soldaten durch die Wildnis gezerrt werden! Von brutalen, mitleidlosen Kerlen, die weder Verständnis noch Geduld kannten und ihn dafür hassten, weil er Mühsal bedeutete. Allein der Gedanke weckte Erinnerungen an die grauenhafteste Zeit seines Lebens. Damals hatte es keine Vorwarnung gegeben, man hatte ihn einfach aus den Armen seiner Amme gepflückt und fortgeschickt.
„Mein lieber Freund.“ Rantwyns Augen füllten sich mit Tränen – was die Angst zur Panik anwachsen und Tarryn entsetzt aufspringen ließ.
„Dieser Brief sowie ein weiterer mit Anweisungen für mich wurde nicht von einem Boten überbracht, sondern von genau jenem Soldatentrupp, der dich nach Skomark bringen soll. Du hast noch Gelegenheit, deine Sachen zu packen und dich von deinen Brüdern zu verabschieden. Nach der Abendmahlzeit geht es bereits los.“
Tarryn presste das kostbare Buch wie einen Rettungsanker an sich. Als könnte es die schwarzen Schatten der Todesangst fernhalten, die gerade in sein Bewusstsein krochen und alles auslöschten, was ihm an Hoffnung und Lebensfreude geblieben war. Fünf Jahre. Fünf! Er wusste, warum Rantwyn ihm ein solches Buch überantwortet hatte. Der Großmeister glaubte nicht daran, dass er jemals lebendig zurückkehren würde. Jemand wie er, der seine Heldentaten am Schreibpult beging und sich nie einer größeren Gefahr aussetzte als Tintenflecken an den Fingern und Staubhusten vom Bewegen uralter Pergamentrollen zu riskieren, sollte einen Bund mit einem Krieger eingehen? Sein Gatte würde ihn vermutlich vergewaltigen, wie das Recht es gestattete, und ihn den Hunden zum Fraß vorwerfen, sobald er zu langweilig geworden war. Was kümmerte es einen blutsaufenden Mörder, ob die Herrin des Herdfeuers unzufrieden war? Nein, Hoffnung war vergebens. Die Reise nach Skomark, sofern er überhaupt lebendig das Ziel erreichte, würde die letzte seines Lebens sein.
I
ch kann nicht reiten.“ Tarryn stand in Sichtweite des Konvents, jenseits der übermannshohen weißen Mauern, die er bereits jetzt vermisste. Er starrte das Pferd an, das ihm der Hauptmann mit einer Geste angeboten hatte. Es war ein riesiges Tier mit braunem Fell und beängstigender Bemuskelung. Allein die Adern, die auf diesen gewaltigen Schenkeln auflagen, sie wirkten erschreckend auf ihn … Der Sattel befand sich noch oberhalb von Tarryns Kopf. Nun gut, er war nicht sonderlich groß, aber trotzdem. Völlig ausgeschlossen, dass er Leib und Leben einer solchen Bestie anvertraute!
„Ihr seid ein Sohn des Herrschers von Caeruth!“, fauchte der Hauptmann ungeduldig. „Eure Sippe regiert ein Land, das groß genug ist, dass man einen ganzen Monat braucht, um es zu durchqueren. Vierhundert Adelsfamilien knien im Staub vor Eurem Vater. Jede Sippschaft, jeder Landesherr im weitesten Umkreis fürchtet seinen Namen und den Eurer Brüder. Jeder junge Fürst, selbst wenn er aus der niedersten möglichen Familie entstammt, kann reiten. Also hört auf, Euch zum Narren zu machen!“
Tarryn wich unwillkürlich vor so viel Feindseligkeit zurück. „Ich bin ein Sohn der Nennita!“, brachte er tapfer hervor. „Im Konvent hat es niemanden interessiert, aus welchem Schoß ich einst entsprungen bin, denn ich war ausschließlich der Göttin der Weisheit geweiht. Man hat keinen Fürstensohn aus mir gemacht, sondern einen Bewahrer der Schriften. Ich kann lesen, schreiben, feinste Illustrationen erstellen, beherrsche vier Sprachen, Mathematik, Geometrie, Pflanzen- und Heilkunde. Ich könnte diesem Tier ein eitriges Geschwür aufstechen und zur Heiligung bringen. Reiten hingegen kann ich nicht. Nennitas Kinder laufen zu Fuß.“
„Das Vieh ist praktisch genügsam. Einfach draufsetzen. Einer von uns kann es an der Hand führen“, rief einer der Soldaten. „Es wird den anderen nachlaufen.“
„Spinnst du?“, zischte ein anderer. Sie sahen für Tarryn alle gleich aus – schwere Lederplattenrüstung, Helme, Schild, Schwert. Jeder der Männer war groß, muskelbepackt und strahlte gewaltsame Gefahr aus. Einen geringfügigen Unterschied gab es in Gestaltung und Farbe ihrer Bärte. Derjenige, der gerade gezischelt hatte, besaß einen hellbraunen Backenbart, der Hauptmann hingegen, dessen Miene sich gerade gefährlich verdüsterte, eine angegraute volle Manneszier. „Das ist ein Hengst, du Schwachkopf. Ein kleines Zeichen von Schwäche, und unser Nennita-Sohn übt den Weitflug.“
„Halt’s Maul!“, grollte er in Richtung Backenbart. „Wir sollen ihn innerhalb von drei Wochen in der Skomark abliefern. Das ist auch so schon ein hartes Stück Weg. Wie sollen wir es schaffen, wenn der Tintenkleckser zu feige ist, ein Pferd zu besteigen?“
Tarryn presste sein Bündel an sich. Der Tintenkleckser besaß Ohren und diesseits der Hügelkette verstand er leider noch jede Beleidigung. Er fühlte sich unwohl in der einfachen braunen Leinenhose und dem gleichfarbigen Überwurf. Nie hatte er seit seiner Ankunft im Konvent etwas anderes als Priesterroben getragen. Die Hose war zu weit und zu lang, aus Mangel an Gürteln bändigte er sie mit einem groben Strick. Das Hemd kratzte, die Ärmel musste er umschlagen, um seine Hände noch benutzen zu können. Passendere Kleidung war leider nicht vorrätig gewesen, er hatte erhalten, was Reisende einst zurückgelassen hatten. Dementsprechend fadenscheinig und geflickt war der Stoff … Es trug zu seiner allgemeinen Demütigung bei, dass er wie ein halb verhungertes Straßenkind aussah und es hatte eine entsprechende Wirkung auf die sechs Soldaten. Sie flößten ihm allein durch ihre massige Wirkung Angst ein, auch wenn sie ihn nicht mehr so gewaltig überragten wie damals, als er gerade einmal fünf Jahre alt gewesen und einem ähnlichen Trupp ausgeliefert worden war. Jeglicher Willkür stand er dennoch ebenso hilflos gegenüber wie vor achtzehn Jahren.
„Nun, ich sehe ein, dass Ihr nicht über Nacht lernen werdet, ein Kriegsross zu bändigen. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass der Gaul Euch einfach auf seinem Rücken ignorieren und den anderen nachtraben würde. Er ist schon recht alt und hat nicht mehr das Temperament wie ein junger Klepper. Dann setzt Euch eben auf den Vorratskarren. Und beeilt Euch dabei, das Tageslicht schwindet.“
„Ihr wollt ihn wie einen Bauerntölpel nach Skomark bringen?“, fragte der Backenbart. „Die werden ihn auffressen.“
„Ist das mein Problem? Nein. Er will nicht aufs Pferd. Also ab auf den Karren.“ Der Hauptmann schnaufte verächtlich. „Vielleicht erinnert er sich ja zwischendurch an ungeahnte Fähigkeiten. Als Kind ist er bei seiner Sippe aufgewachsen. Er muss geritten sein, noch bevor er laufen konnte.“
Stillschweigend kroch Tarryn auf den schweren Karren, der hoch mit Vorräten und Gepäckstücken und Zelten beladen war und von einem noch gewaltigeren Pferd als dem, das man für ihn gedacht hatte, gezogen wurde. Den Braunen spannten die Soldaten mit vor den Karren, wohl damit das zusätzliche Gewicht das Zugpferd nicht verlangsamte. Tarryn wusste mit ziemlicher Sicherheit, dass er auch in seinen ersten fünf Lebensjahren keinem Pferd zu nah gekommen war. Er erinnerte sich deutlich, wie seine Amme sich einmal bei einem Diener darüber beklagt hatte, dass sie Tag und Nacht mit ihm in einem finsteren Gemach hocken musste, das im Winter kaum beheizt wurde. Gelegentlich war er wohl an die frische Luft gekommen, doch man hielt ihn von seinen Geschwistern getrennt. Ihm geisterten Worte durch den Sinn, ob sie von einem Diener oder sogar von seinem Vater ausgesprochen wurden – und ob sie überhaupt jemals gesprochen worden waren – wusste er nicht: „Einem nutzlosen Balg, das bald weg ist, gibt man kein Pony! Der kann froh sein, dass er was zu essen bekommt, mehr ist er nicht wert!“
Also nein, er war wohl niemals in seinem Leben geritten oder anderweitig seinem Geburtsrang entsprechend erzogen worden. Sprich, Holzschwerter hatten auch nicht zu seinem kindlichen Alltag gehört. Das mussten die Soldaten nicht unbedingt erfahren. Im Moment behandelten sie ihn mit gerade noch angemessenem Respekt, wie es einem Adligen gebührte. Zähneknirschend, widerwillig, sehr unduldsam und alles andere als höflich, doch weitläufig stimmte das Weltbild noch. Tarryn wollte nicht riskieren, dass sie diesen letzten Respekt verloren. Als Kind hatte man ihn lediglich geschlagen. Heute würden sie ihm die Kehle durchschneiden und behaupten, es wären Räuber gewesen, nachdem er leichtsinnig in den Wald hineingelaufen war. Sehr ärgerlich für Tarryns Vater, aber nichts, wofür man gute Soldaten bestrafen müsste, die schließlich nichts dafür konnten, wenn sich Gesindel in der Wildnis herumtrieb.
Der Karren ruckelte los. Das Geschaukel war entsetzlich. Schon nach kurzer Zeit schmerzten ihm sämtliche Knochen, ihm war elend und er wusste nicht, ob ihm zuerst die Zähne herausfallen oder das Abendessen rückwärts kommen würde. Dabei hatte er kaum zwei Bissen herabwürgen können, so schrecklich war der Abschied gewesen. Im Nachhinein war er gar nicht wirklich undankbar dafür, dass das Ganze wie eine Springflut über ihn zusammengeschlagen war. Der Schock mochte ihm auf ewig in den Knochen steckenbleiben, aber wenn er zwei Wochen hätte warten und das Mitleid seiner Brüder ertragen müssen … Schwer zu sagen, was da besser gewesen wäre.
Ihr Götter! Dieses Gerumpel war pure Folter. Die Straße bestand offenbar ausschließlich aus Steinen und Schlaglöchern! Zwanzig Tage sollte er auf diese Weise überleben? Völlig ausgeschlossen.
Etwa zwei Stunden nach Aufbruch wurde es zu dunkel, um weiter reisen zu können. Tarryn war ein gutes Stück des Weges zu Fuß gelaufen und nur zwischendurch zurück in den Karren gesprungen. Sollten die Soldaten ihn für lächerlich halten, er hielt es nicht aus, die gesamte Strecke durchgeschüttelt zu werden. Leider war er nicht ausdauernd genug, um laufend mitzuhalten. Obwohl die Pferde im Schritt gingen, holten sie dabei mächtig aus und kamen deutlich schneller voran als ein Mensch, sofern dieser nicht im Eilschritt marschierte. Der Hauptmann war unzufrieden – er hatte zwölf Meilen für den heutigen Tag veranschlagt und kaum neun waren es wohl geworden. Entsprechend übellaunig erteilte er die Befehle, wer für was beim Aufbau des Nachtlagers zuständig war. Mit routinieren Bewegungen wurden die Zelte aufgebaut. Da sie alle vor dem Aufbruch im Konvent gegessen hatten, wurde kein Feuerholz verschwendet, um etwas Warmes zu kochen. Tarryn saß still auf dem Karren, um niemandem in den Weg zu geraten. Keiner sprach mit ihm, seine Mithilfe war nicht erforderlich oder gewünscht. Er war ein Stück Ballast, das transportiert werden musste. Nicht mehr und nicht weniger. Dementsprechend dankbar war er, als man ihm direkt das erste Zelt mit einer knappen Geste zuwies. Eine Decke oder anderweitigen Komfort gab es nicht, lediglich eine Stoffplane, die ihn vor Kälte, Nässe und den Unebenheiten des Waldbodens schützen sollte.
Seine Begleiter waren offenkundig davon ausgegangen, dass er die gesamte notwendige Ausrüstung für die Reise selbst mitbringen würde. Ein Versagen in der Absprache, das sich durch den Schock dieses unerwarteten Überfalls erklärte. Großmeister Rantwyn hätte ihm mit Freuden alles mitgegeben, wenn er gewusst hätte, dass die Soldaten ihn mit nichts als einem Zelt und Essen während der Reise versorgen würden. Nun, Reisen war für ein Kind der Nennita nicht weiter üblich, dementsprechend unerfahren war Großmeister Rantwyn in solchen Dingen. Für gewöhnlich kam jeder zu ihnen, der einen Auftrag erteilen oder kostbare Schriften zum Verkauf anbieten wollte. Zum Glück waren die Nächte nicht frostig, er würde also auch ohne Decke überleben.
Leider war er nicht im Mindesten abgehärtet. Tarryn war an strohgefüllte Matratzen, Federkopfkissen und warme Wolldecken gewöhnt. An wohltemperierte, gut belüftete Räume, die bei Kälte beheizt wurden. Auf blanker Erde zu liegen, nachdem ihm auf dem Karren die Knochen durchgeschüttelt wurden, dass ihm jetzt noch jeder einzelne davon schmerzte, tat ihm nicht gut. Ohne wärmende Decke fühlte er sich nicht sicher vor Insekten, Schlangen und andere nächtliche Besucher, auch wenn dieser Schutz eher im Kopf als tatsächlich existierte. Trotzdem trug dieses Empfinden von Unsicherheit zu seinem Unbehagen bei. Feuchtigkeit und Windböen drangen durch Zeltwände und -boden, die Kälte wiederum kroch ihm unter die Haut, nistete sich bis ins Mark ein und verhinderte jeden Gedanken an Schlaf. Bibbernd und zitternd quälte er sich durch die endlosen Stunden der Dunkelheit. So gerne wollte er schlafen, um seine Angst vergessen zu können, doch Ruhe war einfach nicht möglich.
Als es in den frühen Morgenstunden auch noch zu regnen begann, war es endgültig vorbei. Zwar war das Zelt wasserdicht, aber das Geräusch der prasselnden Tropfen ließ nicht einmal mehr kurzes Dösen zu.
Beim ersten Tageslicht rüttelte einer der Soldaten an seinem Zelt und rief: „Herr, wacht auf! Es geht gleich weiter!“
Tarryn hätte weinen können. Er fühlte sich völlig zerschlagen, dazu schmutzig, klamm und durchgefroren. Dementsprechend torkelte er, als er ins Freie trat.
„Wir frühstücken unterwegs“, wurde ihm mitgeteilt. „Bei dem Dauerregen ist leider kein warmes Essen möglich. Ihr habt ein paar Augenblicke für alles, was Ihr vor dem Aufbruch erledigen wollt.“ Tarryn nickte bestätigend. Der kalte Regen begann ihn bereits zu durchweichen, seine dünne Leinenkleidung bot keinerlei Schutz. Er stakste durch den Matsch, um seine Blase hinter einem Busch zu entleeren. Danach stieg er auf den Karren, bereits jetzt niedergeschlagen, gequält und bis auf den letzten Faden durchnässt. Besonders am Kopf fror er und wünschte, er hätte an ein Tuch gedacht, um den ungeschützten, kahl geschorenen Schädel zu bedecken. Spontan beschloss er, während dieser Reise das Rasieren sein zu lassen, auch wenn das einem Sohn Nennitas nicht anstand. Der nachwachsende Haarflaum würde ihm zumindest einen geringfügigen Schutz vor der Kälte bieten. Außerdem würde er heute nicht zu Fuß hinter den Pferden herlaufen. Nicht durch kniehohe Schlammlöcher. Es fehlte nur noch, dass er im Matsch ausrutschte und sich damit endgültig vor den Soldaten erniedrigte.
„Herr.“ Einer der Soldaten reichte ihm eine Schale mit Getreideklumpen, bestehend aus Roggenmehl, das mit Wasser aufgekocht und mit etwas Honig gewürzt wurde. Normalerweise aß man den Getreidebrei warm und direkt aus dem Kessel. Man konnte es allerdings auch auf Vorrat mitnehmen. Es nahm dabei eine unangenehme Konsistenz an und verlor jegliches bisschen Geschmack. Dass der Klumpen sich nun mit eisigem Regenwasser mischte, das Gerumpel im Karren kaum angenehmer als gestern war und Matsch bis zu ihm hochspritzte, machte die Mahlzeit nicht schmackhafter. Tarryn schaffte es kaum, zwei Löffel voll herunterzuwürgen, während die Soldaten gierig beim Reiten aßen.
„Wollt Ihr das nicht, Herr?“, fragte einer von ihnen, ein recht junger Bursche mit zauseligem dunklen Flaum am Kinn, aus dem wohl erst in einigen Jahren ein anständiger Bart wachsen würde. Schweigend reichte Tarryn ihm die Schüssel, froh, sie los zu sein. Er rollte sich zwischen Säcken und Bündeln möglichst klein zusammen, und wartete zähneklappernd darauf, was zuerst geschehen würde – dass der Regen aufhörte ihn zu quälen oder dass er erfor und es endlich hinter sich hatte.
Im Gegensatz zu ihm waren die Soldaten in lange Umhänge gehüllt. Diese schienen wasserabweisend zu sein und ihre Helme boten zusätzlichen Schutz. Jedenfalls wirkte es nicht, als ob einer von ihnen unter Kälte und Nässe zu leiden hatte. Vielleicht war Tarryn auch bloß verweichlicht bis an den Rand der Lebensunfähigkeit? Jedenfalls besaß er keinen Umhang. Sein schöner Wintermantel war mit dem Emblem des Konvents bestickt, darum hatte er ihn nicht mitnehmen können. An solche Banalitäten wie Regen hatte Tarryn keinen Gedanken verschwendet, als er über die Reise nachgedacht hatte. Auf der Hinfahrt hatte er sich fast ausschließlich in der Kutsche aufgehalten, da war die Witterung unerheblich gewesen. Weiter als bis zum Haus der Schwesternschaft war er bei schlechtem Wetter nie gegangen … Ihm war wirklich nicht bewusst gewesen, welch ein verwöhntes und priviligiertes Dasein er als Bewahrer der Schriften geführt hatte. Vermutlich würde ihn das umbringen, noch bevor sie die Häfte der Strecke überwunden hatten.
„Herr, wollt Ihr nicht langsam Euren Umhang überlegen?“, hörte er eine Stimme wie aus weiter Ferne. „Selbst wenn er nicht wasserabweisend sein sollte, könnte er Euch ein wenig schützen. Ihr seid längst nass bis auf die Knochen und ich bekomme Schwierigkeiten, wenn Ihr in meiner Obhut an Lungenentzündung sterben solltet.“ Der Hauptmann war es, der sein Pferd neben den Karren gelenkt hatte.
„Hab nichts“, stieß Tarryn bebend hervor.
„Dann Eure Decke? Irgendwas?“
„Hab nichts!“, wiederholte er. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie der Hauptmann sich das Bündel schnappte, in dem Tarryn seinen geringen Besitz aufbewahrte. Er wollte protestieren, doch dafür war er bereits zu schwach.
„Zwei Garnituren schlechte, viel zu dünne Leinenkleidung, Zahnpflegepulver, Seife, Rasiermesser, ein in Öltuch eingeschlagenes Buch. Das ist alles? Das ist Eure gesamte Ausrüstung?“, rief der Hauptmann ungläubig. „Keine Decke, kein wärmender Umhang, nicht einmal Geld? Oder ein Dolch zur Verteidigung?“
„Das dort ist mein gesamter Besitz“, erwiderte Tarryn matt. „Meine Familie hat mir nichts zukommen lassen, der Konvent hatte nichts weiter im Vorrat als diese wenigen Kleidungsstücke. Ihr habt mir keine Zeit zugestanden, mich auf die Reise vorzubereiten.“
„Diese Sachen sind also Leihgaben, sie gehören noch nicht einmal Euch?“, hakte der Hauptmann nach. Tarryn richtete sich mühsam auf, zitternd und bebend vor Kälte und zugleich innerlich brennend vor Scham. Sie hatten angehalten, wurde ihm mit sehr viel Verspätung bewusst.
„Die Kleidung wurde mir geschenkt“, sagte er möglichst würdevoll. „Ich darf sie verschleißen, wie es mir beliebt. Diese Sachen sind zu groß und bereits stark abgenutzt, aber ja, man könnte sagen, dass sie mir gehören. Das Gleiche gilt für die Körperpflegeausrüstung, sie ist mein Eigentum. Das Buch hingegen ist eine Leihgabe, das darf ich unter keinen Umständen verkaufen, aus irgendeinem Grund fortgeben oder zulassen, dass es beschädigt wird. Selbst wenn es den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen würde, es gehört mir nicht. An Geld habe ich nicht gedacht, ich bin davon ausgegangen, dass ihr genügend Ausrüstung und Verpflegung dabei habt.“
„Zusammengefasst besitzt Ihr auf dieser Welt also ein wenig Kleidung, Stiefel und ein Rasiermesser. Jeder Tagelöhner ist reicher ausgestattet als Ihr. Und selbst die meisten Bettler verfügen über eine Decke gegen die Nachtkälte und einige Münzen in der Tasche.“ Der Hauptmann schüttelte heftig den Kopf, gab Tarryn das Bündel zurück und beugte sich danach zum Karren hinab. Er nahm eines der zu Paketen geschnürten Zelte und löste die Haltebänder. „Herr, kriecht unter den Stoff. Er ist wasserabweisend und so dick, dass Ihr warm bleibt. Zieht vorher Eure nasse Kleidung aus, sonst holt ihr Euch endgültig den Tod. Bei der nächsten Gelegenheit kaufe ich eine Wolldecke für Euch. So viel gibt mein Reisebudget her.“ Die Worte waren beinahe freundlich. Der Tonfall, in dem sie hervorgestoßen wurden, gemahnte hingegen eher an eine Morddrohung. Der Blick des Hauptmanns sprach Bände: Er verachtete Tarryn aus tiefstem Herzen.
Um zu verhindern, dass er handgreiflich wurde und ihm aus lauter Ungeduld die nasse Kleidung eigenhändig vom Leib riss, brachte Tarryn es einfach hinter sich. Gekränkter Stolz war kein Grund, schamhaft zu sein. Die Soldaten hielten ihn bereits für ein wertloses Nichts, für weniger als einen Bettler. Was machte es da, wenn er sich Ihnen nackt präsentierte?
„Wurdet Ihr von den Schreibbrüdern oft geschlagen?“, fragte der Hauptmann und wies auf Tarryns entblößten Rücken. Dorthin, wo sich mehr als ein Dutzend feiner, weißer Linien kreuzten.
„Kein einziges Mal“, entgegnete er und kroch hastig unter die Stoffbahnen des Zelts. Mit nichts als seinen Stiefeln am Leib lag er unter diesem überraschend schweren Haufen.
„Euer Bündel ist wasserdicht, nehmt es doch als Kopfstütze. Dem Buch ist nichts geschehen, Herr“, murmelte der Hauptmann. Sein Tonfall hatte sich geändert. Mit einem Mal klang er peinlich berührt. Auf unangenehme Weise betreten. Erklärt wurde das nicht. Dafür ruckelte der Karren wieder an.
Es dauerte ziemlich lange, bis Tarryn aufhörte zu zittern. Er lag nackt auf seiner durchnässten Kleidung – der Karren war selbst nass und der Stoff schützte ihn vor Splittern. Sein Körper musste zunächst die notwendige Wärme bilden, die von den schweren Bahnen des Zelts eingefangen und gehalten werden konnte. Er hatte diese Bahnen dergestalt drapiert, dass auch sein Kopf vor dem Regen größtenteils bewahrt blieb und er dennoch atmen konnte. Bestimmt eine Stunde oder mehr verging mit übelkeitserregendem Schaukeln und unaufhörlichem Prasseln. Bis es schließlich warm wurde und zugleich Erschöpfung über ihn hinwegwusch. Schlafen konnte Tarryn nicht, dafür war die Fahrt zu unruhig. Doch er dämmerte in einen Zustand hinein, wo ihn all das nicht mehr länger quälte. Es würde vorbeigehen. Auf die eine oder andere Weise.
Als sie anhielten, war es bereits stockdunkel und die Soldaten hatten Laternen entzündet, damit die Pferde ihren Weg fanden.
„Endlich wieder im Zeitplan!“, verkündete der Hauptmann und rieb sich zufrieden die Hände. Der elende Regen wollte nicht aufhören, darum wusste Tarryn nicht, wie man sich so darüber freuen konnte, dass man zwei Meilen mehr geschafft hatte. Aber er war ja auch kein Soldat, sondern lediglich ein Stück Transportgut, also war seine Meinung unerheblich.
„Freut Euch, Herr“, sagte einer der Soldaten – der junge Kerl, der ihm heute Morgen das Frühstück abgenommen hatte. „Kein Zelt heute Nacht, dafür ein schönes Feuer und ein festes Dach über dem Kopf.“
Tarryn blickte über den Karrenrand, wofür er sich halb aufrichten musste. Er konnte außer Schatten, Silhouetten von Baumstämmen und noch mehr Dunkelheit nichts erkennen. Die Gelegenheit, sich in trockene Kleidung zu hüllen, ohne noch einmal seinen Körper nackt präsentieren zu müssen. Sie waren vom Weg abgewichen und befanden sich unter dichten Baumkronen, wo der Regen sie nur noch in vereinzelten Tropfen erreichte. Er war gerade fertig mit dem Ankleiden, hielt sein Bündel in der rechten, die feuchten Sachen in der linken Hand, wobei er sich ungeschickt unter dem Zeltstoff vor der Nässe zu schützen versuchte, als der Schein einer Laterne auf ihn zukam.
„Kommt mit“, hörte er die Stimme des Hauptmanns. „Es sind lediglich ein paar Schritte, wir nächtigen heute in einer verlassenen Bauernhütte.“
Die war exakt so klein und beengt, wie Tarryn sich das vorstellte. Möbel gab es keine mehr, dafür waren Lehmwände und Dach noch vollständig intakt und im Kamin loderten bereits die ersten Flammen auf, als er eintrat. Der festgestampfte Lehmboden war trocken und eben. Obwohl er den ganzen Tag liegend verbracht hatte, fühlte er sich vollkommen zerschlagen und war glücklich, als er sich nah am Feuer einrollen durfte. Jemand legte ihm eine Decke über. Eine unerwartet freundliche Geste, die er nicht zu zerstören wagte; darum hielt er die Augen geschlossen und reagierte nicht, ganz so, als würde er schlafen.
„Der is‘ völlig hinüber“, sagte einer der Männer leise. „Wahrscheinlich wird er uns am Lungenfieber verrecken.“
„Möglich“, erwiderte der Hauptmann. „Andererseits ist er jung und gut genährt. Ein Leben als Gottesdiener mag ihm nicht wohlgetan haben, um ihn auf Reisen vorzubereiten. Eine starke Grundlage kann dennoch genügen, um durchzukommen.“
„Ist er wirklich ein Herrschersohn? Ich kann es nicht recht glauben“, flüsterte der junge Bursche mit dem zauseligen Bartflaum. Tarryn drehte sein Gesicht so, dass es im Schatten lag und er nach Belieben Grimassen ziehen konnte. Wenn sie schon über ihn sprachen und er jedes Wort mit anhören musste, sollten sie ihn nicht beim Lauschen erwischen.
„Ich habe heute beim Reiten lange Zeit nachgedacht“, sagte der Hauptmann zögerlich. „Über Dinge, die vor vielen Jahren geschehen sind. Dinge, die man mir erzählt hat und damals keine Bedeutung für mich hatten. Es ist so: Vor rund achtzehn Jahren, es kann auch mehr sein, diente ich noch als blutjunger Gefreiter unter einem der niedrigen Edelmänner. Der hohe Fürst Evingaer forderte von meinem Herrn einen Soldaten für einen Geleitschutztrupp. Der Trupp war aus Männern von verschiedenen niedrigen Adelsfamilien zusammengestellt, keiner davon stammte von der Herrschersippe selbst. Es hieß, wir würden einen Bastardsohn des Herrschers zu jenem Nennita-Konvent begleiten, der auch diesmal das Ziel gewesen war. Ein unwichtiges, ungewolltes Balg, für das der Herr nicht seine eigenen Leute belasten wollte. Es hieß ausdrücklich, dass wir uns keine weitere Mühe mit ihm geben und ihn nicht als Adligen behandeln sollten. Das wäre uns noch gleichgültig gewesen, aber es war keine Amme bei dem Jungen, oder irgendjemand sonst, der sich um ihn kümmern sollte. Wir alle waren wütend, weil wir für eine dämliche Rotznase von gerade fünf Jahren, die man bei Geburt hätte ersäufen sollen, wochenlang durch die Wildnis reisen mussten. Für das Balg war eine Kutsche aus rohen Planken zusammengezimmert worden. Darin war der Junge Tag und Nacht eingesperrt. Wir haben ihn bloß morgens und abends kurz zu Gesicht bekommen, damit er pinkeln, scheißen und essen konnte.“
„Ein Kleinkind zwei Wochen lang in eine Kiste sperren ist Folter“, murrte einer der Männer. „Er hat euch sicherlich die Ohren vollgebrüllt?“
„Das hatten wir erwartet“, entgegnete der Hauptmann. Seine Stimme nahm einen seltsam gedrückten Tonfall an. „Tatsächlich hat er bloß ein einziges Mal geschrien. Gleich am ersten Tag hat er sich vollgepisst. Wir hatten keine Pause gemacht und er hatte vor dem Aufbruch wohl einiges getrunken. Es war wie gesagt niemand da, der ihn waschen und umziehen und den Boden der Kutsche abwischen konnte. Vor Zorn ist der Truppführer außer sich geraten, hat von einer Weide einen langen Zweig abgeschnitten, dem Kind die Kleider vom Leib gerissen und es geschlagen, bis das Blut spritzte. Der Kleine hat so dermaßen geschrien …“ Der Hauptmann stockte kurz, bevor er seufzte und fortfuhr: „Als er aufhörte zu schreien, kam der Mann endlich zu sich und hat von ihm abgelassen.