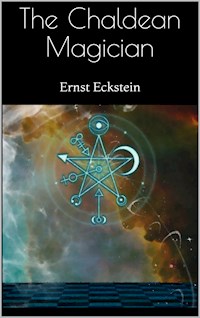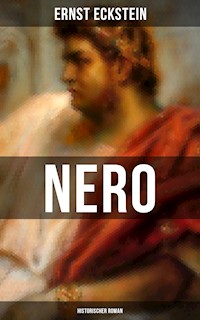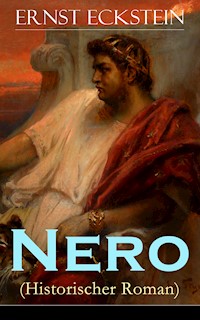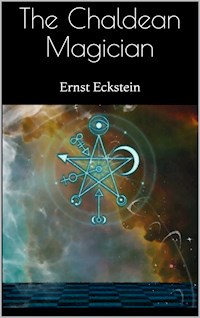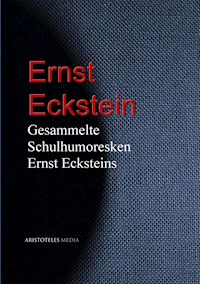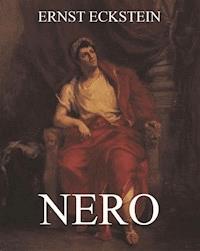
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ecksteins Roman stellt sich der Aufgabe, den Lesern zu schildern, wie und durch welche Momente sich der ursprünglich so milde, unverdorbene, groß und edel veranlagte Nero in das übermenschliche Ungeheuer verwandelt hat, von dem uns die alten Autoren so unbegreifliche Dinge erzählen. Spannend und authentisch erzählt gehört dieser biographische Roman zu den großen Werken historischer Romane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nero
Ernst Eckstein
Inhalt:
Ernst Eckstein – Biographie und Bibliographie
Nero
Zum Eingang.
Erstes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Zweites Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Drittes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Nero, E. Eckstein
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849628154
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ernst Eckstein – Biographie und Bibliographie
Deutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 6. Febr. 1815 in Gießen, gest. 18. Nov. 1900 in Dresden, studierte 1863–67 in Gießen, Bonn, Berlin und Marburg Philologie und Philosophie und wandte sich 1868 nach Paris, wo er sein Erstlingswerk, das humoristische Epos »Schach der Königin« (Stuttg. 1870; 3. umgearbeitete Aufl., das. 1877), vollendete. Das groteske Nachtstück »Die Gespenster von Varzin« (3. Aufl., Leipz. 1877), das komische Epos »Der Stumme von Sevilla« (Stuttg. 1871) und die »Pariser Silhouetten« (3. Aufl., Leipz. 1876) fallen gleichfalls in diese Zeit. Nach wiederholten größern Reisen veröffentlichte er das satirische Epos »Venus Urania« (Stuttg. 1872; 5. Aufl., Berl. 1883) und zwei Bände »Novellen« (»Margherita«, »Am Grabmal des Cestius«, »Die Moschee von Cordova« u.a., Leipz. 1874; 2. Aufl. 1880), lebte dann 1872–74 als Mitarbeiter der »Neuen Freien Presse« in Wien und nahm 1875 seinen Wohnsitz in Leipzig, wo er eine Zeitlang die poetisch-kritische Zeitschrift »Deutsche Dichterhalle« sowie (bis Ende 1882) die humoristische Wochenschrift »Der Schalk« redigierte. 1885 siedelte er nach Dresden über. Seine poetische Produktion begann etwas in die Breite zu schwellen, besonders seitdem die Humoresken »Aus Sekunda und Prima« (Leipz. 1875, 56. Aufl. 1893), aus denen »Der Besuch im Karzer« (das. 1875, 57. Aufl. 1902) besonders abgedruckt (auch dramatisiert) ward, sich eines glänzenden äußern Erfolgs erfreuten. Außer einer Reihe weiterer Humoresken sowie den Gedichtsammlungen: »Initium fidelitatis« (Leipz. 1875 u. ö.), »Exercitium Salamandri« (Leipz. 1876 u. ö.), »Jucunda juventus« (das. 1893) folgten unter anderm: »Satirische Zeitbilder« (1876, 4. Aufl. 1878); »Das Hohelied vom deutschen Professor« (1878, 6. Aufl. 1890); »Pariser Leben« (4. Aufl. 1879); »In Moll und Dur«, Gedichte (1877); »Murillo«, ein Lied vom Guadalquivir (1880); »Glück und Erkenntnis«, Studienblätter und Skizzen (1881, sämtlich Leipzig) und zahlreiche Novellen: »Lisa Toscanella« (Stuttg. 1876, 3. Aufl. 1878), »Sturmnacht« (das. 1878, 2 Bde.) u.a. Von seinen Romanen, in denen er mit Vorliebe antike Stoffe behandelte, nennen wir: »Die Claudier« (Wien 1881, 3 Bde.; 16. Aufl., Leipz. 1901), »Prusias« (Leipz. 1883, 3 Bde.; 5. Aufl. 1896), »Das Vermächtnis« (das. 1884, 3 Bde.), »Aphrodite« (das. 1885), »Hertha« (Berl. 1890), »Pia« (Leipz. 1887), »Jorinde« (das. 1888), »Nero« (das. 1889, 3 Bde.), »Camilla« (das. 1889), »Dombrowsky« (Dresd. 1892, 2 Bde.), »Themis« (Berl. 1892, 2 Bde.), »Familie Hartwig« (das. 1894), »Kyparissos« (das. 1895), »Roderich Löhr« (das. 1896), »Die Hexe von Glaustädt« (das. 1898), »Die Klosterschülerin« (Dresd. 1899); »Der Bildschnitzer von Weilburg« (Berl. 1900). Ecksteins poetisches Talent zeichnet sich vor allem durch sprudelnde Laune und große Formgewandtheit aus. Schriften literarisch-ästhetischen Inhalts (zum Teil gesammelte Beiträge zu Zeitschriften) sind: »Leichte Ware« (Leipz. 1875), »Beiträge zur Geschichte des Feuilletons« (das. 1876, 2 Bde.), »Guttae in lapidem« (das. 1879), »Ringkämpfe« (das. 1886), »Verstehn wir deutsch?« (2. Aufl., Dresd. 1894) u.a.
Nero
Zum Eingang.
Der vorliegende Roman stellt sich die Aufgabe, seinen Lesern zu schildern, wie und durch welche Momente sich der ursprünglich so milde, unverdorbene, groß und edel veranlagte Nero in das übermenschliche Ungeheuer verwandelt hat, von dem uns die alten Autoren so unbegreifliche Dinge erzählen. Aus dieser Absicht ergibt sich naturgemäß die umfassendere Behandlung der einzelnen Entwicklungsstadien im Vergleich mit den Ausschreitungen des fertigen Missethäters. Sobald der Cäsar den Höhepunkt seiner Entartung erreicht hat, ist unser Problem der Hauptsache nach gelöst; nur die Entsühnung, falls eine solche möglich erscheint, reizt noch unser künstlerisches Interesse.
Dies zur Vorbemerkung für solche Leser, die, verführt durch die herkömmliche Betrachtung dieses Charakters, vielleicht eine breitere Ausmalung des Schauderhaften und Widerlichen erwartet haben.
Noch sei hier erwähnt, daß die Ereignisse, die sich in Wahrheit auf einen erheblich längeren Zeitraum verteilen, aus leicht ersichtlichen Gründen zusammengedrängt worden sind. Auch sonst finden sich kleine Abweichungen von der Chronologie, die nicht über Gebühr auffallen werden. Für diese und andere Punkte – insbesondere für die innere Motivierung der geschichtlichen Vorgänge – nehme ich selbstverständlich ganz die gleiche Freiheit in Anspruch, die der Dramatiker, einem historischen Stoff gegenüber, längst als sein unbestreitbares Recht betrachtet. Uebrigens wird ein genaueres Studium der einschlägigen Litteratur den Beweis liefern, daß gar manche »Kühnheit«, die den Leser anfänglich überrascht – so z. B. die Intimität der Poppäa Sabina mit der Phönicierin Hasdra, die Beziehungen Senecas zu dem Fanatiker Nicodemus, die Genesis der Christenverfolgung u. a. – nicht so ganz in der Luft schwebt, sondern durch die Berichte der alten Autoren und die neue und neueste Kritik vielfach getragen wird.
Erstes Buch.
Erstes Kapitel.
Drei Soldaten des römischen Stadtpräfekten schleppten einen Gefangenen durch die cyprische Gasse.
Der kaum vierundzwanzigjährige Mensch war zum Tode verurteilt. Er sollte durch die Klinge des Henkers enthauptet und dann auf dem Anger der Missethäter vergraben werden.
Ueberall, wo die Bewaffneten mit dem jungen Manne vorüberkamen, blieb man einen Augenblick stehen. Das bleiche und doch so gefaßte Antlitz des Unglücklichen erregte selbst bei den leichtlebigen Römern eine gewisse Teilnahme. Dies Volk, das jährlich Tausende von Gladiatoren und Tierkämpfern bluten und sterben ließ, dem das Röcheln der Todesopfer die wonnevollste Musik war, schien von plötzlichem Mitleid ergriffen. Insbesondere die Frauen: denn Artemidorus war schön. Die ebenmäßigen Züge, klar, wie in Marmor gemeißelt, das schwärmerisch-dunkle Auge mit den tiefschwarzen Wimpern, die edle Stirn und das prächtige Haupthaar – dies alles gemahnte fast an die würdevolle Erscheinung des Phthapriesters Necho, der die vornehme Damenwelt Roms gleichermaßen durch die Kunst seiner Weissagung wie durch den Zauber seiner Persönlichkeit fesselte.
Auch Artemidorus war Orientale.
Er entstammte dem fernen Damaskus, war zu Jerusalem von dem Senator Flavius Scevinus käuflich erworben und mit nach den sieben Hügeln gebracht worden. Bald danach mit der Freiheit beschenkt, diente er seinem ehemaligen Eigentümer als Schatzmeister, Vorleser und Bibliothekar, ja beinahe als Vertrauter, bis ein plötzlicher Umschwung der Dinge dies friedliche und behagliche Dasein zerstörte und den einst so Beneideten in die Arme der Häscher warf.
Je mehr man dem entsetzlichen Ziele sich näherte, um so schwerer und zögernder schritt Artemidorus einher. Der Obersoldat, der die kleine Geleitschaft befehligte, mußte ihn wiederholt durch ernsthafte Mahnworte aufrütteln.
Es war ein wundervoller Oktobertag. Ganz Rom schien wie in flüssigem Golde zu schwimmen. Rotglühendes Weinlaub, mit dunkelbeerigen Trauben durchsättigt, hing über die Mauern der Gärten oder schmiegte sich an den weithinschattenden Ulmen hinauf. Ein unbeschreiblicher Hauch von Frische und Lebenslust wehte durch alle Straßen. Die Männer hielten sich stattlicher, die Frauengesichter leuchteten schöner und lockender.
Ihm wenigstens dünkte es so, dem armen Verurteilten, der in kurzer Frist Abschied nehmen sollte von dieser Welt des glänzenden Scheins.
Wo war jetzt der vertrauende Todesmut, der noch vor kurzem seine Adern geschwellt hatte wie vom Odem eines besseren übermenschlichen Daseins?
Wie er die purpurfarbigen Reben so wogen und wuchern sah, gedachte er einer zierlichen Rhodierin, deren schamhaft gerötete Stirne er einst mit solchem Blattwerk geschmückt hatte, – in glücklicher Einsamkeit, tief in der lauschigen Parkwildnis seines Gebieters.
»Chloris, Chloris!« seufzte er qualdurchschauert.
Welch ein Verhängnis, daß ihm das Bild der Geliebten gerade jetzt vor die Seele trat, wo er all seiner Kraft und all seiner Lebensverachtung benötigte, um zu zeigen, daß ein Jünger des Zimmermannssohnes von Nazareth freudig und hoffnungsklar dem Beispiele seines Heilands folgt!
So sehr er dagegen ankämpfte, seine Erinnerung malte ihm die ganze glückberauschte Vergangenheit in brennender Farbenpracht.
Vor einigen Wochen erst hatte er Chloris gesehen, als sie im Hause des Cajus Calpurnius Piso die neunsaitige Kithara spielte und dazu ein fröhliches Liebeslied des Alcäus vortrug. Es war dies ihr erstes Auftreten auf dem gefährlichen Boden der Siebenhügelstadt, – und gleichzeitig ihr erster Triumph. Alles jubelte ihrer köstlichen Meisterschaft, ihrer herrlichen Stimme zu.
Artemidorus, der sich in der Gefolgschaft seines Gebieters Flavius Scevinus befand, war wie verzaubert. Von dieser Minute an hatte er keinen andern Gedanken als ihren Besitz.
Doch – einen andern, einen höheren Gedanken: ihr Seelenheil! Nach jener unvergeßlichen Stunde, da er zum erstenmal ihre Lippen geküßt, war ihm der leidenschaftliche Wunsch erwacht, die Verlorene zu retten. Verloren war sie, der Anschauung des gläubigen Nazareners zufolge, wenn es ihm nicht gelang, sie von der himmlischen Wahrheit zu überzeugen, die Jesus Christus geoffenbart hatte.
Artemidorus warb daher, wie er erst um ihr Herz geworben, voll Inbrunst um ihre Seele.
Leider vergeblich.
Chloris kannte das Leben nur von seiner rosenfarbensten Seite her. Die Erde schien ihr ein duftiger Lustgarten, recht geschaffen zum Glück und zum kampflosen Frohgenuß. Als Griechin schreckte sie vor allem Herben und Düstern zurück; die Kreuzeslehre mit ihrem schwermutsvollen Entsagen wollte nicht Eingang finden in diesem Gemüt, das ganz durchtränkt war von der Sonnenhelle der althellenischen Götterwelt. Die schöne Kitharaspielerin zuckte die Achseln; sie lächelte; sie erklärte ihrem Artemidorus, daß er sie langweile, und schloß nach langem unerquicklichem Widerstreit mit einem spöttischen »Niemals!«
In hellem Ingrimm hatte er die Geliebte nach diesem »Niemals!« verlassen. Nicht auf sie zürnte er, – denn es war ja nicht ihre Schuld, wenn die bösen Geister ihr thörichtes Herz so umklammert hielten, – sondern auf die Tücke der alten Götter, die trotz der Geburt des Erlösers noch so viel Macht besaßen über die Reinsten selbst und die Edelsten.
So geschah denn, was ihm die Anklage wegen Beschimpfung der Staatsreligion und die Verurteilung zum ehrlosen Tode zuziehen sollte. . . .
War sein Elend vielleicht nur eine Strafe der einen und wahrhaftigen Gottheit? Wollte sie ihn zu Boden schmettern für die Hartnäckigkeit, mit der seine Liebe an Chloris, der Spötterin, festgehalten?
Er übersann dies alles in wirrer Gedankenfolge. Keuchend kämpfte er wider die seltsamen Regungen, die ihn fast zu ersticken drohten. Er versuchte zu beten. »Selig sind, die um der Lehre des Heilands willen den Tod erleiden,« murmelte er mit zuckender Lippe. Weiter kam er nicht. Das goldene Sonnenlicht strömte jetzt so voll über den Weg; ein balsamischer Lufthauch quoll ihm entgegen – und alle Heilslehren übertäubend, schrie es laut in seinem geängstigten Herzen auf: »Wehe deiner blühenden Jugend!«
Er fühlte die warmbeglänzte Herrlichkeit, die ihn um gab, wie eine grausame Verschärfung seines Geschicks. »So sterben zu müssen, – fern von ihr . . .!« klang es ihm unaufhörlich durch das brennende Hirn; – »fern von ihr, fern von ihr!«
Ja, die unerbittliche Gottheit hatte ihn auserlesen zur Höchsten irdischen Marter, zur tiefsten Verzweiflung. Wäre sein scheidender Blick nur noch einmal dem der Geliebten begegnet, – welch ein Labsal in der letzten fürchterlichen Minute! So aber – das war der Tod noch während des Lebens!
»Fern von ihr!« brauste es um ihn her. »Fern von ihr!« Die Kniee wankten ihm. Es ward ihm schwarz vor den Augen.
»Taumele nicht!« sagte der Obersoldat. »Wenn du denn sterben mußt, so stirb wie ein Mann!«
Artemidorus raffte sich auf. Die Anwandlung war vorüber. Er holte Atem und schritt dann ruhig und gleichmäßig weiter.
Jetzt, da die Geleitschaft mit dem Verurteilten links in südöstlicher Richtung von der cyprischen Gasse abbog, drängten sich Männer und Frauen, meist in ärmlicher Kleidung, so dicht und zahlreich heran, daß die Eskorte für einige Augenblicke nicht weiter konnte.
»Artemidorus!« erklang es in allen Tonarten. »Sei standhaft, Artemidorus! Fahr wohl, Artemidorus! Vergiß deine Freunde nicht! Bitte für uns vor dem Thron des Allmächtigen!«
Einzelne ergriffen die gefesselten Hände des jungen Mannes und küßten sie; andre stimmten nach feierlich klagenden Melodien Gesänge an, in denen der Name »Jesus« durch besonders eigenartige Tonverbindungen gekennzeichnet war.
Ein hochgewachsener, hagerer Fünfziger, dessen breitschimmernder Goldring verriet, daß er dem Ritterstand angehörte, bahnte sich jetzt den Weg durchs Gedränge.
»Gestattest du,« sagte er zu dem Obersoldaten, »daß ich euren Verurteilten, eh' sich sein Schicksal erfüllt, noch einmal umarme?«
Der Soldat krauste die Stirne. Die Anzahl derer, die hier von allen Seiten mit Artemidorus sympathisierten, flößte ihm augenscheinlich Bedenken ein. Er durfte den finsterblickenden Mann, der die Toga so stolz und bedrohlich über der Schulter trug, nicht schroff zurückweisen wie einen schäbigen Kornspenden-Empfänger.
»Mach's kurz!« sagte er zögernd. »Ich bin sonst nicht von Eisen und Stein: aber hört's der Präfekt, so komm' ich in Ungelegenheiten.«
»Nicodemus!« flüsterte Artemidorus, während der Freund ihm wie segnend einen Kuß auf die Stirn drückte, – »welch ein Schicksal! Welch ein trauervolles Verhängnis!«
»Mut, mein Sohn! Harre aus bis zuletzt! War es unklug, daß du so voreilig wider den Wall gestürmt, so war es doch immerhin hochherzig. Glückliche Jugend, die da nicht ahnt, wieviel sicherer der ruhige Bedacht zum Ziele führt, als der Zorn und das Ungestüm!«
»Du hast recht,« murmelte Artemidorus. »Da ihr doch alle so hoffnungsfreudig der Zukunft entgegensaht, kam es mir, einem der Jüngsten, vielleicht nicht zu. . . . Aber Chloris, die hassenswerte, geliebte Chloris war daran schuld mit ihrem entsetzlichen Unglauben. Ich war wie von Sinnen. Alles, alles hatte ich aufgeboten: umsonst! Und wie ich nun heimkehre und erblicke im Atrium die abscheulichen Götzenbilder mit ihrem höhnischen Grinsen . . .«
»Schweig! Du hast die römische Gesellschaft gereizt, – und das war zwecklos. Niemand wird hier seines Glaubens wegen gekränkt. Wir können und werden in aller Ruhe und Vorsicht den Pfad verfolgen, der den Bekennern des Evangeliums klar vor der Seele steht. Nur keine Stürme, keine Gewalttaten! Auch du, mein teurer Artemidorus, wärest bei dem, was ich so mühsam geplant habe, vielleicht ein Bundesgenosse gewesen. Ich bin trostlos, dich verloren zu haben!«
Der junge Mann richtete sich hoch auf.
»Wie? Du beklagst mich? Aber ist es denn nicht das Höchste, was Gottes Huld uns bescheren kann: siegreich dahin zu sterben als Blutzeuge für die Lehre von Nazareth?«
»Dein Zeugnis, Artemidorus, wird nicht verloren sein,« flüsterte Nicodemus beschwichtigend. »Aber du hättest leben können, leben . . .«
Mitten in seiner Rede ward Nicodemus durch eine plötzliche Unruhe in den Reihen des Volks unterbrochen. »Der Kaiser!« klang es von hundert Lippen zugleich, und aller Augen wandten sich in der Richtung der Porta Querquetulana, von wo eine prachtvolle Sänfte mit purpurnem Baldachin langsam näher kam. Acht stämmige, flachsblonde Sigambrer in scharlachroter Gewandung trugen das verschwenderisch ausgestattete Prunkbett auf Tragbalken von vergoldetem Zedernholz.
Die faltenreichen Gardinen waren zurückgeschlagen.
In den Kissen lehnte ein stolzes, majestätisches Weib – Agrippina, die Kaiserin-Mutter – und ihr zur Seite ein Jüngling von gewinnender Schönheit, beinahe mädchenhaft in dem Ausdruck seiner großen, forschenden Augen, den üppigen Mund von einer Fülle liebenswürdiger Gedanken umspielt, halb Küsse atmend, halb Melodien träumend.
Der Führer der kleinen Eskorte zuckte bei diesem Anblick zusammen. Er wußte, wie ungern der Imperator an Dinge gemahnt wurde, die mit der ruhig-klaren Stimmung seines Gemüts im Widerspruch standen; wie insbesondere die Rechtsprechung und der Eindruck ihrer grausamen Konsequenzen ihn aufregte.
»Pharax, du bist zum Unheil erkoren!« sagte der Soldat zu sich selbst. »Wenn der Stadtpräfekt das erfährt, wird der Rebstock des Centurio dir mit gaditanischer Grazie über den Rücken tanzen! Freilich, die Sache ist nur ein Zufall; aber ein Knecht des Präfekten büßt sogar für die Launen des Fatums . . .«
»Der Kaiser!« hatte auch Nicodemus gerufen. »Er kömmt auf zwei Schritte an dir vorbei. Fleh' seine Gnade an, Artemidorus!«
Alles machte jetzt Platz. Nicodemus ergriff die Hand einer jungen Blondine, deren Auge bis dahin voll heiligen Mitleids auf dem Gefangenen geruht hatte. Fragend sah sie empor. Eine bedeutsame Gedankenverbindung mußte sich hinter der Stirne des Mannes vollzogen haben: denn ein Leuchten unverhoffter Befriedigung ging über sein Antlitz und der fast triumphierende Zug um die Lippen schien zu besagen: Das bedeutet Erfolg!
Er beugte sich zu dem Mädchen hernieder und flüsterte hastig: »Acte, du siehst es! Der Himmel selber zeigt uns die Pfade! Wenn du noch irgend gezweifelt hast, ob mein Plan dem Gott Jesu Christi wohlgefällig und lieb sei, so wird dies wunderbare Zusammentreffen dir Klarheit gewähren. Höre nun, was ich heische! Sobald ich dir zunicke, trittst du vor, wirfst dich dem Kaiser zu Füßen und suchst den mutigen Artemidorus zu retten!«
»Das will ich!« gab ihm Acte zurück. »Bete du, daß mich der Cäsar erhören möge!«
»Ich hoffe, er wird . . .« murmelte Nicodemus. »Sprich nur so warm und so innig, wie dir's ums Herz ist! Oder jammert's dich nicht dieser blühenden Jugend, die unter dem Beilhieb des Henkers hilflos verbluten soll?«
Acte seufzte und schwieg. Starr und zaghaft blickte sie in das bunte Getümmel.
»Wie schön sie ist und wie kindlich!« dachte Nicodemus erregt. »Keine zweite gleicht ihr in Rom . . . Es muß gelingen, es muß! . . .«
»Heil dem Kaiser!« klang es immer näher und näher. Und nun stimmten die Wachsoldaten weithallenden Rufes mit ein und das gaffende Volk und die meisten der Nazarener. »Ruhm und Ehre dem Imperator! Heil dem Claudius Nero, der Wonne des Menschengeschlechts!«
Der Kaiser hatte seinen Sigambrern ein Zeichen gegeben. Die Sänfte hielt an. Auf den Sturm der Begrüßungsrufe, die Nero mit einer liebenswürdigen Handbewegung erwidert hatte, folgte lautlose Stille.
»Ein Unglücklicher!« wandte der junge Fürst sich zu Agrippina. »Du erlaubst, teure Mutter, daß ich die Stadtsoldaten befrage, was er verbrochen hat?«
»Ganz, wie du willst,« versetzte die Kaiserin-Mutter. »Dem Herrscher des Weltreichs steht es unzweifelhaft wohl an, sich um alles, auch um das Kleinste zu kümmern, was ihm den Weg kreuzt.«
»Um das Kleinste?« lächelte Nero, der Mutter ins Auge blickend. »Ein kettenbeladener Mensch, dem das Weh und der Jammer im Antlitz geschrieben steht . . . Nein, teure Mutter, das redest du neben dem Herzen her! Oder verlangt es die Würde des Imperators, das Unglück der Staatsangehörigen leicht zu nehmen, – leicht wie das Mißgeschick dieser pästischen Rose, die deinem schönen Gelock zu entgleiten droht?«
Mit anmutsvoller Gebärde schob er den Stengel der sinkenden Blume unter das strahlende Diadem, das Agrippinas flammfarbigen Schleier hielt.
Dann, zu dem Obersoldaten gekehrt, fragte er wohlwollend: »Wen haltet ihr da und worin besteht sein Verbrechen?«
»Herr,« sprach der Soldat, »es ist ein Freigelassener des Flavius Scevinus . . .«
»Wie? Unsres Freundes, des ewig jungen Senators?«
»Des nämlichen.«
Nero warf einen prüfenden Blick auf den jungen Mann, der unbeweglich die Augen zu Boden senkte.
»In der That, ich erkenne ihn . . . Artemidorus, der uns damals im Parke die Schriften des Ennius entrollte . . . Flavius Scevinus war deines Lobes so voll. Er pries deine Zuverlässigkeit, deine Klugheit. Und jetzt? Ich begreife das nicht!«
»Herr,« hub der Obersoldat wiederum an, »der Verurteilte leidet nach dem Gesetz. Ein Sklave hat ihn dabei überrascht, wie er die Hausgötter grimmig verhöhnte und zuletzt von den Sockeln warf.«
»Artemidorus,« wandte sich Nero an den Gefesselten, »ist das wahr?«
Blitzenden Auges hob der Gefragte sein schönes, bleiches Gesicht.
»Ja, Herr,« sprach er mit fester Stimme.
»Wußtest du,« fuhr der Kaiser mit ruhiger Strenge fort, »wußtest du, daß du mit diesem Angriff auf die Heiligtümer des Hauses ein todwürdiges Verbrechen begingst?«
»Todwürdig, im Sinn des Gesetzes, – ja!«
»Und was bewog dich, dieses Gesetz unter die Füße zu treten?«
»Die Liebe zur Wahrheit.«
»Wieso?«
»Eure Penaten und Laren sind falsche Götter: ich aber glaube an den wahrhaftigen Gott, den Jesus Christus gelehrt hat.«
»Du bist Nazarener?«
»Ja, Herr!«
»Ist das deinem erhabenen Schutzherrn Flavius Scevinus bekannt gewesen?«
»Ja, Herr!«
»Hat er dich jemals darum belästigt?«
»Nein, Herr!«
»Nun also! Glaub', was du willst, und laß die andern glauben, was sie wollen. Siehst du nicht ein, daß diese Forderung schlicht und gerecht ist?«
»Jesus Christus hat uns geboten, die Lehre des Heils weiter zu tragen und wider die feindlichen Truggötter anzukämpfen.«
»Sei's darum! Kämpfe, – aber kämpfe im Geist! Ueberzeugt man etwa mit der geballten Faust? Sind Schmähworte ein philosophisches Argument? In der That, du hast deine Strafe verdient, Artemidorus . . .«
Der Obersoldat machte ein sehr beklommenes Gesicht. Er hatte fast mit Bestimmtheit darauf gerechnet, Claudius Nero würde den Gang der Ereignisse durch einen Akt seiner kaiserlichen Machtvollkommenheit unterbrechen. Geschah dies, so mußte der Stadtpräfekt den Rebstock des Centurionen natürlich im Schrank lassen. Jetzt mit einemmal und gegen jedes Erwarten erklärte der Cäsar die Strafe, die selbst er, Pharax, und seine Mitsoldaten barbarisch und überlebt fanden, für billig und sachgemäß! Verdrießlicher Umschwung!
Acte inzwischen, dem Zeichen des Nicodemus gehorchend, hatte sich aus den Reihen des Volkes stürmisch hervorgedrängt. Dicht vor der Sänfte des Imperators warf sie sich knieend aufs Straßenpflaster. Voll unsäglichen Liebreizes hob sie ihr rosig blühendes Antlitz zu dem Herrscher des Weltreichs empor und hauchte mit einer Stimme, in welcher die ganze bestrickende Allgewalt mitfühlender Weiblichkeit zitterte: »Gnade, Herr! Gnade für meinen Bruder!«
Das Auge des jungen Kaisers weilte mit staunendem Wohlgefallen auf der schlanken Gestalt, die so inbrünstig zu ihm aufschaute. Selbst die Kaiserin-Mutter konnte sich einer flüchtigen Regung von Sympathie nicht erwehren, und milder als sonst glitt ihr ein Lächeln über das ernste, stolze Gesicht.
»Ich dachte es wohl,« sagte der Kaiser bewegt. »Wer eine Schwester von so holdseliger Art und Gebärde besitzt, der mag aus Irrtum und Uebereilung gefehlt haben, aber kann nicht schlecht sein.«
Einige Augenblicke schien er völlig versunken in diese zauberhafte Erscheinung. Dann ergriff er die Hand Agrippinas und hub mit deklamatorischem Pathos wiederum an: »Eh'vorgestern war dein Geburtstag! Bei allen Schmuckverkäufern und Juwelieren der Zweimillionenstadt habe ich Umschau gehalten, um etwas bilden zu lassen, was deiner würdig wäre: aber ich fand nur dieses klägliche Diadem. Kostbar an sich, drückt es dennoch dein ambrosisches Haupt wie ein Reif aus Korinthermetall. Jetzt vergönnt mir das Schicksal etwas Erlauchteres! Zur Ehre deines vielteuren Namens, geliebte Mutter, übe ich hier das Recht, zu lösen und zu entsühnen.«
Er befahl den Soldaten, ihren Gefangenen dicht vor die Sänfte zu führen, während sich Acte mit einem leuchtenden Dankesblicke zurückzog.
»Du hast es gehört,« sprach Nero. »Ich begnadige dich! Bringt ihn zurück nach dem Hause des Flavius Scevinus und meldet meinem vortrefflichen Freunde, was vorgefallen! Ich lasse ihn bitten, den Missethäter acht Tage lang einzusperren. Dir aber, junger Mann, empfehle ich Klugheit und Vorbedacht! Nochmals: Hältst du die Götter des Römerreiches für Traumgestalten, so opfere meinetwegen der Isis oder dem Horus, aber mäßige deine vorlaute Zunge und beleidige nicht das Feingefühl der Quiriten!«
Dem Begnadigten zuckte es um die Lippen, als wolle er, trotz aller Huld, die er erfahren, dem Kaiser etwas erwidern. Er unterdrückte jedoch seine Entgegnung, kreuzte die Hände über der Brust und stammelte ein fast unvernehmliches »Dank, Herr!«
Die Leute des Stadtpräfekten, voran der fröhliche Pharax, entledigten ihn sofort seiner Ketten. Man behandelte ihn von dieser Minute ab mit höflicher Auszeichnung. Pharax beglückwünschte ihn mit kraftvollem Händedruck.
Im Hause des Flavius Scevinus fand der Zurückgekehrte eine begeisterte Aufnahme. Die Kunde von dem Gnadenakte des Kaisers war ihm vorangeeilt. Scevinus in eigener Person empfing ihn am Ostium. Der Sklave, der die unbedachte Handlung des Artemidorus mit so großer Beflissenheit angezeigt hatte, war von dem tiefbetrübten Senator bereits vor mehreren Tagen verschenkt worden.
Zweites Kapitel.
Unter den schallenden Jubelrufen der Menge hatte sich die kaiserliche Lectica wieder in Bewegung gesetzt.
Nero und Agrippina kamen vom Haus des Afranius Burrus, des Oberbefehlshabers der prätorianischen Leibwache. Burrus litt seit einigen Tagen am Fieber. Das Uebel schien, dem Ausspruch der Aerzte zufolge, geringfügig: aber dem einflußreichen Gardepräfekten schuldete man eine besondere Aufmerksamkeit.
Wie die Sänfte mit ihrer kriegerischen Gefolgschaft jetzt aus dem Vicus Cyprius abbog, kehrten die Gedanken der Kaiserin an das Krankenlager des Burrus zurück.
Heimliche Mißstimmung lag auf ihrem Gemüt: je mehr sie wahrnahm, daß sich die Gunst der Massen ihrem einst so zärtlich geliebten Sohne zuwandte, um so eifersüchtiger ward sie auf den gefährlichen Nebenbuhler. Nun suchte sie Befreiung von diesem Druck, indem sie bei Vorstellungen verweilte, die ihr die alte Zuversicht wiedergaben.
Burrus, der Oberst der Leibwache, und Seneca, der ehemalige Lehrer des Nero, hatten bis dahin ihr treulich zur Seite gestanden, wenn es galt, den jugendlichen Imperator zu lenken, die Regierungsgeschäfte im Sinne der Kaiserin zu erledigen und ihrem Sohne die Anschauung beizubringen, sie, Agrippina, sei die Erste im Reich, er aber, aus Gründen natürlicher Pietät, nur der Zweite.
Wenn so Burrus ihr Schwert und Lucius Annäus Seneca ihr Schild war: was fragte sie dann nach dem Gemurre oder dem Jubel des Volkes? Was kümmerte sie das heimliche Schwirren jener dunklen Gerüchte, die – sie spürte es, wie man den ungesehenen Blick eines feindseligen Beobachters spürt – allenthalben von Mund zu Mund gingen? Burrus zumal war ein Präfekt, wie sie ihn besser nicht wünschen konnte: sehr empfänglich für ihre Schönheit, äußerst dankbar für jedes huldvolle Lächeln, aber mehr noch durchdrungen von dem Gefühl seiner Pflicht und dem Gedanken des Allgemeinwohls. Er hatte Verständnis dafür, daß ein erfahrenes, geistig begabtes Weib besser für die Regierung taugt, als ein kaum zur Reife gelangter phantastischer Jüngling . . .
»Was sinnst du, Mutter?« fragte der Imperator auf griechisch. »Du beachtest kaum noch die Grüße der Senatoren . . .«
»So? Ich bemerkte nichts . . .«
»Thrasea Pätus kam des Weges daher mit vielen Klienten. Ich nickte ihm zu: du aber danktest ihm nicht, sondern verbargst dich sogar wie mit Absicht hinter dem Vorhang.«
»Schien es dir so?« erwiderte Agrippina. »Dergleichen verzeiht man füglich den Müttern, die unablässig ans Wohl ihrer Söhne denken. Ich übersann deine Zukunft, – und ich gestehe dir, daß ich nicht ganz ohne Sorge bin.«
»Sorge? Weshalb? Liegt die Erde nicht blühend zu meinen Füßen? Bin ich nicht Cäsar? Ja, beim Glanz dieses Himmels: ich kann Glückliche machen bis in die fernsten Gelände, – Glückliche, so weit ein römisches Segel das Meer durchfurcht! Mein Volk liebt mich! Noch eben, in dieser Minute, hast du gehört, wie das dankbare Jubelgeschrei, einem helvetischen Bergstrom vergleichbar, aus tausend Kehlen erquoll! ›Heil dem Kaiser! Heil dem Claudius Nero, der Wonne des Menschengeschlechts!‹ Ach, Mutter, das klingt meinem Ohr wie ein Festgesang der Unsterblichen!«
Agrippina errötete. Sie schüttelte langsam das majestätische Haupt.
»Dennoch, mein Knabe, – ich bin besorgt! Du scheinst mir zu weich, zu schmiegsam für das furchtbare Herrscheramt eines Cäsar. Dein harmloses Auge übersieht die entsetzliche Tücke, die rings in den Höhlen und Schlupfwinkeln eines verabscheuungswürdigen Neides lauert. Du mußt frühzeitig mit gebührender Strenge walten. Geliebt sein ist gut; gefürchtet sein ist besser und sicherer. Füge dich hier, wie in so mancher bedeutsamen Frage, meiner bewährten Einsicht! Laß mich handeln, wo ich's für gut finde! Meinst du, die Senatoren, die sich in scheinbarer Ehrerbietung vor deiner Größe beugen, seien innerlich von dieser Größe durchdrungen? Ach, wie schlecht kennst du die römischen Aristokraten! Sie denken: ›Nero ist Cäsar durch unsre gnädige Duldung!‹ Fällt's ihnen bei, und bietet sich die erwünschte Gelegenheit, so zertrümmern sie deine Herrschaft so gut, wie jüngst die Herrschaft des Claudius.«
»Des Claudius?« wiederholte der Kaiser befremdet.
»Jawohl, – deines Stiefvaters, meines erlauchten Gemahls. Mitglieder des hohen Rates sind es gewesen, die ihn vergiftet haben.«
»Seneca hat mir die Sache anders erzählt,« erwiderte Nero.
Agrippina erblaßte. Gleich darauf aber sagte sie mit erkünstelter Ruhe: »Du machst mich neugierig. Damals – du weißt, der Senat verwehrte die Untersuchung, – und dieser Umstand allein . . .«
»Sie wäre zwecklos gewesen, da der Giftmörder nicht zu erreichen war. Solltest du in der That keine Ahnung haben . . .?«
Die Kaiserin zitterte.
»Nicht die geringste,« sprach sie, die Augen schließend.
»So hat man dich schonen wollen,« fuhr Nero fort. »Ein persönlicher Gegner des Claudius, der Freigelassene Eutropius, hat die Unthat begangen.«
»Allerdings,« stammelte Agrippina, – »aber ich dachte, er sei nur das Werkzeug höherstehender Feinde gewesen.«
»Nicht doch! Der Kaiser Claudius hatte gedroht, ihn wegen zahlreicher Diebstähle zur Verantwortung zu ziehen, – und so kam der Verbrecher seinem Richter zuvor. Eh' man ihn fassen konnte, war er spurlos verschwunden. Aber lassen wir dies betrübsame Thema! Der Mahnung des Seneca eingedenk, hätte ich's überhaupt nicht berühren sollen.«
Er zog die Gardine vor, als gälte es, eine empfindliche Dulderin vor allzugrellem Lichtschein zu hüten. Dann lehnte er sein Haupt zärtlich an die Schulter der Mutter, holte tief Atem und fragte sie plötzlich: »Wie gefiel dir das blonde Mädchen, das für den Freigelassenen des Flavius Scevinus um Gnade flehte?«
»Ich hatte nicht acht auf sie.«
»Ich fand sie bezaubernd! Dieses kindlich-holde Gesicht, diese wonnigen Augen! Sie glich ein wenig der Psyche im Oecus der Acerronia, und doch, wie viel hundertmal schöner und lebensvoller!«
»Das klingt ja fast wie Begeisterung. Leider gelingen dir solche Gemütstöne immer nur da, wo sie nicht völlig am Platze sind. Schwärmtest du halb so sehr für Octavia!«
»Mutter, ich bin dir stets ein gefälliger Sohn gewesen; ich werde auch jetzt gehorchen, zumal schon dein verstorbener Gatte diese Verbindung gewünscht hat . . .«
»Gehorchen! Als wär's eine Strafe, dem vornehmsten, liebenswürdigsten Mädchen der Hauptstadt die Hand zu reichen!«
»Für andre vielleicht ein unermeßliches Glück,« sagte der Kaiser gemessen. »Ich bestreite nicht ihren Wert, aber mir fehlt das Verständnis dafür. Octavia ist zu vollkommen für mich.«
»Stehst du schon jetzt auf diesem bedenklichen Standpunkt? Ein Blumenmädchen vom Argiletum oder ein schmetterlingshaftes Geschöpf, wie die Kitharaspielerin Chloris, die ihr neulich so überschwenglich gepriesen habt: – das wäre dir wohl erwünschter? Kleine Flecken reizen euch ja, wie schon Ennius behauptet.«
»Streiten wir nicht, teure Mutter! Ich werde Octavia heiraten; ich werde sie achten und ihrer Stellung gemäß behandeln. Aber daß ich sie lieben soll, das kann mir selbst ein unsterblicher Gott nicht aufzwingen. Eros naht sich uns nicht auf Befehl: er kommt ungerufen, und manchmal gerade da um so stürmischer, wo die Vernunft ihn verbannen möchte. Vor seinen Augen gilt keine Tugend und kein Verdienst. Oft hat eine Sklavin größere Leidenschaften erweckt als fürstliche Jungfrauen, und – so versichert mich Seneca – das höhere Recht ist dann allemal auf seiten der Sklavin.«
»Thorheit!«
» Keine Thorheit, dafern du erlaubst! Die Sklavin stellt in diesem Falle den Ausdruck des Naturwillens dar, – und die Natur ist wahrer und echter als die menschlichen Satzungen.«
»Also auch hierin unterrichtet dich Seneca?« fragte Agrippina mit verdrießlichem Lachen. »Vortrefflich! Wie es den Anschein hat, besiegt er mit seiner glänzenden Theorie meine Praxis.«
»Du thust ihm unrecht. Solche und andre Betrachtungen knüpft er gelegentlich an die Erklärung einer Tragödie. Ueber Octavia hat er niemals gesprochen. Im Ernste, Mutter: Du hast auch nicht den leisesten Grund zur Verstimmung. Mein Herz ist frei. Dank den Lehren meines vortrefflichen Meisters hab' ich entsagen gelernt. Das Getändel der Freunde war mir von jeher nur ein Gegenstand der Beobachtung. Ich habe niemals geliebt; ja ich zweifle, ob ich dieser Empfindung überhaupt fähig bin. Trotzdem, ich wiederhole dir's, werde ich unsrer Octavia mit aller Zartheit begegnen, die sie als Gattin des Imperators beanspruchen kann. Bist du zufrieden, Mutter?«
»Nicht ganz. Diese blutlose Gleichgültigkeit macht mich bekümmert. Octavia ist wie geschaffen für dich. Ihr klarer, unbestechlicher Blick wird dem Schwärmer zu gute kommen, der tagtäglich Gefahr läuft, sich in philosophischer Träumerei zu verlieren oder im Strudel künstlerischer Phantasmen. Du kennst meine Ansicht. Die Stoa ist eine tüchtige Schule, aber sie darf unsre Kräfte nicht lahmlegen. Die Kunst hat ihre bestrickenden Reize, aber der Cäsar darf nicht zum Künstler werden. Denke, aber vergiß nicht das Leben! Baue Theater, beschütze die Modedichter, wirf dein Gold wie Gerste unter die Sänger und Flötenbläser: aber dichte und deklamiere nicht selbst! Singe nicht wie ein schmachtendes Mägdlein! Ueberlaß die Kithara den Kitharöden! Die Hand, die das Scepter führt, ist nicht geschaffen für das elfenbeinerne Leierstäbchen. Das ist mein Begriff von der Sache, – und Octavia wird just in dem gleichen Sinn auf dich einwirken.«
Nero lächelte.
»Du erinnerst mich wieder ganz an die Zeit, da du mich unsanft beim Ohre nahmst, wenn ich in der Subura mit den Söhnen der Bäcker und Garköche allerlei Tollheiten aufgeführt hatte.«
»Willst du mir's etwa verwehren, den Sohn, den ich erzogen habe, zu tadeln?« fragte Agrippina gereizt. »Wem verdankst du denn, was du bist? Mit dieser welterschütternden Faust hab' ich dich auf den Thron gesetzt. Solang du dies anerkennst, wird dein Genius über dir wachen. Lehnst du dich auf, – wohl, so zweifle ich, ob du die Kraft besitzest, auf so schwindelnder Höhe dich festzuhalten.«
»Du erregst dich ganz ohne Ursache. Auflehnen? Du allein hast dieses abscheuliche Wort gebraucht. Ich weiß zur Genüge, daß es keinen – selbst nicht den Cäsar – entehrt, den Ratschlägen seiner Mutter zu folgen. Eins nur sähe ich gern – da wir denn doch einmal von der Sache jetzt reden –: wenn du die Form dieser Ratschläge etwas mildern und mäßigen wolltest. Du selber kannst doch nicht wollen, daß jemand das Recht hätte, über die allzu kindliche Pietät des Nero zu lächeln.«
»Ich wüßte nicht, inwiefern du Veranlassung hättest . . .« grollte die Kaiserin.
»Doch, doch, Mutter! Aber ich sehe, du nimmst die Sache zu schwer. Brechen wir ab! Es war vielleicht überflüssig, daß ich's erwähnte. Im Laufe der Zeit wird sich das alles von selber ausgleichen.«
»Aber du siehst doch,« versetzte sie lebhaft, »wie frei ich von allem persönlichen Ehrgeize bin! Würde ich sonst so eifrig deine Vermählung betreiben? Diese Ehe wird meinen Einfluß naturgemäß abschwächen. Ist Octavia erst Kaiserin, so fällt ihr eine bedeutsame Rolle zu, eine Rolle . . .«
»Das kann ich mir vorstellen,« spottete Nero. »Sie wird mit den Augen des Argus darüber wachen, daß nie und nirgends eine Zeremonie versäumt wird, und wäre sie für mein Gefühl die absurdeste. Sie wird verlangen, daß ich allmorgendlich zum vergötterten Romulus bete; daß ich ein Amulett um den Hals hänge mit dem Bildnis der Wölfin und der hungrigen Zwillinge; daß ich ihr glauben helfe, wenn sie in jedem Ereignis den unmittelbaren Einfluß Jupiters und seiner zärtlichen Juno gewahrt.«
»Und wenn sie das thäte, was wäre dir Schlimmes dabei?«
»Schlimmes?« wiederholte der Kaiser. »Nun, ich weiß nicht, wie du über die Göttergeschichte unsrer Vorfahren denkst. Du hast mir niemals davon gesprochen, selbst da ich noch Knabe war. So vermute ich fast, wir denken das nämliche.«
»Wie meinst du das?«
»Ich glaube nicht an die Fabeln des Pöbels.«
»So? Und was glaubst du denn?«
»Kann ich das gleich so in Worte fassen? Ich glaube mit Seneca an das Vorhandensein einer gewaltigen Urkraft, eines verborgenen Geistes, der alles umspannt und alles mit seinem Odem durchsättigt. Diese Urkraft lebt auch in uns; ihr Wollen ist unser Wollen, ihr Fühlen ist unser Fühlen! Die Götter aber, wie sie der Pöbel verehrt, halt' ich für Märchengestalten, gerade gut genug, um als letzter Kitt für die zerbröckelnde Tugend unsrer Gesellschaft zu dienen.«
Agrippina schwieg lange.
»Weißt du, mein Sohn,« sagte sie endlich, »daß du dich auf dem besten Wege befindest, ein Staatsverbrecher zu werden, – ganz nach der Weise des kaum begnadigten Artemidorus?«
Nero lächelte.
»Du unterschätzest meine Gewandtheit. Ich weiß den Kaiser von dem Privatmann zu trennen. Vor dem Senat zum Beispiel werd' ich mich hüten, die philosophischen Ueberzeugungen, die ich im Busen trage, leichtsinnig preiszugeben. Ich werde dort ebensogut von der allgeliebten Minerva reden, wie der Dümmste unter den Dummen. Aber das hindert doch nicht, daß ich es langweilig finde, wenn ich daheim, als Gatte, nicht einmal ausruhen soll von dieser unbequemen Komödie, wenn ich sogar im Schlafgemach eine Priesterin finde, die an den Stier der Europa glaubt! Ein prächtiger Gott, dieser hellenisch-römische Zeus, der mit der Tochter des Königs Agenor über das Meer schwimmt, um auf den Matten von Kreta den Minos und Radamanthos zu zeugen!«
Agrippina zuckte die Achseln.
»An Jupiter als an den Lenker des Weltalls glauben, und diese Schwänke der griechischen Volkspoeten für bare Münze nehmen, ist zweierlei.«
»Der Wahrhaft-Gläubige glaubt auch die Schwänke,« erwiderte Nero. »Wäre das nicht der Fall, so müßte er doch in der bildlichen Darstellung solcher Narrenspossen eine Lästerung erblicken.«
»Ich fürchte, du redest dir da mancherlei ein,« sagte die Kaiserin. »Uebrigens danke ich dir für dein offenes Bekenntnis. Ach, und was soll ich's leugnen: ich sehe, du bist der Sohn deiner Mutter. Ganz richtig hast du vermutet, daß die Götter auch mir vollständig fremd sind. Ich glaube nichts als das Fatum, die Moira, die uns die Wege des Lebens vorzeichnet von Anbeginn bis zum Ende. Dennoch – ich glaube auch an die Kraft der Bevorzugten, diese Wege mit Blumen zu schmücken, wo der Alltagsmensch nur in klägliche Dornen tritt. Ich glaube an die Fähigkeit des Genies, dort und da der Moira eine Vergünstigung abzutrotzen. Hierzu ist Klarheit erforderlich, Ruhe, die alle Vorteile ausnützt, Standhaftigkeit in der Verfolgung der Ziele. Deine Gemütsart kennt diese Tugenden nur als Keime: Octavia wird sie leicht zur Entfaltung bringen.«
»Octavia, die stille Octavia?«
»Sie ist nur still, so lange sie dich in der Nähe weiß. Ein Mädchen auch von geringerem Feingefühl würde herausmerken, daß du ihre Empfindung nicht teilst. Sie liebt dich von ganzer Seele: du aber, so freundlich du ihr begegnest, hast noch nie einen Ton gefunden, der wie Neigung geklungen hätte. Das, mein Sohn, macht sie befangen; das drückt sie beinah zu Boden. Scheute sie nicht das peinvolle Aussehen, hoffte sie nicht, daß es ihr dennoch vielleicht gelingen möchte, deine Gleichgültigkeit zu besiegen, sie hätte längst wohl ein Ende gemacht.«
»Das wäre das beste!« murmelte Nero gedankenvoll.
»Es wäre dein Unheil!« rief Agrippina empört. »Ich gestehe dir, daß ich die Oedigkeit, die du ausströmst, wenn du mit Octavia zusammen bist, längst müde bin, müde zum Krankwerden. Ich verlange, daß du dich änderst. Und da du als Bräutigam so gar kein Talent zeigst, will ich nun Sorge tragen, daß ihr endlich ein Paar werdet. Du gewinnst ihr vielleicht Geschmack ab, wenn du sie ganz besitzest und völlig kennen gelernt hast.«
»Mutter! Ein Jahr noch war mir als Frist gegönnt . . .«
»Das ist zu lange.«
»Ich habe dein Wort.«
»Ich nehm' es zurück. Diesen Winter hindurch magst du denn meinetwegen noch Philosophie treiben und griechische Trauerspiele entwerfen. Sobald aber der Lenz in die Lande zieht . . .«
»Soll mein Frühling zu Ende sein,« seufzte der Kaiser. »Nun, wir besprechen das noch!«
Die Sänfte hielt vor der Eingangshalle der Hofburg. Ernstlich verstimmt begab sich die Kaiserin Mutter in ihre Gemächer. Nero jedoch hatte den Mißklang der letzten Minuten sofort vergessen. Gleich im Säulenhofe begrüßte ihn Seneca und lud ihn ein, bis zur Stunde des Mahles mit ihm zu lustwandeln. Unter den Baumwipfeln der palatinischen Gärten erzählte der geistsprühende Lehrer seinem wißbegierigen Schüler allerhand wundersame Geschichten von der neuen sozialreligiösen Bewegung, die, zur Zeit noch unscheinbar und verborgen, unter dem Namen des Nazarenertums von Osten her nach dem Westen vorschreite, in ihren Lehrsätzen mancherlei ungeahnte Berührungspunkte mit der Philosophie des Palatiums aufweise und wohl geeignet erscheine, von Männern wie Nero und Seneca vorurteilsfrei studiert zu werden.
Drittes Kapitel.
Es war acht Tage später.
Man hatte sich im Palatium soeben von der Frühstückstafel erhoben.
Agrippina lehnte auf blumiger Ottomane unter den Bäumen des Xystus und plauderte mit einer kleinen Schar Auserwählter, an deren Spitze sich wie gewöhnlich der Staatsminister und Philosoph Lucius Annäus Seneca durch Geist und Frische hervorthat. Ihm zur Seite stand Burrus, der Oberst der Leibwache. Zum erstenmal seit seiner Genesung war er heut in der Hofburg zu Gaste und nun erlabte er sich an dem Bilde der Herrscherin wie ein Mitrasdiener am Glanz der Sonnenscheibe. Auch der jugendliche Poet Lucanus, ein Neffe des Seneca, befand sich im Kreis der Erkorenen; denn die beißenden Epigramme, die er auf diese oder jene Persönlichkeit der römischen Aristokratie zu fertigen wußte, hatten ihm bei der Kaiserin mehr genützt als selbst die eifrigen Empfehlungen seines Oheims.
Während so Agrippina auf ihre Art Hof hielt und alle diejenigen wahrhaft entzückte, denen die vollerblühte Erscheinung des stolz prangenden Weibes nicht allzu weltgebietend und mannhaft erschien, hatte sich Nero, der ernsten Mahnungen seines gelehrten Meisters uneingedenk, heimlich hinweggeschlichen.
Im Gemüte des jungen Fürsten regte sich nachgerade, halb im Widerspruch mit dem künstlich herangezogenen, weisheitstriefenden Nero, ein andrer, minder pathetischer, der – von dem lebenslustigen Adjutanten Sophonius Tigellinus beeinflußt – zuweilen die Oberhand über den ersten gewann und schüchterne Anstalten machte, das Leben und seine mannigfachen Genüsse praktisch kennen zu lernen. Sophonius Tigellinus aus Agrigentum war dem Kaiser zuerst im Circus Maximus näher getreten, als der Besitzer nämlich der auserlesensten, immer siegenden Rennpferde. Nero ließ ihn ans kaiserliche Pulvinar entbieten, beglückwünschte ihn und war von der bestechenden Liebenswürdigkeit des glänzenden Kavaliers so entzückt, daß sich bald eine wirkliche Freundschaft entwickelte. Da Tigellinus früher bereits den Rang eines überzähligen Militärtribunen bekleidet hatte, machte ihn Nero zum Offizier der prätorianischen Leibwache und erkor ihn zu seinem persönlichen Dienste. Seneca wollte zunächst zwar Einwendungen erheben, denn der dreißigjährige Tigellinus galt für den ausgesprochensten Herzenseroberer der Siebenhügelstadt und flößte auch sonst nur geringes Vertrauen ein. Nero jedoch betonte so sehr die gesellschaftlichen und künstlerischen Talente des Mannes, daß der Minister bald seinen Widerstand aufgab, und nur mit verdoppelter Sorgfalt über dem Wohl und Wehe des Imperators zu wachen beschloß.
Sophonius Tigellinus war es gewesen, der die abenteuernden Regungen Neros zuerst geweckt und neuerdings mit seiner köstlichen, ewig sprudelnden Laune in Handlungen umgesetzt hatte.
Insbesondere packte den Kaiser von Zeit zu Zeit eine mächtige Schaulust im kleinen, das reizvoll-dunkle Verlangen, sich, ohne erkannt zu sein, unter das Volk zu mischen, interessante Beobachtungen zu machen, Scenen, Begegnungen zu erleben und echte, unverkünstelte Menschlichkeit aufzusuchen.
Vorläufig schienen die Anwandlungen des Kaisers noch äußerst harmlos, und Sophonius Tigellinus hütete sich, in dieser Beziehung die Rolle eines Verführers gar zu deutlich zu spielen. Das wäre ihm, falls etwa Seneca davon Kunde bekommen hätte, teuer zu stehen gekommen. Aber er hoffte bestimmt, die Sache werde sich mit der Zeit machen. Was jetzt noch beinahe knabenhaft und kindlich erschien, das mußte allmählich, trotz aller Warnungen Senecas, in tolle Vergnügungssucht und rasende Lebensgier ausarten, – und dann war Sophonius Tigellinus Beherrscher der Situation. Die Stoa verdrängt durch die Lehren des fröhlichen Epikur; – Senecas philosophische Weisheit als drückende Last empfunden; – er, Tigellinus, als der trostreiche Erretter aus dem Sumpfe des Ueberdrusses und der Langeweile vergöttert: – das war eine Basis, von der es nur eines einzigen Schrittes zur höchsten Gewalt bedurfte!
Von all diesen hochfliegenden Plänen ließ der schlaue Agrigentiner natürlich nicht das Leiseste ahnen. Er gab sich den Schein, als teile er die jugendliche Sehnsucht des Kaisers – er, Tigellinus, der alles bereits genossen, der schon als Knabe in ungezügelter Freiheit geschwelgt hatte! Nero begriff nicht den Unterschied zwischen seinem Entwickelungsgange und dem des Agrigentiners, und glaubte ihm. Er hielt den verwöhnten, üppigen Lebemann für ebenso frisch, wie sich selbst. Er vergaß die freudlose Existenz, die er nach dem Tod seines Vaters Domitius Aënobarbus geführt hatte, bis die zweite Ehe der Agrippina mit dem damaligen Imperator Claudius ihn aus dem Dunkel emporhob. Der künstlerischen Veranlagung Neros schien es ja überdies selbstverständlich, daß ein Auge nach Bildern, ein Geist nach Stoff, eine glühende Phantasie nach Erlebnissen haschte.
Noch stand die Sonne hoch über dem langgestreckten Janiculus-Berg, als Nero und Tigellinus, in leichte Mäntel gehüllt, das menschenerfüllte Marsfeld betraten.
Die zehn Germanen der Leibwache, die man, um jedes Aufsehen zu meiden, vom Palatium her mit weggenommen, saßen bereits in einer der großen Tabernen unweit des Kapitols und tranken das Wohl des Kaisers und seines liebenswürdigen Adjutanten im roten Signiner.
Der Tag war herrlich. Die faltige Kopfhülle, die Nero und Tigellinus, wie zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen, übergestreift hatten, hinderte ihr Erkanntwerden, zumal ja in Rom, wo jeder vornehme Bürger sich stets nur mit einer größeren Gefolgschaft zeigte, keine menschliche Seele in den beiden einsamen Wandrern so hochgestellte Persönlichkeiten vermuten konnte.
Tief Atem holend, sog der Kaiser die warme und doch so erquickende Luft ein. Ueber den riesigen Baumgängen, die hier und da bereits die Verfärbung des Herbstes zeigten, glänzte ein tiefblauer Himmel. Die sorgsam gepflegten Rasenplätze prangten in leuchtendem Grün. Die Marmorbilder, die zahllosen Prunkläden, die Kolonnaden und Denkmäler schienen von reinerem Lichte umflossen als je. Durch die Hauptallee bewegte sich eine endlose Reihe von Sänften und Fußgängern. Rechts und links auf den Reitwegen sprengten feurige Kappadozier einher, schmalhufige Renner aus der Ebene von Hispalis und schnaubende Ponies. Rings aber in den buntverschlungenen Spazierwegen, zwischen den Lorbeer und Myrtenhecken, drängte sich ein farbenreiches Gewimmel aus den verschiedenartigsten Ständen: Senatoren in purpurverbrämter Toga, von zahlreichen Klienten und Freunden umgeben; vornehme Kleinasiaten in goldgesticktem Himation; schwarzlockige Perser mit hoher Tiara und kunstvoll gestickten Beinkleidern; blühende Griechenmädchen in krokusfarbenem Diploïdion; Aethiopier und Gallier, Freie und Sklaven, Kornspenden-Empfänger und Stutzer, Pädagogen mit ihren Schützlingen, Erbsenverkäufer und Schmuckhändler, beide mit gleich gellender Stimme ihre Ware empfehlend, Wahrsager, Schiffsknechte, Soldaten der Stadtkohorte und Invaliden.
»Fühlst du nun wieder, vielteurer Cäsar,« hub Tigellinus an, »wie vortrefflich mein Rat ist, wenn ich dir zuspreche, deinem Genius zu leben und die mühsamen Staatsgeschäfte dem herrlichen Dioskurenpaare Seneca und Afranius Burrus zu überlassen? Du bist jung, Cäsar! Du mußt die vielköpfige Menschheit, die du regieren sollst, in all ihren tausendfachen Gestalten erst kennen lernen.«
»Du hast recht, Tigellinus,« versetzte der Kaiser. »In der That, – was wäre ich ohne Burrus und Seneca? Und mehr noch: was wäre ich ohne dich? Beim Herkules, dir gelingt es doch, mich für Stunden wenigstens aus dem Banne zu lösen, den die Pflicht meines Herrscheramtes mir auferlegt. Ich bin Kaiser, – aber zuvor bin ich Mensch, und so spreche ich mit dem Poeten: Für alles Menschliche hab' ich ein flammenloderndes Herz!«
Sie erreichten jetzt den marmorglänzenden Festraum, wo das römische Volk einen immerwährenden Jahrmarkt feierte. Kauf und Schaubuden aller Art lockten hier in fröhlichem Durcheinander. Tummelplätze für Diskuswerfer und Ballspieler wechselten mit Garküchen, Weinschenken und duftigen Obstlagern ab. Weiter hinaus, am Ufer des Tiberstromes, ragten die Holzgerüste, von denen die Wettschwimmer sich in die kräuselnde Flut stürzten. Dazwischen allerwärts schattende Bäume, hochquellende Sträucher, schimmernde Blumenbeete und parische Götterstatuen.
Vor dem silberumschnürten Leinwandzelt eines ägyptischen Zauberers machte der Cäsar mit seinem Begleiter Halt.
Cyrus – so hieß laut Inschrift am oberen Zeltsaum der lockende Wundermann – war erst vor wenigen Tagen aus Alexandria eingetroffen und bildete jetzt schon den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
Die bartumwallte Gestalt lehnte nachlässig neben dem Eingange. Gleichmütig lächelnd blickte er auf das massenhaft herandrängende Volk.
Dann plötzlich, als ob ihm eben nur so der Einfall gekommen sei, stellte er ein sechs oder siebenjähriges Kind auf den sogenannten magischen Dreifuß, überstülpte das Ganze mit einem mannshohen Spitzhute nach persischem Zuschnitt, berührte die bildergeschmückte Umhüllung mit seinem elfenbeinernen Stabe und hob sie empor.
Zum unbeschreiblichen Staunen des Volkes war das Kind spurlos verschwunden.
Nunmehr begab sich der Aegypter ins Innere, während zwei kraushaarige äthiopische Sklaven ihm den Dreifuß und den Papierhut unter mancherlei drolligen Bewegungen nachtrugen.
Alle Umstehenden jubelten Beifall. Auch Nero klatschte mit großer Lebhaftigkeit in die Hände.
»Ein Meisterstück,« sprach er leise zu Tigellinus. »Als wohlerzogener Lebenskünstler soll man nicht staunen; aber ich frage dich: hast du die leiseste Ahnung, wie er dies Wunder bewerkstelligt?«
Tigellinus versetzte achselzuckend: »Wenn nicht die Erde mit diesem Aegypter im Bunde ist, wenn sie nicht insgeheim ihre Tiefen öffnet, um das Kind zu verschlingen, wie einst den todesmutigen Curtius – so fehlt mir die Lösung.«
Jetzt trat ein gelb und rot gekleideter Herold auf das gezimmerte Podium und stieß dreimal mit voller Gewalt in seine dröhnende Tuba.
Hiernach lud er die edlen Quiriten und Quiritinnen ein, länger nicht zögern zu wollen.
»Drei Sesterzen!« so klang es gellend von seinen Lippen. »Drei Sesterzen nimmt man euch ab, um euch anderthalb Stunden hindurch zu Göttern zu machen! Cyrus, mein ruhmgekrönter Gebieter, der Stern des Morgenlandes, der Meister von Babylon, Susa und Alexandria, der Freund so vieler asiatischer Könige, der Liebling aller Völker vom Aufgang zum Niedergang, bietet euch seinen Gruß und fragt, ob jemals ein andrer euch das Gleiche für drei Sesterzen geboten hat? ›Nein!‹ werdet ihr antworten. ›Solches vermag nur Cyrus, der Einzige.‹ Also greift in den Bausch eurer Tunica und ersteht die Elfenbeinmarke, die euch berechtigt, anderthalb Stunden lang die Luft des Olympos zu atmen! Wenn ich zum zweitenmal hier in die Tuba schmettere, wird der unsterbliche Cyrus beginnen!«
In hellen Haufen strömten die Zuschauer rechts nach den Tischen, wo drei stämmige Friesen, gleichfalls in märchenhaftem Kostüm, die Marken verkauften.
Nero und Tigellinus folgten dem Beispiel der Menge.
Der Andrang war ein so heftiger, daß sich der Kaiser schon nach wenigen Augenblicken von Tigellinus getrennt sah.
»Freund,« rief Nero in griechischer Sprache über die Köpfe der jungen Mädchen hinweg, die es so eilig hatten, »sollten wir während der Vorstellung auseinander kommen, so treffen wir uns nach Schluß dort drüben am Ahornbaum des Agrippa!«
»Abgemacht!« nickt der Adjutant.
Das Zelt des Aegypters war von ungewöhnlicher Ausdehnung. Durch eine Längsspalte von der Breite eines Tricliniums fiel reichliches Oberlicht in den prächtig ausgestatteten Raum. Matten aus Spartgras überdeckten den Boden. Teppiche, die man von weitem für syrische halten konnte, hingen von silberdurchwirkten Schnüren herab. In der Mitte eines bühnenartig erhöhten Aufbaus, der vom Zuschauerraum durch bronzene Ketten abgesperrt war, stand ein großer Altar.
Unmittelbar dahinter öffnete sich nun langsam ein gewichtiger Vorhang aus tarentinischer Amethystwolle. In majestätischer Haltung trat der Magier aus den Falten der üppigen Draperien hervor, während draußen der Herold zum zweitenmal seine Tuba erdröhnen ließ.
Nero hatte sich – jetzt mit bewußter Absicht – weiter und weiter von Tigellinus getrennt. Er stand ziemlich vorn bei den Bronzeketten und schaute dem stolzen Aegypter erwartungsvoll in die blitzenden Augen.
Das erste, was der Magier zum besten gab, war sein bereits in Alexandria so hoch gepriesenes Wunder: die schwarze Eurydice. So nannte er, im Anklang an die hellenische Sage, die Tötung und Wiederbelebung einer schwarz gefiederten Taube.
Wie er das ängstlich flatternde Tierchen scheinbar in Stücke riß, da erklang unmittelbar in der Nähe des Kaisers ein leises »Ach!«
Er wandte sich um.
Die da hinter ihm stand, war keine andre, als das reizende blonde Mädchen, das für Artemidorus um Gnade gefleht hatte. Jetzt erst schien sich dem seltsam bewegten Jüngling der ganze Liebreiz dieses rosigen Angesichtes zu offenbaren. Der süße, halbgeöffnete Mund, der von den Zähnchen einen verführerisch blinkenden Streif sehen ließ, atmete Unschuld, Sehnsucht und Wonne zugleich; der Ausdruck des Staunens und des Bedauerns verlieh dem holden Kindergesicht etwas Mütterlich-Schmollendes . . .
Ach, und die Stimme!
Nero fühlte, wie ihn der flüchtige Ausruf immer noch unter dem Bann seines unbeschreiblichen Wohllauts hielt, wie es ihn stürmisch antrieb, diese Stimme weiter plaudern zu lassen, unbekümmert um alle Zauberkünste Aegyptens und Babylons.
Langsam, damit er nicht auffalle, trat er ein wenig zurück. Bald hatten sich andre ihm vorgedrängt. Er stand jetzt dicht an der Seite des jungen Mädchens und flüsterte bebend: »Kennst du mich noch?«
»Ja, Herr!« versetzte sie gleicherweise.
»So verrate mich nicht!«
»Wie du befiehlst.«
»Bist du allein?«
Sie zögerte eine Weile. Dann hauchte sie schüchtern: »Ich bin allein, Herr.«
»Wie heißt du?« fragte der Cäsar.
»Mein Name ist Acte.«
»Leben dir noch die Eltern? – Und welchem Stande gehörst du an?«
»Meine Eltern sind tot. Der Vater stammte aus Mediolanum, die Mutter aus Griechenland. Beide waren von unfreier Geburt.«
»Unmöglich! Du eine Sklavin?«
»Eine Freigelassene des Nicodemus . . .«
»Des Mannes, der zuweilen mit Seneca Philosophie treibt . . .?«
»Des nämlichen.«
Ein brausender Lärm ging jetzt durch die Reihen der Zuschauer.
»Herrlich! Herrlich!« jauchzte die begeisterte Menge. »Es lebe Cyrus, der Götterliebling!«
Das vielbewunderte Meisterstück »Eurydice« war in Scene gegangen, ohne daß Nero das Geringste davon bemerkt hätte. Er stand regungslos. In starrer Bewunderung blickte er dem jungen Mädchen ins Antlitz und prüfte wie traumverloren die berückende Lieblichkeit ihrer Züge. Wer unter allen senatorischen Damen konnte sich mit dieser leuchtenden Holdseligkeit messen? Keine, selbst nicht Poppäa Sabina, die jugendrosige Gattin des Otho, obgleich ganz Rom von der Herrlichkeit dieser Frauenblüte berauscht war! Und nun vollends Octavia, die zukünftige Kaiserin! Ja, Octavia war, vom Standpunkt eines hellenischen Bildners betrachtet, vielleicht untadelhafter; sie besaß eine fürstliche Gemessenheit der Bewegungen: aber wie kalt, wie öde, wie leblos berührte das alles im Vergleich mit der knospenden, duftigen Anmut dieser Niedriggeborenen!
»Unmöglich!« wiederholte der Cäsar. » Was behauptet Acte zu sein?«
»Eine Freigelassene.«
»Eine Göttin,« murmelte Nero, ihr leidenschaftlich die Hand pressend. »Kind, du hast keine Ahnung, wie unsterblich schön du bist!«
»Herr, du verwirrst mich . . . Siehe, ich weiß ja, die Großen der Erde lieben es, mit den Armen und Schutzlosen ihre Scherze zu treiben. Aber von dir, dem edlen Befreier des Artemidorus, kann und darf ich nicht denken, daß du die Absicht habest, meiner zu spotten . . .«
»Ich deiner spotten? Auf den Händen möcht' ich dich tragen wie eine Schwester. Ich beneide den Artemidorus, wie der Tote den Lebenden! Wenn' s dir genehm ist, du liebes Geschöpf, so treten wir aus dem Getümmel hier abseits. Dort drüben am Ausgange beobachtet uns niemand, – und ich habe dir noch so vieles zu sagen!«
Sie folgte ihm schweigend.
»Wahrhaftig, der Gedanke läßt mich nicht los,« fuhr er mit herzentquellender Stimme fort. »Artemidorus! Wer mit ihm tauschen könnte!«
»So glaube ich dennoch, du spottest meiner! Du, der allmächtige Princeps – und Artemidorus! Welch eine gähnende Kluft . . .!«
»Freilich, – aber zu meinem Nachteil! Artemidorus hat das entzückende Recht, dir die Stirne zu küssen, dich in die Arme zu schließen . . . Wie froh und selig muß ihm zu Mute sein, wenn dein frühlingsblühender Mund auf dem seinen geruht hat!«
»Ich küsse den Artemidorus nicht,« sagte das Mädchen bestimmt.
»Wie? Deinen leiblichen Bruder?«
»Das ist er nicht, mit Vergunst. Claudius Nero hat übersehen, daß Artemidorus dem fernen Damaskus entstammt, während Acte einen italischen Vater hat.«
»Aber du hast doch um Gnade gebeten für deinen Bruder . . .«
»Ja, Herr, – im Sinne der nazarenischen Lehre. Ihr zufolge sind alle diejenigen meine Brüder, die ein menschliches Antlitz tragen.«
»So hast du mich nahezu überlistet.«
»Wahrlich, nein! Frage doch einen der Unsern, ob ich dich täusche! Wir Nazarener nennen uns auch im Alltagsverkehr Brüder und Schwestern, – weil wir jegliche Schranke, die uns, nach Ansicht des Volkes, zu trennen scheint, als nicht vorhanden betrachten. Wir nennen uns so, ob nun der eine auch Sklave, der andre ein Ritter sei; denn Menschen sind wir durch unsre Geburt, Sklaven, Ritter und Senatoren aber durch Zufall, wenn nicht durch die Gewalt und die Ungerechtigkeit früherer Geschlechter . . .«
Leuchtenden Auges schaute der Cäsar in das holde Gesicht.
»Mädchen,« raunte er, ganz betäubt von ihrer zaubrischen Weiblichkeit, »du bist eine Frühlingsblume und redest doch weise wie ein Pythagoräer. Was du gesprochen, ist nicht mehr und nicht weniger, als der tiefinnerste Kern jener Philosophie, die mir Seneca in die Seele geträufelt. Du beschämst mich tief. Ich glaubte mit meiner Weltanschauung hoch über den besten meiner Zeitgenossen zu stehen, und nun finde ich hier eine kaum erblühende Jungfrau, die das gleiche empfindet, ja, die es klarer und trefflicher ausdrückt, als mein bewunderter Meister! Träume ich denn? – Hat sich denn Plato mit Sokrates und dem wuchtigen Zeno in eins verschmolzen, damit diese göttliche Dreizahl in Gestalt eines Mädchens aufs neue geboren würde?«
Das Antlitz des Imperators schien bei diesen Worten hellster Begeisterung von einem Feuer durchglüht, das alle Züge verklärte, alle Bewegungen adelte. Die großen Pupillen saugten sich gleichsam fest an Actes tiefblauen Augen. Um die schwellenden, kaum vom ersten Flaume bedeckten Lippen bebte ein Zug unendlicher Sehnsucht, – so beredt, daß selbst ein Ungeübter ihn ablesen konnte. Es war das übersprudelnde, heiße Bekenntnis einer ersten, vergötternden Liebe.
Ungeübt waren nun freilich die Augen nicht, die aus dem Menschengewühle heraus den Imperator beobachteten, so verschieden auch der Gang ihrer Schulung und Erfahrungen sein mochte.
Sophonius Tigellinus, der schlaue, lebenslustige Agrigentiner, verfolgte die Scene zwischen dem Kaiser und dem hocherrötenden Mädchen mit jenem Behagen, das den Lehrer ergreift, wenn er wahrnimmt, wie die Saatkörner, die er ausgestreut, Wurzel schlagen. Claudius Nero schien auf bestem Wege, den hochnäsigen Philosophen Seneca für einen Esel zu halten, und was bis dahin Ausnahme war, zur Richtschnur der Existenz nehmen zu wollen. Die Kleine da mit dem wallenden Blondhaar und den küßlichen Lippen war ganz allerliebst. Hätte nicht Nero so unverhofft angebissen, so würde Sophonius Tigellinus vielleicht in eigener Person . . . Beim Hercules, er konnte sich vorstellen, daß ein kleines intimes Gelage – Cäcuber, Cyprier und dann die Knospe da als Dessert – selbst für ihn seine Reize gehabt hätte. Daran war nun allerdings nicht zu denken, und das blieb sich im Grunde auch gleich, denn Sophonius Tigellinus hatte die Auswahl unter den Schönsten und Vornehmsten; er brauchte die Hand nur auszustrecken, und selbst Poppäa Sabina schlug ihrem Ehegemahl ein Schnippchen . . . Ja, ja, davon war er fest überzeugt, der glänzende Tigellinus, – und nächstens wollte er sich die Sache einmal überlegen. Vorläufig hatte er alle Veranlassung, über das Resultat dieser Marsfeldwanderung zufrieden zu sein, kolossal zufrieden, denn Claudius Nero ging in der That ganz über alle Erwartung ins Zeug, – bei der Pferdegöttin Epona, ganz über alle Erwartung! . . .
Das andre Augenpaar, das unbemerkt auf dem Kaiser und seiner rosigen Partnerin weilte, gehörte dem Nicodemus. Durch seine Späher und Horcher hatte er in Erfahrung gebracht, was Tigellinus und Nero für die Zeit zwischen dem Frühstück und dem Hauptmahl geplant hatten. Sofort war er mit Acte nach dem Marsfeld geeilt, – und als er des Kaisers ansichtig ward, zog er sich schleunigst zurück, alles übrige der Klugheit des jungen Mädchens anheimgebend. Acte, die erst seit einigen Wochen in Rom weilte – sie hatte bis dahin eine Verwandte des Nicodemus in Ostia gepflegt – war in den Kreisen der Nazarener fast schon berühmt geworden wegen der wundersamen Kraft und Eindringlichkeit ihrer Bekehrungsversuche. Die Anhänger, die sie der Lehre Christi erworben hatte, zählten nach Dutzenden. So hatte sich denn der rastlose, fieberische Nicodemus entschlossen, dem verblüffenden Ziele, das er sich vorgesetzt, nicht nur auf dem Weg über Seneca, sondern unmittelbar nahe zu kommen und Acte, die unwiderstehliche Fürsprecherin, schlankweg in den Gesichtskreis des Imperators zu stellen. Ehedem Inhaber eines bedeutenden Handlungshauses, war Nicodemus auf einer Orientfahrt mit den Lehren der Nazarener bekannt geworden; der Tod eines geliebten Sohnes festigte in seinem trostbedürftigen Herzen die Ueberzeugung von der göttlichen Wahrheit des Christentums; und nachdem ihn der Glaube siegreich über den Jammer dieses Verlustes emporgehoben, brannte er nun von einer wahrhaft verzehrenden Glut, diesem Allheilmittel zum endgültigen Triumph über die Irrlehren des römischen Staats zu verhelfen. Wohlvertraut mit der Philosophie des Seneca, den er in früheren Jahren durch finanzielle Gefälligkeiten dringend verpflichtet hatte, fand er die innere Verwandtschaft zwischen der Lehre Jesu und dem weltverachtenden Stoicismus freudig heraus und knüpfte daran die tollkühne Hoffnung, mit einiger Klugheit den Zögling des Seneca in den Jünger des Zimmermannssohnes von Nazareth zu verwandeln.
Acte schien ihm als Mittel zu diesem Zweck wie geschaffen, nicht nur um ihrer warmherzigen Beredsamkeit willen, sondern auch – so sehr er sich dies verhehlte –, weil sie der Inbegriff aller Anmut und Weiblichkeit war. Sie würde auf Neros Gemüt, vielleicht sogar auf sein Herz wirken, – und was schadete es, wenn hier der welterlösende Glauben ausnahmsweise einmal seinen Einzug hielt auf den Flügeln der irdischen, baldvergänglichen Liebe? Acte wußte ja, was sie sich schuldig war . . . Sie würde im letzten Moment noch die Kraft finden, ihre Tugend aus der tosenden Brandung ans Ufer zu flüchten.
So legte sich Nicodemus die Sache zurecht . . . .
In Wahrheit und sich selber nicht klar, hatte er das Gefühl: »Und wenn dies eine Lamm auch zu Grunde geht, – der großen Herde wird sein Verderben zum Heil gereichen.« Der Bethörte hatte vergessen, daß aus dem Ueblen und Schändlichen niemals ein Gutes entsproßt; die vorurteilsfreie Abschätzung der Dinge war ihm abhanden gekommen.