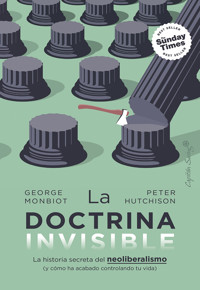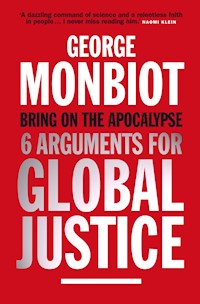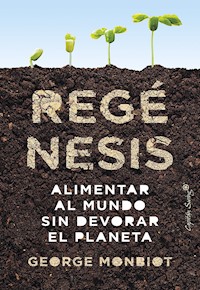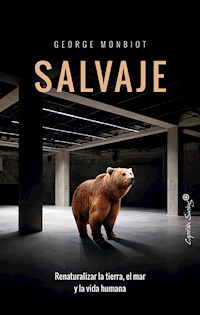11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Landwirtschaft ist die weltweit größte Ursache für Umweltzerstörung – und die, über die wir am wenigsten sprechen. Wir haben große Teile des Planeten gepflügt, eingezäunt und beweidet, vergiftet, um uns zu ernähren. Unser Ernährungssystem gerät dadurch ins Wanken.
Aber George Monbiot entwirft die atemberaubende Vision einer neuen Landwirtschaft. Er trifft Obst- und Gemüsebauern, die unser Verständnis von Fruchtbarkeit revolutionieren, Züchter mehrjähriger Körner, die das Land von Pflügen und Giften befreien, Wissenschaftler, die neue Wege für den Protein- und Fettanbau beschreiten. Auf der Grundlage erstaunlicher Fortschritte in der Bodenökologie zeigt Monbiot, wie wir die Welt ernähren können, ohne den Planeten zu verschlingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Die Landwirtschaft ist die weltweit größte Ursache für Umweltzerstörung – und die, über die wir am wenigsten sprechen. Wir haben große Teile des Planeten gepflügt, eingezäunt und beweidet, vergiftet, um uns zu ernähren. Unser Ernährungssystem gerät dadurch ins Wanken.
Aber George Monbiot entwirft die atemberaubende Vision einer neuen Landwirtschaft. Er trifft Obst- und Gemüsebauern, die unser Verständnis von Fruchtbarkeit revolutionieren, Züchter mehrjähriger Körner, die das Land von Pflügen und Giften befreien, Wissenschaftler, die neue Wege für den Protein- und Fettanbau beschreiten. Auf der Grundlage erstaunlicher Fortschritte in der Bodenökologie zeigt Monbiot, wie wir die Welt ernähren können, ohne den Planeten zu verschlingen.
Der Autor
GEORGEMONBIOT, Jahrgang 1963, studierte Zoologie in Oxford und ist einer der bekanntesten Journalisten und Autoren Großbritanniens. Seine wöchentlichen Kolumnen im britischen Guardian werden überall auf der Welt nachgedruckt. Seine Bücher Captive State und The Age of Consent (dt. Ausgabe United People) waren Bestseller. 1995 verlieh ihm Nelson Mandela den Global 500 Award der Vereinten Nationen für außergewöhnliche Leistungen im Umweltschutz. George Monbiot hat – im Rahmen von Gastprofessuren – u. a. an der University of Oxford (Umweltpolitik), an der University of Brixon (Philosophie) und der University of East London (Umweltwissenschaft) gelehrt. Er sitzt außerdem im beratenden Ausschuss des BBC Wildlife Magazine.
GEORGE MONBIOT
NEULAND
Wie wir die Welt
ernähren können,
ohne den Planeten
zu zerstören
Aus dem Englischen
von Rita Gravert
BLESSING
Originaltitel: Regenesis. Feeding the World without Devouring the Planet
Originalverlag: Allen Lane, Penguin Books, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by George Monbiot
Copyright der Übersetzung by Blessing Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München und by Verlagsservice Mihr, Tübingen
Satz: Leingärtner, Nabburg
Umschlaggestaltung: Bauer & Möhring Grafikdesign; Berlin
ISBN 978-3-641-27006-3V001
www.blessing-verlag.de
Für meine wunderbare Assistentin Fi,
ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre
Inhalt
1 WAS UNTER UNS LIEGT
2 WAS VOR UNS LIEGT
3 LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHENFRASS
4 FRUCHTBAR
5 GENUSS IN ZAHLEN
6 WURZELN SCHLAGEN
7 FARMFREE
8 BLÜHENDE LANDSCHAFTEN
9 DIE EISHEILIGEN
Danksagung
Anmerkungen
1 WAS UNTER UNS LIEGT
Ein wunderschöner Ort für einen Obstgarten, aber ein furchtbarer, um Obst anzubauen. Hier in Zentralengland, weit weg vom schützenden Puffer des Meeres, werden die Bäume vom späten Frost hart getroffen. Für gewöhnlich fließt kalte Luft wie Wasser ab, doch auf dieser flachen Parzelle, umgeben von einem Damm aus Häuserreihen, staut und sammelt sie sich und ertränkt den Obstgarten in einer Kältewelle.
Jedes Jahr, wenn die Bäume zu blühen anfangen, erwacht mit den aufbrechenden Knospen auch meine Hoffnung. Doch in zwei von drei Jahren verkümmern sie mitsamt den Blüten. Wie ein Giftgas kriecht der Frost in die Zweige, färbt die Staubgefäße schwarz und lässt sie welken.
Im Herbst ist der Obstgarten schließlich ein lebendes Abbild der Frühjahrstemperaturen. Die verschiedenen Apfelsorten erblühen zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten, doch jede hat Jahr für Jahr den gleichen Rhythmus. Der Frost vernichtet nur die bereits geöffneten Blüten, es sei denn, er ist ungewöhnlich hart. Anhand der Bäume mit und ohne Blüten kann man beinahe bis auf die Nacht genau bestimmen, wann der Frost zugeschlagen hat.
Jede Sorte gehört zur selben Art: Malus domestica, was wörtlich übersetzt das gezähmte Böse heißt. Die Ursachen für die jahrhundertealte begriffliche Herabsetzung dieses hübschen Baumes sind komplex. Am wahrscheinlichsten handelt es sich um eine etymologische Verwirrung: Anscheinend ist eine dialektale Bezeichnung für Frucht – μᾶλνο oder ›malon‹ – vom Griechischen ins Lateinische gerutscht, wo es sozusagen korrumpiert wurde: zu malum, das Böse.
Aus dieser einzelnen Art, zu gut, um wahr zu sein, wurden die unterschiedlichsten Sorten gezüchtet: Speiseäpfel, Backäpfel, Saftäpfel und Trockenäpfel in einer erstaunlichen Variation von Größen, Formen, Farben, Düften und Geschmacksrichtungen. Bei uns wächst Miller’s Seedling, der im August reif ist und direkt vom Baum verzehrt werden sollte, weil die kleinste Erschütterung Stellen in seiner durchscheinenden Schale hinterlässt. Er ist süß und mild und enthält mehr Saft als Fruchtfleisch. Dagegen ist der Wyken Pippin beim Pflücken hart wie Holz und bis in den Januar kaum essbar. Dann aber bleibt er knackig bis zum folgenden Mai. Wir ernten den St. Edmund’s Pippin, dessen Schale an Sandpapier erinnert, im September, wenn er für zwei Wochen trocken, nussig und aromatisch ist, und danach zerfällt. Außerdem den Golden Russet, dessen Geschmack und Textur beinahe identisch ist, sich bei ihm jedoch erst im Februar ausprägen. Mein Lieblingsapfel, der Ashmead’s Kernel, ist knackig mit einer Note Kümmel und schmeckt am besten mitten im Winter. Der Reverend W. Wilks bauscht beim Backen auf wie Wolle und schmeckt wie weicher Weißwein. Wenn man den Catshead an Weihnachten röstet, ist er kaum von Mangopüree zu unterscheiden. Ribston Pippin, Mannington’s Pearmain, Kingston Black, Cottenham Seedling, D’Arcy Spice, Belle de Boskoop und Ellis Bitter: All diese Äpfel sind Kapseln von Zeit und Ort, Kultur und Natur.
Da jeder Baum unterschiedliche Bedingungen braucht, um zu gedeihen, wachsen einige von ihnen hier besser als andere. Einige Sorten sind so stark an Boden und Klima ihres Ursprungsortes angepasst, dass sie sich bereits auf der anderen Seite desselben Hügels enttäuschend entwickeln. Indem wir Sorten angepflanzt haben, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen, versuchen wir das Risiko einer Missernte zu minimieren. Dennoch verlieren wir in schlechten Jahren, wenn es wiederholt friert, fast die gesamte Ernte.
Aber ja, trotz all der geplatzten Träume ist es ein wundervoller Ort für einen Obstgarten. Als ich ihn heute Morgen betrat, verschlug seine Schönheit mir den Atem. Die ersten Apfelbäume haben zu blühen begonnen: Die rosa Knospen haben sich geöffnet und zeigen ihre blassen Herzen. Die Birnen- und Kirschbäume stehen in voller Blüte und tragen so viele weiße Blütenblätter, dass ihre Zweige sich mit jeder Brise heben.
Ich laufe die Baumreihen ab und sauge ihren Duft ein. Jede Sorte hat einen schwachen, ganz eigenen Duft: Einige Blüten duften wie Hyazinthen, andere nach Flieder, wiederum andere nach Seidelbast oder Schneeball. Ich bilde mir ein, eine bestäubte Blüte am Geruch zu erkennen: Kaum dass ihr Parfüm nicht mehr gebraucht wird, um Bienen und Schwebfliegen anzulocken, verliert es sich. Die schneeweiße Birnenblüte mit ihren zwanzig schwarzen Staubgefäßen, die wie kleine Pferdehufe aussehen, sondert einen widerlichen Gestank nach Sardellen ab. Die Blütenblätter der Kirschbäume fallen bereits herunter und schweben wie Federn im leichten Wind. Das frische Gras ist von Schatten durchzogen, und Ringeltauben gurren in den Pflaumenbäumen. All dies nur ein paar hundert Meter von unserem Haus entfernt zu haben, erscheint mir als ein großer Luxus. Ein Luxus, für den wir unter den fünf Familien, die daran beteiligt sind, nur 75 Pfund im Jahr zahlen, was etwa 88 Euro entspräche.
Der Obstgarten befindet sich auf drei aneinander grenzenden Parzellen einer gemeinschaftlichen Gartensiedlung. Seit 1878 haben die Lokalregierungen in England den Bürgern Land zugeteilt, auf dem sie Gemüse und Früchte anbauen können. Im Prinzip haben wir seit 1908 per Gesetz das Recht, anzubauen.
In der Praxis beträgt die Wartezeit in manchen Städten allerdings zwanzig Jahre oder sogar mehr. Ohne es zu wollen, verbreitete dieses Gesetz im wahrsten Sinne des Wortes Anarchie. Es schuf Tausende selbst organisierter, selbst regierter Gemeinschaften, commons genannt. Auch wenn das Land der jeweiligen Gemeinde gehört, wird es von den Menschen, die darauf arbeiten, verwaltet und gepflegt.
Unsere Siedlung in Oxford teilt sich in 220 Parzellen, die von Menschen bewirtschaftet werden, die aus aller Welt in die Stadt gekommen sind. Wir bestäuben unser Wissen gegenseitig mit fremden Körnchen aus den seltsamsten Erfahrungsschätzen.
Vor siebzehn Jahren schienen die Gemeinschaftsgärten auszusterben. Lediglich ein Zehntel der Parzellen war besetzt. Die verbleibende Gemeinschaft suchte verzweifelt nach Menschen, die eine Parzelle übernahmen: Ansonsten würde die Stadt das Grundstück zur Bebauung freigeben. Sie verpachteten mir zweieinhalb aneinandergrenzende Parzellen, von der eine von bis zu drei Meter hohen Brombeersträuchern überwuchert war. Ich verbrachte einen Monat damit, sie mit einem Buschmesser zurückzuschneiden und ihre Wurzeln mit einer Hacke auszugraben. Unter ihnen lag eine schlafende Schönheit. Wiesengräser, Schlüsselblumen, Margeriten, Wildes Vergissmeinnicht, Wicke, Flockenblume, Gemeines Benediktenkraut, Skabiosen, Schafgarbe, Spitzwegerich, Gewöhnliches Ferkelkraut und Löwenzahn sprossen aus der Erde. Ihre Samen mussten jahrzehntelang darin geschlummert haben. Ich überredete ein paar Freunde, sich mir anzuschließen, und wir pflanzten alte Kulturobstsorten: Vor allem Apfelbäume, ein paar Pflaumenbäume, Kirschen, Birnen, einen Mispel- und einen Quittenbaum.
Gerade als die Bäume anfingen, Früchte zu tragen, verließ ich Oxford und zog nach Wales. Den Obstgarten hinter mir zu lassen, war eines der wenigen Dinge, die mir den Abschied erschwerten. Meine Freunde gaben ihn an andere Leute weiter, die ihn wiederum an andere weitergaben. Ein paar Jahre später kehrte ich aus familiären Gründen unerwartet zurück. Kurz nachdem ich angekommen war, erzählte mir einer meiner besten Freunde aus der Stadt, dass ein paar Leute, die kürzlich weggezogen waren, ihm einen wunderschönen Obstgarten überlassen hatten, der ein paar Jahre zuvor in den Gemeinschaftsgärten gepflanzt worden war … Allein war er der Aufgabe nicht gewachsen, und da fiel mir ein, dass ich ein bisschen was von Obstbäumen verstand.
Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Obwohl der Obstgarten weniger als ein Zehntel Hektar umfasst, kommt er mir inzwischen manchmal vor wie meine halbe Welt. Ein lebender Kalender, der mein Jahr strukturiert. Wir haben drei weitere Familien aufgenommen und eine kleine Gemeinschaft innerhalb der commons gegründet. Alle paar Monate organisieren wir einen Arbeitstag mit einer Mittagspause zwischen den Bäumen. Im späten Winter und im Frühling schneiden wir die Apfel- und Birnenbäume zurück. Im Mai und September mähen wir Gras. Im Juni dünnen wir die Früchte aus. Im Oktober ernten wir die Äpfel, lagern die unversehrten ein und verbringen, falls die Ernte es erlaubt, einen ganzen Tag damit, wie verrückt den Rest zu schneiden, zu zerdrücken, zu pressen, abzukochen und in Flaschen zu füllen. Einige werden zu Saft, andere zu Apfelcider. Echter Cider enthält keine Zusatzstoffe. Die Äpfel liefern den nötigen Zucker, den Geschmack und in ihrer Schale die Hefe. Bereits an Weihnachten ist der Cider genießbar, wenn auch noch süß und voller Kohlensäure. Binnen Februar hat er sich zu einem weichen, ausgewogenen Gebräu gesetzt, meiner leidenschaftslosen Meinung nach das beste alkoholische Getränk, das je Menschenleben ruiniert hat. Ende Mai ist der Cider bereits ein wenig zu trocken und im Juli macht er seinem lateinischen Namen für Äpfel alle Ehre: Er taugt, um Graffitis zu entfernen.
Mitten im Winter veranstalten wir ein »Wassail« im Obstgarten. »Wassailing« ist ein wissenschaftliches Prozedere, das sicherstellen soll, dass die Bäume im kommenden Jahr eine reiche Ernte tragen. Die Methodologie besteht darin, zu singen und Cider zu trinken. Einer sorgfältig geprüften Hypothese zufolge gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Reichtum der Ernte und dem Aufwand, den man betrieben hat: »For more or lesse fruits they will bring, / As you givethem Wassailing.«[1] Allerdings ist die Hypothese noch nicht bestätigt worden.
Und schon beginnt der Kreislauf von Neuem.
Am späten Vormittag befinde ich mich fast zwei Meter über dem Boden, mit einer Handsäge und einer langstieligen Baumsäge hantierend. Unser freundlicher Gartennachbar Stewart hat entschieden, dass er zu alt ist, um sich um seine Obstbäume zu kümmern: Er hat uns seine gesamte Baumreihe überlassen, die etwa die Größe unseres Obstgartens hat, womit unsere drei Parzellen komplett sind. Seine alten Bäume sind in einem ziemlich bemitleidenswerten Zustand, mit krummen Ästen, die entweder den Boden streifen oder so hoch in den Himmel ragen, dass man ihre Früchte unmöglich ernten kann. Darum stehe ich jetzt mitten in einem Kirschbaum, dessen Äste so voller Blüten sind, dass man kaum die Rinde erkennen kann, und begehe eine Schandtat.
Während Apfel- und Birnenbäume im Winter zurückgeschnitten werden können, müssen Steinobstbäume im Frühjahr oder frühen Sommer zurückgeschnitten werden, wenn ihre Lebenskraft steigt. Andernfalls riskiert man einen Pilzbefall oder, dass sie Baumkrebs oder die Kräuselkrankheit bekommen. Das bedeutet, dass man das unverzeihliche Verbrechen begehen muss, einen Baum in voller Blüte oder Frucht zu beschneiden. Die Äste krachen in einer Wolke aus schneeweißen Blüten zu Boden.
Obwohl mich das Gemetzel nicht unberührt lässt, liebe ich die Baumpflege. Beinahe zum Selbstzweck geworden, ist sie sowohl Pflege als auch Bildhauerei. Wenn man die großen Strukturschnitte hinter sich hat, stutzt man die verbleibenden Zweige bis auf eine Knospe zurück, die in die Richtung zeigt, in die der Baum wachsen soll. Sobald der Baum neue Triebe bildet, nimmt er die Form an, um die man ihn gebeten hat. Meine Lieblingsform ist die Spanische Form, auch Kelch genannt, bei der man den Baum zu einer breiten Tassenform zurückschneidet. Wenn man es richtig anstellt, bekommt jedes Blatt Sonnenschein und frischen Wind ab, was einem Blattlausbefall und Mehltau vorbeugt, ohne dass man Chemikalien einsetzen muss.
Während ich mich durch den Baum arbeite, denke ich über die Geschichte dieses kleinen Fleckens nach. Als wir den Boden umgruben, fanden wir Teile weißer Tonpfeifen, wie sie früher Arbeiter geraucht haben. Einige davon waren mit Punkten, Ringen oder Ranken verziert; und sie trugen die Fingerabdrücke und die Nageleinkerbungen ihrer Hersteller. Wir fanden zerbrochene Bewässerungsrohre, ein Eselshufeisen und moderne Austernmuscheln, die zum Teil schwer von Teilen fossiler Gryphae zu unterscheiden waren, die wir ebenfalls ans Licht holten: Eine knotige, gekrümmte Auster aus der Jurasteinzeit, hierzulande auch als Devil’s Toenails – »Zehennägel des Teufels« – bekannt. Früher, als das Meer noch reich an Fischen und Meeresfrüchten war, gehörten Austern selbst in Zentralengland zum Essen der armen Leute. Eines Tages fand ich eine halbe Perle mit einem Bohrloch für die Schnur, an der sie gehangen hatte.
Bevor sie von der Stadt eingekreist und an die Stadtbewohner verteilt wurden, waren diese Parzellen Ackerland gewesen, auf dem – den Bewässerungsrohren und schlafenden Wildblütensamen nach zu urteilen – wahrscheinlich verschiedene Fruchtfolgen angebaut worden waren. Einige Orte in der nahen Umgebung haben im Namen das Suffix -ley oder -leys, was oft eine vorübergehende Wiese bezeichnet, auf der zwischen Feldfruchtfolgen Heu und Viehfutter angebaut wird. Unsere Austernmuschelfunde konzentrieren sich auf einen ganz bestimmten Teil des Gartens, was darauf hinweist, dass hier möglicherweise einmal ein Baum stand, unter dem die Arbeiter sich zum Mittagessen niederließen, genau wie wir heute. Ich stelle mir vor, wie sie ausgestreckt dalagen, die breiten Hüte schief auf den Köpfen, und ihre Sensen lehnten zwischen den knotigen Wurzeln der großen Eiche.
Auch wir mähen das Gras hier ausschließlich mit Sensen. Zum einen, um möglichst wenig auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen, zum anderen, um die Frösche und Wühlmäuse zu schonen. Anfangs haben wir ziemlich grob auf das Gras eingehackt. Je angestrengter wir versuchten, es zu mähen, desto schlimmer sah es aus. Bis ich eines Tages bemerkte, wie eine Gartennachbarin, die 81-jährige serbische Geflüchtete Angela, uns ungläubig bei der Arbeit zusah.
Trotz allem, was sie gesehen und erlebt hat, findet Angela stets Freude am Leben und sieht das Gute in den Menschen. Ihren bäuerlichen Wurzeln treu geblieben, drängt sie uns oft ihr überzähliges Gemüse auf. Dabei erklärt sie uns stets, dass heutzutage keiner mehr weiß, was echtes Gemüse ist und wir keine Ahnung hätten, wie man es zubereitet, aber das sei nicht ihr Problem, denn sobald sie ihr Gemüse aus der Hand gegeben hätte, läge es in Gottes Händen. Im Gegenzug geben wir ihr Äpfel zum Rösten, Mispeln (die man im Balkan weitaus mehr zu schätzen weiß als hierzulande) und Pflaumen, aus denen sie alkoholische Getränke braut.
Irgendwann hielt sie es nicht länger aus, uns beim Grasmähen zuzusehen.
»Nein, stopp! Ihr macht alles falsch!«
Angela riss einem von uns die Sense aus der Hand und prüfte deren Gewicht, indem sie das Arbeitsgerät leicht hob und senkte, als würde sie damit Zwiesprache halten.
»Ich mache das, seit ich kleine Mädchen. Ich zeige es euch.«
Sie ließ das Blatt ins Gras sinken und tat dann etwas, was aussah wie ein leichter Hüftschwung. Das Gras fiel gleichmäßig zu Boden. Ohne in Schweiß auszubrechen, arbeitete sie sich die ganze Reihe hoch und hinterließ einen perfekt gemähten Rasen. Das gemähte Gras lag vollkommen einheitlich zu einer Seite, als wäre jeder Halm zurechtgekämmt worden.
Ich blicke von meinem Posten im Kirschbaum hinunter auf seine nutzlos gewordenen Äste am Boden. Lediglich vier habe ich am Baum gelassen, die mehr oder weniger in alle vier Himmelsrichtungen zeigen. Nun sieht er arg verstümmelt aus, doch er wird sich erholen. Ich klettere wieder hinunter und beginne, die abgesägten Äste zu zerteilen. Hier wird nichts weggeworfen. Die schweren Äste stapeln wir vorn am Eingang zu den Gemeinschaftsgärten, wo die Leute sie als Brennholz mit nach Hause nehmen. Obstbaumholz lässt sich sauber zuschneiden und brennt gut. Das Sägemehl verwende ich für meinen Holzgrill: So nehmen all meine Grillgerichte den weichen, dunklen Geschmack des Holzes an. Ein paar der dünneren Zweige verwenden wir, um die Erbsenpflanzen zu stützen, und den Rest stapeln wir zu einem Haufen. Nach fünf Jahren sind die Zweige zu einem nährstoffreichen, trockenen Kompost zerfallen, den wir entlang der Tropflinie der Bäume ausstreuen. Als Tropflinie bezeichnet man den Ring rund um den Baum entlang des Kronenrandes. Da die Baumkrone wie ein Regenschirm funktioniert, tropft das meiste Regenwasser entlang dieser Linie zu Boden. Infolgedessen konzentrieren sich in diesem Bereich die Nährwurzeln der Bäume. Schichtet man, wie einige es (aus Unwissenheit) tun, den Kompost rund um den Stamm, riskiert man lediglich, dass er schimmelt, anstatt den Baum zu ernähren.
In einem Frühling kam eine ganze Igelfamilie aus dem Zweigstapel. Die Jungen waren neugierig und arglos. Eines watschelte auf mich zu, schnupperte an meiner Hand und versuchte hineinzubeißen.
Wer Obst oder Gemüse anbaut, wie ich es in großen Mengen in meiner Zeit in Wales getan habe, wird jeden Tag an die Grenzen der Anbaubedingungen erinnert, die uns die Biologie und das Klima auferlegen und daran, wie diese Bedingungen zu flackern begonnen haben. Während ich keinen einheitlichen Wandel in den Frosteinbrüchen erkennen konnte, die immer wieder lärmend, aber ohne Signalwirkung über unseren Obstgarten kommen, sind andere Muster aufgetreten, die wir unmöglich ignorieren können. Dazu zählt vor allem der extreme Wechsel zwischen Dürren und heftigen Regenfällen, die nicht nur unseren Obstbäumen, dem Boden, sondern – wie wir inzwischen alle wissen – dem Rest der Nation und der gesamten Welt zusetzen. Diesen winzigen Landstrich zu bearbeiten, hat mir die Augen für das ganze Ausmaß der Notlage geöffnet, auf die wir zusteuern. Denn die Bedingungen, die es uns bisher ermöglicht haben, genug Nahrungsmittel anzubauen, sind im Wandel begriffen.
Ich lege die letzten Zweige auf den Komposthaufen und verstaue meine Sägen, Baumscheren und den Helm. Dann hole ich ein Set an Instrumenten aus dem Schuppen, um etwas zu tun, von dem ich kaum glauben kann, dass ich es noch nie getan habe. Ich habe Waldgebiete und Regenwälder, Savannen und Graslandschaften, Flüsse, Seen und Sumpfgebiete, die Tundra und Berggipfel, Küstenlinien und flache Ozeanregionen erforscht. Doch ich habe noch nie gründlich und bewusst den Boden unter meinen Füßen untersucht.
Es gibt Momente, in denen ich Mühe habe, mich selbst zu verstehen. Dies ist einer davon. Wo ich doch ein halbes Jahrhundert lang in unsere Lebenswelt eingetaucht bin und jede sich bietende Gelegenheit – so glaube ich zumindest – ergriffen habe, um die natürliche Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken und die mich umgebende Ökologie zu verstehen, wie konnte ich so kläglich daran scheitern, das Ökosystem, das so vielem anderen zugrundeliegt, zu erforschen? Warum habe ich, obwohl ich seit dreißig Jahren Nahrungsmittel anbaue, das Substrat vernachlässigt, das direkt oder indirekt rund 99 Prozent der von uns konsumierten Kalorien zur Verfügung stellt?[2]
Wie so viele stelle ich mir gern vor, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Doch wir alle sind in einem viel größeren Maße von der Gesellschaft und dem Zeitgeist beeinflusst, als wir uns eingestehen. Wir denken entlang der Linien, die andere für uns ausgelegt haben und folgen ausgetretenen Pfaden. Wir sehen, was andere sehen, und sind blind für Dinge, für die andere blind sind. Gut möglich, dass wir uns leidenschaftlich für die kleine Anzahl an Problemen einsetzen, die ins Rampenlicht geraten sind, aber wir kommen unbewusst und stillschweigend überein, andere Themen, die oft viel wichtiger sind, zu übersehen. Es gibt nur wenige Themen, die für uns so wichtig und zugleich so unbekannt sind wie der Boden.
Ein paar Meter vom Kirschbaum entfernt, treibe ich meinen Spaten in die Erde. Da ich meine Werkzeuge beständig schärfe, teilt sich die Grasnarbe trotz des schweren, von Wurzeln durchzogenen Bodens in einem sauberen Schnitt. Ich steche mit dem Spaten ein kleines Quadrat in die Grassode und hebe eine halbe Spatenlänge aus, etwa ein Kilogramm Boden. Dann lege ich mich bäuchlings ins Gras und arbeite mich Stück für Stück durch meine Probe.
England ist – so glaubte ich zumindest, bis ich mit den Recherchen für dieses Buch begann – für einen Naturforscher ein ziemlich entmutigender Ort. Auch wenn seine sichtbare Tier- und Pflanzenwelt einst sehr viel artenreicher war als heute, war sie nie so vielfältig wie in anderen Teilen der Erde, insbesondere in den Tropen. Inzwischen existiert nur noch ein trauriger Rest. Die Inselgruppe hat all ihre großen Landraubtiere verloren, ebenso wie die meisten großen Pflanzenfresser. Unsere Nahrungsnetze sind zerlumpt und zerlöchert, da viele Fäden fehlen. Es gibt kaum noch nicht bewirtschaftete Flächen und selbst diese werden oft falsch verwaltet und sind verschmutzt. In großen Teilen des Landes gibt es nicht viel zu entdecken. So glaubte ich zumindest.
Nun ging mir auf, dass ich am falschen Ort gesucht hatte. Während das Leben über der Erde hierzulande unterdrückt und ausgelaugt ist, verbirgt sich unter ihrer Oberfläche eines der reichsten Ökosysteme der Welt. In diesen Breitengraden ist der Boden diverser als beinahe irgendwo sonst. Ein wissenschaftlicher Artikel vermutet eine umgekehrte Beziehung zwischen der Diversität des Pflanzenlebens über der Erdoberfläche und dem Tierreich darunter.[3] In einem Quadratmeter unseres Obstgartenbodens leben wohl viele hunderttausend Tiere, die Tausende Arten umfassen. Diese Erkenntnis musste ich erst einmal verdauen. Mehrere Tausend Arten in einem Quadratmeter Boden.
Der englische Boden ist womöglich ebenso artenreich und ebenso unerforscht wie der Regenwald des Amazonas (den Boden des Amazonas nicht mitgerechnet). Wissenschaftler gehen davon aus, dass bisher lediglich 10 Prozent der kleinen Bodentiere identifiziert wurden.[4] In meinem Obstgarten gibt es wahrscheinlich Tausende unentdeckter Arten, von denen viele wohl auch noch einzigartig für diese Region sind: Kaum eine Mikroarthropode (kleine herumflitzende Kriechtiere) ist in Bodengemeinschaften in verschiedenen Teilen der Welt heimisch.[5] Über ihre Beziehungen untereinander ist noch weniger bekannt. So staunen Ökologen beispielsweise über etwas, das sie das Rätsel der Hornmilben nennen.[6] Mag sein, dass es nicht so romantisch oder mysteriös klingt wie das Rätsel der Sphinx, aber ich finde es genauso faszinierend. Hornmilben sind eine Unterordnung einer Unterordnung der Milben, die wiederum eine Unterordnung der Arachniden oder Spinnentiere darstellen, die Klasse, zu der unter anderem die Spinnen zählen. Sie sind winzig, krabbenartig und auf den ersten Blick vollkommen unauffällig. Doch in nur einer Handvoll Boden können Hunderte Arten Hornmilben vorkommen, die scheinbar alle die gleiche ökologische Nische besetzen. Ökologen sind es gewohnt, dass eine einzelne Art eine ganz bestimmte Nische besetzt, weil sie die anderen übertrifft und somit verdrängt. Hier hingegen haben wir es mit einer erstaunlichen Anzahl verwandter Tiere in einer breiten Variation von Formen, Größen und Farben zu tun, die augenscheinlich friedlich nebeneinander her leben und offenbar alle dasselbe tun. Wie ist das möglich?
Schon Leonardo da Vinci merkte an, dass wir mehr über die Bewegung der Himmelskörper wissen als über den Boden unseres eigenen Planeten. Das gilt auch heute noch.
Das Erste, was ich erblicke, sind ein Knochenteilchen, ein blasses Schneckenhaus, ein vertrockneter Pflaumenkern und eine blaue Keramikscherbe. Dann sehe ich genauer hin und entdecke eine Landassel und einen kleinen, bleichen Tausendfüßer, dessen Beine sich entlang seines Körpers in Wellen zusammenkrümmen und wieder auseinander streben. An seinen Flanken prangen rote Flecken wie die Schilde eines Wikingerlangschiffes. Ein brauner Hundertfüßer eilt Segment für Segment vorbei und verschwindet in einer dunklen Erdwand. Ich sehe karamellfarbene Käferlarven und ganze Trauben durchsichtiger Kugeln, die die hellweißen Sicheln von Schneckenembryos enthalten. Die verschlungenen Triebe der Setzlinge arbeiten sich auf der Suche nach Licht durch die Bodenmatrix.
Ich zerbrösele eine Prise Boden über einem feinen Sieb und platziere es im hellen Licht über einem Trichter, der in ein Reagenzglas gefüllt mit Gin führt. Den Reagenzglasständer hindere ich mit kleinen Stöcken am Umfallen und stelle das Ganze zum Erwärmen in die Sonne.
Dann breche ich einen Klumpen aus dem Boden, nehme mein 40-faches Vergrößerungsglas und stelle die Brennweite ein. Kaum habe ich das getan, erwacht die Erde zum Leben. Das Erste, was ich sehe, ist ein Springschwanz: Ein schwach olivfarbenes, rundliches Wesen, leicht pelzig wie ein gehäkeltes Spielzeug, das vor dem Licht flieht. Nun, da ich einen gesehen habe, entdecke ich sie überall: Es gibt kleine graue mit einer Länge von weniger als einem Millimeter, winzige weiße, einen Drei-Millimeter-Giganten, der grau, pink und blau schillert und eine buckelige, bernsteinfarbene Art, die aussieht wie ein Tropfen Honig.
Springschwänze sehen ein bisschen aus wie Insekten, doch sie bilden eine ganz eigene Klasse von erstaunlichem Artenreichtum: Manchmal findet man 100 000 oder mehr in einem Quadratmeter Boden. Sie können männlich, weiblich, hermaphroditisch (ein bisschen von beidem) oder parthenogenetisch sein, was bedeutet, dass sie sich durch unbefleckte Empfängnis reproduzieren (eingeschlechtliche Fortpflanzung). Sie leben fast überall, selbst in der Antarktis, und haben in den vergangenen 400 Millionen Jahren jedes Ereignis, das zu einem Massenaussterben geführt hat, überlebt. In vielen Teilen der Erde verknüpfen sie das gesamte Nahrungsnetz miteinander. In anderen Worten, sie sind der Kanal, der vieles Leben an Land miteinander verbindet. Doch kaum jemand weiß von ihrer Existenz.
Während ich den Springschwänzen folge, schiebt sich ein riesiges Ungeheuer vor meine Linse. Erschrocken fahre ich zurück. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, dass es sich um eine Ameise handelt. Als ich mich umsehe, fällt mir auf, dass ich mich am Rande der Myrmekosphäre befinde, also der Bodenschicht, die unter dem Einfluss der Ameisen steht. Neben meiner Schulter befindet sich einer ihrer Hügel, etwa 40 Zentimeter hoch, mit dessen Bau die Vertreter der Gelben Wiesenameise beinahe sofort, nachdem ich die Brombeersträucher entfernt hatte, begonnen haben.
Ameisenhügel sind fest wie Beton. Wenn ich Pflaumenschösslinge und wieder auflebende Brombeersträucher aus dem Boden hacke, weiß ich immer, wenn ich den Rand eines Ameisenhügels treffe, weil das Werkzeug in meinen Händen stumpf und unangenehm zum Stillstand kommt. Die Ameisen holen Lehm aus dem Untergrund hoch und vermischen ihn mit ihrem Speichel zu einem Zement, der stark genug ist, um ihre mehrstöckigen Gewölbe zu tragen. Verglichen mit menschlichen Behausungen wären diese Türme hundert Meter hoch. In ihre Keller, die bis zu einem Meter tief in den Boden reichen,[7] verschleppen sie Blattläuse, die sich von den verzweigten Wurzeln der Pflanzen ernähren und den Honigtau produzieren, von dem sich wiederum die Ameisen ernähren.
Ameisen sind die Ingenieure des Ökosystems, die alles Leben in ihrem Gebiet beeinflussen. Im Obstgarten habe ich beobachtet, dass der Germander-Ehrenpreis, eine kleine blaue Blume, am liebsten die Dächer der Ameisenhügel besiedelt, während um sie herum ungewöhnlich dichtes, dunkles Gras wächst. In und rund um ihre Wolkenkratzer sammeln die Ameisen Nährstoffe und füttern damit unbeabsichtigt die Lebewesen, die sich daran angepasst haben, neben ihnen zu leben. Die südöstliche Seite jedes Ameisenhügels ist flach und wie ein Solarpaneel ausgerichtet, um die Morgenwärme aufzunehmen.
Bald nachdem ich die Ameise gesichtet habe, entdecke ich ein weißes Krebstier, das nur einen Millimeter lang ist. Als ich es nachschlage, finde ich heraus, dass es sich um eine Ameisenassel handelt. Ganz im Gegensatz zu seinen Verwandten kann es zwischen diesen kampfeslustigen Tieren leben, ohne entzweigerissen und verspeist zu werden. Noch viel eindrucksvoller: Es überredet sie, es zu füttern, indem es sie mit seinen Antennen streichelt und solange bettelt, bis sie die Futterteilchen wieder hochwürgen, die sie normalerweise nur untereinander teilen.[8] Da Gelbameisen fast blind sind, scheint es so zu sein, dass die Assel sie an der Nase herumführt, indem sie ihren Geruch annimmt. Ihr Geruch und die Liebkosungen ihrer Antennen überzeugen sie, dass es sich um ein hungriges Mitglied ihres eigenen Staates handelt. Wenn die Verkleidung jedoch auffliegt und die Ameisen angreifen, hebt die Assel die beiden Hörner an ihrem Hintern und spritzt ihnen einen Stoff ins Gesicht, der ihre Kiefer verklebt.
Ich belichte einen langen, blassen Hundertfüßer, der in der Vergrößerung so furchterregend wie ein mittelalterlicher Riesenwurm aussieht. Er schnappt mit seinen Fängen – genaugenommen handelt es sich um ein umgewandeltes Vorderbeinpaar, im Englischen forcipules genannt –, durch die Gift fließt, und kriecht dann in einer grausamen Mischung aus wuseligen und geschmeidigen Bewegungen davon. Im Gegensatz dazu wirkt der unterwürfige, rosa-braune Tausendfüßer, der mit seinem flachen Körper unter einem breiten, überlappenden Panzer seine Eier bewacht, auf beruhigende Weise schlicht wie eine Hofhenne. Kleine, weiße Enchyträen winden sich unter dem Lichtstrahl, und überall sieht man runde, krabbenartige Milben. In Böden wie diesem sind sie sogar noch zahlreicher vertreten als Springschwänze: Es gibt Orte, an denen man auf erstaunliche 500 000 pro Quadratmeter kommt.[9] Einige haben winzige Füßchen, die wie bei Einsiedlerkrebsen gerade so aus ihrem Panzer ragen, andere haben lange Tastbeine. Es gibt sie in Braun, Rosa, Violett, Gelb, Orange und Weiß. Überhaupt scheint es im Boden eine weiße Version von allem zu geben. Die weißen Tiere leben für gewöhnlich in tieferen Schichten, wo alle blind sind (abgesehen von einer groben Fähigkeit, Licht von Dunkelheit zu unterscheiden) und somit keinerlei Verkleidung vonnöten ist. Alles, was ein Tier kreiert, bedeutet einen zusätzlicher Energie- und Ressourcenaufwand, auch Farbe und Augen. Wenn sie ohne auskommen können, sorgt die natürliche Selektion dafür, dass sie es auch tun.
Ich nehme das Reagenzglas aus der Halterung und halte es gegen ein Blatt schwarzes Papier. Mit meinem Objektiv kann ich ganz schwach winzige, weiße Filamente ausmachen: Nematoden (Fadenwürmer) werden durch das Licht und die Wärme der Sonne aus der Bodenprobe in den Trichter und von da in den Gin getrieben. Auch von ihnen gibt es geradezu fantastisch viele und sie sind für das Nahrungsnetz des Bodens von entscheidender Bedeutung. Wenn die Bedingungen stimmen, können sie sich zwölfmal am Tag vermehren.[10]
Während ich in die verborgenen Kammern des Bodens vordringe, komme ich mir riesig, gewalttätig und ungeheuer langsam vor. All seine Bewohner verabscheuen das Licht und bewegen sich überraschend schnell, wenn es auf sie trifft. Andernfalls würden sie in diesem unersättlichen Dschungel sofort gefressen werden. Ich sehe deutlich das Blutbad, das Bodenraubtiere hinterlassen haben: die leeren Panzer der Tausendfüßer, die Flügelplatten von Käfern, leere Schneckengehäuse, die verstreuten Rüstungen nach der Schlacht.
Dann bemerkte ich etwas, das aussieht, als wäre es einem japanischen Zeichentrickfilm entstiegen: lang und geduckt, mit zwei feinen Fühlern vorn und zwei hinten, sprungbereit und gefedert wie ein kräftiger Drache oder ein fliegendes Pferd. Beinahe rechne ich schon damit, eine Studio-Ghibli-Heldin auf seinem Rücken vorzufinden. An diesem Punkt hätte mich nichts mehr überrascht. Es verfügt über sechs Beine, ist aber kein Sprungschwanz und ähnelt keinem mir bekannten Insekt. Als ich es nachschlage, finde ich heraus, dass es sich um Doppelschwänze oder Diplura handelt. Sie gehören einer ganz eigenen Klasse an Lebewesen an – eine Gruppe mit dem gleichen Status wie Insekten oder Säugetiere –, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte.[11] Wie konnte es sein, dass ich, nachdem ich mich mein Leben lang mit Naturgeschichte beschäftigt und einen Abschluss in Zoologie in der Tasche habe, noch nie davon gehört hatte? Aber das ist noch nicht die spektakulärste Enthüllung meiner Ignoranz.
Kurz darauf sichte ich ein weiteres Tier, das auf den ersten Blick aussieht wie ein kleiner, weißer Hundertfüßer. Bei genauerem Hinsehen entdecke ich jede Menge von ihnen. Als ich eines von ihnen unter mein Objektiv lege, zähle ich jedoch statt der für Hundertfüßer üblichen fünfzehn oder mehr Beinpaaren lediglich zwölf, und statt des gepanzerten Kopfes mit den gefährlich geschwungenen Kiefern hat dieses Geschöpf das weiche, runde Gesicht eines Pflanzen- oder Aasfressers. Als ich durch ein Buch über Bodenökologie blättere, stoße ich auf ein Foto, das erstaunt. Es handelt sich um ein Lebewesen namens Symphyla, Mitglied nicht nur einer mir noch nie untergekommenen Klasse von Lebewesen, sondern einigen Sachkundigen zufolge gar eines gesamten Phylums.[12]
Ein Phylum ist eine große Sache. Menschen gehören zur Familie der Hominidae, der Menschenaffen. Diese Familie wiederum ist Teil der Ordnung der Primaten: Menschenaffen, Affen, Faulaffen, Koboldmakis, Galagos und Lemuren. Diese Ordnung ist eine Unterkategorie der Klasse, die wir Säugetiere nennen und die alles von Spitzmäusen bis hin zu Walen umfasst. Die Säugetiere sind ein Zweig des Phylums Chordata, was uns mit Vögeln, Reptilien, Amphibien, Fischen, Lanzettfischchen und Seescheiden eint. Jetzt betrachte ich (einigen Quellen zufolge) ein Phylum, eine mit den Chordata vergleichbare Gruppe, die wahrscheinlich noch artenreicher ist und von der ich bis heute nie etwas gehört hatte.
Mir kommt ein überraschender Gedanke. In diesem halben Spatenstich Boden sehe ich mehr Hauptzweige des Lebens versammelt, als ich je in der Serengeti oder irgendeinem anderen Ökosystem zu Gesicht bekommen habe. Hier gibt es Insekten und Krebstiere, Milben und Spinnen, Chilopoda (Hundertfüßer) und Diplopoda (Tausendfüßer), Springschwänze und Regenwürmer, Nematoden, Weichtiere und andere Lebewesen, von deren Existenz ich bisher nichts wusste.
Der außergewöhnliche Artenreichtum im Boden ist nur aufgrund seiner riesigen Oberfläche möglich. In Extremfällen – sehr feiner Lehm – könnte ein einziges Gramm (in trockenem Zustand ein halber Teelöffel), wenn all die Oberflächen flach ausgelegt wären, 800 Quadratmeter bedecken, also ein Gebiet, das etwas größer ist als unser Obstgarten. Ebenso wichtig: Anders als die homogene Masse, für den ich ihn einst gehalten habe, ist der Boden eine kosmopolitische Stadt aus verschiedenen Zonen und Strukturen, in der unterschiedliche Kulturen angrenzende Gemeinden bewohnen. Eine dieser Zonen ist die Myrmekosphäre, der Ameisenbezirk, der wiederum in untergeordnete Stadtteile gegliedert ist. Aber ökologisch noch wertvoller sind die schmalen Abteilungen rund um die Pflanzenwurzeln, auch Rhizosphäre genannt. Auf dieser Zone baut die gesamte Menschheit auf. Als ich den Klumpen auseinanderziehe, ist das Wurzelgeflecht so dicht, dass es sich anfühlt, als würde ich Stoff zerreißen.
Ich wende meine Aufmerksamkeit einem winzigen Wurzelhaar zu. Für das bloße Auge sieht es aus wie eine einzelne Faser, dünn wie ein Baumwollfaden. Doch unter dem Mikroskop entdecke ich, dass es von sehr viel feineren Haaren umrankt und eingeschlossen ist, die wie Kristalle im Sonnenlicht glitzern. Jede Wurzel hat sie, sogar um die sprießenden Spitzen herum, die um diese Jahreszeit nicht älter als ein oder zwei Tage sein können. Einige sehen aus wie Schnurrhaare, andere sind so fest miteinander verwoben, dass sie an ein ausgefranstes Nylongeflecht rund um das Kabel eines Bügeleisens erinnern. Es sind die Filamente – Hyphen – der Pilze, deren Leben eng mit dem der Pflanzen verflochten ist.
In den meisten Fällen handelt es sich nicht um Pilze, deren Früchte wir über der Erde sehen können, auch wenn Speisepilze und Giftpilze ebenfalls Beziehungen mit Pflanzen eingehen. Die große Mehrheit der Pilze – vielleicht eine Million Arten – lebt ausschließlich im Boden und viele von ihnen verflechten sich mit und vermehren sich durch die Pflanzenwurzeln, von denen ihr Leben abhängt. Die meisten Pflanzen sind wiederum darauf angewiesen, dass die Pilze ihnen Mineralstoffe und Feuchtigkeit aus dem Boden zuführen.[13] Die Pflanze versorgt den Pilz mit Kohlenhydraten und Lipiden – die chemischen Stoffe, die die Bausteine für Fette und andere wichtige Verbindungen bereitstellen –, die sie mittels der Fotosynthese herstellt. Die Pilze hingegen liefern der Pflanze Stickstoff, Phosphor und andere Elemente, nach denen sie den Boden absuchen und die sie weitaus effizienter transportieren können als Pflanzen. Ihre feinen Filamente kriechen in Poren und Furchen, die selbst für die dünnsten Wurzelhaare zu schmal wären und die Enzyme und Säuren, die sie freisetzen, trennen Mineralverbindungen, die Pflanzen nicht aufspalten könnten.
Diese für beide Seiten vorteilhafte symbiotische Beziehung ist so alt wie die ersten Landpflanzen, nämlich etwa 460 Millionen Jahre.[14] Als sich die ersten Algen aus dem Wasser an Land zurückzogen, hatten sie noch keine Wurzeln: Im Meer konnten sie die Nährstoffe direkt aus dem Wasser absorbieren. Um zu überleben, mussten sie Beziehungen mit Pilzen eingehen, die das Land besiedelt hatten und im Grunde nichts anderes als Wurzeln waren. So wie wir nicht die einzelnen Lebewesen sind, für die wir uns halten, sondern eine Gemeinschaft aus Milliarden von Mikroben und den vielzelligen Strukturen, die sie bewohnen, dürfen wir Pflanzen nicht als unverwüstliche Individuen sehen, sondern als Vereinigung miteinander nicht verwandter Lebewesen, die mit vereinten Kräften Lebensformen schaffen, die so komplex sind, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen, wie wenig wir eigentlich wissen.
An Orten wie unserem Obstgarten, wo die Pflanzen bereits seit längerer Zeit etabliert sind, finden sich in jedem Gramm Boden insgesamt rund ein Kilometer Pilzhyphen:[15] ein Kilometer in weniger als einem Teelöffel. Die Hyphen eines jeden Pilzes bilden ein dichtes Netz, das Mycel heißt. In einigen Wäldern kann sich das Mycel eines einzigen Pilzes über mehrere Quadratkilometer Boden erstrecken, doch die meisten sind weitaus kleiner. Sie befinden sich in einem konstanten Wachstums- und Rückzugsprozess, gehen neue Beziehungen ein, verändern die Bedingungen der bereits etablierten, greifen ineinander, bewegen Nährstoffe von einem Ort zum anderen und sichern ihr eigenes Überleben, während sie zugleich den Pflanzen dienen, mit denen sie eine Symbiose eingegangen sind. Einige von ihnen verbinden die Wurzeln Hunderter Pflanzen miteinander.
Die Entdeckung, dass zuweilen Zucker von den Wurzeln starker, gesunder Bäume zu den Wurzeln schwacher oder kranker bewegt wird, sorgte für Aufregung, da einige darin einen Beweis für den Altruismus unter Pflanzen sahen. Doch, wie Merlin Sheldrake in seinem wundervollen Pilzbuch Verwobenes Leben darlegt, lautet die wahrscheinlichere Erklärung, dass die Pilze ihre Beziehungspartner im Grunde bewirtschaften, indem sie Nahrung von einer Pflanze zur nächsten bewegen und so dafür sorgen, dass all jene, von denen sie abhängig sind, am Leben bleiben.[16]
Sheldrake bespricht in seinem Buch auch die Möglichkeit, dass es sich bei Pilzmycelien um intelligente Lebewesen handelt. Sie besitzen ein räumliches Erinnerungsvermögen, finden sich in Labyrinthen zurecht, können Nachrichten von einem Ende des Netzwerks zum anderen senden und weit entfernt vom Ort der Stimulation die Reaktionen des Netzwerks beeinflussen. Seit man herausgefunden hat, dass Pilzhyphen elektrische Signale leiten können, deren Intervall den Signalen tierischer Nervenzellen – grob gesagt, vier Aktionspotenziale pro Sekunde – ähnlich ist, betrachten manche Wissenschaftler die Millionen Zweigstellen im Mycel als Entscheidungstore oder Prozessoren und das Netzwerk als eine Art Computer.
Pilze tragen wesentlich zur Gesundheit der Pflanze bei, mit der sie wachsen. In vielleicht noch größerem Maße als ihre grünen Partner binden sie den Boden,[17] schützen ihn vor Erosion, nehmen Regen auf und speichern den darin enthaltenen Kohlenstoff.
All das ist erstaunlich genug. Doch einige Dinge, die ich noch nicht einmal durch mein Objektiv sehen kann, sind sogar noch viel überwältigender.
Hier kommt eine Tatsache, die alles ändert, was wir einst über das lebende System zu wissen glaubten, das unser aller Leben zugrunde liegt: Von dem Zucker, den Pflanzen durch Fotosynthese herstellen, geben sie zwischen 11 und 40 Prozent an den Boden ab.[18] Sie verlieren ihn nicht aus Versehen. Sie pumpen ihn aus freien Stücken in den Boden. Noch bizarrer: Bevor sie ihn freigeben, verwandeln sie einige dieser Zucker in höchst komplexe Verbindungen mit unmöglichen Namen wie
2,4-Dihydroxy-7-Methoxy-2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-on.
Chemische Substanzen wie diese herzustellen, erfordert einen beträchtlichen Aufwand an Energie und Ressourcen. Auf den ersten Blick erscheint es völlig wahnsinnig, dieses teure Gebräu einfach in den Boden zu kippen: Als würde man Geld den Abfluss hinunterspülen. Warum sollte man so etwas tun? Die Antwort darauf öffnet das Tor zu einem geheimen Garten.
Diese komplexen chemischen Substanzen werden nicht wahllos in den Boden ausgeschüttet, sondern in den Bereich rund um die Wurzeln:[19] die Rhizosphäre. Sie werden freigesetzt, um eine Reihe wundersamer und verschlungener Beziehungen mit den Wesen aufzubauen und zu pflegen, auf denen alles Leben fußt: Mikroben.
Der Boden birst nur so vor Bakterien. Sein erdiger Geruch ist in Wahrheit der Duft chemischer Stoffe, die sie herstellen. Petrichor, der Geruch, der von trockener Erde ausgeht, wenn der erste Regen darauf fällt, wird größtenteils von Bakterien der Ordnung Actinomycetales hervorgerufen. Keine zwei Böden riechen gleich, weil keine zwei Böden dieselbe Bakterienbesiedlung haben. Jeder hat sozusagen sein eigenes Terroir. Biologen bezeichnen Bodenmikroben auch als »Nadelöhr«, das alle in verwesendem Material enthaltenen Nährstoffe passieren müssen, bevor sie vom restlichen Nahrungsnetz recycelt werden können.[20]
Mikroben leben im gesamten Boden verteilt, doch in den meisten Ecken verbringen sie ihre Zeit größtenteils in einem Schwebezustand und warten auf Nachrichten, die sie aus ihrer Starre holen. Wenn eine Pflanzenwurzel in einen Klumpen Boden vordringt und anfängt, Signalsubstanzen und Zucker auszuschütten, löst sie explosionsartige Aktivität aus. Die Bakterien antworten auf ihren Ruf, indem sie die reichhaltige Suppe konsumieren, mit denen die Pflanze sie versorgt und vermehren sich in unglaublicher Geschwindigkeit, um einige der dichtesten Mikrobenkolonien der Erde zu bilden. In einem einzigen Gramm Boden der Rhizosphäre können bis zu einer Milliarde Bakterien stecken.[21]
Die Bakterien sammeln und setzen viele Nährstoffe frei, die die Pflanze zum Überleben braucht. Neben den Pilzen, deren Hyphen mit den Wurzeln verflochten sind, fangen Bakterien und andere Mikroorganismen Eisen, Phosphor und andere Elemente aus dem Boden auf und machen sie für die Pflanzen verfügbar. Sie spalten komplexe organische Verbindungen, die dann von den Wurzeln aufgenommen werden können.[22] Bakterien können auf einzigartige Weise inaktiven Stickstoff aus der Atmosphäre in Mineralstoffe verwandeln (Nitrate und Ammonium), die entscheidend für die Proteinherstellung sind. Kein Teil des Nahrungsnetzes kann ohne Bakterien überleben.
Bodenbakterien produzieren außerdem Wachstumshormone und andere spezifische chemische Stoffe, die die Pflanzen in ihrer Entwicklung unterstützen. Die Komplexität einiger Verbindungen, die die Pflanze in den Boden ausschüttet, erklärt sich dadurch, dass sie nicht alle, sondern bestimmte Bakterien erreichen will, die ihr Wachstum am effektivsten fördern.[23] Pflanzen sprechen chemische Sprachen, die nur die Mikroben, die sie erreichen wollen, verstehen können.
Diese Sprachen ändern sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit, je nachdem, was die Pflanze braucht.[24] Wenn es Pflanzen an einem bestimmten Nährstoff mangelt oder der Boden zu trocken oder zu salzig ist,[25] wenden sie sich an die Bakterien, die diese Engpässe überwinden können. Einige Biologen sprechen von einem »Hilferuf«. Als Antwort auf diese chemischen Rufe der Pflanze vermehrt sich eine spezifische Bakterienkultur rund um ihre Wurzeln.
Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich diese Fakten vor Augen führt, erkennt man etwas, das unser Verständnis vom Leben auf der Erde von Grund auf verändert. Obwohl die Rhizosphäre außerhalb der Pflanze liegt, ist sie ebenso entscheidend für ihre Gesundheit und ihr Überleben wie das pflanzliche Gewebe. Im Grunde ist sie ihr externer Darm.[26]
Die Rhizosphäre weist eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit dem menschlichen Darm auf, wo ebenfalls Bakterien in erstaunlicher Zahl zu finden sind. In beiden Systemen spalten Mikroben organisches Material in einfachere Verbindungen auf, die die Pflanze oder der Mensch aufnehmen kann. Obwohl es bei Bakterien mehr als 1000 Phyla (Stämme) gibt, dominieren die gleichen vier Phyla[27] die Rhizosphäre und den Darm von Säugetieren.[28] Vielleicht weisen diese vier Bakterienstämme Charakteristika auf, die sie besser kooperieren lassen als andere.
Bei Menschen ist das kindliche Immunsystem weniger aktiv als das von Erwachsenen, wodurch sich eine Vielzahl von Bakterien in ihrem Darm ansiedeln kann. Parallel dazu geben junge Pflanzen weniger Abwehrstoffe in den Boden ab als ältere und erlauben somit einer breiten Variation von Mikroben, sich in ihrer Rhizosphäre anzusiedeln.[29] Menschliche Muttermilch enthält bestimmte Zuckermoleküle, die Oligosaccharide. Anfangs verstanden Wissenschaftler nicht, warum Mütter diese chemischen Verbindungen produzieren, obwohl ihre Säuglinge sie nicht verdauen können. Inzwischen hat es allen Anschein, als bestünde ihr einziger Zweck darin, die Bakterien zu ernähren, mit denen das Kind aufwachsen wird. Sie kultivieren eine ganz bestimmte Bakterienart – Bifidobacterium longum infantis –, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Darmflora und des Immunsystems spielen.[30] Auch junge Pflanzen geben große Mengen Saccharose an den Boden ab, um ihre neuen Mikrobiome zu ernähren und wachsen zu lassen.
Wie auch der menschliche Darm verdaut die Rhizosphäre nicht nur Nahrung, sondern hilft auch dabei, die Pflanze vor Krankheiten zu schützen. Genau wie unsere Darmbakterien eindringende Krankheitserreger zahlenmäßig übertreffen und angreifen, bilden die Mikroben der Rhizosphäre rund um die Wurzeln einen Verteidigungswall. Pflanzen ernähren nützliche Bakterienarten, damit sie pathogene Mikroben und Pilze verdrängen.[31]
Manchmal verfolgen Pflanzen eine chemische Kriegsführung, indem sie Stoffe ausschütten, die schädliche Mikroben vergiften oder unterdrücken und nützliche fördern.[32] Einige dieser Chemieattacken sind so präzise, dass sie eine pathogene Unterart einer Bakterienspezies vollkommen ausschalten, nicht jedoch eine nützliche genetische Variante derselben Art.[33] Manchmal verbinden Pflanze und Bakterium sich gegen einen gemeinsamen Feind und produzieren dieselben Abwehrstoffe.[34] Manchmal veranlassen die von den Pflanzen abgefeuerten Warnsignale freundlich gestimmte Mikroben, ihre Rivalen mit Antibiotika anzugreifen.[35] Manchmal, wenn es schädlichen Pilzen gelungen ist, in die Wurzeln einzudringen, baut die Pflanze ihre gewöhnlichen Abwehrmechanismen ab und erlaubt bestimmten Bakterienarten ebenfalls einzudringen, um die Pilze im Wurzelgewebe zu bekämpfen.[36]
Krankheitserreger wehren sich, indem sie tödliche »Effektorproteine« gegen die pflanzlichen Hilfsmikroben aussenden.[37] Einige pathogene Arten haben die Fähigkeit entwickelt, unter chemischen Stoffen aufzublühen, die sie eigentlich bekämpfen sollen. Einige Pilz- und Insektenschädlinge wiederum nutzen die Hilferufe der Pflanzen, um sie zu lokalisieren und zu attackieren.[38]
Pflanzen rufen auch größere Lebewesen zur Unterstützung herbei. Wenn ihre Wurzeln von Insekten angegriffen werden, geben sie flüchtige chemische Substanzen an den Boden ab, die bestimmte Nematodenarten anlocken:[39] Die kleinen, weißen Fadenwürmer, auf die ich in meinem Reagenzglas gestoßen bin. Die Nematoden dringen mit ihren scharfen Beißwerkzeugen in die Haut von Erdraupen ein und winden sich in ihre Körperhöhle. Dort würgen sie die lumineszenten, symbiotischen Bakterien hervor, die ihren Darmtrakt besiedeln. Die Bakterien produzieren ein Insektizid, das die Larve tötet und Antibiotika, die die Mikroben, die bereits im Insekt leben, auslöschen. Dann verdauen sie die Raupe von innen heraus, und die Nematoden fressen die sich vermehrenden Bakterien.
Daraufhin explodiert die Population der Nematoden. In einem einzigen verwesenden Raupenkörper können sie bis zu 400 000 Nachkommen produzieren.[40] Aus seiner erschlafften Haut schießen sie in den Boden und begeben sich auf die Suche nach neuer Beute. Diese ist leicht zu finden, da die lumineszenten Bakterien bei den infizierten Raupen ein blaues Leuchten hervorrufen. Das Leuchten scheint andere Raupen anzulocken, die wiederum angegriffen werden.
Im amerikanischen Bürgerkrieg wurden 1862 nach der Schlacht in Shiloh, Tennessee, Tausende junge, verletzte Soldaten im Schlamm des Schlachtfeldes zurückgelassen. Da beide Seiten hohe Opfer zu beklagen hatten und ihre Bergung und Versorgung die Kapazitäten der Armeen überstieg, lagen manche für volle zwei Tage und zwei Nächte dort. Viele erlagen ihren Verletzungen und den damit einhergehenden Infektionen. Doch nachts bemerkten einige der Verletzten ein seltsames blaues Leuchten in ihren Wunden und ihr geisterhafter Halbschatten war weithin zu erkennen. Feldärzte beobachteten, dass die Wunden der leuchtenden Soldaten schneller verheilten und sie eine höhere Überlebenschance hatten als andere Verwundete.[41] Sie nannten es den Angel’s Glow.
139 Jahre später lieferte der siebzehnjährige Highschool-Schüler William Martin die Erklärung für den Angel’s Glow. Einer Vermutung folgend, überredete er seinen Freund Jonathan Curtis, ihm bei der Recherche zu helfen.[42] In ihrem Aufsatz, für den sie einen nationalen Wissenschaftspreis erhielten, argumentierten sie, dass die im Schlamm liegenden Soldaten offenbar von insektenfressenden Nematoden angegriffen wurden, die aus der Erde in ihre Wunden gelangt waren. Die Nematoden würgten ihre Bakterien hervor und die Antibiotika, die diese Mikroben produzieren, haben wahrscheinlich andere Krankheitserreger, die ihre Wunden befallen hatten, zerstört. Da die lumineszenten Bakterien an die Infektion von Insekten angepasst sind, deren Körpertemperatur niedriger ist als die von Menschen, vermuteten die Schüler, dass nur unterkühlte Soldaten auf diese Weise geschützt wurden. Als sie zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht und aufgewärmt wurden, starben die Bakterien, die ihnen das Leben gerettet hatten, ab, und so wurden weitere Komplikationen verhindert. (Eine verwandte Art, die an die Temperatur von Säugetieren angepasst ist, verursacht lebensgefährliche Infektionen.)[43]
Viele der heute in der Medizin verwendeten Antibiotika wurden von Bodenbakterien[44] für ihre brutalen Untergrundschlachten entwickelt, von denen die meisten in der Rhizosphäre geschlagen werden. Da einige dieser wichtigen Mittel inzwischen ihre Wirkung verlieren – da die Keime, die wir mit ihnen abtöten wollen, resistent werden –, müssen wir dringend neue ausfindig machen. Die Rhizosphäre ist dafür aller Wahrscheinlichkeit nach eine reiche Quelle. Mittels des sogenannten Genome Mining, bei dem man den genetischen Code eines Lebewesens nach biosynthetischen Gen-Clustern absucht, die komplexe chemische Verbindungen herstellen, haben Wissenschaftler bereits damit begonnen, neue Antibiotika in den mit Pflanzen lebenden Bakterien ausfindig zu machen.[45] Da lediglich die Hälfte aller Hauptstämme von Bodenbakterien bisher in Laboren kultiviert wurden,[46] können wir kaum Aussagen darüber treffen, was die Rhizosphäre uns noch alles zu bieten hat.
Eine weitere Methode, wie Mikroben Pflanzen in der Rhizosphäre – ihrem »externen Darm«– vor Schädlingen schützen, besteht in der Stimulierung ihres Immunsystems. Wenn ihre Blätter von Pilzen oder Insekten befallen werden, könnte eine der ersten Antworten der Pflanze lauten, Hormone an den Boden abzugeben und so einen Hilferuf an die dort lebenden Bakterien auszusenden. Auf den ersten Blick eine höchst seltsame Reaktion: Schließlich können die Bakterien nicht aus dem Boden kommen, um die Krankheitserreger hoch oben in den Blättern zu attackieren. Doch sie beantworten das Signal der Pflanze mit einer eigenen chemischen Nachricht, die ihr Immunsystem aktiviert.[47] Dadurch kann die Pflanze chemische Abwehrstoffe in ihren Blättern produzieren und ihre Poren (die Stomata), durch die Pilzsporen eindringen, verschließen.[48]
Ein sehr umständlicher Weg, einen Schädling abzuwehren, sollte man meinen. Doch da sich das Immunsystem der Pflanze gemeinsam mit den Bakterien entwickelt hat und ein Leben lang durch sie trainiert und vorbereitet wurde, funktioniert es nur in dieser Form. Auch dieser Prozess ähnelt Beziehungsstrukturen, wie wir sie im menschlichen Darm vorfinden. Dickdarmbakterien, von denen einige harmlos, andere Krankheitserreger sind, und wieder andere zwischen diese beiden Rollen wechseln können, erziehen unsere Immunzellen. Wenn Krankheitserreger versuchen, durch die schützende Schleimschicht des Dickdarms zu gelangen und die Darmwände angreifen, senden sie ihnen chemische Warnsignale.[49]
Inzwischen wissen wir, dass die Kombination aus übertriebener Hygiene, dem übermäßige Einsatz von Antibiotika und dem Wandel von einer abwechslungsreichen Ernährung, die viele Ballaststoffe enthält, hin zu einer gleichförmigeren, ballaststoffarmen Ernährung unsere Darmflora zerstört und die dortige Artenvielfalt verringert. Das schadet unserer Gesundheit und unserem Immunsystem. Zugleich haben Agrarwissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden, dass Pflanzen, wenn sie in geschwächten Böden mit einer verringerten Mikrobenvielfalt wachsen, anfälliger für einen Befall durch bestimmte Krankheitserreger werden.[50] Wo der Boden durch zu viel Dünger, Pestizide oder Fungizide und übermäßiges Pflügen strapaziert und durch schwere Maschinen verdichtet wurde, wird ihr Hilferuf eher durch Krankheitserreger und Schädlinge ausgenutzt. In beiden Fällen hat dies eine Dysbiose zur Folge,[51] der medizinische Fachbegriff für einen Kollaps unserer Darmkulturen. Doch er könnte auf die Vernichtung eines jeden Ökosystems angewandt werden.[52]
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Böden mit einem reichen und ausgewogenen Mikrobenbiom pathogene Bakterien, die bei Menschen Krankheiten auslösen, unterdrücken[53] und die Übertragung von menschlichen Krankheiten durch Nahrungsmittel unwahrscheinlicher machen.[54] Unsere Gesundheit hängt auf naheliegende und weniger offensichtliche Weise von der Gesundheit der Böden ab.
Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Böden, genau wie eine gesunde oder ungesunde Darmflora, Krankheitserregern gegenüber entweder »suppressiv« (hemmend) oder »konduktiv« (krankheitsförderlich) sein können. Wenn Pflanzen sterben, hinterlassen sie als Erbe die Bakterien, die sie im Boden kultiviert haben, und schützen damit die nachfolgenden Pflanzen, die an ihrer Stelle dort wachsen. Einige Forscher experimentieren nun mit dem landwirtschaftlichen Äquivalent zu Stuhltransplantationen. Genau wie Ärzte gesunden Menschen Stuhlproben entnehmen und in den Darm kranker Patienten einsetzen, spekulieren einige Agrarwissenschaftler, dass man durch die Transplantation suppressiver Bodenproben in ungesunde, konduktive Böden pathogene Bakterien und Pilze verdrängen könnte.[55]
In dem Loch, das ich gegraben habe, erregt etwas meine Aufmerksamkeit. Es ist ein riesiger Regenwurm, der in der Leere baumelt und sich zweifellos fragt, wo sein Bau hin verschwunden ist. Ich habe gelernt, dass die Gänge von Regenwürmern für viele Jahre, teils sogar Jahrzehnte, bestehen können und genau wie unsere Häuser von mehreren Generationen genutzt werden.[56] Sie bilden eine weitere wichtige Bodenschicht: Die Regenwurmschicht oder Drilosphäre.
Jeder Hektar einer weitestgehend naturbelassenen Wiese wie dieser kann von 800 Kilometern Regenwurmgängen durchzogen sein.[57] Sie lüften den Boden und sorgen dafür, dass Wasser schneller versickert. Ein Experiment hat gezeigt, dass sich die Versickerungsgeschwindigkeit von regenwurmarmen Böden nach ihrer Wiedereinführung innerhalb von zehn Jahren beinahe verdoppelt.[58] Dadurch wird weniger Wasser über die Oberfläche hinweggespült, das wertvollen Boden mit sich reißt. Stattdessen gelangt mehr Wasser an die Wurzeln der Pflanzen. Einer Schätzung nach halbieren Regenwurmbauten die Bodenerosion. Doch ihr Einfluss ändert sich von Ort zu Ort und von Jahr zu Jahr. In anderen Fällen wiederum können Regenwürmer dabei helfen, den Boden weniger brüchig zu machen und die Erosionsrate verdichteter Böden erhöhen, indem sie lose Erde an die Oberfläche bringen.
Regenwürmer können beinahe alle Arten von Blättern, Stängeln und Zweigen, die auf den Boden fallen, in ihre Gänge hinabziehen.[59] Genau wie Vögel schlucken sie kleine Steine und Split, um damit in ihrem Speisetrakt, der in Wahrheit ein einziger Muskel ist, totes Pflanzenmaterial zu zerkleinern. Ihre Darmbakterien helfen ihnen bei der Verdauung und einige Arten scheiden dann alles, was sie nicht aufnehmen können, in Form von kleinen Hügeln an der Bodenoberfläche aus.
In Kombination haben diese Vorgänge eine enorme Wirkung. An Orten wie unserem Obstgarten können Regenwürmer pro Hektar 40 Tonnen Boden an die Oberfläche transportieren.[60] In tropischen Savannen sind es sogar 1000 Tonnen.[61] Verfallene Gebäude verschwinden nicht etwa im Laufe der Zeit im Boden, weil sie einsinken, sondern weil der stets neu von den Würmern ausgeschiedene Boden um sie herum steigt.[62] Aufgrund des organischen Materials, das die Regenwürmer aufnehmen, ist ihr Kot sehr viel mineralstoffhaltiger als der Rest des Bodens. Indem sie totes Pflanzenmaterial zermahlen, machen sie die Nährstoffe für Bakterien und Pilze verwertbar, die sie wiederum für lebende Pflanzen zur Verfügung stellen. Wo Regenwürmer leben, ist das Gewicht von Pflanzen und Tieren über der Erdoberfläche durchschnittlich um 20 Prozent höher als dort, wo keine vorkommen.[63]
Zudem geben Regenwürmer wachstumsfördernde Hormone für die Pflanzen an den Boden ab,[64] auch wenn noch nicht geklärt ist, ob sie es direkt tun oder Bakterien dazu bringen, sie herzustellen. Indem sie Nährstoffe aufspalten oder ihre Immunsysteme mit chemischen Signalen triggern,[65] machen Regenwürmer Pflanzen in einigen Fällen widerstandsfähiger gegen parasitäre Nematoden[66] und Stechinsekten. Im Gegenzug beeinflussen Pflanzen möglicherweise mit ihren chemischen Botenstoffen das Verhalten der Würmer.[67] Je genauer wir uns jedes Ökosystem ansehen, desto komplexer wird es.
In meinem Klumpen Boden entdecke ich eine ledrige, ockerfarbene Hülle in Form einer Zitrone, etwa sieben Millimeter lang. Sie erinnert mich an die trockenen, aufgepumpten Schweineblasen, mit denen man früher Fußball gespielt hat. Ich nehme meine Lupe zur Hand und erkenne im Inneren einen roten Streifen, der abwechselnd schwach und stark pulsiert, als würde Blut durch ein Gefäß gepumpt werden. Es ist ein kleiner Wurm, der in seinem Kokon heranwächst. Wie alles im Boden ist die Regenwurmreproduktion eine ziemlich seltsame Angelegenheit. Nachdem Regenwürmer sich gepaart haben (jeder Wurm innerhalb einer Art kann sich mit einem anderen paaren, da beide sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsteile besitzen), werden die Sättel rund um ihre Körpermitten dick und hart. Dann gleitet eine Hülle, die Eier und Sperma enthält, vom Sattel hinunter und über den Kopf des Wurmes. Sie verbindet sich an beiden Enden und bildet einen Kokon. Als ich mit der Untersuchung meines Klumpen Bodens begann, kam ein Gefühl auf, das ich nicht ganz verorten konnte. Jetzt wird es mir klar: Meine Reise durch den Boden erinnert mich an mein erstes Schnorchelerlebnis. Als ich damals, genau wie jetzt, durch die Wasseroberfläche brach, fand ich mich in einer neuen Welt wieder, die von oben nicht zu erkennen war. Kaum ist mir dieser Gedanke gekommen, da erscheint mir der Boden immer mehr wie ein Korallenmeer. Genau wie das Meer mit seinen Riffen und dem offenen Gewässer hat er mehr oder weniger strukturierte Zonen: Orte intensiver biologischer Aktivität (wie die Rhizosphäre, die Drilosphäre und die Myrmekosphäre) und dann den freien Boden, durch den große Raubtiere streifen. Nur, dass es sich in diesem Fall um Hundertfüßer und Käfer handelt statt um Haie und Delfine.
Wie im Falle der Korallenriffe sind die am meisten strukturierten Bereiche reich an Symbiosen. Genau wie Korallen eine Verbindung aus von den Felsen stammenden Mineralstoffen, Tieren, Pflanzen und Mikroben sind, die allesamt miteinander kooperieren und im Wettbewerb stehen, Strukturen aus diesen Mineralstoffen zu bauen, ist der Boden ein Ökosystem, das von Lebewesen aus toten Materialien geschaffen wird.[68] Von diesen biologischen Beziehungen hängen die Gesundheit und die Fruchtbarkeit des Bodens ab – und damit fast alles Leben auf der Erde. Mag sein, dass er nicht so schillernd anzusehen ist wie die Korallen, doch wenn man beginnt, ihn zu verstehen, dann ist er für den Geist ebenso faszinierend.
In Wahrheit wissen wir kaum etwas über ihn. Dieses Ökosystem wurde so vernachlässigt und man hat so wenig Geld und Mühe in seine Erforschung gesteckt, dass wir gerade erst damit begonnen haben, seine komplexen Strukturen aufzudecken. Die kläglichen Mittel, die für die Erforschung des Bodenlebens bereitgestellt werden, wurden hauptsächlich dafür aufgewendet, neue Wege zu finden, ihn zu töten: mit anderen Worten, zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung. Wie einer meiner Dozenten an der Universität sagte: »Ich erforsche Insekten, weil ich sie liebe. Aber die einzigen Fördermittel, die ich bekommen kann, haben das Ziel, sie umzubringen.« Im Gegensatz zu den vielen Forschungsgruppen, die sich anderen lebenden Systeme gewidmet haben, gibt es auf der ganzen Welt kein einziges Institut für Bodenökologie.
Während wir den Boden einst als homogene Masse angesehen haben, besteht er in Wahrheit aus Strukturen innerhalb von Strukturen innerhalb von Strukturen. Regenwürmer, Wurzeln und Pilze stellen aus Fasern und chemischen Klebstoffen Bodenklumpen her, die Aggregate genannt werden.[69] Innerhalb dieser Aggregate formen winzige Tiere wie Milben und Springschwänze kleinere Klumpen, innerhalb derer wiederum Bakterien und ihre mikroskopisch kleinen Fressfeinde – Lebewesen, die ich noch nicht einmal mit meinem Vergrößerungsglas erkennen kann, wie Bärtierchen, Wimperntierchen und Amöben – noch kleinere Aggregate formen.
Zwischen diesen Clustern gibt es Löcher verschiedener Formen und Größen. Sie sind von Schichten aus Wasser und komplexen chemischen Verbindungen umschlossen, die von Pflanzen und Tieren abgegeben werden. Jedes dieser Cluster, Lücken und Schichten hat seine eigenen Proportionen und schafft Millionen winziger, ökologischer Nischen, die verschiedene Arten sich zunutze machen können.
Im Jahr 2020 haben Wissenschaftler etwas auf den Weg gebracht, was als die ersten vorsichtigen Schritte in Richtung einer Theorie des Bodens betrachtet werden könnte.[70] Mit anderen Worten, sie fangen an zu verstehen, was Boden in seiner Ganzheit überhaupt ist. Auch wenn es seltsam klingen mag: Es hat bis heute gedauert, bis wir wirklich begriffen haben, dass das Substrat, von dem unser aller Leben abhängt, eine biologische Struktur ist.
Mikroben bauen Aggregate, indem sie winzige Partikel mit den kohlenstoffbasierten Polymeren oder Zementen, die sie ausscheiden, zusammenkleben. Sie stabilisieren den Boden und schaffen zugleich ihren eigenen Lebensraum. Mit der Zeit entsteht durch diesen Prozess eine noch komplexere Architektur: Es bilden sich Poren und Passagen, durch die Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen. Der Boden ähnelt einem Wespennest oder einem Biberdamm. Er ist ein von Lebewesen geschaffenes System, das ihr Überleben sichert. Doch im Gegensatz zu diesen simpleren Strukturen entstehen in diesem Fall unermesslich verschlungene, sich endlos verzweigende Katakomben, die von Bakterien, Pflanzen und Bodentierchen in unbewusster Zusammenarbeit gebaut werden. Der Boden verhält sich wie der Staub in Philip Pullmans Romanreihe: Er organisiert sich spontan in kohärente Welten, die auf dem Prinzip des Fraktals aufbauen. Das bedeutet, dass die Struktur, unabhängig von der Vergrößerung, aus der sie betrachtet wird, immer die gleiche Form behält.
Die selbst organisierte, anpassungsfähige Welt, die Mikroben, Pflanzen und Tiere für sich erschaffen, liefert eine Erklärung, warum der Boden so erstaunlich widerstandsfähig gegen Dürren und Überschwemmungen ist. Er überlebt Krisen, die ihn andernfalls in formlosen Puder verwandelt hätten. Doch diese Entdeckungen könnten auch erklären, warum Boden, der in Ackerland umgewandelt wurde, oft beginnt, in sich zusammenzufallen. Wenn Bauern oder Gärtner unter bestimmten Bedingungen Stickstoffdünger hineingeben, antworten die Mikroben, indem sie den Kohlenstoff verbrennen, der in den Polymeren gelagert wird, aus denen die Katakomben bestehen.[71] Ohne Zement löst sich die Struktur – und damit das gesamte System – nach und nach auf. Die Poren brechen zusammen, die Gänge stürzen ein und Wasser und Sauerstoff können nicht länger hindurchfließen. Da der Boden fraktal aufgebaut ist, brechen mit dem Einsturz der Mikrostrukturen auch die Makrostrukturen ein: Er wird durchweicht, fest und verdichtet. Paradoxerweise haben Pflanzen in überdüngten Böden große Mühe, die Nährstoffe zu erhalten, die sie brauchen.