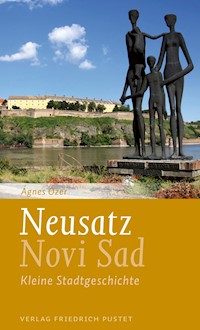
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Stadtgeschichten
- Sprache: Deutsch
Auf einem Felsen über der Donau thront die Festung Peterwardein als das Wahrzeichen der serbischen Stadt Novi Sad, die auf Deutsch Neusatz heißt. Drei Brücken verbinden die Stadtteile rechts und links des Flusses. Die Kleine Stadtgeschichte zeichnet kompakt und beispielreich die Entwicklung der königlichen Freistadt nach, die heute nach Belgrad die zweitgrößte Stadt Serbiens ist. Neusatz blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, in der es seine Landeszugehörigkeit mehrfach gewechselt und Kriege miterlebt hat, zuletzt 1999. Durch das Zusammenleben vieler verschiedener ethnischer Gruppen, darunter auch Donauschwaben, entwickelte die Stadt einen ganz eigenen Charakter. Diesen Charakter reflektiert László Végel in seinem Essay auf literarische Weise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ágnes Ózer
Neusatz / Novi Sad
Kleine Stadtgeschichte
Mit einem literarischen Essayvon László Végel
Herausgegeben und redaktionell bearbeitet
von der Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum
Direktor: Christian Glass
Wiss. Mitarbeit: Angelika Pilz
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATION DERDEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Angaben sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3224-4
Reihen-/Umschlaggestaltung und Layout: www.martinveicht.de
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Übersetzung aus dem Ungarischen: Hans-Henning Paetzke
Fachlektorat: Joachim Schneider
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2022
eISBN 978-3-7917-6196-1 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter
www.verlag-pustet.de
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Neusatz / Novi Sad – Eine multiethnische Stadt
Links der Donau: Neusatz entsteht
Vor- und Frühgeschichte / Die Anfänge von Neusatz: Die Peterwardeinschanze als Zentrum der Stadt / Die Brückenschanze / Ein zeitgenössischer Blick auf die Stadt / Neusatz als königliche Freistadt / Die Stadt und ihr Name / Ein dreisprachiges Ortsschild
Peterwardein – Festung an der Donau
Festung Cusum – Peterwardein in der Römerzeit / Vom Kloster zur Festung / Peterwardein unter Osmanenherrschaft / Bericht eines osmanischen Reisenden / Die Festung heute / 5. August 1716: Schlacht von Peterwardein / Letzter Ausbau der Festung / Entwicklung der Festung am Anfang des 20. Jhs. / Die Festung Peterwardein nach dem Zweiten Weltkrieg
Revolutionsjahre in Neusatz
Neusatz in den Jahren 1848/49 / Das ausgefallene Stadtjubiläum 1848 / Kanonenfeuer gegen Neusatz / Wiederaufbau der Stadt
Neusatz in unruhigen Zeiten
Die Stadt im Ersten Weltkrieg / Machtübernahme durch die Serben / Neusatz im neuen südslawischen Staat: Neusatz und Peterwardein vereinen sich / Die »Kalten Tage« von Neusatz / Neusatz im Oktober und November 1944 / Neusatz nach dem Zweiten Weltkrieg / Neusatz verändert sein Gesicht / 1999: Die Nato bombardiert Neusatz
Stadtentwicklung vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
Die Anfänge der industriellen Entwicklung / Schiffe auf dem Fluss / Lange Zeit fehlte Neusatz ein eigener Hafen / Die ganze Stadt ein Markt / Neusatz ist stolz auf seine Märkte / Die Neusatzer Messen und Ausstellungen / Vom weltberühmten Musikfestival EXIT zur Europäischen Kulturhauptstadt
Neusatz und seine multiethnische Gesellschaft
Novi Sad – die serbische Facette / Serbische Bildung und Politik in der Stadt / Serbisches Kulturleben / Die Matica Srpska / Újvidék – die ungarische Seite / Ungarisches Kulturleben / Die Zeitschrift Új Symposion / Eine Neusatzer Geschichte – Deutsche in der Stadt / Pflege deutscher Kultur in der Zwischenkriegszeit / Deutsche Wirtschaftsvereine in Aktion: der Habag Palast wird gebaut / Die Situation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg / Juden in Neusatz / Bedeutende jüdische Gebäude / Neusatzer Slowaken, Ruthenen und Roma / Magyarisierungsbestrebungen / Die Kirchen von Neusatz
Neusatz und die Donau
Leben mit dem Fluss / Brücken verbinden die Stadt / Von Donaufischen und -fischern / Ein Paradies für Fische / Badevergnügen an der Donau / Neusatz – die Bäderstadt
Abschließende Betrachtung: Versuch einer Stadtbeschreibung
Die unsichtbare Dreifaltigkeitsstatue / Das Marmorkreuz an der Ecke Brotgasse
In einer aus den Fugen geratenen Welt Ein literarischer Essay von László Végel
Anhang
Zeittafel / Literatur / Karte von Neusatz / Ortsregister / Personenregister / Bildnachweis
Vorwort des Herausgebers
Seit 1920 ist Novi Sad der amtliche Name für die nach Belgrad zweitgrößte serbische Stadt, die zugleich das Zentrum der Autonomen Provinz Wojwodina ist. In der Gründungsurkunde aus dem Jahr 1748 steht der Name gleichberechtigt in vier Sprachen. Neben der lateinischen Bezeichnung ist er in Deutsch, Ungarisch und Serbisch für die dort lebenden Sprachgemeinschaften festgelegt. Die Habsburger Kaiserin Maria Theresia unterzeichnete das Dokument über die Erhebung zur königlichen Freistadt mit dem Hinweis, dass sie Neoplanta, also Neusatz heißt. Der Name ist zutreffend, denn die Stadt ist eine Neugründung, und ihr Ursprung liegt eigentlich am Donauufer auf der gegenüberliegenden Seite. Dort steht auf einem Felsen weithin sichtbar eine der größten europäischen Verteidigungsanlagen, die Festung Peterwardein. Die Habsburger hatten das gewaltige Bauwerk seit Ende des 17. Jhs. als Bollwerk gegen die Osmanen erbaut. Heute ist die Festung das Wahrzeichen von Neusatz. Dort befinden sich ein Museum, Restaurants und Künstlerateliers. Jeden Sommer findet hier das EXIT-Festival statt, die größte Musikveranstaltung in Südosteuropa.
Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Neusatz zur Habsburgermonarchie, die mit spätbarocken und klassizistischen Bürgerhäusern das Stadtbild im historischen Zentrum geprägt hat. Im 20. Jh. und bis in die Gegenwart entstehen um dieses Zentrum stark verdichtete Wohn- und Geschäftsviertel, um die stetig wachsende Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen. Novi Sad ist seit 1960 auch eine Universitätsstadt mit über 50.000 Studierenden, die viel zur lebendigen Atmosphäre dieser Donaustadt beitragen. Die deutsche Bezeichnung Neusatz ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es aber selbstverständlich, dass in den Straßen neben Serbisch und Ungarisch auch Deutsch oder besser: donauschwäbische und österreichische Dialekte gesprochen wurden. Die Donauschwaben kamen im 18. Jh. als Kolonisten in die heutige Region Wojwodina, wo sie nach dem Ende der sog. Türkenkriege von den Habsburgern und von privaten Grundherren angesiedelt wurden. Nach 1944 ist die deutsche Bevölkerung durch Flucht, Entrechtung, Internierung und Deportation aus der Stadt fast vollständig »verschwunden«.
Dieses Buch legt besonderes Augenmerk auf die multiethnischen Aspekte der Stadt, die im Jahr 2022 als erste Kommune außerhalb der EU den Titel Europäische Kulturhauptstadt trägt. Die Neusatzer Historikerin Ágnes Ózer bereitet die Geschichte der Stadt erstmals für das Publikum im deutschsprachigen Raum auf, indem sie das gut funktionierende Neben- und Miteinander unterschiedlicher ethnischer Gruppen in der Stadt beschreibt. Seit dem späten 19. Jh. zerstörten aber aufkommender Nationalismus und in den 1940er Jahren der Eroberungskrieg des Deutschen Reiches vieles von dieser multikulturellen Stadtgesellschaft. Die Geschichte von Neusatz im 20. Jh. vom Ersten Weltkrieg bis zu den Nato-Bombardements 1999 kann auch als eine Aufeinanderfolge von immer neuen Verwundungen angesehen werden. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass alle Donaubrücken, die im 20. Jh. gebaut wurden, auch im 20. Jh. wieder zerstört wurden.
Diese Entwicklung zu beschreiben kann nicht allein eine Sachdarstellung einer Historikerin oder eines Historikers leisten. Das Donauschwäbische Zentralmuseum als Herausgeber dieses Bandes hat deshalb den in Neusatz lebenden Schriftsteller László Végel gebeten, einen literarischen Essay über die jüngere Geschichte der Stadt zu verfassen. László Végel hat seiner Erzählung den ernüchternden Titel »In einer aus den Fugen geratenen Welt« gegeben. Er stellt fest, dass mit dem Nationalstaat der Verlust des Multikulturalismus einhergeht, und im Laufe des 20. Jhs. die Minderheiten immer mehr zurückgedrängt wurden – egal unter welchem Regime, besonders aber in Zeiten der parlamentarischen Demokratie seit den 1990er Jahren.
Christian Glass
Direktor Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
Neusatz / Novi Sad – Eine multiethnische Stadt
Die Stadt Neusatz im Norden Serbiens ist eine aufregende, vielschichtige und im besten Sinne des Wortes europäische Stadt. Mit der Erhebung zur königlichen Freistadt im Jahr 1748 erhielt sie gleichberechtigt vier Namen: Novi Sad für die serbische, Újvidék für die ungarische, Neusatz für die deutsche Bevölkerung, und Neoplanta hieß sie auf Lateinisch. Ihr klingender und facettenreicher Name deutet auf den besonderen Kontext ihrer Entstehung hin: Sie ist – wie sich zeigen wird – jung und alt zugleich. Ihre topografische Lage lässt angesichts ihrer Gründung im einst sumpfigen Überschwemmungsgebiet der Donau durchaus baugeschichtliche Vergleiche mit niederländischen Städten zu. Häufig wird die Stadt in Anbetracht ihrer Bedeutung als geistiges Zentrum auch als »serbisches Athen« bezeichnet, in der historischen Literatur mit Blick auf ihre Lage und die Festung Peterwardein gar als »ungarisches Gibraltar«. Heute haben wir es mit einer individuellen und eigentümlichen, einer jugendlichen und dynamischen Stadt zu tun, deren historische Spuren allerdings nicht zu übersehen sind. Auf die Besucher von Neusatz, aber auch auf diejenigen, die hier leben oder gelebt haben, wirkt dieser Ort wie ein Magnet – und die meisten kehren immer wieder zurück.
Diese am Donauufer entstandene Stadt ist heute nach Belgrad die zweitgrößte Serbiens und als Verwaltungssitz der autonomen Provinz Wojwodina deren administratives, wirtschaftliches, kulturelles, wissenschaftliches und touristisches Zentrum. In der einstigen k.-u.-k.-Monarchie der Habsburger schloss die damals mittelgroße Stadt im Laufe des 19. und frühen 20. Jhs. sowohl hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl als auch in ihrer ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung zu den Großstädten der umliegenden Staaten auf.
Die geografischen Koordinaten zeigen Neusatz in etwa auf der Höhe von Venedig und in ihrer Ost-West-Ausrichtung ungefähr auf einer Linie mit Krakau. Die Stadt befindet sich auf einer Meereshöhe von 70 bis 80 Metern; dabei ragt der Peterwardeiner Felsen noch markant darüber hinaus. Mit ihrem gemäßigten Kontinentalklima liegt die Stadt am Stromkilometer 1255 der Donau. Die Verkehrsmöglichkeiten wirkten sich auf die städtische Entwicklung von Anbeginn günstig aus. Zu Land und zu Wasser entstanden wichtige Handelsrouten. Heute liegt Neusatz am paneuropäischen Korridor X und am Donaukorridor VII: Der eine verbindet Budapest mit Belgrad und Thessaloniki, der andere Westeuropa mit dem Schwarzen Meer. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 250.000 im direkten Stadtgebiet und 350.000 im urbanen Großraum.
In jeder Stadt, so auch in Neusatz, wirken sich die geografische und strategische Position und die historischen Ereignisse und Kontexte auf den urbanen Charakter aus. So ist Neusatz etwa im Zusammenhang mit der ungarischen Niederlage gegen das osmanische Heer unter Suleiman I. in der Schlacht bei Mohács im Jahr 1526 zu sehen, die eine fast zweihundertjährige Herrschaft der Osmanen nach sich zog. Mehrere Befreiungsversuche von der Fremdherrschaft spielten sich in den südlichen ungarischen Grenzgebieten ab. Und im Jahr 1716 wurde diese Scharnier-Position in der Schlacht von Peterwardein besonders deutlich, die etwa drei Jahrzehnte später, im Jahr 1748, zur Erhebung zur freien königlichen Stadt führen sollte.
Die Anfänge des heutigen, modernen Neusatz sind in der Umgebung des linksseitigen Fährhafens zu suchen. Gegenüber der Festung Peterwardein, am anderen Donauufer, entstanden zwischen 1692 und 1788 die ersten Siedlungen, die man zunächst Alt-Peterwardein oder Marktwardein nannte. Diese Siedlungen wurden im Zuge der Wiederherstellung der Festung erbaut, die während der habsburgisch-osmanischen Kriege zerstört worden war. Die Rekonstruktion der Festungsanlage und die endgültige Vertreibung der Osmanen durch die militärischen Aktionen der Habsburger sowie der Bau des Brückenkopfes an der Donau-Schiffsbrücke, die sog. Brückenschanze, waren nicht nur für die Siedlung Peterwardein (Petrovaradin) von Bedeutung, sondern auch für die angrenzenden Ansiedlungen – etwa Ratzenstadt, Croatendorf oder Schwabendörfl –, die sowohl militärischen als auch zivilen Zwecken dienten und die später zu Teilen von Neusatz werden sollten. Die städtische Entwicklung hing also zunächst eng mit militärischen und handelsstrategischen Aspekten zusammen.
Für die Neusatzer ist die Uferpromedade gegenüber der Festung ein beliebter Aufenthaltsort.
Die unterschiedlichen Interessenlagen der Neusatzer Bevölkerung erzeugten zwischen den angesiedelten ethnischen Gruppen – Serben, Ungarn und Deutsche, um die prägendsten zu nennen – stellenweise Spannungen, die etwa im Rahmen des Ungarischen Unabhängigkeitskriegs zum offenen Konflikt gerieten: 1849 wurde die Stadt fast vollkommen zerstört. Für das urbane Gebilde wurde aus solchen Erfahrungen klar, dass sich Gegensätze auch auf das Entwicklungstempo lähmend auswirken und zu erheblichen Rückschritten in Bezug auf Wohlstand und Lebensqualität führen können. Nach all den Zerstörungen und Konflikten erholte sich Neusatz in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. von den Rückschlägen und wurde mit den neu aufgebauten Brücken, die sich über die Donau spannten, immer dynamischer und größer.
Der Stadtkern, der im 17. Jh. begonnen hatte, seine bis heute sichtbaren Konturen herauszubilden, zeigt in seiner geografischen Lage typische Merkmale damaliger Donausiedlungen. Die religiösen und ethnischen Zugehörigkeiten waren vielfältig. Von Zeit zu Zeit scheinen sie in Bräuchen und Lebensgewohnheiten auf, die auch auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit Serbiens zum Osmanischen Reich zurückzuführen sind.
Heute stellen die Serben die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe dar. Als Universitätsstadt im 21. Jh. steht der Ort für einen innovativen Zeitgeist und für Weltoffenheit. Die Stadt wirkt jung und progressiv. Mit dem Musikfestival EXIT konnte sie ihre internationale Bekanntheit im positiven Sinn ausbauen, und sie zieht jährlich Tausende Besucher und Musikbegeisterte an. Die legeren Lebensauffassungen, die Ansprüche an die Kultur oder auch die politische und gesellschaftliche Sensibilität der Bewohner haben eine besondere Mentalität hervorgebracht, die als typische Neusatzer aufgefasst werden kann. Neusatz erhielt 2022 den Titel Europäische Kulturhauptstadt!
Links der Donau: Neusatz entsteht
Vor- und Frühgeschichte
Die verbreitete Auffassung, wonach Neusatz eine recht junge Stadt sei, ist dem Umstand zu verdanken, dass nach dem Ende der Osmanenherrschaft eine große Migration einsetzte und die Ansiedlung eine neue Dynamik entwickelte. In der Tat lässt sich mit Blick auf die eigentliche Gründung im 18. Jh. von einer im europäischen Kontext relativ jungen Stadt sprechen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es auf dem Gebiet der heutigen Stadt in der Zeit vor der osmanischen Herrschaft keine Siedlungen gegeben hätte. Archäologische Ausgrabungen sowie die verschiedenen Fundorte belegen eine Besiedlung schon weit vor den Ungarn und Osmanen, und zwar nicht nur auf dem Peterwardeiner Felsen, sondern auch am linksseitigen Donauufer, dem heutigen Stadtzentrum.
Betrachtet man diese Gebiete, so muss man deren besondere geografische, topografische, aber auch strategische Position betonen – gegeben vor allem durch die Donau als verbindende Verkehrsader zwischen Mittel- und Südosteuropa und zugleich als Grenze, die Einflussgebiete gliedert. Zum spezifischen topografischen Setting gehört zweifelsohne der Peterwardeiner Felsen, auf dem schon früh befestigte Bauwerke entstanden. Durch ihre Größe und Bedeutung nahm die mittelalterliche ungarische Festung später einen besonderen Platz ein. Von hier aus ließ sich nicht nur der Schiffsverkehr auf der Donau kontrollieren, sondern auch das ausgedehnte Flachland der Batschka.
Die gegenüberliegende Siedlung – die später zum heutigen Stadtkern wurde – entstand auf dem für das Flussufer typischen sumpfigen, aber dennoch fruchtbaren und an dieser Stelle flachen Gelände. Südlich davon liegt die an Erzen, Wäldern, Wild und Obst reiche Fruška Gora (dt. hist.: Frankenwald). Geologisch betrachtet war das rechtsseitige Überschwemmungsgebiet der Donau mit dem sich 125 Meter über den Meeresspiegel erhebenden Dioritfelsen und der Fruška Gora verbunden. Auch unter dem heutigen Neusatz ist in nicht allzu großer Tiefe dieses Dioritgestein zu finden – sozusagen der abgesunkene Teil des Peterwardeiner Felsens. Geomorphologische Untersuchungen belegen, dass die Donau im Vergleich zum gegenwärtigen Flussbett einst ca. 20 Kilometer weiter nördlich floss. Aufgrund der Flussverschiebung liegt die Stadt heute auf dem Schwemmland, dass der Strom zurückgelassen hat.
Für Archäologen gilt das Gebiet des heutigen Neusatz als überaus reicher Fundort. Von den während der Osmanenherrschaft in der Wojwodina bekannten 17 Kulturen sind auf dem Territorium der Stadt 16 nachgewiesen worden. Deshalb dürfen wir in Neusatz von einer im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtigen Frühgeschichte sprechen.
Ausgrabungen konnten zahlreiche Siedlungsspuren auftun. Auf einer Anhöhe, dem heute Klisa (ecclesia, Kirchenhügel) genannten Stadtteil, befinden sich die ersten archäologischen Fundorte. Einer davon, in der Fachliteratur als Popov-Quartier erwähnt, geht auf die Bronzezeit zurück. Die frühzeitlichen Bewohner gehörten der Vatini-Kultur an und waren auf dem Gebiet des heutigen Neusatz zu finden.
Darüber hinaus liegen zahlreiche archäologische Fundorte nördlich von Klisa und weisen etwa die Körös-Kultur der frühen Jungsteinzeit in diesem Raum nach. Ebenso wurde ein zur Vinča-Kultur gehörender Friedhof gefunden. Mit einem weiteren Friedhof wurden Spuren der spät-neolithischen Vučedol-Kultur entdeckt. Auf dem Territorium der heutigen Stadt wurden auch vier sarmatische oder sauromatische Siedlungen freigelegt – zwei davon in Klisa.
Etwa einen Kilometer westlich des Popov-Quartiers endete ein aus der Römerzeit stammender und etwa 25 Kilometer langer römische Wall bei Tschene. Manche Experten vermuten, dass es sich nicht um einen Wall, sondern um einen Kanal gehandelt habe, wodurch in der Römerzeit der Wasserstraßenverkehr zwischen dem damaligen Cusum (Peterwardein) und dem an der Theiß gelegenen Čurug abgekürzt wurde.
Die Siedlung Marktwardein, also der frühe Vorläufer des heutigen Neusatzer Zentrums, ist im Mittelalter entstanden. Sie besaß eine Kirche und einen Friedhof. Diese Siedlung wird in einem Besitzverzeichnis aufgeführt, das der ungarische König Béla IV. (1235–1270) den Zisterziensermönchen des Peterwardeiner Felsens neben anderen Siedlungen überlassen hatte. Marktwardein und einige andere Siedlungen auf dieser Seite des Stroms waren mit dem Donaufährhafen verbunden, von dem aus man nach Peterwardein übersetzen konnte. Sie verschwanden allerdings während des Mongolensturms (1241), wurden dann erneut besiedelt, um in der Zeit der osmanischen Herrschaft ab dem 16. Jh. wiederum einen Großteil ihrer Bevölkerung einzubüßen. Als größte mittelalterliche Siedlung auf dem Territorium des heutigen Neusatz galt Sajlovo (Zajol), was auch heute noch der Name eines Neusatzer Stadtteils ist.
Die Anfänge von Neusatz: Die Peterwardeinschanze als Zentrum der Stadt
Die Geschichte der Stadt Neusatz lässt sich nicht schlüssig darstellen, ohne die Anfänge der Stadt zu erörtern und auf das ursprüngliche Zentrum, die Peterwardeinschanze, einzugehen. Peterwardeinschanze wurde der Marktflecken auf der linken Donauseite genannt, aus dem 1748 Neusatz als freie königliche Stadt hervorging und der zunächst rund um die dort befindliche Brückenschanze herum entstanden war, einem Militärbau am linken Donauufer.
Von österreichischen Kriegsingenieuren 1694 errichtet, diente die sternförmige Brückenschanze auf der Flussseite als Schutz für die provisorischen Pontonbrücken zu Füßen der Festung Peterwardein. Die in der Umgebung von Peterwardein stationierten Einheiten nutzten sie als Verbindung zwischen der Festung Peterwardein und dem Ufer auf syrmischer Seite. Gleichzeitig mit dem Bau der Brückenschanze wurde die Heeresinsel unterhalb der Festung errichtet: die sog. Inselschanze. Seit seiner Entstehung sollte die Geschichte von Neusatz immer von der Militärbesatzung im gegenüberliegenden Peterwardein geprägt sein. Erst der Zerfall der k.-u.-k.-Monarchie machte es später möglich, dass aus beiden Orten eine Stadt wurde.
HINTERGRUND
DIE BRÜCKENSCHANZE
Die Brückenschanze war ein imposantes Bauwerk, das noch vor der Schlacht von Peterwardein von Eugen von Savoyen verstärkt worden war. Einigen Berichten zufolge kam diesem befestigten Schanzensystem bei den Truppenbewegungen der österreichischen Heere eine bedeutende Rolle zu. Innerhalb der Schanze befanden sich Kasernen und auch das Haus des Schanzenbefehlshabers. Daneben gab es einen Park. Aber vor allem die zur Befestigung der Pontonbrücke erforderlichen Vorrichtungen befanden sich hier. Auch die kleine, dem Heiligen Johannes Nepomuk geweihte Barockkirche hatte ihren Platz, allerdings wurde diese 1928 zusammen mit den Anlagen der Brückenkopfschanze abgerissen.
Zu den ersten Bewohnern der Peterwardeinschanze gehörten serbische Grenzwachen, österreichische Soldaten, Handwerker, Kaufleute, Lebensmittellieferanten und Fischer. Sie nutzten geschickt die Möglichkeiten, die ihnen der Verkehrsknotenpunkt der von Nord nach Süd und von Ost nach West führenden Wege und der Flussübergang sowie die immer häufigeren und längere Zeit andauernden Friedenszeiten boten. Nicht nur der Wohlstand wurde gemehrt, sondern auch ein Beitrag zur schnellen Stadtentwicklung geleistet. So entwickelte sich die Peterwardeinschanze bereits bis 1699 zu einer selbstständigen Siedlung, noch bevor sie in den Rang eines Marktfleckens erhoben wurde. Nach Abschluss des Friedens von Karlowitz im gleichen Jahr waren 43 Männer, 18 Jungen und 215 Soldaten als bürgerliche Einwohner registriert. In der Siedlung gab es zu dieser Zeit drei Wirtschaften, einen Bierkeller, zwei Schnapsbrennereien und drei Werkstätten.
Die Entwicklung dieser verhältnismäßig kleinen Ansiedlung beschleunigte sich nach der Schlacht von Peterwardein im Jahr 1716. Bereits drei Jahre später traten das von Kaiser Karl VI. verliehene Wochenmarktrecht und die Genehmigung für jährlich zwei Landesmärkte in Kraft. Diese Rechte und die spätere Erhebung zum Marktflecken im Jahr 1738 trugen maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung bei. Doch eine echte Urbanisierung setzte erst mit der Verleihung des Titels einer freien Königsstadt ab 1748 ein.
Plan der Brückenschanze von Ingenieurhauptmann Boulange aus dem Jahr 1775.
Die auf einem Sandrücken errichtete Siedlung und spätere Stadt hatte anfangs dank des regen Handels mit dem Osmanischen Reich ein orientalisches Gepräge. Neben den aus guten Baustoffen hochgezogenen, mehrgeschossigen Häusern gab es auf dem Territorium der Peterwardeinschanze auch Erdhäuser. Auf dem Markt erwarben bürgerlich gekleidete Käufer orientalische Waren.
Vom 17. Jh. bis Ende des 19. Jhs. verband eine schwimmende Pontonbrücke Peterwardein und Neusatz, wie es diese historische Ansichtskarte zeigt. Erst 1883 wurde eine feste Brücke gebaut.
Die außerhalb der Brückenschanze entstandene Siedlung war geteilt: in einen zur militärischen Grenzschutzregion und einen zur königlichen Kammer des Burgbezirks gehörenden bürgerlichen Teil. Als Amtssprache wurde Latein genutzt. Doch für den Alltag war Mehrsprachigkeit – Ungarisch, Serbisch und Deutsch – bezeichnend. Wer keinen Militärdienst versah, ging gern auf der Schanze und deren Umgebung spazieren.
Auch vor der Verleihung des Stadtrechts fanden sich hier, wie auch sonst an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, zahlreiche Wirtschaften und Herbergen, in denen die durchreisenden Kaufleute Quartier nehmen konnten. In den Gasthäusern »Zum Grünen Kranz« und »Zu den Drei Kronen« stiegen für gewöhnlich wohlhabendere, aus ganz Europa kommende Kaufleute ab, während in der Herberge »Türkisches Haus« Reisende aus dem Orient nächtigten. Je nach Schicht oder Zugehörigkeit wählten die Menschen ihre Wirtschaft oder Herberge: Die Schiffer suchten Orte nahe der Donau auf. Ebenso hatten die Handwerksmeister, Gesellen und Lehrjungen ein Gasthaus, in dem sie ihre Freizeit verbrachten.
HINTERGRUND
EIN ZEITGENÖSSISCHER BLICK AUF DIE STADT
Melchior Érdujhelyi (geboren als Melchior Ellinger, 1860–1912), der als Erster die Geschichte von Neusatz erforscht und schriftlich festgehalten hat, führte die Stadtentwicklung Ende des 17. und Anfang des 18. Jhs. auf ein hohes Bevölkerungswachstum und günstige Naturbedingungen zurück. Er nannte Neusatz als die nach Budapest sich am schnellsten entwickelnde Siedlung und zitierte dazu den ungarischen Theologen und Historiker Matthias Belius (1684–1749) wie folgt: »An der diesseitigen Donau wird Peterwardein von Schanzen umgeben, die weder sehr weitläufig noch eng genannt werden können und von Häusern der Militärbesatzung gesäumt werden. Außerhalb und innerhalb der Schanzen gibt es zahlreiche Häuser, die von Soldaten der Landmark, den der Rechtshoheit des Komitats unterstellten Bürgern und dem dazugehörigen Landvolk bewohnt werden. Dessen ungeachtet territorial voneinander separiert. An der Spitze der Bürgerschaft steht ein Richter. Im Wechsel zwischen deutschem und serbischem. Oberhaupt des Militärs ist der Oberstadthauptmann. Die Katholiken haben eine, die Serben drei Kirchen.«
Neusatz als königliche Freistadt
Bereits im Jahr 1746 unternahmen die wohlhabenden Kaufleute und Handwerker der Peterwardeinschanze ernsthafte Anstrengungen, den Titel einer königlichen Freistadt verliehen zu bekommen. Trotz religiöser und nationaler Unterschiede zogen die Bürger in öffentlichen Angelegenheiten häufig an einem Strang – und mit Blick auf die Stadterhebung ganz besonders. Hieran beteiligten sich nicht nur Serben und Deutsche, sondern auch in größerer Anzahl angesiedelte Ungarn, Juden, Armenier und Griechen. Diese allgemeine Stimmungslage wird auch durch den Vertragstext dokumentiert, der am 24. September 1747 von nicht-serbischen und serbischen Bewohnern der Stadt unterzeichnet wurde: »Unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Serben eine Bevölkerungsmehrheit der Stadt stellen und aktiv an der Befreiung der Stadt mitgewirkt haben, wollen und fordern sie, dass auch den serbischen Bürgern dieselben Freiheitsrechte und Privilegien zuteilwerden wie den Katholiken.«
Die Privilegienurkunde von 1748 zeigt erstmalig das Wappen der Stadt: drei Türme an einem Fluss (die Donau) und darüber die Friedenstaube.
Die meisten der angesprochenen Rechte bezogen sich auf die Achtung der religiösen Unterschiede, während sich die katholischen Bürger zur Parität bei der Besetzung der Posten für die Machtausübung in der Stadt verpflichteten. Die Bürger der Peterwardeinschanze, des späteren Neusatz, regelten also schon zu Beginn des 18. Jhs. bewusst ihre gesellschaftlichen und ortsgebundenen Beziehungen. Dadurch schufen sie die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben. Von solchem Geist zeugt auch der Vertrag mit dem Adligen Georg Zeiger über einen Kredit von 12.000 Gulden, der notwendig war, um den festgelegten Preis von 80.000 Rheinischen Gulden für die Erlangung des Rangs einer königlichen Freistadt zahlen zu können. Der im Namen der Stadt vom Kämmerer, vom Richter, von zwölf Ratsherren, Vertretern der städtischen Zünfte und einigen Stadtoberen unterzeichnete Kreditvertrag wurde durch deren Unterschriften und Siegel beglaubigt. Der Vertrag enthält auch eine Schlussklausel, die von David Rackovics, Ratsherr und Richter der Stadt, gleichfalls durch Unterschrift und Siegel bestätigt wurde: »Hiermit wird beglaubigt, dass ich den Text obiger Obligationen Wort für Wort zusammen mit allen Artikeln der gesamten in der Peterwardeinschanze wohnenden Comminität und Gemeinschaft nicht nur auf Ungarisch und Deutsch, sondern auch auf Raizisch [Serbisch] erklärt und vorgelegt habe.«
Es war also von den Akteuren gewollt, dass in die vom 1. Februar 1748 stammende kaiserliche und königliche Urkunde über die Verleihung des Ranges einer königlichen Freistadt nach Zahlung von 80.000 Rheinischen Gulden neben den Statusbestimmungen und wirtschaftlichen Verfügungen auch Garantien für ein tolerantes Miteinander Aufnahme fanden. In einer Privilegienurkunde wurden in 21 Punkten die neuen Rechte der Stadt zusammengefasst. Demnach sollte die königliche Freistadt frei einen Magistrat, einen Richter und zwölf Ratsherren wählen, außerdem sonstige städtische Beamte und Bedienstete. In den Punkten acht bis 13 wird darauf verwiesen, dass nicht nur religiöse Gleichberechtigung zu gewährleisten sei, sondern auch die Wahrung der alten kaiserlich-königlichen Privilegien der griechisch-östlichem Ritus verpflichteten Serben.
Diese späten Privilegien als Überreste des feudalen Rechtssystems waren für die künftige Entwicklung der Peterwardeinschanze von entscheidender Bedeutung. Die Urkunde verfügte auch über den neuen Namen der Siedlung: »Neoplanta« (lat.). In der Privilegienurkunde wurden verschiedenen Namensvarianten genannt: das lateinische Neo-Plantae, das ungarische Uj-Videgh und das deutsche Ney-Satz. Der serbische Stadtname – Novi Sad – ist lediglich die Übersetzung der lateinischen, ungarischen und deutschen Benennungen.
HINTERGRUND
DIE STADT UND IHR NAME
Nicht nur der Erwerb der Privilegienurkunde, auch die Namensgebung der neuen Stadt war keine einfache Sache. 1746 wandte sich die Bevölkerung der einstigen Peterwardeinschanze an die Ungarische Königliche Kanzlei mit einer Eingabe: Der zufolge sollte man die Siedlung nach der Verleihung des Titels einer freien Königsstadt »Batschburg« oder »Donauburg« nennen. Die Kanzlei leitete diesen Vorschlag am 26. Januar 1748 an Königin Maria Theresia mit der Anmerkung weiter, dass der Namen »Batschburg« nicht vergeben werden könne, da eine Siedlung gleichen Namens bereits existiere. Außerdem liege die Stadt nicht in der Batschka, sondern im Komitat Bodrog. Zugleich befand die Kanzlei, dass Donauburg, Vízköz (Wasserburg) oder lateinisch Neoplanta – deutsch Neusatz und ungarisch Uj-Vidégh – treffender seien. Das letzte Wort hatte, wie damals üblich, die Kaiserin und Königin Maria Theresia. In einer Notiz an die Kanzlei schrieb sie eigenhändig: »Nominetur Neoplanta.« Zeitgenossen und spätere Historiker meinten, die Namenswahl der Königin sei glücklich und treffend, weil der Ausdruck die Neuentstehung der Stadt hervorheben würde.
Nun galt es, die serbische Entsprechung des Stadtnamen zu finden. Am 23. März 1748 ist in amtlichen Dokumenten erstmals die Verfassung der Stadt unter der Bezeichnung Novi Sad in einem Exemplar in kyrillischer Schrift zu lesen. Gleiches in einem Eid serbischer Priester der orthodoxen Kirche. Da es in Neusatz neben serbischen, deutschen und ungarischen Bewohnern auch griechische gab, begegnet man manchmal auch der griechischen Variante: Neophyte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde der Name der Stadt im Zuge der Gründung des neuen südslawischen Staates in Frage gestellt. Die Stadtobrigkeit entschied allerdings, dass der historisch traditionelle Name Novi Sad beibehalten werden solle. Der Beschluss wurde am 26. März 1920 gebilligt und der Stadtrat erklärte den Namen Novi Sad 1923 für amtlich. Die offizielle Bezeichnung wurde in der Folge noch dreimal geändert. Laut gültigem Beschluss von 2004 heißt die Stadt auf Serbisch Нови Сад (Novi Sad), auf Ungarisch Újvidék, auf Deutsch Neusatz, auf Slowakisch Novy Sad und auf Ruthenisch Нови Сад (Novi Sad).





























