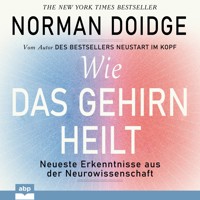Norman Doidge
Neustart im Kopf
Wie sich unser Gehirn selbst repariert
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Die erstaunlichen Fähigkeiten unseres Gehirns
Unser Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr auf verblüffende Weise umgestalten und sogar selbst reparieren - und das bis ins hohe Alter. Diese Erkenntnis ist die wohl sensationellste Entdeckung der Neurowissenschaften.
»Dr. Doidge, ein hervorragender Psychiater und Forscher, erkundet die Neuroplastizität in Begegnungen mit Pionieren der Forschung und mit Patienten, die von den neuen Möglichkeiten der Rehabilitation profitiert haben. …Das Buch ist ein absolut außergewöhnliches und hoffnungsvolles Zeugnis der Möglichkeiten des menschlichen Gehirns.«
Oliver Sacks
»… ein faszinierender Abriss der jüngsten Revolution in den Neurowissenschaften!«
The New York Times
»Das Gehirn ist kein fertig verdrahteter Denkapparat, der im Laufe des Lebens immer weiter verschleißt. Es kann sich umorganisieren, umformen und manchmal kann es sogar wachsen. Der Psychologe Norman Doidge erklärt neueste Ergebnisse der Hirnforschung: Durch einfühlsam geschilderte Beispiele macht er sie für jedermann verständlich und nachvollziehbar.«
Deutschlandfunk
Über den Autor
Norman Doidge, M.D., forscht als Psychiater und Psychoanalytiker am Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research in New York und an der University of Toronto. Seine Veröffentlichungen als Autor und Essayist sind mehrfach ausgezeichnet worden.»Neustart im Kopf« wurde von der Dana Brain Foundation als »bestes Sachbuch aller Zeiten über das Gehirn« prämiert. 2015 erschien bei Campus sein Buch »Wie das Gehirn heilt«.
Für Dr. Eugene L. Goldberg Weil Sie es gern lesen wollten
Ein Hinweis für den LeserDie Namen der Personen, die neuroplastische Veränderungen erlebt haben, sind real. In den wenigen Ausnahmefällen, in denen die Namen von mir oder von Wissenschaftlern geändert wurden, erwähne ich dies ausdrücklich. Die Namen von Kindern und deren Familienangehörigen habe ich verändert.
INHALT
Vorwort zur Neuauflage
Vorwort
1. Eine Frau fällt ins Bodenlose
2. Die Frau, die sich ein besseres Gehirn baute
3. Die Neuerfindung des Gehirns
4. Lieben und Vorlieben
5. Rettung aus der Finsternis
6. Das entfesselte Gehirn
7. Die Welt des Schmerzes
8. Die Kraft der Vorstellung
9. Wie wir Gespenster in Vorfahren verwandeln
10. Die ewige Jugend des Gehirns
11. Mehr als die Summe ihrer Teile
Anhang 1:Gehirn und Kultur
Anhang 2:Neuroplastizität und Fortschritt
Dank
Anmerkungen
Personenregister
Sachregister
VORWORT ZUR NEUAUFLAGE
Das Vorwort zur Neuauflage eines Buches gibt dem Autor die Gelegenheit auf Entwicklungen seit der Erstveröffentlichung einzugehen: Wurde das Buch entsprechend den Absichten des Autors von der Leserschaft gut angenommen, stehen Selbstkorrekturen an, und wie sind die darin ausgedrückten Gedanken weiterzuentwickeln?
Nun, da seit Erscheinen der Originalausgabe von Neustart im Kopf sieben Jahre vergangen sind, ist der zentrale Begriff des Buches »Neuroplastizität« vielerorts geläufig geworden. Neuroplastizität bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Funktion in Reaktion auf geistige Erfahrungen zu verändern.
Mir ging es zunächst darum, neue Wege zu finden, um Menschen mit neurologischen und psychiatrischen Leiden zu helfen. Zu diesem Zweck sammelte ich Beispiele klinischer Neuroplastizität: Heilungen oder ungewöhnliche Besserungen in Situationen, die hoffnungslos erschienen. Vom Standpunkt der Wissenschaftsgeschichte aus betrachtet, handelte es sich bei diesen Beispielen um Anomalien, denn sie schienen dem konventionellen Paradigma zu widersprechen, wonach die »Schaltkreise« des Gehirns in der Kindheit gebildet und festgelegt würden. Nicht lange aber, nachdem ich mit dem Sammeln solcher Anomalien begann, erkannte ich, dass das allgemeine Verständnis des Gehirns im Kern unrichtig war. Das Gehirn ist nicht nur in der Lage, sich neu zu »verdrahten«, dies ist sogar seine normale Funktionsweise. So erlebte ich, was Wissenschaftshistoriker als »Krise« eines Paradigmas bezeichnen. Schließlich kam ich an einen Punkt, an dem ich genügend Beispiele grundlegender neuroplastischer Verwandlungen angehäuft hatte, um daraus zu schließen, dass im Lichte dieser Entdeckungen mit dem alten Paradigma ganz zu brechen sei. Ich kam zum Schluss, dass dieses neue Paradigma die wichtigste Veränderung unseres Verständnisses des Gehirns seit gut vierhundert Jahren |7|bedeutete, führte es doch zur Preisgabe des seit Descartes vorherrschenden Bildes vom Gehirn als Maschine.
Freilich verspürte auch die Mehrzahl derjenigen Wissenschaftler und Ärzte, die ich als »Neuroplastiker« bezeichne, diese Krise. Ihre hochkomplexe, ins Detail gehende Arbeit war derart umstritten, und fand sozusagen außerhalb der regulären Arbeitszeit statt, dass sie sich anfangs oft scheuten, zur Erklärung ihrer Ergebnisse das Wort »Neuroplastizität« zu verwenden, weil es weithin als Hirngespinst galt. Infolgedessen fand ihre Arbeit am Thema oft in relativer Abgeschiedenheit statt, im jeweils eigenen geistigen Silo, ohne die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Zu meinem Glück hatte ich die Möglichkeit, gleichsam über diesen voneinander getrennten neuroplastischen Silos zu schweben, zwischen ihnen hin- und herzuspringen, Verbindungen zwischen den dort entwickelten Projekten herzustellen und somit auch weitere Folgerungen daraus zu ziehen. Darunter waren auch Erkenntnisse, zu welchen den Neuroplastikern selbst, die alle Hände voll mit ihren neuen Techniken zu tun hatten, schlicht die Zeit fehlte. Das vorliegende Buch zeigt diese Erkenntnisse, die für die medizinische Praxis ebenso wie für unser Verständnis von Liebe, Beziehungen, Sexualität, Bildung und, wie ich im Anhang zeige, der Kultur von großer Bedeutung ist. Die Neurowissenschaft hat viele Einzelstudien hervorgebracht sowie eine Flut ernst zu nehmender wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was allerdings oftmals fehlt, sind Denker, die in der Lage sind, sich diese Erkenntnis anzueignen, sie zu ordnen und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Zu diesem Unterfangen wollte ich mit dem vorliegenden Buch zumindest einen Anfang machen, mit Blick auf die Veränderbarkeit des Gehirns.
Manche Leser erwarten geradezu, dass ein wissenschaftliches Buch nahezu undurchdringbar sein müsse, und auf jeden Fall mit mathematischen Formeln durchsetzt. Woraus es auf jeden Fall nicht bestehen sollte, sind Geschichten. Tatsächlich kamen einige Leser (fast immer handelte es sich bei Ihnen um Journalisten) zu dem Fehlschluss, dass dieses Buch, handelt es doch einerseits von einem naturwissenschaftlichen Thema und ist es andererseits für verständlich befunden worden, wohl der Kategorie »populäre Naturwissenschaft« und damit dem Journalismus zuzuordnen sei, eine Vereinfachung zur Unterhaltung des Laienpublikums. Tatsächlich aber lag es in meiner Absicht, Wissenschaftler und Ärzte ebenso wie eine breitere Leserschaft anzusprechen. |8|Wenn dieses Buch für sich Verständlichkeit beanspruchen darf, dann liegt das an der Eigenart des Genres, dem es in Wahrheit angehört.
Wenn eine Wissenschaft sich einmal etabliert hat, dann schreiben die darin arbeitenden Wissenschaftler für gewöhnlich keine Bücher, sondern Artikel. Diese Fachartikel schreiben sie an- und füreinander, oft in Begriffen und in einem Duktus, die nur Eingeweihten verständlich sind. Sie tun dies, weil sich dadurch erübrigt, im Rahmen eines fortgeschrittenen Paradigmas jeden Begriff, jede Gleichung und jedes Verfahren aufs Neue erklären zu müssen. Das bleibt den Lehrbüchern vorbehalten.
Doch wie der große Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn feststellte, ist der kurze Zeitraum zwischen dem Zusammenbruch eines alten Paradigmas und der Festigung eines neuen oftmals der richtige für ein Buch – und obendrein ein verständliches. Da das alte Paradigma nicht mehr gilt, ist auch der Autor dieses Buches nicht mehr an dessen esoterischen Sprachgebrauch oder Jargon gebunden. Es ist vielmehr seine Aufgabe, den umfassenden Problemzusammenhang und die Ansätze zu einem neuen Paradigma in allgemein verständlicher Sprache für alle potenziellen Interessenten zu schildern. Anders als der in einem hergebrachten Paradigma arbeitenden Wissenschaftler obliegt es ihm, seine neuen Begriffe zu definieren. Selbst wenn solche Bücher es zu einer gewissen Popularität bringen, so sind sie doch nicht als »populäre Naturwissenschaft« einzustufen, worunter ich die vereinfachte Beschreibung einer eingeführten Disziplin verstehe.
Dass ich beschloss, dieses Buch in Form von Geschichten zu schreiben, sollte dem Leser ermöglichen, das zu sehen, was ich auch sah. Meine ganze Erfahrung, im Leben wie bei der Erforschung des Gehirns, führt mich zu dem Schluss, dass die meisten Menschen durch Geschichten, in denen sie zu Zeugen des Geschehens werden, viel besser lernen als durch abstrahierende Darstellungen. Ich wollte meinen Lesern zutrauen, mit einem Minimum an Hilfestellung die einzelnen Punkte zu verknüpfen, die Verbindungslinien zwischen den Geschichten zu ziehen und zu erkennen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Damit sollte begreiflich gemacht werden, dass das Buch ein neues Paradigma zum Verständnis des Gehirns schildert.
Ist aus diesem Paradigma aber nun eine neue Disziplin »Neuroplastizität« hervorgegangen, mit ihren eigenen Fachzeitschriften, Fakultäten und Studiengängen? Manchmal, in Augenblicken der Schwäche, wünsche ich mir das, und im Grunde hätte ich nichts dagegen. Insgesamt |9|aber glaube ich, dass die Idee eines plastischen Gehirns zu umfassend ist, um als Unterkategorie behandelt zu werden. Das hängt mit meinem Verständnis der Neurowissenschaft zusammen, und mit der Rolle, die Neuroplastizität darin zu spielen hat.
In der Öffentlichkeit findet man heute oftmals die Vorstellung, es handele sich bei der Neurowissenschaft um einen eigenständigen Forschungsbereich, dessen Institute fertige Neurowissenschaftler hervorbringen (und davon gibt es immerhin einige, seitdem der Begriff »sexy« geworden ist). Tatsächlich aber ist »die« Neurowissenschaft weniger ein eigenständiger Forschungsbereich als ein Ansatz zur Lösung von Fragen, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche aufgeworfen werden. Die bedeutendsten Neurowissenschaftler kommen aus verschiedenen Disziplinen. Eric Kandel, der als erster einen Nobelpreis für neuroplastische Forschung erhielt, war ursprünglich Psychiater, der sich später Kenntnisse in Neurobiologie und Molekularbiologie erwarb. Gerald Edelman bekam einen Nobelpreis für seine Verdienste um die Erforschung der Antikörper, gilt aber heute als angesehener Neurowissenschaftler. So auch Francis Crick, der Biologe, der zuerst als Mitentdecker der DNA berühmt wurde. Unter den Neurowissenschaftlern finden sich Psychologen, Neurophysiologen, Neurologen, Psychopharmakologen, Spezialisten für Rehabilitationsmedizin oder »Neuroimaging«, Neuropsychologen, Erziehungswissenschaftler, Genetiker und selbst eine Handvoll Psychoanalytiker. Warum also bezeichnen sie sich nun auch noch als Neurowissenschaftler?
Der Grund hierfür ist, wie ich meine, Mitte des 20. Jahrhunderts zu suchen, zu einer Zeit, als diese verschiedenen Disziplinen ihre eigenen Sprachen entwickelt und dabei die Fähigkeit verloren hatten, miteinander zu kommunizieren. So kam es zur Krise, denn alle beschäftigten sich auf unterschiedliche Weise mit Geist und Gehirn, und alle hatten etwas zum großen Ganzen beizutragen. Bald bildeten sich zwei, einander oftmals bekriegende, Lager heraus: Jene, die sich mit dem »Geist« beschäftigten (viele Psychologen, Psychiater, einige Philosophen usw.) standen jenen entgegen, denen es um das Gehirn ging (zum Beispiel Neurophysiologen, Psychopharmakologen usw.). Diese Balkanisierung der Wissenschaften von Geist und Gehirn stand dem gemeinsamen Fortschritt im Weg. Lässt man außer Acht, dass die Funktion des Gehirns in der Erzeugung geistiger Aktivität besteht, kommt man bei seiner Erforschung nicht weiter, als wenn man den Verdauungstrakt ohne Berücksichtigung der Verdauung studiert. Das Schisma schien eine Trennung von Geist und Gehirn festzuschreiben, die vor den Erkenntnissen der Neuroplastizität nicht bestehen kann.|10|
Diese Krise, und die heraufdämmernde Erkenntnis, dass wir viel voneinander zu lernen hatten, führte zum Aufbau eines großen Daches, unter dem alle diese wunderbaren Disziplinen miteinander ins Gespräch kommen konnten. Dieses Dach heißt Neurowissenschaft. Ihr Wert liegt darin, dass sie ein Projekt darstellt, das weiter gefasst ist als irgendeine ihrer Teildisziplinen, und dass Neurowissenschaft versucht, unsere Erkenntnisse über Geist und Gehirn miteinander zu verbinden. Darin liegt ihre Faszination für eine breite Öffentlichkeit. Die Neurowissenschaft ist somit zu verstehen als eine längst überfällige Zusammenarbeit zwischen Einzeldisziplinen und zwischen geist- und gehirnzentrierten Ansätzen.
Dem entspricht, dass Neuroplastizität sich nicht einfach mit »Hirnwachstum« oder »Hirnveränderung« beschäftigt, wie sie selbst manche im Labor arbeitenden Forscher verengend definieren würden. Neuroplastizität ist die Veränderung des Gehirns infolge geistiger Aktivität. Zugegeben, im Labor können wir das Gehirn verändern, mit chemischen oder anderen Mitteln. Doch handelt es sich dabei um künstliche Eingriffe. In der Natur stellt sich Neuroplastizität als eine grundlegende Eigenschaft dar, die in Verbindung mit geistiger Aktivität steht.
Neuroplastizität ist demnach ein Begriff, der das Unternehmen Neurowissenschaft zusammenhält, indem er zwei Leitgedanken vertritt: Das Gehirn ist Hervorbringer geistiger Zustände, und diese bringen wiederum Veränderungen in Struktur und Funktion des Gehirns hervor. Neuroplastizität ist für alle neurowissenschaftlichen Forschungsgebiete von Belang, kann zu allen etwas beitragen und von allen etwas lernen. Deshalb glaube ich, dass eine Unterdisziplin, die allein der Neuroplastizität gewidmet wäre, diesen Vorteil verspielen würde.
Man fragt mich oft, wie die »neuroplastische Revolution« vorankomme und ob ihre Erkenntnisse klinische Bestätigung finden. Darauf kann ich keine eindeutige Antwort geben. Manche Forschungsbereiche, wie diejenigen, die sich mit Lernbehinderungen beschäftigen, machen große Fortschritte. Auch die Disziplinen, die sich mit der Rehabilitation beispielsweise nach Schlaganfällen beschäftigen, Sprachspezialisten, Beschäftigungstherapeuten, Aspekte von Psychologie, Psychiatrie und Kinderpsychiatrie, Sporttrainer, Hypnotiseur, Spezialisten für Neurofeedback und andere haben sich Erkenntnisse der Neuroplastizität zunutze machen können. Sie alle haben bereits Erfahrungen mit mentalem Training gemacht und konnten ihren Praktiken einen Schub verpassen, als sie lernten, dass dieses Training sich auf die Strukturen des Gehirns auswirkt.
Aber geistige Revolutionen und Entdeckungen benötigen Jahrzehnte, |11|nicht Jahre, zu ihrer Entfaltung. Unser Verständnis des Elektromagnetismus begann vor etwa 150 Jahren, doch haben wir noch längst nicht alle möglichen Anwendungen des Prinzips erforscht. Der Sinn dieses Buches ist, zu zeigen, dass Neuroplastizität Wirklichkeit besitzt, und dass sie in vielen klinischen Bereichen anwendbar ist. Aber die neuroplastische Revolution steht noch am Anfang.
Norman Doidge, Januar 2014|12|
VORWORT
Seit wenigen Jahren verbreitet sich eine revolutionäre Erkenntnis, die lange für unmöglich gehalten wurde: Das menschliche Gehirn kann sich verändern. Dieses Buch stellt diese Entdeckung vor und erzählt die Geschichten von Wissenschaftlern, Ärzten und Patienten, die gemeinsam ganz erstaunliche Veränderungen des Gehirns bewirkt und erlebt haben. Ganz ohne Operationen und Medikamente nutzten sie dieses bislang unbekannte Veränderungspotenzial des Gehirns. Einige der Patienten litten unter angeblich nicht behandelbaren neurologischen Erkrankungen. Andere wollten lediglich die Funktionsfähigkeit ihres Gehirns verbessern oder sie im Alter erhalten. Vierhundert Jahre lang galt allein der Gedanke an Modifizierungen des Gehirns als völlig unvorstellbar, denn die gängige Lehre der Medizin und der Neurowissenschaften behauptete, die Anatomie des Gehirns sei fest vorgegeben. Nach Abschluss des Entwicklungsprozesses in der Kindheit sei nur noch eine einzige Veränderung möglich: der schleichende Verfall. Wenn Gehirnzellen sich nicht richtig entwickelten, wenn sie verletzt wurden oder abstarben, sollten sie demnach nicht ersetzt werden können. Das Gehirn könne seine Struktur nicht abwandeln oder neue Funktionen entwickeln, wenn ein Teil beschädigt sei. Diese Theorie erklärte, dass Menschen, die mit einem eingeschränkt funktionsfähigen Gehirn zur Welt kamen oder später Gehirnverletzungen erlitten, bis ans Ende ihrer Tage mit diesen Einschränkungen zu leben hatten. Die Frage, ob sich die Funktionsfähigkeit eines gesunden Gehirns durch bestimmte Aktivitäten oder geistige Übungen erhalten oder gar verbessern ließe, galt unter Wissenschaftlern als pure Zeitverschwendung. Mit dieser Überzeugung, dass jede Behandlung von Gehirnschäden sinnlos sei, hatte eine Art neurologischer Nihilismus die gesamte Kultur erfasst. Er schränkte sogar unser Menschenbild ein: Da sich das Gehirn nicht ver|13|ändern konnte, musste auch die menschliche Natur, die aus dem Gehirn hervorgeht, ein für alle Mal festgeschrieben sein.
Dieser Glaube an das unveränderbare Gehirn hatte vor allem drei Ursachen: Erstens erholten sich Patienten in den seltensten Fällen vollständig von ihren Gehirnverletzungen. Zweitens entzog sich die Aktivität des lebenden Gehirns lange Zeit der Beobachtung durch die Wissenschaft. Und drittens verglich man das Gehirn seit den Anfängen der modernen Naturwissenschaften mit einer Art genialer Maschine – und Maschinen leisten zwar Außergewöhnliches, doch sie können sich weder verändern noch wachsen.
Durch meine praktische Arbeit als Psychiater und Psychoanalytiker interessierte ich mich immer mehr für die Frage, ob sich das Gehirn nicht vielleicht doch verändern könnte. Wenn Patienten nicht die erwünschten psychischen Fortschritte machten, erklärte die Schulmedizin für gewöhnlich, die Probleme seien fest in den »Schaltkreisen« des unveränderbaren Gehirns »verkabelt«. Die Vorstellung eines Schaltkreises ist eine jener Metaphern, die das Gehirn mit einer Maschine, genauer gesagt mit einem Computer vergleichen, dessen Prozessoren nur ganz spezifische und fest vorgegebene Funktionen übernehmen.
Als ich erfuhr, dass das Gehirn möglicherweise doch nicht fest verschaltet sein könnte, musste ich der Sache auf den Grund gehen und die Beweise selbst in Augenschein nehmen. Diese Forschung führte mich weit über meine Praxis hinaus.
Ich machte mich auf die Reise und lernte eine Reihe brillanter Wissenschaftler kennen, die Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre einige überraschende Entdeckungen gemacht hatten. Sie hatten gezeigt, dass das Gehirn mit jeder seiner Tätigkeiten seine Struktur veränderte und dass es seine Schaltkreise ständig optimierte, um anstehende Aufgaben besser lösen zu können. Wenn einige »Teile« ausfielen, sprangen oft andere ein. Mit der verbreiteten Vorstellung des Gehirns als einer Art Maschine, deren Einzelteile klar definierte Aufgaben übernahmen, ließen sich diese Beobachtungen nicht erklären. Diese Wissenschaftler begannen daher, von einer grundlegenden Veränderungsfähigkeit des Gehirns zu sprechen, eine Eigenschaft, die sie »Neuroplastizität« nannten.
»Neuro« steht für »Neuron«, die Nervenzelle in unserem Gehirn und unserem Nervensystem, und »Plastizität« bedeutet Veränderbarkeit, Formbarkeit, Wandelbarkeit. Anfangs scheuten sich Wissenschaftler, den |14|Begriff »Neuroplastizität« in ihren Publikationen zu verwenden, und wurden von ihren Kollegen belächelt, weil sie eine derart fantastische Theorie vertraten. Doch sie hielten hartnäckig an ihren Erkenntnissen fest, und ganz allmählich gelang es ihnen, die Doktrin von der Gehirnmaschine zu widerlegen. Sie konnten zeigen, dass Kinder nicht auf die geistigen Eigenschaften festgelegt sind, die sie bei ihrer Geburt mitbekommen, dass sich das Gehirn nach dem Ausfall eines Bereichs umstrukturieren und die fehlenden Funktionen an anderer Stelle neu entwickeln kann, dass abgestorbene Gehirnzellen unter bestimmten Umständen ersetzt werden können und dass viele der »Schaltkreise« und selbst grundlegende Reflexe keineswegs »fest verdrahtet« sind. Einem dieser Wissenschaftler gelang sogar der Beweis, dass wir durch unsere Lernprozesse und Handlungen Gene ein- und ausschalten und damit die Anatomie unseres Gehirns und unser Verhalten formen können. Dies ist zweifelsohne eine der außergewöhnlichsten Entdeckungen des zwanzigsten Jahrhunderts.
Auf meinen Reisen habe ich einen Naturwissenschaftler kennen gelernt, der geburtsblinden Menschen das Sehen ermöglicht, und einen anderen, der Taube hören lässt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die Jahrzehnte zuvor einen Schlaganfall erlitten hatten und als unheilbar galten und die mithilfe neuroplastischer Methoden wieder vollständig genesen waren. Ich bin Menschen begegnet, die ihre Lernbehinderungen überwunden und ihren Intelligenzquotienten verbessert haben. Ich habe gesehen, wie Achtzigjährige ihr Gedächtnis mit geeigneten Übungen so trainieren können, dass es wieder so leistungsfähig ist wie im Alter von 55 Jahren. Ich habe beobachtet, wie Menschen ihr Gehirn allein mithilfe ihrer Gedanken neu strukturierten, angeblich unheilbare Zwangsvorstellungen ablegten und Traumata überwanden. Und ich habe mit Nobelpreisträgern gesprochen, die über ein neues Modell des Gehirns debattieren, das die neuen Erkenntnisse über dessen Wandelbarkeit mit einbezieht.
Wie alle Revolutionen wird auch diese weitreichende Auswirkungen haben, und ich hoffe, dass dieses Buch einige davon aufzeigen kann. Die neuroplastische Revolution zeigt, wie sich unser Gehirn durch Liebe, Sex, Trauer, Beziehungen, Sucht, Kultur, Technologie und Psychotherapie (um nur einige zu nennen) verändert. Auch die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, die sich mit der menschlichen Natur beschäftigen, sind betroffen, genau wie alles, was mit Lernen zu tun hat. In jede dieser Disziplinen muss die Erkenntnis Eingang finden, dass sich die |15|Struktur des Gehirns von einem Menschen zum anderen unterscheidet und dass sie sich im Lauf eines Lebens verändert.
Offenbar hat sich also das menschliche Gehirn lange Zeit selbst unterschätzt. Trotzdem hat die Neuroplastizität auch ihre Schattenseiten: Sie macht unser Gehirn nicht nur flexibler, sondern auch verwundbarer gegenüber äußeren Einflüssen. Die Neuroplastizität kann sowohl flexible als auch starre Verhaltensweisen hervorbringen, weshalb man auch von einem »plastischen Paradoxon« sprechen kann. Ironischerweise sind einige unserer hartnäckigsten Angewohnheiten und Störungen Produkte eben dieser Plastizität. Wenn eine bestimmte neuroplastische Modifikation im Gehirn stattgefunden hat, dann kann diese möglicherweise weitere Veränderungen verhindern. Nur wenn wir die positiven und negativen Auswirkungen der Neuroplastizität verstehen, können wir das Ausmaß der menschlichen Möglichkeiten wirklich erkennen.
Da ein neues Wort nützlich sein kann, um neue Sachverhalte zu beschreiben, nenne ich die Naturwissenschaftler, die sich mit den Veränderungen des Gehirns befassen »Neuroplastologen«. Dieses Buch ist die Geschichte meiner Begegnung mit ihnen und mit den Patienten, deren Verwandlung sie bewirkt haben.|16|
Kapitel 1
EINE FRAU FÄLLT INS BODENLOSE … … und wird von dem Mann aufgefangen, der die Plastizität unserer Sinne entdeckte
Cheryl Schlitz hat das Gefühl, sich unaufhörlich im freien Fall zu befinden. Und weil sie dieses Gefühl hat, fällt sie tatsächlich.
Wenn sie sich frei hinstellt, hat man binnen weniger Augenblicke den Eindruck, als stünde sie kurz davor, in einen Abgrund zu stürzen. Ihr Kopf wackelt hin und her und kippt zur Seite, und sie rudert mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Momente später schwingt sie ihren Oberkörper von einer Seite zur anderen, wie eine Frau, die panisch versucht, sich auf einem Hochseil zu halten. Dabei steht sie, die Beine weit gespreizt, auf festem Boden. Sie wirkt, als hätte sie weniger Angst zu fallen, als gestoßen zu werden.
»Sie sehen aus wie jemand, der am Rand eines Abgrunds taumelt«, sage ich zu ihr.
»Ja, ich habe das Gefühl, ich muss gleich springen, obwohl ich das gar nicht will.«
Sie versucht, stillzustehen und pendelt dabei hin und her, als würde sie von unsichtbaren Dämonen gepiesackt, die sie von einer Seite zur anderen stoßen und zu Boden zerren wollen – nur dass diese Dämonen in ihrem Innern toben und sie schon seit fünf Jahren quälen. Wenn sie sich fortbewegen will, muss sie sich an einer Wand entlang tasten und torkelt dabei wie eine Betrunkene.
Cheryl kommt nie zur Ruhe, selbst wenn sie schließlich stürzt.
»Was fühlen Sie, wenn Sie gestürzt sind?«, frage ich sie. »Hört das Gefühl des Fallens auf, wenn sie auf dem Boden liegen?«
»Manchmal verliere ich buchstäblich den Boden unter den Füßen«, erwidert sie. »Plötzlich geht eine Falltür auf und verschluckt mich.« Noch auf dem Boden liegend hat sie das Gefühl, immer weiter zu fallen, in einen endlosen Abgrund.|17|
Die Ursache für Cheryls Problem ist eine Störung ihres Vestibularapparats, des Gleichgewichtsorgans im Innenohr. Sie ist erschöpft, das Gefühl des Fallens macht sie schier verrückt, denn sie kann an nichts anderes denken. Sie hat Angst vor der Zukunft. Kurz nachdem ihr Problem begann, musste sie ihre Stelle als internationale Handelsvertreterin aufgeben und lebt nun von einer schmalen Behindertenrente. Neuerdings fürchtet sie sich vor dem Älterwerden. Außerdem leidet sie unter einer seltenen Form der Angststörung, für die es keinen Namen gibt.
Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, hängt unser Wohlbefinden zu einem guten Teil von einem funktionierenden Gleichgewichtssinn ab. In den dreißiger Jahren untersuchte der österreichische Psychiater Paul Schilder, inwieweit ein gesundes Selbstgefühl und ein »stabiles« Körperempfinden mit dem Gleichgewichtssinn zusammenhängen. Wenn wir davon sprechen, dass wir uns »ausgeglichen« oder »unausgeglichen«, »ruhig« oder »unruhig«, »geerdet« oder »entwurzelt« fühlen, dann verwenden wir Begriffe, die sich auf unser körperliches Gleichgewicht beziehen. Doch was das wirklich bedeutet, können nur Menschen wie Cheryl nachempfinden. Es ist daher kaum überraschend, dass Patienten mit dieser Störung enormen psychischen Belastungen ausgesetzt sind und nicht selten Selbstmord begehen.
Wir haben Sinne, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben – bis wir sie verlieren. Unser Gleichgewichtssinn funktioniert in der Regel so reibungslos, dass Aristoteles ihn nicht in seine Liste der fünf Sinne aufnahm. Erst Jahrhunderte später wurde er überhaupt entdeckt.
Unser Gleichgewichtssinn ermöglicht uns die Orientierung im Raum. Das Gleichgewichtsorgan, der Vestibularapparat, besteht aus drei halbkreisförmigen Bogengängen im Innenohr, die Bewegungen im dreidimensionalen Raum wahrnehmen und uns auf diese Weise anzeigen, wann wir senkrecht stehen und wie die Schwerkraft auf unseren Körper wirkt. Einer dieser Bogengänge erkennt Bewegungen in der Horizontalen und der zweite in der Vertikalen, während der dritte Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen registriert. Die Gänge sind mit feinen Härchen ausgekleidet und mit einer Flüssigkeit gefüllt. Wenn wir den Kopf bewegen, dann streicht diese Flüssigkeit über die Härchen hinweg. Daraufhin senden diese ein Signal an unser Gehirn und teilen ihm mit, dass wir in einer bestimmten Richtung beschleunigen. Jede unserer Bewegungen erfordert ausgleichende Gegenbewegungen im Rest unseres Körpers. Wenn wir beispielsweise den Kopf nach vorn |18|strecken, gibt unser Gehirn den entsprechenden Körperteilen Anweisung, auf diese Bewegung zu reagieren, um die Verlagerung des Gewichtsschwerpunkts auszugleichen und uns im Lot zu halten. Über einen Hirnnerv gelangen die Signale aus dem Vestibularapparat in ein Kerngebiet im Rautenhirn, in die vier sogenannten Vestibulariskerne (Gleichgewichtskerne). Diese verarbeiten das Signal und leiten die entsprechenden Befehle an unsere Muskeln weiter. Außerdem besteht eine Verbindung zwischen dem Vestibularapparat und unserer visuellen Wahrnehmung. Wenn Sie hinter einem Bus herrennen und ihr Kopf dabei auf- und abpendelt, dann können Sie den fahrenden Bus nur deshalb im Auge behalten, weil Ihr Vestibularapparat Ihrem Gehirn mitteilt, wie schnell Sie in welche Richtung laufen. Mithilfe dieser Signale passt ihr Gehirn die Position ihrer Augäpfel so an, dass sie immer auf Ihr Ziel, den Bus, gerichtet bleiben.
Ich bin zu Besuch im Labor von Paul Bach-y-Rita, einer der Pioniere der Neuroplastizitätsforschung. Cheryl sieht dem heutigen Experiment optimistisch und mit stoischer Ruhe entgegen. Yuri Danilov, ein Biophysiker in Bach-y-Ritas Team, berechnet die Daten, die die Wissenschaftler aus Cheryls Vestibularsystem gewonnen haben. Danilov ist Russe und spricht mit einem erkennbaren Akzent: »Cheryl hat ihr Vestibularsystem verloren – zu 95 oder vielleicht sogar zu 100 Prozent.«
Aus Sicht der Schulmedizin ist Cheryl ein hoffnungsloser Fall. Die gängige Lehrmeinung betrachtet das Gehirn als eine Ansammlung hoch spezialisierter Module, von denen jedes genetisch darauf programmiert ist, eine ganz bestimmte Funktion zu übernehmen, und zwar nur diese: Jedes dieser Module hat sich im Lauf einer Jahrmillionen langen Evolution entwickelt und immer weiter spezialisiert. Wenn eines davon zerstört wird, ist es nicht zu ersetzen. Cheryls Aussichten, ihren Gleichgewichtssinn wiederzuerlangen, sind in etwa so groß wie die Chancen, dass ein Mensch mit einer zerstörten Netzhaut wieder sehen kann. Doch diese Lehrmeinung soll heute eindrucksvoll infrage gestellt werden.
Cheryl trägt einen Bauarbeiterhelm mit Löchern an der Seite, in dessen Innerm ein Beschleunigungsmesser angebracht ist. Aus diesem hängt ein Plastikstreifen mit Elektroden, den sich Cheryl auf die Zunge legt. Der Beschleunigungsmesser schickt Signale zu den Elektroden, und sowohl das Messgerät als auch die Elektroden sind mit einem Compu|19|ter verbunden. Cheryl muss lachen, als sie sich mit dem Helm sieht, und meint: »Wenn ich nicht lache, dann muss ich weinen.«
Die Maschine ist einer von Paul Bach-y-Ritas merkwürdig aussehenden Prototypen. Er ersetzt Cheryls Vestibularapparat und schickt Signale von ihrer Zunge an ihr Gehirn. Dieser Helm könnte dazu beitragen, ihr gegenwärtiges Trauma wieder rückgängig zu machen.
Nach der Entfernung ihrer Gebärmutter im Jahr 1997 erkrankte die damals 39 Jahre alte Cheryl an einer postoperativen Infektion. Zur Behandlung erhielt sie ein Antibiotikum namens Gentamicin. Dieses Antibiotikum kann zu einer Schädigung des Innenohrs und zum Verlust des Gehörs, zu einem Klingeln in den Ohren und zum Verlust des Gleichgewichtssinns führen. Doch da Gentamicin billig und wirksam ist, wird es bis heute verschrieben, wenn auch nur für Kurztherapien. Cheryl erhielt dieses Medikament jedoch weit über den zulässigen Zeitraum hinaus. Und so kam es, dass sie heute zu einer kleinen Gruppe von Gentamicin-Opfern gehört, die sich selbst »Wobbler« nennen.
Eines Tages stellte sie fest, dass sie nicht mehr frei stehen konnte, und fiel zu Boden. Als sie den Kopf bewegte, drehte sich der ganze Raum. Sie wusste nicht, ob sie oder das Zimmer sich bewegte. Schließlich gelang es ihr, sich an der Wand aufzurichten und einen Notarzt anzurufen.
Im Krankenhaus führten die Ärzte verschiedene Tests durch, um die Funktionsfähigkeit ihres Vestibularapparats zu überprüfen. Sie schütteten ihr kaltes und warmes Wasser ins Ohr und legten sie auf einen Tisch. Als sie sich mit geschlossenen Augen hinstellen sollte, fiel sie hin. Ein Arzt sagte ihr: »Ihr Vestibularsystem funktioniert nicht.« Die Tests ergaben, dass ihr Gleichgewichtsorgan zu 98 Prozent zerstört war.
»Er klang so unbeschwert«, erinnert sich Cheryl. »›Sieht ganz nach Nebenwirkungen von Gentamicin aus‹, sagte er zu mir.« Hier wird Cheryl von ihren Gefühlen überwältigt. »Warum hat mir das vorher keiner gesagt? ›Der Schaden ist nicht zu behandeln‹, meinte er. Ich war allein. Meine Mutter hatte mich ins Krankenhaus gefahren, doch sie war losgegangen, um das Auto zu holen, und hat vor dem Krankenhaus auf mich gewartet. Sie hat mich gefragt: ›Wird es wieder gut?‹ Und ich habe ihr gesagt: ›Es ist nicht zu behandeln. Es wird nie wieder gut.‹«
Da die Verbindung zwischen Cheryls Gleichgewichtsorgan und ihrem visuellen System beschädigt ist, kann sie einem beweglichen Objekt nur |20|schwer mit den Augen folgen. »Alles springt auf und ab wie in einem Amateurfilm«, erzählt sie. »Es ist so, als ob alles aus Wackelpudding wäre. Bei jedem Schritt den ich mache, wabbelt alles.«
Obwohl sie nicht in der Lage ist, beweglichen Objekten mit den Augen zu folgen, hat sie nur ihr Sehvermögen, um zu erkennen, ob sie aufrecht steht. Unsere Augen helfen uns dabei, unsere Position im Raum zu bestimmen, indem sie sich an horizontalen Linien orientieren. Als einmal bei einem Stromausfall das Licht ausging, fiel Cheryl sofort hin. Doch das Sehvermögen ist eine unzuverlässige Krücke, da jede Bewegung vor Cheryls Augen – etwa von jemandem, der ihr die Hand entgegenstreckt – das Gefühl des Fallens verstärkt. Sie kann sogar über das Zickzackmuster eines Teppichs stolpern, da ihr Gehirn ihr eine Unmenge widersprüchlicher und falscher Botschaften übermittelt und sie das Gefühl bekommt, sie stehe schief, obwohl sie in Wirklichkeit aufrecht steht.
Sie leidet unter geistiger Erschöpfung, da sie ununterbrochen hoch konzentriert sein muss. Um sie einigermaßen im Lot zu halten, benötigt ihr Gehirn eine Menge Energie, und diese Energie fehlt anderen zentralen Funktionen wie dem Gedächtnis und der Fähigkeit zu planen und nachzudenken.
Während Yuri das Experiment am Computer vorbereitet, frage ich, ob ich die Maschine einmal ausprobieren darf. Ich setze mir den Bauarbeiterhelm auf und lege mir den Plastikstreifen mit den Elektroden auf die Zunge. Das Zungendisplay ist flach und kaum dicker als ein Kaugummistreifen.
Der Beschleunigungsmesser im Helm registriert Bewegung auf zwei Ebenen. Jede meiner Kopfbewegungen wird in eine Karte auf dem Computerbildschirm übertragen, mit deren Hilfe die Wissenschaftler die Bewegung überwachen. Dieselbe Karte wird an die 144 Elektroden des Zungendisplays geschickt. Als ich mich nach vorn lehne, verspüre ich leise Stromstöße auf der Zungenspitze, die prickeln wie Sektperlen und mir mitteilen, dass ich mich zu weit nach vorn beuge. Als ich den Kopf in den Nacken lege, spüre ich, wie eine sanfte Welle in Richtung der Zungenwurzel perlt. Dieselbe Wirkung stellt sich ein, wenn ich den Kopf zur Seite lege. Dann schließe ich die Augen und versuche, mich allein mit der Zunge im Raum zu orientieren. Bald vergesse ich, dass die Information aus meinem Mund kommt und stelle mithilfe des Prickelns auf der Zunge fest, in welcher Position ich mich befinde.|21|
Ich nehme den Helm ab und gebe ihn Cheryl. Sie hält ihr Gleichgewicht, indem sie sich an einen Tisch lehnt.
»Fangen wir an«, sagt Yuri und stellt die Regler ein.
Cheryl setzt den Helm auf und schließt die Augen. Sie tritt vom Tisch zurück und hält mit nur zwei Fingern den Kontakt. Sie fällt nicht, obwohl ihr nur die »Sektperlen« auf der Zunge verraten, was oben und was unten ist. Schließlich nimmt sie auch die beiden Finger vom Tisch. Sie steht völlig frei, ohne dabei zu torkeln. Sie beginnt zu weinen. In dem Moment, in dem sie den Helm trägt und sich sicher fühlen darf, bricht sie ob ihres Zustands in Tränen aus. Als sie zum ersten Mal den Helm aufsetzte, hatte sie auch zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht mehr das Gefühl, gleich hinfallen zu müssen. Heute besteht ihre Aufgabe darin, mit dem Helm auf dem Kopf zwanzig Minuten lang frei und aufrecht zu stehen. Für jeden Menschen, insbesondere für Wobbler, erfordern zwanzig Minuten Stehen das konditionelle Training und die Fähigkeiten eines Wachsoldaten vor dem Buckingham Palace in London.
Cheryl wirkt zufrieden. Sie nimmt kleinere Korrekturen vor. Die ruckartigen Bewegungen haben aufgehört und die geheimnisvollen Dämonen, die sie von einer Seite auf die andere zu stoßen schienen, sind verschwunden. Ihr Gehirn verarbeitet die Signale ihres künstlichen Gleichgewichtsorgans. Für sie sind diese friedlichen Augenblicke ein Wunder – ein neuroplastisches Wunder, denn unter normalen Umständen würde ein Prickeln auf der Zunge in eine Hirnregion namens somatosensorischer Kortex geleitet, in der die Tastempfindungen verarbeitet werden – doch nun gelangt dieser Reiz auf einem neuen Weg in eine ganz andere Hirnregion, nämlich die, die für das Gleichgewicht zuständig ist.
»Wir wollen diesen Apparat irgendwann so klein machen, dass wir ihn im Mund unterbringen können«, erklärt Bach-y-Rita. »So ähnlich wie eine Zahnspange. Dann können Cheryl und andere Patienten mit diesem Problem ein ganz normales Leben führen. Cheryl könnte den Apparat tragen und dabei sprechen und essen, ohne dass ihn jemand bemerkt. Damit helfen wir nicht nur Menschen, die von den Nebenwirkungen von Gentamicin betroffen sind. Gestern stand in der New York Times ein Bericht über Stürze von Senioren.1 Alte Menschen haben mehr Angst vor einem Sturz als vor einem Überfall. Ein Drittel aller Senioren erleidet schwere Stürze. Aus Angst hinzufallen, trauen sich viele nicht mehr aus dem Haus, benutzen ihre Beine nicht und werden |22|körperlich immer schwächer. Ich vermute aber, dass diese Stürze oft dadurch verursacht werden, dass der Gleichgewichtssinn, ähnlich wie unser Gehör, unser Geschmackssinn, unsere Augen und alle anderen Sinne, im Alter immer schwächer werden. Dieser Apparat könnte auch alten Menschen helfen.«
»Die Zeit ist um«, erklärt Yuri und schaltet den Apparat ab.
Nun beginnt das zweite neuroplastische Wunder. Cheryl nimmt den Streifen von der Zunge und setzt den Helm ab. Sie grinst übers ganze Gesicht und steht frei mit geschlossenen Augen, ohne umzufallen. Dann öffnet sie die Augen, hebt ein Bein und hält auf dem anderen das Gleichgewicht, ohne sich am Tisch festzuhalten.
»Ich liebe diesen Mann«, sagt sie, geht auf Bach-y-Rita zu und umarmt ihn. Dann kommt sie zu mir. Überwältigt vom Gefühl, dass sie die Welt unter ihren Füßen spürt, umarmt sie auch mich.
»Ich fühle mich verankert und stabil. Ich muss nicht darüber nachdenken, wo meine Muskeln sind. Ich kann an andere Dinge denken.« Sie geht zu Yuri und gibt ihm einen Kuss.
»Wir sollten vielleicht erklären, warum dies ein Wunder ist«, erklärt Yuri, der sich selbst als streng empirischen Skeptiker beschreibt. »Cheryl hat keinen natürlichen Wahrnehmungsapparat. Wir haben ihr zwanzig Minuten lang einen künstlichen Wahrnehmungsapparat gegeben. Doch das eigentliche Wunder ist das, was jetzt mit ihr passiert, wenn sie das Gerät abgenommen hat und weder einen natürlichen noch einen künstlichen Vestibularapparat besitzt. Wir haben irgendeine Kraft in ihr zum Leben erweckt.«
Beim ersten Mal trug Cheryl den Helm nur eine Minute lang. Nachdem sie ihn abgenommen hatte, stellten die Wissenschaftler eine »Nachwirkung« fest, die ungefähr zwanzig Sekunden lang anhielt, also ein Drittel der Zeit, die sie den Apparat getragen hatte. Beim zweiten Mal trug Cheryl den Helm zwei Minuten lang, und die Nachwirkungen hielten vierzig Sekunden lang vor. Als sie die Dauer des Experiments auf zwanzig Minuten steigerten, gingen sie davon aus, dass die Nachwirkungen etwas weniger als sieben Minuten andauern würden. Stattdessen hielt sie dreimal so lang vor, also eine volle Stunde. Mit dem heutigen Experiment wollen Bach-y-Rita und seine Mitarbeiter herausfinden, ob weitere zwanzig Minuten eine Art Lerneffekt auslösen und die Nachwirkungen über einen noch längeren Zeitraum hinweg anhalten.
Cheryl beginnt, herumzualbern und mit ihren Fähigkeiten anzuge|23|ben. »Ich kann wieder gehen wie eine Frau. Den meisten Menschen ist das vermutlich ziemlich egal. Aber mir bedeutet es eine Menge, dass ich nicht mehr mit gespreizten Beinen durch die Gegend laufen muss.«
Sie steigt auf einen Stuhl und springt herunter. Sie bückt sich, um Gegenstände vom Boden aufzuheben und zu demonstrieren, dass sie sich aufrichten kann. »Letztes Mal konnte ich in der Nachwirkungszeit seilhüpfen.«
»Das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur ihr Gleichgewicht hält«, erklärt Yuri. Nach einer gewissen Zeit mit dem Apparat kann sie sich beinahe normal verhalten. Sie kann auf einem Balken balancieren, sie kann Auto fahren, der Gleichgewichtssinn ist vollständig wiederhergestellt. Wenn sie den Kopf bewegt, kann sie ihr Ziel im Auge behalten – auch die Verbindung zwischen dem Gleichgewichtssinn und den Augen ist wieder da.«
Ich blicke auf und beobachte, wie Cheryl mit Bach-y-Rita tanzt. Sie führt.
Wie kommt es, dass Cheryl ohne den Apparat tanzen und sich ganz normal bewegen kann? Bach-y-Rita hält verschiedene Erklärungen für denkbar. Zum einen könnte ihr beschädigter Vestibularapparat weiterhin Signale aussenden, allerdings völlig willkürlich. Das »Rauschen« des zerstörten Gewebes könnte die Signale des gesunden Gewebes übertönen. Der Apparat könnte den Effekt haben, die korrekten Signale des gesunden Gewebes zu verstärken. Bach-y-Rita hält es allerdings auch für möglich, dass der Apparat hilft, andere Verbindungen zu verwenden. Hier kommt die Neuroplastizität ins Spiel. Unser Gehirn besteht aus einer Vielzahl von Nervenbahnen oder Nervenzellen, die untereinander in Verbindung stehen und miteinander kommunizieren. Wenn wichtige Bahnen blockiert sind, verwendet das Gehirn ältere Bahnen, um diese zu umgehen. »Das ist etwa so, als würden sie von hier nach Milwaukee fahren und feststellen, dass die wichtigste Brücke gesperrt ist. Zuerst wissen Sie nicht, was Sie tun sollen, dann nehmen Sie eine Nebenstraße und fahren übers Land. Wenn Sie diese Strecke öfter fahren, finden Sie Abkürzungen und kommen schneller ans Ziel«, erläutert Bach-y-Rita. Diese »Nebenstraßen« im Gehirn werden freigelegt und durch Benutzung gestärkt. Diese »Demaskierung« gilt allgemein als eine der wichtigsten Möglichkeiten des plastischen Gehirns, sich neu zu strukturieren.
Die Tatsache, dass Cheryls Nachwirkungen allmählich immer länger |24|anhalten, deutet darauf hin, dass die demaskierte Bahn gestärkt wird. Bach-y-Rita hofft, dass Cheryl durch Training diese Nachwirkungen immer weiter verlängern kann.
Einige Tage später erhält Bach-y-Rita eine E-Mail von Cheryl, in der sie ihm berichtet, wie lange die Nachwirkungen diesmal vorgehalten haben. »Gesamtdauer der Nachwirkungen: drei Stunden, zwanzig Minuten. Dann beginnt das Wobbeln im Kopf – wie immer. Ich habe Schwierigkeiten, Worte zu finden. Mein Kopf schwimmt. Müde, erschöpft, deprimiert.«
Es ist eine schmerzhafte Aschenputtelgeschichte. Die Rückkehr aus der Normalität ist sehr schwer. Sie hat jedes Mal das Gefühl, vom Tod zu neuem Leben erweckt worden zu sein, nur um ein weiteres Mal zu sterben. Andererseits ist eine Nachwirkung von drei Stunden und zwanzig Minuten inzwischen zehnmal so lang wie die Zeit, die sie den Apparat trug. Sie ist die erste Wobbling-Patientin, die je behandelt wird, und selbst wenn die Nachwirkungen nicht länger werden, könnte sie den Helm jetzt viermal am Tag für kurze Zeit aufsetzen und ein relativ normales Leben führen. Doch es gibt gute Gründe, mehr zu erwarten, denn mit jeder Sitzung scheint ihr Gehirn dazugelernt zu haben, und die Nachwirkungen halten immer länger vor. Wenn das so weiter geht …
Und es ging so weiter. Im Lauf des folgenden Jahres trug Cheryl den Helm öfter, um sich Momente der Erleichterung zu verschaffen und um die Nachwirkungen zu verlängern. Diese hielten bald mehrere Tage und schließlich vier Monate lang vor. Heute verwendet sie den Apparat nicht mehr und sieht sich nicht mehr als Wobblerin.
Im Jahr 1969 veröffentlichte Europas führendes Wissenschaftsmagazin Nature einen kurzen Artikel, der sich wie eine Science-Fiction-Geschichte las. Der federführende Autor Paul Bach-y-Rita arbeitete nicht nur als Grundlagenforscher, sondern war auch Arzt in einer Rehabilitationsklinik – eine seltene Kombination. Der Artikel beschrieb einen Apparat, der geburtsblinde Menschen in die Lage versetzte, zu sehen.2 Sämtliche Versuchsteilnehmer hatten Netzhautschäden und waren als unbehandelbar diagnostiziert worden.
Die Tageszeitung New York Times und die Magazine Newsweek und Life berichteten über den Nature-Artikel, doch die darin aufgestellten Behauptungen klangen vermutlich derart unglaubwürdig, dass das Gerät und sein Erfinder bald in Vergessenheit gerieten. |25|
Neben dem Artikel druckte Nature das Foto einer merkwürdig aussehenden Maschine ab, die wie ein großer alter Zahnarztstuhl mit einem Gewirr von Kabeln und unhandlichen Computern aussah. Dieses Monster aus Altmetall und Elektronik der sechziger Jahre wog sage und schreibe 200 Kilogramm.
Auf diesen Stuhl wurde eine Versuchsperson gesetzt, die von Geburt an blind war. Vor ihr wurde eine große Kamera aufgebaut, wie sie seinerzeit in Fernsehstudios zum Einsatz kamen. Die Versuchsperson »betrachtete« die Szenerie, indem sie mittels einer Handkurbel die Kamera schwenkte, die wiederum elektrische Bildsignale an einen Computer sandte. Diese Signale wurden auf 400 vibrierende Stimulatoren übertragen, die in mehreren Reihen auf einer Metallplatte im Stuhlrücken angebracht waren, sodass die Versuchsperson die Vibrationen auf der Haut spürte. Diese Stimulatoren funktionierten wie die Bildpunkte eines Schwarz-Weiß-Bildschirms: Vibration entsprach einem dunklen Bildpunkt, keine Vibration einem hellen. Dieses sogenannte Tast-Sicht-Gerät erlaubte es blinden Menschen, zu lesen, Gesichter und Schattierungen zu erkennen und wahrzunehmen, welche Gegenstände näher oder weiter entfernt waren. Es erlaubte ihnen, perspektivisch zu sehen und zu beobachten, wie ein Gegenstand scheinbar seine Form ändert, wenn er aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. An dem Experiment nahmen sechs Versuchspersonen teil. Sie lernten, Dinge wie etwa ein Telefon zu identifizieren, auch wenn sie durch einen anderen Gegenstand teilweise verdeckt waren. Und weil es die sechziger Jahre waren, lernten sie auch, ein Bild des dürren Supermodels Twiggy zu erkennen.
Benutzer dieses etwas unhandlichen Tast-Sicht-Geräts machten eine bemerkenswerte Wahrnehmungserfahrung, als sie von einer Tastwahrnehmung dazu übergingen, Menschen und Gegenstände zu »sehen«. Mit ein wenig Übung nahmen die blinden Versuchspersonen den Raum als dreidimensional wahr, obwohl sie ihre Informationen über eine zweidimensionale Platte in ihrem Rücken erhielten. Wenn jemand einen Ball in Richtung der Kamera warf, duckten sie sich instinktiv weg. Wenn die Platte mit den Stimulatoren vom Rücken auf den Bauch verlegt wurde, erkannten sie nach wie vor richtig, dass sich das Geschehen vor ihnen beziehungsweise vor der Kamera abspielte. Wenn sie in der Nähe eines Stimulators gekitzelt wurden, verwechselten sie diesen Reiz nicht mit einer optischen Wahrnehmung. Für die Versuchspersonen fand die mentale Wahrnehmung in der Welt statt, nicht auf der Haut. Zudem waren |26|die Wahrnehmungen komplex. Mit ein wenig Übung waren die Versuchspersonen in der Lage, die Kamera zu bewegen und Dinge zu sagen wie: »Das ist Betty. Sie trägt ihr Haar heute offen und hat keine Brille auf. Ihr Mund ist geöffnet und sie bewegt ihre linke Hand von der Seite hinter ihren Kopf.« Die Auflösung war zugegebenermaßen nicht die beste, doch wie Bach-y-Rita erklärte, muss das Sehvermögen nicht perfekt sein, um als Sehvermögen zu gelten: »Wenn wir eine neblige Straße entlanggehen und den Umriss eines Gebäudes erkennen, sehen wir es dann etwa nicht, weil die Auflösung schlecht ist? Wenn wir ein Schwarz-Weiß-Bild sehen, sehen wir es dann etwa nicht, nur weil die Farben fehlen?«
Diese längst vergessene Maschine war eine der ersten und mutigsten Anwendungen der Neuroplastizität. Sie stellte den Versuch dar, ein Sinnesorgan durch ein anderes zu ersetzen. Der Versuch glückte. Trotzdem galt die Maschine als unglaubwürdig und wurde lange ignoriert, denn nach Ansicht der damaligen Wissenschaft war die Struktur des Gehirns unveränderbar, und unsere Sinnesorgane – die Kanäle, auf denen die Erfahrung in unser Gehirn gelangt – waren fest verschaltet. Diese Vorstellung, die bis heute zahlreiche Anhänger hat, ist unter dem Namen »Lokalisationstheorie« bekannt. Sie vertritt die Ansicht, dass das Gehirn einer komplexen Maschine ähnelt, die aus zahlreichen Einzelteilen besteht, von denen jedes eine ganz bestimmte Aufgabe übernimmt und einen genetisch vorherbestimmten festen Platz einnimmt – daher auch der Name der Theorie. Doch in einem Gehirn, das derart fest verschaltet ist und in dem jede Funktion an einem ganz bestimmten Ort ausgeführt wird, ist kein Platz für Plastizität.
Die Theorie, derzufolge unser Gehirn nichts anderes ist als eine komplexe Maschine, stammt aus dem siebzehnten Jahrhundert. Sie ersetzte die damals verbreiteten mystischen Vorstellungen von Körper und Seele und beherrschte fortan die Neurowissenschaften. Unter dem Einfluss von Galileo Galilei (1564 – 1642), der nachwies, dass die Planeten leblose Körper waren und durch mechanische Kräftenbewegt wurden, glaubten viele Naturwissenschaftler, die gesamte Natur verhalte sich wie ein gigantisches kosmisches Uhrwerk und unterliege den Gesetzen der Mechanik. Sie begannen, auch Lebewesen und Organe des menschlichen Körpers mit den Gesetzen der Mechanik zu erklären, so als handele es sich um Maschinen. Diese Theorie, die Natur verhalte sich wie ein gewaltiges Räderwerk und unsere Organe wie Maschinen, löste die |27|zweitausend Jahre alte Vorstellung der Griechen ab, die die Natur als einen gigantischen lebendigen Organismus beschrieben und für die unsere Organe alles waren, nur keine leblosen Maschinen.3 Die erste Leistung der neuen »mechanistischen Biologie« war eine brillante und originelle Entdeckung. William Harvey (1578 – 1657), der an Galileos Universität im italienischen Padua Anatomie studierte, erkannte, dass das Blut durch unsere Adern fließt und das Herz wie eine Pumpe funktioniert. Bald kamen immer mehr Naturwissenschaftler zu dem Schluss, dass eine Erklärung mechanistisch sein musste, wenn sie als wissenschaftlich gelten sollte, das heißt, dass sie den Bewegungsgesetzen der Physik gehorchen musste. Im Anschluss an Harvey erklärte der französische Philosoph René Descartes (1596 – 1650), auch das Gehirn mit dem Nervensystem verhalte sich wie eine Pumpe. Unsere Nerven seien in Wirklichkeit Röhren, so erklärte er, die das Gehirn mit den Gliedmaßen verbanden. Er war der erste Denker, der eine Theorie über die Reflexe aufstellte, als er behauptete, wenn wir auf der Haut berührt würden, fließe eine Flüssigkeit von dieser Stelle zum Gehirn und werde dort auf mechanischem Wege über die Nervenröhren zu den Muskeln geleitet. So holzschnittartig es klingt: Es ist jedoch gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Naturwissenschaftler entwickelten diese Theorie bald weiter und erklärten, es fließe keine Flüssigkeit durch die Nerven, sondern eine Art elektrischer Strom. Descartes’ Vorstellung vom Gehirn als Pumpe gipfelte schließlich in der modernen Vorstellung des Gehirns als eine Art Computer und in der Lokalisationstheorie. Das Gehirn galt bald als eine Maschine mit unterschiedlichen Teilen, von denen sich jedes an einem klar definierten Ort befindet und eine klar definierte Aufgabe übernimmt. Das hatte zur Folge, dass keines dieser Teile bei einem Ausfall durch ein anderes ersetzt werden könnte – schließlich können sich Maschinen ja auch keine neuen Teile wachsen lassen.4
Die Lokalisationstheorie wurde auch auf unsere Sinne angewendet. Danach hat jeder unserer Sinne – Gesichtssinn, Gehör, Geschmack, Tastsinn, Geruch und Gleichgewicht – seine eigenen Sinneszellen, die darauf spezialisiert sind, eine der verschiedenen Formen der Energie in unserer Umwelt wahrzunehmen.5 Wenn diese Sinneszellen angeregt werden, senden sie ein elektrisches Signal in eine ganz bestimmte Gehirnregion, die auf die Verarbeitung genau dieses Reizes spezialisiert ist. Die meisten Wissenschaftler gingen davon aus, dass diese Gehirnregio|28|nen derart hoch entwickelt sind, dass keine Region die Aufgaben einer anderen übernehmen könnte.
Paul Bach-y-Rita war einer der wenigen, der die Lokalisationstheorie ablehnte. Er erkannte, dass unsere Sinne unerwartet plastisch sind, und stellte fest, dass bei der Beschädigung eines Sinnes ein anderer dessen Aufgaben übernehmen kann. Diesen Prozess nannte er »Sinnessubstitution«, das Ersetzen eines Sinnes durch einen anderen. Er entwickelte Methoden, um diese Substitution zu fördern und Geräte, mit deren Hilfe wir gewissermaßen »übersinnliche Fähigkeiten« erlangen. Seine Erkenntnis, dass das Nervensystem lernen kann, mithilfe einer Kamera statt mit der Netzhaut zu sehen, gab den Anstoß zur Entwicklung von Geräten, die heute als größte Hoffnung für Sehbehinderte gelten: Netzhautimplantate, die in einem operativen Eingriff ins Auge eingesetzt werden können.
Anders als die meisten Naturwissenschaftler, die selten über den Tellerrand ihrer jeweiligen Disziplin hinausblicken, ist Bach-y-Rita Experte auf den unterschiedlichsten Fachgebieten: in der Medizin, der Psychopharmakologie, der okularen Neurophysiologie (die sich mit der Augenmuskulatur befasst), der visuellen Neurophysiologie (die den Zusammenhang von Sehorganen und dem Nervensystem untersucht) und der biomedizinischen Technik. Er spricht fünf Sprachen und lebte längere Zeit in Italien, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Schweden und verschiedenen Bundesstaaten der USA. Er hat in den Labors der bedeutendsten Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger gearbeitet, doch er hat sich nie sonderlich dafür interessiert, was andere von seinen Arbeiten halten, und nie die politischen Spielchen gespielt, mit denen andere Wissenschaftler ihre Karriere betreiben. Zu Beginn seiner Laufbahn war er praktizierender Arzt, gab die Medizin jedoch auf und wechselte in die Grundlagenforschung. Dort stellte er Fragen, die dem gesunden Menschenverstand zu widersprechen schienen, zum Beispiel: »Brauchen wir zum Sehen Augen, zum Hören Ohren, zum Schmecken eine Zunge und zum Riechen eine Nase?« Im Alter von 44 Jahren kehrte der rastlose Denker zurück in den Krankenhausdienst mit seinen endlosen Tagen und schlaflosen Nächten. Er entschied sich ausgerechnet für die Rehabilitationsmedizin, vielleicht eines der zähesten Spezialgebiete. Sein Ziel war es, dieses vernachlässigte Gebiet zu einer Wissenschaft zu machen, indem er dort sein Wissen über die Plastizität einbrachte.|29|
Paul Bach-y-Rita ist ein sehr bescheidener Mann. Wenn seine Frau ihn lässt, trägt er billige Anzüge aus den Läden der Heilsarmee. Er fährt eine zwanzig Jahre alte Rostlaube, seine Frau einen nagelneuen Passat. Er hat volles, welliges graues Haar, spricht leise und schnell und hat die dunkle Haut seiner spanischen und jüdischen Vorfahren. Dass er 69 Jahre alt ist, sieht man ihm nicht an. Er ist ganz offensichtlich ein Kopfmensch, doch im Umgang mit seiner Frau, einer Maya aus Mexiko, strahlt er eine jungenhafte Wärme aus.
Er ist das Außenseiterdasein gewohnt. Er wuchs in der Bronx auf und maß nur 1,45 Meter, als er in die Highschool kam, weil sein Wachstum acht Jahre lang durch eine geheimnisvolle Krankheit gehemmt worden war. Zweimal hieß es, er leide unter Leukämie. Die größeren Mitschüler verprügelten ihn täglich, und in diesen Jahren entwickelte er eine beachtliche Schmerzunempfindlichkeit. Als er zwölf Jahre alt war, brach sein Blinddarm, und die geheimnisvolle Krankheit entpuppte sich als eine seltene Form der chronischen Blinddarmentzündung. Danach wuchs er 20 Zentimeter und gewann seine erste Schlägerei.
Wir fahren zusammen durch Madison im US-Bundesstaat Wisconsin, wo er lebt, wenn er sich nicht in Mexiko aufhält. Jede Form der Prahlerei ist ihm fremd, und in den vielen Stunden, die wir uns unterhielten, habe ich nur eine Äußerung von ihm gehört, die im entferntesten nach Eigenlob klang: »Ich kann alles mit allem verbinden«, sagte er und lächelte.
»Wir sehen mit dem Gehirn, nicht mit den Augen«, erklärt Bach-y-Rita. Damit widerspricht er dem gesunden Menschenverstand, der davon ausgeht, dass wir mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit der Zunge schmecken, mit der Nase riechen und mit der Haut fühlen. Doch Bach-y-Rita erklärt, dass unsere Augen lediglich Veränderungen der Lichtintensität registrieren – es sind unsere Gehirne, die diese Eindrücke in Bilder verwandeln und daher sehen.
Nach Ansicht von Bach-y-Rita ist es völlig gleichgültig, auf welchem Weg ein Reiz ins Gehirn gelangt: »Wenn ein Blinder einen Stock verwendet, dann schwenkt er ihn von einer Seite zur anderen und hat nur einen einzigen Punkt zur Verfügung, nämlich die Spitze des Stocks, der ihm über die Tastrezeptoren der Hand Informationen übermittelt. Doch mit dieser Schwenkbewegung findet er heraus, wo sich der Türrahmen |30|oder ein Stuhl befindet. Er kann den Fuß eines anderen Menschen erkennen, weil der ein bisschen nachgibt, wenn er ihn mit dem Stock trifft. Diese Informationen verwendet er, um den Stuhl zu finden und sich hinzusetzen. Obwohl die Tastrezeptoren der Hand der Ort sind, an dem er die Informationen aufnimmt und wo sich der Übergang zwischen ihm und dem Stock befindet, nimmt er subjektiv nicht den Druck des Stocks auf die Hand war, sondern die Anordnung des Zimmers: Stühle, Wände, Füße und den dreidimensionalen Raum. Die Tastrezeptoren der Hand sind lediglich das Informationsmedium, eine Art Datenschnittstelle. Die Rezeptoren selbst verlieren im Wahrnehmungsprozess ihre Identität.«
Bach-y-Rita kam zu dem Schluss, dass die Haut und ihre Tastrezeptoren als Ersatz für die Netzhaut dienen konnten, denn sowohl bei der Haut als auch der Netzhaut handelt es sich um zweidimensionale, von Sinneszellen bedeckte Flächen, auf denen ein »Bild« entsteht.6
Es ist eine Sache, eine neue Datenschnittstelle zu finden, über die Reize ins Gehirn gelangen können. Doch es ist für das Gehirn eine andere Sache, diese Reize zu entschlüsseln und ein Bild entstehen zu lassen. Dazu muss es neue Fähigkeiten erlernen, und Gehirnregionen, in denen die Information der Tastorgane verarbeitet werden, müssen sich auf die neuen Signale einstellen. Diese Anpassung würde jedoch bedeuten, dass das Gehirn plastisch und in der Lage sein muss, sein Wahrnehmungssystem umzustrukturieren.
Wenn das Gehirn jedoch in der Lage ist, sich selbst neu zu strukturieren, dann kann die Lokalisationstheorie nicht richtig sein. Anfangs war auch Bach-y-Rita ein Vertreter dieser Theorie und stand unter dem Eindruck ihrer genialen Erkenntnisse. Ihr erster ernst zu nehmender Vertreter war der französische Chirurg Paul Broca. Dieser behandelte im Jahr 1861 einen Patienten, der infolge eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen konnte und ein einziges Wort wiederholte. Egal, was er gefragt wurde, antwortete er »tan, tan«. Nach dem Tod dieses Patienten untersuchte Broca sein Gehirn und fand im linken Frontallappen zerstörtes Gewebe. Skeptiker bezweifelten, dass die Sprachfähigkeit in einem einzigen Bereich des Gehirns verortet sein sollte, bis Broca ihnen das beschädigte Gewebe vorlegte und von anderen Patienten berichtete, die ebenfalls nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnten und deren Gehirn an derselben Stelle beschädigt war. Die Region wurde nach ihrem Entdecker Broca-Zentrum genannt und galt als verantwortlich für die Koordination der Lippen- und Zungenmuskulatur. Bald da|31|rauf stellte der Mediziner Carl Wernicke eine Verbindung zwischen der Verletzung eines zweiten, weiter hinten gelegenen Bereichs und einem anderen Problem her: dem Verlust des Sprachverständnisses. Wernicke vermutete, dass diese Region, nach ihm als Wernicke-Areal bezeichnet, für die Verarbeitung und das Verständnis von Wortbedeutungen verantwortlich war. Im Lauf des folgenden Jahrhunderts wurde die Topografie des Gehirns immer weiter verfeinert und die Lokalisationstheorie immer spezifischer.
Leider wurde die Lokalisationstheorie schon bald zum Dogma erhoben. Beruhte sie zu Beginn auf einer Reihe faszinierender Einzelerkenntnisse darüber, dass Verletzungen von spezifischen Gehirnarealen zum Verlust ganz bestimmter Fähigkeiten führen, verwandelte sie sich bald in eine allgemeine Theorie, die behauptete, jede Gehirnfunktion werde von einem und nur von einem Areal übernommen. Dieser Gedanke kam in der Formel »eine Funktion, ein Ort« zum Ausdruck. Das bedeutete, wenn eine bestimmte Region verletzt war, konnte sich das Gehirn nicht selbst umstrukturieren oder die verlorene Funktion wiederherstellen.
Für die Neuroplastizität brachen schwere Zeiten an, denn Ausnahmen für die Regel »eine Funktion, ein Ort« wurden schlicht ignoriert.7 Im Jahr 1868 nahm der französische Neurologe Jules Cotard Untersuchungen an Kindern vor, die von einem sehr frühen Zeitpunkt an unter einer massiven Gehirnerkrankung litten, in deren Verlauf die linke Gehirnhälfte (unter anderem das Broca-Zentrum) verkümmerte. Trotzdem konnten diese Kinder normal sprechen.8 Selbst wenn die Sprache in der Regel in der linken Gehirnhälfte verarbeitet wurde, wie Broca annahm, dann musste das Gehirn folglich so weit formbar sein, dass es sich nötigenfalls selbst umstrukturieren konnte. Im Jahr 1876 entfernte Otto Soltmann bei Hunde- und Kaninchenjungen den Motorcortex, das Bewegungszentrum im Gehirn, das laut Theorie für die bewusste Steuerung der Muskelbewegungen zuständig ist.9 Dabei stellte er fest, dass sich die Tiere trotzdem bewegen konnten. Doch diese Erkenntnisse gingen in der wachsenden Begeisterung für die Lokalisationstheorie unter.
Als Bach-y-Rita Anfang der sechziger Jahren in Deutschland arbeitete, kamen ihm erste Zweifel an der Lokalisationstheorie. Er war Teil einer Gruppe von Naturwissenschaftlern, die sich mit dem Sehprozess beschäftigte. Mithilfe von Elektroden maßen sie dazu die elektrischen Ausschläge im visuellen Kortex oder Sehzentrum von Katzenhirnen. Die Wissenschaftler gingen davon aus, wenn sie der Katze Bilder zeigten, würde die Elektrode im Sehzentrum einen Ausschlag verzeichnen, |32|weil die Katze das Bild verarbeitete. Der erwartete Ausschlag trat auch tatsächlich ein. Doch als zufällig jemand die Pfote der Katze berührte, schlug die Elektrode ebenfalls aus, was darauf hinzudeuten schien, dass das Sehzentrum auch Tastreize verarbeitete.10 Schließlich stellten die Wissenschaftler fest, dass das Sehzentrum auch aktiv wurde, wenn die Katze Geräusche hörte.
Bach-y-Rita begann zu zweifeln, ob die Formel »eine Funktion, ein Ort« so stimmen konnte. Das Sehzentrum der Katze verarbeitete mit Gehör und Tastsinn mindestens zwei weitere Sinnesreize. Er kam zu dem Schluss, dass Teile des Gehirns »polysensorisch« sein mussten, dass also die Sinnesregionen des Gehirns offenbar in der Lage waren, Reize von mehr als einem Sinnesorgan zu verarbeiten.
Dazu kann es kommen, da unsere Sinnesrezeptoren unterschiedliche Formen der Energie aus der Umwelt unabhängig von ihrer Herkunft in elektrische Signale umwandeln, die durch die Nervenbahnen weitergeleitet werden. Diese Signale sind die universelle Sprache des Gehirns – unsere Neuronen kennen keine Bilder, Geräusche, Gerüche oder Tastempfindungen. Bach-y-Rita erkannte, dass sich die Regionen, die diese elektrischen Signale verarbeiten, sehr viel weniger voneinander unterschieden als Neurowissenschaftler gemeinhin annahmen.11 Diese Vorstellung bestätigte sich, als der Neurowissenschaftler Vernon Mountcastle herausfand, dass sich die Seh-, Hör- und Tastzentren des Gehirns auf ähnliche Weise in sechs Schichten einteilen lassen. Bach-y-Rita schloss daraus, dass jeder Teil der Großhirnrinde in der Lage sein musste, jedes elektrische Signal zu verarbeiten, und dass die unterschiedlichen Hirnregionen nicht so spezialisiert sein konnten, wie seinerzeit angenommen wurde.
In den folgenden Jahren beschäftigte sich Bach-y-Rita mit sämtlichen Ausnahmen der Lokalisationstheorie.12 Seine Sprachkenntnisse erlaubten ihm, nicht übersetzte, ältere Forschungsliteratur zu sichten und Arbeiten wiederzuentdecken, die aus der Zeit vor der Verabsolutierung der Lokalisationstheorie entstanden waren. Unter anderem entdeckte er die Forschungsarbeiten von Marie-Jean-Pierre Flourens, der in den zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts gezeigt hatte, dass sich das Gehirn sebst umstrukturieren konnte.13 Und er las die oft zitierten, jedoch kaum übersetzten Arbeiten von Paul Broca im französischen Original und stellte fest, dass dieser die Neuroplastizität keineswegs so entschieden ausgeschlossen hatte wie später seine Anhänger.|33|
Der Erfolg seiner Tast-Sicht-Maschine brachte Bach-y-Rita dazu, seine Vorstellung vom menschlichen Gehirn völlig zu überdenken. Schließlich war nicht seine Maschine das Wunder, sondern das Gehirn, das lebte, sich veränderte und sich an neue, künstliche Signale anpasste. Er nahm an, dass im Zuge der Umstrukturierung des Gehirns Tastreize (die ursprünglich im somatosensorischen Kortex, dem Tastzentrum auf der Oberseite des Gehirns, verarbeitet werden) in das Sehzentrum auf der Rückseite des Gehirns weitergeleitet wurden, um dort verarbeitet zu werden. Das wiederum bedeutete, dass sich die Nervenverbindungen zwischen der Haut und dem Sehzentrum entwickeln mussten.
Vor vierzig Jahren, just auf dem Höhepunkt der Lokalisationstheorie, begann Bach-y-Rita, erste Einwände zu erheben. Er erkannte ihre Errungenschaften an, doch er behauptete, »zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Gehirn sowohl motorische als auch sensorische Plastizität aufweist«14. Einer seiner Aufsätze wurde von sechs Zeitschriften abgelehnt, nicht etwa weil seine Beweisführung widerlegt worden wäre, sondern weil er das Wort »Plastizität« im Titel trug. Nach der Veröffentlichung seines Artikels in der Zeitschrift Nature wurde Bach-y-Rita von Ragnar Granit, seinem geschätzten Mentor, der 1965 den Medizinnobelpreis für seine Arbeiten zur Netzhaut erhalten hatte, zum Tee eingeladen. Nachdem Granit seine Frau gebeten hatte, den Raum zu verlassen, lobte er zunächst Bach-y-Ritas Arbeiten zur Augenmuskulatur und fragte ihn dann, warum er seine Zeit mit diesem »Erwachsenenspielzeug« verplempere. Doch Bach-y-Rita blieb hartnäckig und stellte in einer Reihe von Büchern und Hunderten von Zeitschriftenartikeln immer neue Beweise für die Formbarkeit des Gehirns dar und entwickelte eine Theorie, um sie zu erklären.15
Bach-y-Ritas eigentliches Interesse galt immer mehr der Erklärung der Plastizität, doch er erfand weiterhin Geräte, mit denen er einen Sinn durch einen anderen ersetzte. Er arbeitete mit Ingenieuren zusammen, um das Sichtgerät für Blinde kleiner und handlicher zu machen. Der Zahnarztstuhl mit seiner plumpen, schweren Platte mit vibrierenden Stimulatoren schrumpfte auf ein rund 4 Zentimeter großes, rundes Plastikplättchen mit Elektroden, das auf die Zunge gelegt werden kann. Für Bach-y-Rita ist die Zunge die ideale Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine: Da sie nicht von einer Schicht unsensibler Haut bedeckt ist, eröffnet sie einen ausgezeichneten Zugang zum Gehirn. Auch die Com|34|puter sind erheblich kleiner geworden, und die Kamera, die früher so groß war wie ein Koffer, lässt sich heute an ein Brillengestell montieren.
Bach-y-Rita entwickelte noch weitere Apparate. Im Auftrag der NASA entwickelte er beispielsweise einen »fühlenden Handschuh« für Astronauten. Die Weltraumhandschuhe sind so dick, dass die Astronauten unmöglich kleine Gegenstände fühlen oder präzise Bewegungen ausführen konnten. Also brachte Bach-y-Rita auf der Außenseite der Handschuhe elektrische Sensoren an, die Signale an die Handfläche weitergaben. Dieses Gerät entwickelte er weiter zu einem Handschuh für Leprakranke, deren Haut und periphere Nerven durch die Krankheit zerstört wurden und die daher kein Gefühl mehr in den Händen haben. Auch dieser Handschuh hat Sensoren und schickt die Signale weg von den erkrankten Händen zu nicht betroffenen Hautpartien. Die gesunde Haut wurde die Schnittstelle für die Tastempfindungen der Hand. Außerdem arbeitete er an einem Handschuh, der Blinden ermöglichen soll, Computerbildschirme zu lesen, und plant ein Kondom, mit dessen Hilfe querschnittsgelähmte Männer, die kein Gefühl mehr in ihrem Penis haben, einen Orgasmus erleben können. Das Projekt basiert auf der Erkenntnis, dass sexuelle Erregung, wie jede andere sinnliche Erfahrung, im Gehirn stattfindet; das Gefühl der Bewegung beim Geschlechtsverkehr soll von den Sensoren im Kondom aufgenommen und in die Hirnregion weitergeleitet werden, in der sexuelle Erregung verarbeitet wird. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit seiner Arbeit besteht in der Entwicklung von »übersinnlichen Fähigkeiten«, wie etwa Infrarot- oder Nachtsicht. Beispielsweise entwickelte er ein Gerät für Sondereinheiten der Marine, mit dem sich Taucher unter Wasser orientieren können. Ein anderes Gerät, das mit Erfolg in Frankreich getestet wurde, hilft Chirurgen, während der Operation die genaue Position ihres Skalpells zu erkennen, indem es Signale von einem winzigen elektronischen Sensor am Skalpell über ein Plättchen auf der Zunge des Chirurgen in dessen Gehirn überträgt.
Ein Anstoß für Bach-y-Ritas neues Verständnis der Neuroplastizität war die dramatische Genesung seines Vaters, des katalanischen Dichters und Gelehrten Pedro Bach-y-Rita, von einem schweren Schlaganfall. Im Jahr 1959 erlitt der damals 65-jährige Witwer einen Schlaganfall, der sein Gesicht und eine Körperhälfte lähmte und ihm die Sprachfähigkeit nahm.
Paul Bach-y-Ritas Bruder George, der heute als Psychiater in Kalifor|35|