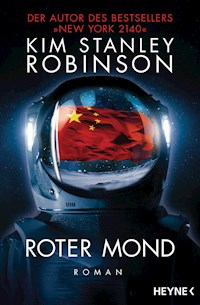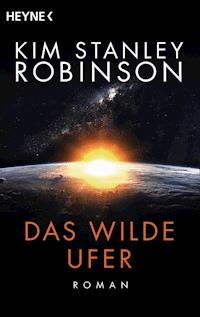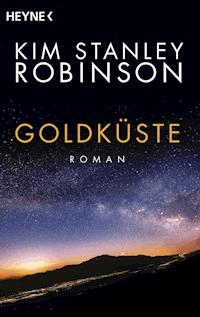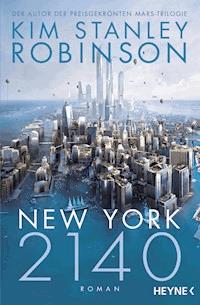
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
New York, einhundert Jahre später. Der Meeresspiegel ist angestiegen, und die Straßen des Big Apple haben sich in Kanäle verwandelt und aus den einstigen Wolkenkratzern sind hoch aufragende Inseln geworden. Aber noch hat New York sich nicht aufgegeben. In einem Haus treffen so unterschiedliche wie ergreifende Schicksale aufeinander – Schicksale, die von der Zukunft nach dem Ökokollaps erzählen. Da ist zum Beispiel ein nimmermüder Detektiv, und da ist das Internet-Sternchen. Auf dem Dach leben die Coder. Ihr Verschwinden setzt schließlich eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Leben aller New Yorker für immer beeinflussen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1094
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die nicht allzu ferne Zukunft: Zwei riesige Flutwellen haben New York im Laufe von hundert Jahren getroffen und die Stadt in eine Art Supervenedig verwandelt, in der man sich mit Booten statt mit Autos fortbewegen muss und die Wolkenkratzer wie Inseln aus dem Ozean ragen. Aber das New York des Jahres 2140 ist keine untergegangene Stadt, ganz im Gegenteil: Die Maschinerie dieser Metropole läuft ungehindert weiter. Auch nach der ökologischen Katastrophe ist Profit alles, was hier zählt – und das gilt nicht nur für New York, sondern für die ganze Welt, die unter den Folgen des Klimawandels leidet. Haben die Menschen nichts gelernt? Das könnte man meinen. Doch dann geschieht etwas, was die Richtung der Zivilisation für immer verändern wird. Und es geschieht in New York, der irrsinnigsten Stadt der Welt …
Mit »New York 2140« legt Bestsellerautor Kim Stanley Robinson einen so meisterhaften wie aktuellen Roman vor – ein Gesellschaftspanorama nicht nur der Zukunft, sondern auch der Gegenwart, und ein faszinierender Kommentar zum wichtigsten Thema unserer Zeit.
Der Autor
Kim Stanley Robinson wurde 1952 in Illinois geboren, studierte Literaturwissenschaft an der University of California in San Diego und promovierte über die Romane von Philip K. Dick. Mitte der Siebzigerjahre veröffentlichte er seine ersten Kurzgeschichten, 1984 seinen ersten Roman. 1992 erschien mit »Roter Mars« der Auftakt zu seiner Mars-Trilogie, die ihn weltberühmt machte und für die er mit dem Hugo, dem Nebula und dem Locus Award ausgezeichnet wurde. Zugleich hat sich Kim Stanley Robinson mit zahlreichen Texten als wichtige Stimme in der amerikanischen Umweltdebatte etabliert. Der Autor lebt mit seiner Familie in Davis, Kalifornien. Im Wilhelm Heyne Verlag sind zuletzt seine Romane »2312«, »Schamane« und »Aurora« erschienen.
Mehr zu Kim Stanley Robinson und seinen Büchern finden Sie auf:
diezukunft.de
KIM STANLEY ROBINSON
NEW YORK
2140
ROMAN
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Jakob Schmidt
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die amerikanische Originalausgabe erscheint unter dem Titel
NEW YORK 2140
bei Orbit, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitatnachweise: John Dos Passos: Manhattan Transfer, übersetzt von Dirk van Gunsteren, Rowohlt, Reinbek 2016; Walt Whitman: Grasblätter, übersetzt von Jürgen Brôcan, Carl Hanser Verlag, München 2009; Ambrose Bierce: Des Teufels Wörterbuch, übersetzt von Gisbert Haefs, Manesse Verlag, Zürich 2013.
Redaktion: Alexander Martin
Copyright © 2017 by Kim Stanley Robinson
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe undder Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagillustration: Stephan Martiniere
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-21658-0V002
www.diezukunft.de
INHALT
ERSTER TEIL
Die Tyrannei der versenkten Kosten
ZWEITER TEIL
Fachmännische Selbstüberschätzung
DRITTER TEIL
Liquiditätsfalle
VIERTER TEIL
Teuer oder unbezahlbar?
FÜNFTER TEIL
Der Einsatz schraubt sich hoch
SECHSTER TEIL
Migrationshilfe
SIEBTER TEIL
Je mehr, desto lustiger
ACHTER TEIL
Die Komödie der Allmende
ERSTER TEIL
DIE TYRANNEI DER VERSENKTEN KOSTEN
a) MUTT UND JEFF
»Wer den Code schreibt, schafft den Wert.«
»Das ist nicht mal ansatzweise wahr.«
»Doch, das ist es. Der Wert wohnt dem Leben inne, und das Leben ist Code, wie bei der DNA.«
»Also haben Bakterien Werte?«
»Klar. Alles Leben will etwas und jagt ihm nach. Viren, Bakterien, bis hin zu uns.«
»Wo wir gerade davon reden, du bist wieder mal mit Kloputzen dran.«
»Ich weiß. Leben bedeutet Tod.«
»Also heute?«
»Irgendwann auch heute. Aber zurück zu dem, worauf ich hinauswill. Wir schreiben Code. Und ohne unseren Code gibt es keine Computer, keine Finanzen, keine Banken, kein Geld, keinen Tauschwert, keinen Wert.«
»Bei allen Punkten – bis auf den letzten – verstehe ich, was du meinst. Und weiter?«
»Hast du heute die Nachrichten gelesen?«
»Natürlich nicht.«
»Solltest du aber. Es gibt schlimme Neuigkeiten. Wir werden aufgefressen.«
»Das kann man immer sagen. Wie du schon sagtest, Leben bedeutet Tod.«
»Aber es ist schlimmer denn je. Es geht zu weit. Inzwischen nagen sie an unseren Knochen.«
»Das weiß ich auch. Deshalb leben wir ja in einem Zelt auf einem Dach.«
»Genau. Und jetzt machen sich die Leute sogar wegen des Essens Gedanken.«
»Das sollten sie auch. Das ist der eigentliche Wert – Essen im Bauch. Weil man Geld nämlich nicht essen kann.«
»Das sage ich doch!«
»Ich dachte, du hättest gesagt, der Code wäre der wahre Wert. Ist wohl auch kein Wunder, dass das gerade ein Programmierer sagt.«
»Mutt, pass auf. Hör mir mal genau zu. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen so tun, als könnte man sich für Geld alles kaufen. Also dreht sich alles ums Geld, also arbeiten wir alle für Geld. Geld wird als Wert betrachtet.«
»Okay, verstehe. Wir sind pleite, das hab ich kapiert.«
»Gut, dann hör weiter zu. Wir leben, indem wir uns für Geld Sachen kaufen, auf einem Markt, der die Preise festlegt.«
»Die unsichtbare Hand.«
»Genau. Verkäufer bieten etwas an, Käufer kaufen es, und durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage wird der Preis festgelegt. Das ist Crowdsourcing, das ist demokratisch, das ist Kapitalismus, das ist der Markt.«
»Ja, so läuft das eben.«
»Genau. Und es ist immer und seit jeher falsch.«
»Was meinst du mit falsch?«
»Die Preise sind immer zu niedrig, und deshalb geht die Welt vor die Hunde. Wir erleben gerade ein Massenaussterben, der Meeresspiegel steigt, das Klima verändert sich, das Essen wird knapp – all das Zeug, das nicht in den Nachrichten kommt.«
»Und alles wegen dem Markt.«
»So ist es! Und das sind keine Fehler im Marktgeschehen. Der Markt selbst ist der Fehler.«
»Wie das?«
»Dinge werden zu einem geringeren Preis verkauft, als ihre Herstellung kostet.«
»Klingt wie der Weg in die sichere Pleite.«
»Ja, und ein Haufen Geschäfte macht auch pleite. Aber diejenigen, die nicht Pleite machen, haben ihren Kram nicht etwa für mehr verkauft, als seine Herstellung kostet. Sie haben nur einen Teil der Kosten ignoriert. Sie stehen unter riesigem Druck, zu einem so geringen Preis wie möglich zu verkaufen, weil jeder Käufer die billigste Version von dem Zeug kauft, um das es gerade geht. Also sorgen sie dafür, dass ein Teil der Produktionskosten nicht bei ihnen zu Buche schlägt.«
»Können sie nicht einfach schlechter für die Arbeit bezahlen?«
»Das haben sie ja schon gemacht! Das war einfach. Deshalb sind alle bis auf die Plutokraten pleite.«
»Ich sehe immer diesen Disney-Hund vor mir, wenn du das sagst.«
»Sie pressen uns aus, bis uns das Blut aus den Augen läuft. Ich halte das nicht mehr aus.«
»Blut aus einem Stein. Sir Plutokrat, der auf einem Knochen rumkaut.«
»Der auf meinem Kopf rumkaut! Aber jetzt sind wir aufgekaut. Wir sind leer gepresst. Wir haben einen Bruchteil der tatsächlichen Herstellungskosten für unseren Kram bezahlt, und der Planet und die Arbeiter, die das Zeug herstellen, bekommen die Kosten ab, und zwar volle Kanne.«
»Aber dafür haben sie auch einen billigen Fernseher gekriegt.«
»Stimmt, damit sie sich was Interessantes ansehen können, während sie pleite herumsitzen.«
»Nur dass nichts Interessantes kommt.«
»Nun, das ist ihr geringstes Problem. Ich meine, genau genommen findet man sogar was Interessantes im Fernsehen.«
»Also, das sehe ich anders. Wir haben alles doch schon eine Million Mal gesehen.«
»Kann sein. Ich sage nur, dass schlechtes Fernsehen nicht unsere größte Sorge ist. Artensterben, Hunger, das kaputte Leben unserer Kinder, das sind alles größere Sorgen. Und es wird immer schlimmer. Das Leid der Menschen nimmt ständig zu. Wenn das so weitergeht, explodiert mir bald der Kopf, das schwöre ich dir.«
»Du regst dich nur auf, weil man uns rausgeschmissen hat und wir jetzt in einem Zelt auf einem Dach leben.«
»Aber das ist nicht alles! Das ist nur ein kleiner Teil von etwas Größerem.«
»Okay, das gebe ich zu. Und was nun?«
»Also pass auf, das Problem ist der Kapitalismus. Wir haben gute Technologie, wir haben einen tollen Planeten – und mit unseren dummen Gesetzen machen wir alles kaputt. Das ist der Kapitalismus, eine Reihe dummer Gesetze.«
»Sagen wir mal, dass ich dir da auch Recht gebe. Was können wir dagegen machen?«
»Es ist ein Regelwerk! Und zwar ein globales! Es umfasst die ganze Erde, man kann ihm nicht entkommen, wir sind alle Teil davon, und man kann machen, was man will, das System dankt nicht ab!«
»Da fehlt mir der Was-können-wir-machen-Teil.«
»Denk doch mal nach! Die Regeln sind Codes! Und sie befinden sich in Computern und in der Cloud. Es gibt sechzehn Gesetze, die den Lauf der ganzen Welt steuern.«
»Das kommt mir zu wenig vor. Zu wenig – oder zu viel.«
»Nein. Natürlich gibt es viele verschiedene Ausformulierungen, aber letztlich haben wir es mit sechzehn grundlegenden Gesetzen zu tun. Ich habe das analysiert.«
»Wie immer. Aber das sind trotzdem zu viele. Ich hab noch nie von den sechzehn sonstwas gehört. Es gibt acht edle Wahrheiten oder die beiden bösen Stiefschwestern. Höchstens gibt’s mal zwölf von was, zum Beispiel bei Genesungsstadien oder bei den Aposteln. Aber normalerweise sind es immer einstellige Zahlen.«
»Jetzt lass das mal. Es sind sechzehn Gesetze, verteilt auf die Welthandelsorganisation und die G20. Finanztransaktionen, Währungswechselkurse, Handelsrecht, Körperschaftsrecht, Steuerrecht. Überall gleich.«
»Ich glaube nach wie vor, dass sechzehn entweder zu viel oder zu wenig sind.«
»Ich sage dir, es sind sechzehn. Und sie sind codiert. Und man kann sie ändern, indem man den Code ändert. Was ich sage, ist: Diese sechzehn Gesetze zu verändern ist so, als würde man einen Schlüssel in einem großen Schloss drehen. Der Schlüssel dreht sich, und mit einem Mal hat man kein schlechtes System mehr, sondern ein gutes. Es hilft den Menschen, es fordert die denkbar saubersten Technologien ein, es stellt Landschaften wieder her, das Artensterben hat ein Ende. Es ist global, Abtrünnige können sich ihm also nicht entziehen. Schlechtes Geld wird zu Staub, und das Gleiche gilt für schlechtes Handeln. Niemand könnte schummeln. Die Leute würden dazu gezwungen, gut zu sein.«
»Jeff, bitte. Du machst mir Angst.«
»Ich sag ja nur. Außerdem, was kann einem denn mehr Angst machen als der jetzige Zustand?«
»Ein Wandel? Ich weiß nicht.«
»Warum sollte Wandel einem Angst machen? Du kannst nicht mal die Nachrichten lesen, stimmt’s? Weil sie einem eine Scheißangst machen!«
»Tja, außerdem habe ich keine Zeit dafür.«
Jeff lacht, bis ihm die Stirn auf den Tisch sinkt. Mutt lacht auch, weil sein Freund das so lustig findet. Aber ihre Heiterkeit ist örtlich sehr begrenzt. Sie sind zusammen, sie heitern einander auf, sie arbeiten hart, schreiben Programme für die Hochfrequenz-Börsencomputer in Uptown. Und nun, nach ein paar Rückschlägen, verbringen sie die Nächte in einem Hotello auf der zur Straße hin offenen Farmetage des alten Met Life Tower. Von hier aus liegt das überflutete Lower Manhattan wie ein Supervenedig zu ihren Füßen, ehrfurchtgebietend, wasserglitzernd, großartig. Ihre Stadt.
Jeff sagt: »Also hör zu. Wir wissen, wie man in die Systeme reinkommt, wir wissen, wie man programmiert, wir sind die besten Programmierer der Welt.«
»Oder zumindest die besten in diesem Gebäude.«
»Nein, jetzt komm schon, die besten der Welt! Und ich habe schon dafür gesorgt, dass wir an der richtigen Stelle Zugriff bekommen.«
»Wie bitte?«
»Hier, schau mal. Während dieser Sache für meinen Cousin habe ich ein paar geheime Zugänge gelegt. Wir sind drin, und ich habe die neuen Codes parat. Sechzehn Revisionen der Finanzgesetze – und einen Arschtritt für meinen Cousin. Soll die Börsenaufsicht ruhig erfahren, was er vorhat, und dann geben wir ihr gleich noch die Mittel an die Hand, um dieser Scheiße nachzugehen. Ich habe mir einen kleinen Zugang gelegt, über den ich das Alpha anzapfen und das Geld direkt aufs Konto der Börsenaufsicht verschieben kann.«
»Jetzt machst du mir wirklich Angst.«
»Schon klar, aber sieh dir die Sache doch wenigstens mal an. Ich will wissen, was du davon hältst.«
Mutt bewegt beim Lesen die Lippen. Er spricht die Worte nicht leise zu sich selbst, sondern stimuliert sein Gehirn wie Nero Wolfe, der Privatdetektiv aus den Büchern von Rex Stout. Das ist seine Lieblings-Neurobic-Übung, und er macht viele. Jetzt beginnt er, sich beim Lesen mit den Fingern die Lippen zu kneten, was ernsthafte Sorge verrät.
»Tja«, sagt er, nachdem er etwa zehn Minuten lang gelesen hat. »Ich verstehe, was du vorhast. Und ich würde sagen, es gefällt mir. Weitgehend. Dieses alte trojanische Pferd der Marke Ken Thompson funktioniert eben einfach immer, was? Wie ein Gesetz der Logik. Also, könnte Spaß machen. Jedenfalls ziemlich amüsant.«
Jeff nickt. Er drückt auf die Return-Taste und entlässt seine Programmzeilen in die Welt.
Dann verlassen sie ihr Hotello, stellen sich an die Brüstung der Farmetage und lassen den Blick Richtung Süden über die geflutete Stadt schweifen, nehmen sie mit Whitman’schem Staunen in sich auf. O Mannahatta! Unter ihnen schlängeln sich die Lichter über das schwarze Wasser. In Downtown erleuchten ein paar Wolkenkratzer die dunkleren Hochhäuser, verleihen ihnen einen geologischen Glanz. Es sieht fremdartig aus, wunderschön, gruselig.
Aus ihrem Hotello ertönt ein Piepsen, und geduckt treten sie durch die Klappe zurück in das große, rechteckige Zelt. Jeff liest etwas auf seinem Computer.
»Scheiße«, sagt er. »Sie haben uns entdeckt.«
Sie betrachten den Bildschirm.
»Allerdings Scheiße«, sagt Mutt. »Wie ist das möglich?«
»Ich weiß es nicht, aber es bedeutet, dass ich recht hatte!«
»Ist das gut?«
»Vielleicht hat es sogar funktioniert.«
»Glaubst du?«
»Nein.« Jeff runzelt die Stirn. »Ich weiß nicht.«
»Sie können das jederzeit umprogrammieren, das ist das Problem. Sobald sie es bemerken.«
»Meinst du, wir sollten abhauen?«
»Wohin?«
»Ich weiß nicht.«
»Wie du schon sagtest«, bemerkt Mutt. »Es ist ein globales System.«
»Ja, aber das hier ist eine große Stadt! Mit vielen Ecken und Winkeln, mit vielen dunklen Löchern, mit ihrer eigenen Untersee-Ökonomie und so weiter. Wir könnten untertauchen und verschwinden.«
»Wirklich?«
»Ich weiß nicht. Wir können es versuchen.«
Dann öffnet sich der große Frachtaufzug zur Farmetage. Mutt und Jeff sehen einander an. Jeff deutet mit dem Daumen Richtung Treppenhaus. Mutt nickt. Sie schlüpfen unter der Zeltwand durch nach draußen.
Um es kurz zu machen …
schlug Henry James vor
b) INSPEKTORIN GEN
Inspektorin Gen Octaviasdottir, die mal wieder Überstunden gemacht hatte, saß zusammengesunken in ihrem Büro und versuchte, genug Energie aufzubringen, um sich zu erheben und nach Hause zu gehen. Ein leises Trommeln von Fingernägeln an der Tür kündigte ihren Mitarbeiter Sergeant Olmstead an. »Sean, hör auf damit, und komm rein.«
Ihre sanftmütige junge Bulldogge brachte eine Frau von etwa fünfzig Jahren herein, die Gen entfernt bekannt vorkam. Eins siebzig, eher kräftig, dichtes schwarzes Haar mit einigen weißen Strähnen. Geschäftsanzug, große Umhängetasche. Weit auseinander stehende, intelligente Augen, mit denen sie in eben diesem Moment Gen genau im Blick behielt. Ausdrucksvoller Mund. Kein Make-up. Eine Person, die es ernst meinte. Attraktiv. Aber sie sah so müde aus, wie Gen sich fühlte. Und sie wirkte verunsichert, vielleicht wegen diesem Treffen.
»Hi, ich bin Charlotte Armstrong«, sagte die Frau. »Ich glaube, wir wohnen im selben Gebäude. Der alte Met Life Tower am Madison Square?«
»Ich dachte gleich, dass Sie mir bekannt vorkommen«, erwiderte Gen. »Was führt Sie zu mir?«
»Es hat mit unserem Gebäude zu tun, deshalb habe ich darum gebeten, dass man mich zu Ihnen bringt. Zwei Bewohner sind verschwunden. Kennen Sie die beiden Typen, die auf der Farmetage gewohnt haben?«
»Nein.«
»Hm, vielleicht wollten die lieber nicht mit Ihnen reden. Obwohl sie eine Wohngenehmigung hatten.«
Der Met Life Tower war eine Genossenschaft, also gemeinsames Eigentum seiner Bewohner. Inspektorin Gen hatte ihre Wohnung vor Kurzem von ihrer Mutter geerbt und sich bisher kaum für organisatorische Fragen rund um das Gebäude interessiert. Oft hatte sie das Gefühl, ohnehin nur zum Schlafen dort zu sein. »Also, was ist passiert?«
»Das weiß niemand. Sie sind einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden.«
»Hat jemand die Überwachungsvideos überprüft?«
»Ja. Deshalb komme ich zu Ihnen. Am letzten Abend, an dem man die beiden noch gesehen hat, haben sich die Kameras für zwei Stunden abgeschaltet.«
»Abgeschaltet?«
»Wir haben die Dateien gecheckt. Bei allen fehlen zwei Stunden.«
»Wie bei einem Stromausfall?«
»Aber es gab keinen Stromausfall. Außerdem haben sie Reserveakkus.«
»Seltsam.«
»Fanden wir auch. Darum bin ich hier. Normalerweise hätte es Vlade, der Supervisor, gemeldet, aber ich musste sowieso her, um einen Klienten zu vertreten, also habe ich den Bericht abgegeben und anschließend um ein Gespräch mit Ihnen gebeten.«
»Gehen Sie jetzt zum Met zurück?«
»Ja, hatte ich vor.«
»Dann lassen Sie uns doch zusammen gehen. Ich wollte gerade los.« Gen wandte sich Olmstead zu. »Sean, kannst du die Unterlagen zu der Sache raussuchen und sehen, was sich über diese beiden Männer in Erfahrung bringen lässt?«
Der Sergeant nickte und sah dabei zu Boden. Offenbar gab er sich alle Mühe, nicht so auszusehen, als hätte man ihm gerade einen Knochen zugeworfen. Sobald sie weg waren, würde er sich darüber hermachen.
Armstrong ging Richtung Aufzüge und wirkte überrascht, als Inspektorin Gen vorschlug, lieber zu Fuß zu gehen.
»Ich wusste gar nicht, dass man von hier zum Met über Hochbrücken kommt.«
»Eine direkte Verbindung gibt es nicht«, erklärte Gen. »Aber man kann die von hier nach Bellevue nehmen, dann die Treppe runter, schräg über die Straße und anschließend auf der Twenty-Third Skyline nach Westen. Dauert etwa vierunddreißig Minuten. Mit dem Vapo brauchen wir zwanzig, wenn wir Glück haben, und dreißig, wenn nicht. Deshalb gehe ich die Strecke ziemlich oft. Ich kann die Bewegung gebrauchen – und wir haben die Gelegenheit, uns zu unterhalten.«
Armstrong nickte, ohne Gen damit wirklich beizupflichten. Sie schob den Gurt ihrer Umhängetasche weiter zum Hals. Gen fiel auf, dass sie die rechte Hüfte entlastete, und versuchte, sich an Einzelheiten aus den regelmäßigen Met-Bulletins zu erinnern. Vergeblich. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass diese Frau die Vorsitzende des Genossenschaftsvorstands war, und zwar mindestens, seit Gen eingezogen war, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Das bedeutete, dass sie schon drei oder vier Amtszeiten hinter sich hatte – in einem Job, für den sich die meisten Leute höchst ungern freiwillig meldeten. Sie bedankte sich bei Armstrong für ihre Arbeit und fragte dann: »Warum machen Sie das schon so lange?«
»Weil ich verrückt bin, wie Sie offenbar andeuten wollen.«
»Das meinte ich nicht.«
»Tja, stimmt aber. Es geht mir einfach besser, wenn ich an etwas arbeite. Dann mache ich mir nicht so viele Sorgen.«
»Sorgen darum, wie es in unserem Gebäude läuft?«
»Ja. Eine ziemlich komplizierte Sache. Da kann alles Mögliche schiefgehen.«
»Sie meinen, dass Wasser eindringen könnte?«
»Nein, das ist größtenteils unter Kontrolle, sonst wären wir am Arsch. Man muss das im Blick behalten, aber dafür sorgen Vlade und seine Leute.«
»Er macht einen guten Eindruck.«
»Vlade macht seine Sache hervorragend. Wobei das Gebäude an sich der einfache Teil ist.«
»Die Leute also.«
»Wie immer, stimmt’s?«
»Bei meiner Arbeit jedenfalls schon.«
»Bei meiner auch. Genau genommen beruhigt mich der Gedanke an das Gebäude an sich. Das kann man immerhin reparieren.«
»Auf welche Art Recht sind Sie denn spezialisiert?«
»Immigration und Gezeitenzonen.«
»Sie arbeiten für die Stadt?«
»Ja. Na ja, früher. Man hat die Einwanderungs- und Asylbehörde letztes Jahr halb privatisiert, und da bin ich mitgegangen. Jetzt heißen wir Householder’s Union. Offiziell sind wir eine öffentlich-private Einrichtung, aber das bedeutet nur, dass sich keine der beiden Seiten um uns kümmert.«
»Machen Sie das seit jeher?«
»Früher habe ich mal für die Amerikanische Bürgerrechtsunion gearbeitet. Aber ja. In erster Linie für die Stadt.«
»Sie verteidigen also Einwanderer?«
»Wir setzen uns für Einwanderer und Wohnungslose ein und eigentlich für alle, die uns um Hilfe bitten.«
»Da sind Sie sicher ziemlich beschäftigt.«
Armstrong zuckte mit den Achseln. Gen führte sie zu dem Fahrstuhl im nordwestlichen Anbau des Bellevue, mit dem man runter zu der Hochbrücke kam, die auf der Nordseite der Twenty-Third von Gebäude zu Gebäude Richtung Westen verlief. Die meisten Hochbrücken verliefen nach wie vor entweder von Süden nach Norden oder von Osten nach Westen, sodass man auf dem Weg durch die Stadt Pferdesprünge machen musste, wie Gen es nannte. Seit Kurzem gab es aber auch einige höhere Brücken, auf denen man sich wie ein Läufer bewegen konnte, was Gen freute, da sie, wenn sie in der Stadt war, mit großer Leidenschaft Finde-den-kürzesten-Weg spielte. »Abkürzen« war die Bezeichnung, die manche für dieses Spiel verwendeten. Gen ihrerseits wollte sich wie eine Dame auf dem Spielfeld durch die Stadt bewegen, immer in gerader Linie ans Ziel. In Manhattan würde das natürlich niemals möglich sein, genauso wenig wie auf einem Schachbrett; beide waren der Logik der Quadrate unterworfen. Trotzdem rief sie sich ihr Ziel vor Augen und begab sich auf der denkbar geradesten Linie dahin, ständig um Verbesserungen bemüht. Mit ihrem Armband konnte sie dabei ihren Erfolg messen. Verglichen mit ihrer sonstigen Arbeit, bei der sie viel schwerer zu fassende und hässlichere Probleme bewältigen musste, war das wunderbar einfach.
Armstrong stapfte neben ihr her, und nach einer Weile bereute Gen ihren Vorschlag. Bei diesem Tempo würden sie wohl eher eine Stunde brauchen. Sie stellte der Rechtsanwältin Fragen über das Gebäude, um sie von ihrem Unwohlsein abzulenken. Derzeit lebten etwa zweitausend Menschen im Met, sagte Armstrong. In etwa siebenhundert Wohneinheiten, von Einpersonen-Kabuffs bis zu großen Gruppenapartments. Man hatte das Gebäude nach der Zweiten Welle, in den nassen Jahren des Ausgleichs, in Wohnraum umgewandelt.
Gen nickte, während Armstrong die Geschichte des Hauses umriss. Dann erzählte sie ihr, dass ihr Vater und ihre Großmutter beide während der Flutjahre Dienst getan hatten. Es war nicht leicht gewesen, damals die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Schließlich erreichten sie die Ostseite des Met. Die Hochbrücke vom Dach des alten Postamts führte auf der fünfzehnten Etage in das Gebäude. Während sie durch die drei hintereinander gestaffelten Türen traten, nickte Gen dem diensthabenden Wachmann Manuel zu, der gerade mit seinem Armband plauderte und leicht erschrocken aufblickte. Gen sah durch die Glastüren zurück. Die Ebbe hatte einen schwärzlich-grünen Badewannenschmutzring auf Kanalhöhe freigelegt. Darüber bestanden die Hauswände aus grünlichem Kalkstein oder Granit oder braunrotem Sandstein. Unterhalb der Hochwasserlinie hing Seetang an den Wänden, oberhalb waren sie mit Schimmel und Flechten bedeckt. Die Fenster direkt über der Wasserlinie waren mit schwarzen Gittern versehen; die höheren hatten keine Gitter, und viele standen offen, um frische Luft reinzulassen. Es war ein milder Septemberabend, weder stickig noch brütend heiß. Ein Moment im skandalösen Wettergeschehen der Stadt, in dem man sich sonnen, den man genießen konnte.
»Diese beiden Spinner haben also auf der Farmetage gewohnt?«, fragte Gen.
»Ja. Kommen Sie doch mit hoch, und sehen Sie es sich an, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Sie fuhren mit dem Fahrstuhl zu dem Gewächshaus hoch, das die gesamte offene Loggia des Met-Wolkenkratzers vom einunddreißigsten bis zum fünfunddreißigsten Stock einnahm. Überall auf dem Boden standen Pflanzenkübel, und im hohen Raum verteilt hingen grünblättrige Hydrokulturen. Die Sommerernte sah inzwischen ziemlich reif aus: Tomaten und Kürbisse, Bohnen, Gurken und Paprika, Mais, Kräuter und vieles mehr. Gen verbrachte nur sehr wenig Zeit im Gewächshaus, aber an und an kochte sie gerne, weshalb sie mindestens eine Stunde im Monat hier einlegte; dadurch hatte sie einen Mitanspruch. Der Koriander wucherte wie verrückt. Pflanzen wuchsen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, genau wie Menschen.
»Die beiden haben hier gewohnt?«
»Ja, drüben in der Südostecke neben dem Werkzeugschuppen.«
»Wie lange?«
»Seit etwa drei Monaten.«
»Sie sind mir nie aufgefallen.«
»Offenbar sind sie unter sich geblieben. Sie haben ihre vorige Unterkunft irgendwie verloren, also hat Vlade ihnen das Hotello aufgebaut, das sie mitgebracht haben.«
»Verstehe.« Hotellos waren Zimmer, die man in einen Koffer packen konnte. Oft stellte man sie im Innern von Gebäuden auf, da sie nicht besonders widerstandsfähig waren. Üblicherweise boten sie Privatsphäre in großen Räumen mit vielen Menschen.
Auf der Suche nach Auffälligkeiten schritt Gen die Farmetage ab. Die Wand der Loggia, die sich in mehreren Bögen zur Straße hin öffnete, verfügte über eine Laibung, die als Geländer diente und ihr – sie war eine großgewachsene Frau – bis zur Brust ging. Beim Blick nach unten sah sie etwa drei Meter tiefer ein Sicherheitsnetz.
Sie gingen an den Innenbögen entlang und kamen schließlich zum Hotello in der Südostecke. Gen kniete sich hin und begutachtete den rauen Betonboden; es war nichts Ungewöhnliches zu entdecken. »Das sollte sich die Spurensicherung genauer ansehen.«
»Ja.«
»Wer hat ihnen die Erlaubnis erteilt, hier zu wohnen?«
»Der Wohnausschuss.«
»Und den beiden geht nicht gerade die Miete aus oder so?«
»Nein.«
»Okay, dann machen wir das volle Vermisstenprogramm.«
Einiges an der Situation war seltsam und erregte Gens Neugier. Warum waren die beiden Männer hergekommen? Warum hatte man sie aufgenommen, obwohl das Gebäude doch schon rappelvoll war?
Wie immer begann die Liste der Verdächtigen im unmittelbaren Umfeld. »Meinen Sie, dass der Supervisor in seinem Büro ist?«
»Normalerweise schon.«
»Dann reden wir mit ihm.«
Sie fuhren mit dem Fahrstuhl wieder nach unten und fanden den Supervisor an seinem Arbeitstisch, der eine ganze Wand seines Büros einnahm. Die Wand daneben war aus Glas und gab den Blick auf das große Bootshaus des Met frei, ehemals das dritte Stockwerk, jetzt geflutet.
Der Supervisor erhob sich und begrüßte sie. Gen war ihm schon hin und wieder begegnet. Vlade Marovich. Er war groß, breitschultrig, hatte lange Arme und Beine und sah aus wie aus Bohlen zusammengenagelt. Fast zwei Meter, schwarzhaarig. Ein Kopf wie ein mit der Axt zurecht gehackter Holzklotz. Slawische Unruhe, Skeptizismus, ein leichter Akzent. Vielleicht mochte er die Gesellschaft von Polizisten nicht. Jedenfalls blickte er nicht besonders glücklich drein.
Gen stellte Fragen und beobachtete ihn, während er die Ereignisse aus seiner Sicht beschrieb. In seiner Position hatte er die Möglichkeit, die Überwachungskameras zu deaktivieren. Und er wirkte misstrauisch. Aber auch erschöpft. Gen war schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass sich niedergeschlagene Menschen normalerweise nicht an kriminellen Verschwörungen beteiligten. Aber man konnte nie wissen.
»Sollen wir uns was zu essen holen?«, fragte sie die beiden. »Ich habe einen Riesenhunger, und ihr wisst ja, wie es im Speisesaal ist. Die Ersten sind die Einzigen.«
Die beiden anderen wussten das nur zu gut.
»Vielleicht essen wir etwas zusammen, und dabei erzählen Sie mir mehr. Und ich mache morgen auf der Wache ein bisschen Druck bei den Ermittlungen.« Gen wandte sich Vlade zu. »Ich brauche eine Liste aller Personen, die für Sie an der Gebäudeinstandhaltung arbeiten. Namen und Akten.«
Er nickte unglücklich.
Die Festlegung des Diskontsatzes ist nun entscheidend für die gesamte Analyse. Ein niedriger Diskontsatz macht die Zukunft wichtiger, ein hoher Diskontsatz misst ihr weniger Bedeutung bei.
– Frank Ackerman: »Can We Afford the Future?«
Die Moral ist offensichtlich. Man kann keinem Programm trauen, das man nicht ganz und gar allein geschrieben hat. Einen Computer falsch zu benutzen ist kein bisschen toller, als betrunken Auto zu fahren.
– Ken Thompson: »Reflections on Trusting Trust«
Ein Vogel in der Hand ist das wert, was er einbringt.
… bemerkte Ambrose Bierce
c) FRANKLIN
Oft ist mein Kopf voller Zahlen. Während ich darauf wartete, dass dieser miesepetrige Supervisor meinen Wasserläufer freigab, der die Nacht wie immer unter der Bootshausdecke verbracht hatte, betrachtete ich die kleinen Wellen, die am großen Tor leckten, und fragte mich, ob sich ihre Schwankungen wohl mit dem Black-Scholes-Modell beschreiben ließen. Die Kanäle waren wie eine Wellentankdemonstration in einem nie endenden Physikkurs: Rückflussinterferenzen, die Krümmung einer Welle um einen rechten Winkel, die Ausbreitung einer Welle, die durch eine Verengung strömt, und so weiter. Und gleichzeitig regten sie zu Gedanken über die Funktionsweise von Liquidität im Finanzwesen an.
So missmutig und träge, wie sich dieser Supervisor gab, hatte ich ziemlich viel Zeit für meine Überlegungen. Parken in New York! Man musste sich eben in Geduld üben. Dann endlich konnte ich in meinen Flitzer einsteigen und fuhr aus dem Bootshaus raus auf das schattige Madison-Square-Bacino. Ein schöner Tag, hell und klar, voller Sonnenlicht, das sich aus Osten durch die Gebäudeschluchten ergoss.
Wie an den meisten Wochentagen ließ ich den Wasserläufer auf der Twenty-Third nach Osten zum East River schnurren. Der Weg durch die südlichen Stadtkanäle wäre zwar kürzer gewesen, aber schon kurz nach Tagesanbruch herrschte auf der Park Avenue Richtung Süden immer ein grauenvoller Verkehr, und am Union-State-Bacino würde es um so schlimmer sein. Außerdem wollte ich ein bisschen fliegen, bevor ich mich an die Arbeit machte. Ich wollte den Sonnenschein auf dem Fluss glitzern sehen.
Auf dem East River war der morgendliche Verkehr ziemlich dicht, aber auf der breiten Südspur gab es noch reichlich Platz, sodass sich der Wasserläufer auf seine sanft gekrümmten Tragflächen erheben und fliegen konnte. Wie immer war der Moment des Abhebens berauschend, als würde man mit einem Wasserflugzeug starten, eine Art nautische Erektion, nach der das Boot auf einem Zauberteppich aus Luft etwa zwei Meter über dem Fluss schwebte und nur die beiden stromlinienförmigen Komposittragflächen unten durchs Wasser schnitten und dabei ständig ihre Form anpassten, um Auftrieb und Stabilität zu maximieren. Ein geniales Boot, das nun auf der Autobahnspur flussabwärts schoss, quer durchs sonnenbeschienene Kielwasser der Lahmärsche, zack-zack-zack, hier hat es jemand eilig, aus dem Weg, ihr kleinen Kähne, ich muss zur Arbeit und mein täglich Brot verdienen.
Wenn mir die Götter wohlgesonnen sind. Möglich, dass ich Verluste einstecke, dass jemand etwas bei mir abzwackt, dass ich vor die Hunde gehe, einen vor die Glocke kriege, hochgehe – so viele Worte dafür! –, aber das alles war in meinem Fall ziemlich unwahrscheinlich, da ich meine Schäfchen immer im Trockenen halte und nicht gerne Risiken eingehe, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Händlern dort draußen. Aber die Risiken gibt es wirklich, die Volatilität volatilisiert; tatsächlich ist es die Volatilität, die man nicht in die partiellen Differenzialgleichungen der Black-Scholes-Familie einbinden kann, selbst wenn man sie umgruppiert, um eben diese Eigenschaft zu berücksichtigen. Das ist es ja, worauf die Leute letztendlich ihre Wetten abschließen. Nicht darauf, ob der Preis eines Produkts hoch oder runter geht – die Händler gewinnen in beiden Fällen –, sondern darauf, wie stark er schwankt.
Viel zu schnell brachte mich meine Spritztour flussabwärts vom Pine Canal ab und zu weit nach draußen. Ich schaltete einen Gang zurück, der Wasserläufer senkte sich und wurde wieder zu einem gewöhnlichen Boot. Manche Tragflächenboote platschen wie eine Gans ins Wasser, aber meines setzte mit kaum einem Spritzer auf der Oberfläche auf. Dann wendete ich und schwappte über die Kielwogen einiger großer Kähne hinweg, um anschließend surrend und glucksend in die Stadt einzufahren, ungefähr mit der Geschwindigkeit jener Brustschwimmer, die sich bei ihrem täglichen Selbstmordgruß an die Sonne ins vergiftete Wasser wagten. Seltsamerweise war das Seebad am Pine Canal sehr beliebt. All die alten Leute in ihren Ganzkörperanzügen und mit ihren Gesichtsmasken hofften offenbar, dass die Vorzüge der sportlichen Betätigung die Mischung aus Schwermetallen aufwogen, die sie dabei unweigerlich in sich aufnahmen. Die Liebe eines Menschen zum Wasser, der bereit war, irgendwo in der Umgebung des New Yorker Hafens schwimmen zu gehen, konnte man nur bewundern, und trotzdem machten die Leute genau das – weil Menschen eben in ihren Ideen schwimmen. Eine großartige Eigenschaft der menschlichen Spezies für alle, die mit ihr Handel treiben.
Das New Yorker Büro des Hedgefonds, für den ich arbeite, WaterPrice, nimmt den gesamten Pine Tower an der Ecke Water Street und Pine Canal ein. Das Gebäude hatte eine vier Stockwerke hohe Wassergarage; und die große, ehrwürdige Eingangshalle war in diesen Tagen mit Wasserfahrzeugen aller Art gefüllt, die wie Modellschiffe in einem Kinderzimmer hingen. Es war eine Freude zu beobachten, wie sich die Gurte unter den Rümpfen meines Trimarans spannten, als er für den Tag hochgezogen wurde. Ein Parkplatz im Bootshaus war eine nette Sache, wenn auch recht teuer. Dann ging es mit dem Fahrstuhl in den dreizehnten Stock hoch und rüber in die Nordwestecke, wo ich mich in meinem Horst niederließ. Von hier aus konnte ich zwischen den Hochbrücken und den Superwolkenkratzern, die in Upper Manhattan ihren Gehry-Glanz verbreiteten, hindurch nach Midtown blicken.
Wie immer begann ich den Tag mit einem Riesenbecher Cappuccino und einem Überblick über die schließenden Märkte in Ostasien und die Mittagsmärkte in Europa. Das globale Schwarmbewusstsein schläft nie, aber es legt auf dem Weg über den Pazifik ein Nickerchen ein, eine halbe Stunde zwischen dem Feierabend in New York und dem Geschäftsbeginn in Schanghai; daher kommt das Wörtchen »Tag« im Handelstag.
Auf meinem Bildschirm waren all die Teile des globalen Gehirns zu sehen, die sich insbesondere mit überschwemmten Küstengebieten befassten, meinem Spezialgebiet. Es war unmöglich, auf einen Blick die unzähligen Graphen, Tabellen, Videofenster, Gesprächsverläufe, Seitenspalten und Randbemerkungen zu erfassen, die auf dem Bildschirm angezeigt wurden, sosehr manche meiner Kollegen das auch vorgaben. Würden sie das alles wirklich auf einmal in sich aufnehmen, würden sie viel zu viel übersehen, und genau genommen übersehen viele von ihnen so einiges, weil sie sich für große Gestalt-Geister halten. Professionelle Selbstüberschätzung, nennt man das. Natürlich kann man einen Blick auf das Gesamtbild erhaschen, aber anschließend muss man wieder langsam machen und die Informationen Stück für Stück verarbeiten. Heutzutage bedeutet das, ständig die Gangart zu wechseln. Mein Bildschirm zeigte eine regelrechte Anthologie von Geschichten, die noch dazu ganz unterschiedlichen Genres angehörten. Ich musste zwischen Haikus und Epen hin und her springen, zwischen Meinungsessays und mathematischen Gleichungen, zwischen Bildungsroman und Götterdämmerung, Statistiken und Tratsch, und alle erzählten mir auf ihre jeweils eigene Art von den Tragödien und Komödien der schöpferischen Zerstörung und zerstörerischen Schöpfung, und auch von der weiter verbreiteten, aber weniger thematisierten schöpferischen Schöpfung und zerstörerischen Zerstörung. Je nach Genre reichte der Zeittakt von den Nanosekunden des Hochgeschwindigkeitshandels bis zu den geologischen Zeitaltern des ansteigenden Meeresspiegels, zerstückelt in Intervalle von Sekunden, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren. Es war großartig, in ein derart kompliziertes Gemenge einzutauchen, während man im Hintergrund durch das Fenster Manhattan sah. Zusammen mit dem Cappuccino und dem Flug über den Fluss kam es mir vor, als würde ich Teil einer brechenden Welle. Das Erhabene der Ökonomie!
Den Ehrenplatz in der Mitte meines Bildschirms nahm die Planet-Labs-Weltkarte ein, die den Meeresspiegel auf Grundlage von Echtzeit-Laser-Altimetrie millimetergenau anzeigte. Dort, wo der Meeresspiegel höher lag als im Durchschnitt des letzten Monats, war er rot eingefärbt, dort, wo er niedriger lag, blau, und grau dort, wo sich nichts verändert hatte. Täglich veränderten sich die Farben und zeigten so an, wie das Wasser im Schwerkraftgriff des Mondes umherschwappte, wie es den vorherrschenden Strömungen folgte, wie es vom Wind gepeitscht wurde, und so weiter. Dieses ständige Ansteigen und Absinken wurde inzwischen geradezu zwanghaft genau gemessen, was angesichts der Traumata des letzten Jahrhunderts und der alles andere als unwahrscheinlichen zukünftigen Traumata nur verständlich war. Nach der Zweiten Welle hatte sich der Meeresspiegel im Großen und Ganzen stabilisiert, doch es gab nach wie vor eine Menge Antarktis-Eis, das kurz vor dem Abbruch stand, weshalb vergangene Verläufe nicht für die Zukunft garantierten.
Und natürlich wetteten die Leute auf den Meeresspiegel. Er diente dabei schlicht und einfach als Index, und man konnte sagen, dass die Leute »in ihn« investierten oder sich »gegen ihn« absicherten, man konnte sagen, dass sie auf ihn »long« oder »short« gingen, aber letztlich schloss man immer eine Wette ab. Ansteigen, stabil bleiben oder fallen. Eine einfache Sache, doch das war nur der Anfang. Der Meeresspiegel war mit all den anderen Gütern und Derivaten verbunden, auf die gewettet wurde, einschließlich der Wohnraumpreise, die fast so unkompliziert waren wie der Meeresspiegel. So spiegelte der Case-Schiller-Index die Entwicklung der Wohnraumpreise wieder, weltweit bis hin zu einzelnen Vierteln und auf allen Ebenen dazwischen, und auch darauf wetteten die Leute.
Einen Wohnraumindex mit dem Meeresspiegel zu verbinden war eine von mehreren möglichen Perspektiven auf die überfluteten Küsten, und das war der Kern meiner Arbeit. Mein Gezeitenzonen-Immobilien-Preisindex war WaterPrice’ stolzer Beitrag zur Chicagoer Börse, und Millionen verwendeten ihn als Orientierungshilfe bei Investitionen, die in die Billionen gingen. Das hatte eine große Werbewirkung für meinen Arbeitgeber und war der Grund dafür, dass meine Aktien hier im Haus ziemlich gut standen.
Aber so schön das alles war, damit es auch wie geschmiert weiterlief, musste der GIPI funktionieren, was hieß, dass er genau genug sein musste, damit Leute, die ihn vernünftig anwendeten, Geld machen konnten. Neben der alltäglichen Jagd nach kleinen Spreads, und während ich die Kauf- und Verkaufsoptionen durchsah und überlegte, ob ich eine davon wahrnehmen wollte, und während ich nebenher die Wechselkurse im Blick behielt, suchte ich also ständig nach Möglichkeiten, die Genauigkeit meines Indexes zu erhöhen. Der Meeresspiegel bei den Philippinen war um zwei Zentimeter gestiegen, ein Riesending, die Leute gerieten in Panik – ohne den Taifun zu bemerken, der sich tausend Kilometer weiter südlich zusammenbraute. Ich nahm mir einen Moment, um ihre Angst zu kaufen, bevor ich den Index anpasste, um die Erklärung dafür zu berücksichtigen. Hochgeschwindigkeits-Geofinanz – das größte aller Spiele!
Irgendwann in der Traumzeit jener nachmittäglichen Börsensession, die realweltistisch lediglich von dem Bedürfnis, kurz zu pinkeln und etwas zu essen, unterbrochen wurde, flackerte die Chatbox in der linken unteren Ecke meines Bildschirms auf, und ich sah eine Nachricht von meinem Börsenfreund Xi in Schanghai.
Hey, Herr der Gezeitenzone! Ganz schöner Flash Bite letzte Nacht, was war da?
Keine Ahnung, tippte ich. Wo kann ich das sehen?
CB
Tja, die Chicagoer Börse ist die größte Terminbörse des Planeten, deshalb war das kein besonders vielsagender Hinweis darauf, wo sich dieser Flash Bite ereignet hatte, doch dann tippte ich ein bisschen rum und stellte fest, dass tatsächlich der gesamte Handel an der Chicagoer Börse einen kurzen, aber kräftigen Schock erlitten hatte. Um Mitternacht herum hatte so ziemlich jeder Abschluss ein bis zwei Prozentpunkte eingebüßt, was genügte, um die meisten davon von der Gewinn- in die Verlustzone zu bringen. Aber eine Sekunde später war es zu einem ebenso plötzlichen Anstieg gekommen. Wie bei einem Mückenstich, den man erst danach am Jucken bemerkt.
WTF?, schrieb ich Xi – What the fuck?
Exaktamundo! Erdbeben? Gravitationswelle? Du Herr der Gezeitenzone erleuchte mich!
WIGKIAN, schrieb ich zurück – Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Das sagen Börsenhändler dauernd zueinander, entweder im Ernst oder um sich rauszureden. In diesem Fall hätte ich es ihm wirklich gerne erklärt, wenn ich gekonnt hätte, aber ich konnte es nicht, und während sich der Tag dem Ende zuneigte, forderten andere dringende Angelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Die Quelle des Lichts, das auf das reale Manhattan draußen vor meinem Fenster fiel, war von rechts nach links gewandert, und Europa hatte inzwischen geschlossen, Asien würde in Kürze öffnen, Anpassungen mussten vorgenommen, Geschäfte abgeschlossen werden. Ich gehörte nicht zu den Händlern, die jeden Abend die Bücher schlossen, aber es war mir lieber zu wissen, zumindest bei den größten offenen Risiken, woran ich war. Also konzentrierte ich mich auf die entsprechenden Posten und versuchte, einen Schlusspunkt zu finden.
Etwa eine Stunde später kam ich wieder zu mir. Zeit, sich nach draußen zu begeben und durch den Feierabendverkehr zu tuckern, solange die Sonne noch aufs Wasser schien, raus auf den Hudson zu fahren und nach Norden zu sausen, um mir all die Zahlen und den Klatsch und Tratsch aus dem Kopf zu pusten. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Heute waren es etwa sechzigtausend gewesen – laut Schätzung der kleinen Programmleiste in der oberen rechten Ecke meines Bildschirms.
Ich hatte eine Option auf mein Boot für 16 Uhr, und es gelang mir mit einem Anruf, sie auf 15 Uhr 55 zu bugsieren. Als ich unten im Bootshaus ankam, lag es bereits abfahrbereit im Wasser, und der Hafenmeister nickte lächelnd, als ich ihm sein Trinkgeld gab. »Mein Franklin Franklin!«, sagte er wie immer. Ich hasse es zu warten.
Raus auf den überfüllten Kanal. Die anderen Boote im Finanzdistrikt waren größtenteils Wassertaxis und Privatboote wie meines, aber es gab auch große alte Vaporettos, die von Pier zu Pier tuckerten und mit Arbeitern vollgestopft waren, die man früh genug herausgelassen hatte, damit sie noch die letzte Stunde Tageslicht mitbekamen. Ich musste also die Augen offenhalten, durch Lücken schlüpfen, auf dem Kielwasser anderer Schiffe surfen, mich schräg durchfädeln, Abkürzungen suchen. Wenn Vaporettos aneinander vorbeifahren, werden sie aus Höflichkeit langsamer, um ihr Kielwasser zur verkleinern; private Boote dagegen beschleunigen. Zur Hauptverkehrszeit kann es da ziemlich nass werden, aber mein Wasserläufer hat eine transparente Blase, die ich über das Cockpit ziehen kann, und wenn es entsprechend wild zugeht, bringe ich sie zum Einsatz. An diesem Nachmittag fuhr ich über den Malden zum Church Canal, dann über den Warren zum Hudson River.
Und dann raus auf den großen Fluss. Ein später Herbstnachmittag, das schwarze Wasser glatt über der ansteigenden Flut, ein Streifen Sonnenlicht, der genau durch die Mitte auf mich zu glitzerte. Auf der anderen Seite die Superwolkenkratzer von Hoboken, wie eine ausgefranste Süderweiterung der Palisades, schwarz unter den rosafarbenen Wolkenbäuchen. Die zahlreichen Hafenbars auf der Manhattan-Seite waren proppenvoll mit Leuten, die von der Arbeit kamen und jetzt zu feiern anfingen. Pier 57 war bei ein paar Leuten, die ich kannte, gerade sehr beliebt, also fuhr ich in die Marina südlich davon ein, die sehr teuer, aber dafür praktisch gelegen war, vertäute den Wasserläufer und stieg die Treppe hoch, um mitzufeiern. Zigarren und Whiskey und im Sonnenuntergang über dem Fluss Frauen anschauen; das alles versuchte ich zu lernen, weil ich in meiner Jugend nur Sonnenuntergänge über der Prärie gekannt hatte.
Ich hatte mich gerade zu meinen Bekannten gesellt, als eine Frau auf den alten Delta-Hedging-Guru Pierre Wrembel zuhielt. Ihr schwarzes Haar schimmerte im horizontal einfallenden Licht wie eine Rabenschwinge. Sie sah den berühmten Investor direkt an und hielt der Macht ihre Schönheit entgegen, was vermutlich üblicher war, als der Macht die Wahrheit entgegenzuhalten, und auf jeden Fall mehr Wirkung zeigte. Sie hatte breite Schultern, muskulöse Arme, hübsche Titten. Sie sah wirklich toll aus. Ich schlenderte an die Bar, um mir so wie sie einen Weißwein zu holen. Bei solchen Gelegenheiten ist es am besten zu schlendern, sich im Kreis durch den Raum zu bewegen, sich zu vergewissern, dass der erste Eindruck zutreffend war. Man kann so viel feststellen, wenn man weiß, wie man richtig hinsieht – das vermute ich zumindest, weil ich nämlich nicht weiß, wie man richtig hinsieht. Aber zumindest versuchte ich es. War sie freundlich gesonnen, unsicher, misstrauisch, entspannt? War sie für jemanden wie mich zu haben? Besser, das vorher in Erfahrung zu bringen. Natürlich war es nie Zeitverschwendung, in einer Bar mit einer schönen Frau zu plaudern, aber ich wollte so viel wie möglich vorher wissen, weil ich, wenn mich eine Frau direkt ansieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen völligen Bewusstseinsausfall erleide. Ich bin sehr viel besser in Termingeschäften als darin, die Absichten von Frauen zu beurteilen, aber dessen bin ich mir bewusst, und ich versuche, das in Rechnung zu stellen.
Außerdem konnte ich, indem ich sie umkreiste, feststellen, ob sie mir wirklich gefiel. Weil mir nämlich auf den ersten Blick jede Frau gefällt. Ich bin durchaus zu der Aussage bereit, dass jede Frau auf ihre eigene Art schön ist, und meistens ziehe ich durch die Bars von New York und denke einfach nur: Wow, wow, wow. Was für eine Stadt der schönen Frauen. Wirklich, das ist sie.
Meiner Meinung nach sieht man den Menschen ihren Charakter am Gesicht an. Es ist unheimlich: Wir sind in dieser Beziehung alle viel zu nackt, nicht nur buchstäblich, insofern wir unsere Gesichter nicht hinter Kleidung verbergen, sondern auch im übertragenen Sinne, weil uns unser wahrer Charakter vorne auf den Kopf geprägt ist wie eine Landkarte. Eine klar erkennbare Landkarte unserer Seele – und ich halte das ehrlich gesagt für unangemessen. Als lebte man in einer Nudistenkolonie. Das muss so ein Evolutionsding sein, mit Sicherheit irgendeine Art von Anpassungsleistung, aber wenn ich in den Spiegel blicke, könnte ich mir durchaus ein netteres Gesicht wünschen – also wohl auch eine nettere Persönlichkeit. Und wenn ich mich umsehe, denke ich mir: O nein! Zu viel Information! Wir wären besser dran, wenn wir alle wie muslimische Frauen Schleier tragen und nur unsere Augen zeigen würden!
Weil die Augen einem nämlich fast gar nichts sagen. Augen sind nur farbige Gallertklumpen, sie verraten längst nicht so viel, wie ich früher immer dachte. Die Vorstellung, dass die Augen die Fenster zur Seele sind und einem etwas Wichtiges mitteilen, war eine reine Projektion gewesen.
Die Augen dieser Frau waren haselnuss- oder dunkelbraun, genau ließ sich das noch nicht erkennen. Ich stand an der Bar, bestellte mir den Weißwein und sah mich um, ließ meinen Blick umherschweifen und dabei immer wieder zu ihr wandern. Als sie in meine Richtung sah, weil sich die Leute in einer Bar immer umsehen, sprach ich gerade mit dem Barkeeper, meinem Kumpel Enkidu, der von sich behauptete, ein reinblütiger Assyrer zu sein, der sich Inki nennen ließ und dessen Unterarme mit alten, schlechten, grünen Tätowierungen bedeckt waren. Popeye? Eine Dose Spinat? Darüber schwieg er sich aus. Jedenfalls sah er, was ich machte, und mixte weiter Drinks, während er meinem wandernden Blick ein Alibi verschaffte, indem er sich gleichzeitig angeregt mit mir unterhielt. Ja, in drei Stunden würde die Flut am höchsten stehen; später würde er sich nach Staten Island treiben lassen können, ohne dafür auch nur den Motor anzuwerfen. Es war die schönste Zeit des Tages, die Dämmerung unter den verschwommenen Sternen, Licht auf dem Wasser, die Ebbe, das Leuchten der gekappten Staten Towers in der Nacht, blabla, so laberten wir und sahen uns dabei entweder um oder arbeiteten oder tranken. Liebe Güte, sah diese Frau gut aus. Hoheitlich, hoch aufgerichtet wie eine Volleyballspielerin kurz vor dem Absprung. Ein geschmeidiger, mühelos ausgeführter Schmetterball direkt in mein Gesicht.
Als sie sich schließlich zu meinen Bekannten gesellte, stahl ich mich heran, um »Hallo allerseits« zu sagen, und meine Freundin Amanda stellte mich denen vor, die ich noch nicht kannte: John und Ray, Evgenia und Paula, und die Königliche hieß Joanna.
»Schön, dich kennenzulernen, Joanna«, sagte ich.
Sie nickte belustigt, und Evie sagte: »Komm schon, Amanda, du weißt doch, dass Jojo es nicht mag, wenn man sie Joanna nennt.«
»Schön, dich kennenzulernen, Jojo«, sagte ich und versetzte Amanda dabei einen gespielten Ellbogenstoß in die Rippen. Gut: Jojo lächelte. Sie hatte ein hübsches Lächeln, und ihre Augen waren hellbraun, mit Iriden, die wie mehrere Brauntöne in einem Kaleidoskop aussahen. Ich erwiderte ihr Lächeln, während ich versuchte, über all diese Schönheit hinwegzukommen. Ich versuchte, locker zu bleiben. Komm schon, sagte ich mir ein wenig verzweifelt, das ist doch genau das, was schöne Frauen bei Männern sehen und verachten, dieser Moment, in dem die Männer in einem Strudel aufgeregter Bewunderung ertrinken. Bleib locker.
Ich gab mir Mühe. Amanda half mir, indem sie mir ebenfalls einen Ellbogenstoß verpasste und sich wegen irgendeiner Option beschwerte, die ich auf dem Hongkonger Anleihenmarkt gekauft hatte. Ich war dabei ihrem Beispiel gefolgt, hatte allerdings zehnmal so viel gekauft. Ob ich sie abziehen wolle, oder war das ein Versehen gewesen? Das war so ein Thema, über das ich den ganzen Tag plaudern konnte, und Amanda und ich kannten uns schon seit Monaten und waren miteinander vertraut. Sie sah auch großartig aus, aber sie war nicht mein Typ. Wir hatten bereits erforscht, was es zwischen uns zu erforschen gab: ein paar Abendessen, eine Nacht im Bett, weiter nichts. Nicht meine Entscheidung, aber ich war auch nicht am Boden zerstört gewesen, als sie behauptet hatte, für die Arbeit ins Ausland zu müssen, und wir getrennte Wege gegangen waren. Natürlich: Ich mag jede Frau, die irgendwann einmal mit mir ins Bett gegangen ist, auf immer und ewig. Solange wir nicht ein Paar geworden sind und nun einander auf immer und ewig hassen. Zuneigung ist schon etwas Seltsames.
»O Mann, sie ist so eine JAP!«, sagte Evie zu John.
»Eine Jap?«, fragte er nichtsahnend.
»Na, komm schon! Eine jüdisch-amerikanische Prinzessin, du Ignorant! Wo bist du denn aufgewachsen?«
»Long Island«, erwiderte John in perfekter, gedehnter Long-Island-Intonation. Das gab einen guten Lacher.
»Wirklich?«, rief Evie ebenso nichtsahnend.
John schüttelte grinsend den Kopf. »Laramie, Wyoming, wenn du es wirklich wissen willst.«
Mehr Gelächter. »Ist das echt eine Stadt? Nicht eher eine Fernsehserie?«
»Es ist eine Stadt! Größer denn je, jetzt, wo die Büffel wieder da sind. In Sachen Büffel sind wir die Meister des Termingeschäftemarkts.«
»Du bist ein Büffel.«
»Genau.«
»Kennst du den Unterschied zwischen einer JAP und einem Eis?«
»Nein?«
»Ein Eis wird warm, wenn man es leckt.«
Mehr Gelächter. Sie waren ziemlich betrunken. Das war vermutlich gut. Jojo war etwas beschwipst, aber nicht betrunken, und ich nicht mal ansatzweise. Ich betrinke mich nie, außer versehentlich, aber wenn ich aufpasse, dann bin ich nie mehr als leicht angeheitert. Ich nippe eine Stunde lang an einem Whiskey und steige dann um auf Ginger Ale und Bitter Lemon. Immer zurechnungsfähig bleiben. Jojo sah aus, als ob sie es genauso halten würde; auf den Weißwein war ein Tonic Water gefolgt. In gewissem Maße war das gut. Aber ein bisschen wild muss eine Frau auch sein. Ich fing ihren Blick ein und deutete mit einer Kinnbewegung zur Bar.
»Soll ich dir was mitbringen?«
Das veranlasste sie zum Grübeln. Sie gefiel mir immer besser.
»Ja, aber ich weiß noch nicht, was«, sagte sie. »Gehen wir mal nachsehen.«
»Mein Kumpel Inki wird uns ein paar Vorschläge machen«, pflichtete ich ihr bei. Lieber Himmel, sie löste mich aus den Klauen des lärmenden Pöbels! Mein Herz machte einen kleinen Satz vor Glück.
Wir standen an der Bar. Sie war ein bisschen größer als ich, obwohl sie keine Schuhe mit Absätzen trug. Mir wurde fast ein wenig schwummerig, als mir das auffiel, und ich stützte die Ellbogen auf die Theke, um aufrecht zu bleiben. Ich mag große Frauen, und ihre Taille war etwa auf Höhe meines Brustbeins. Andere Frauen tragen hohe Absätze, um so auszusehen. Lieber Himmel!
Inki kam zu uns, und wir bestellten auf seine Empfehlung hin etwas Exotisches, das er sich ausgedacht hatte. Was immer. Schmeckte wie bitterer Früchtepunsch. Crème de Cassis war auch mit drin.
»Wie heißt du?«, fragte sie mit einem Seitenblick.
»Franklin Garr.«
»Franklin? Nicht Frank?«
»Franklin.«
»Wie kommst du zu dem Namen?«
»Ben Franklin. Der Held meiner Mutter. Ich bin allerdings nicht ganz so moralisch hochstehend wie er.«
»Wieso, bist du Journalist?«
»Börsenhändler.«
»Ich auch!«
Wir sahen einander an und lächelten ein wenig verschwörerisch. »Bei wem?«
»Eldorado.«
Liebe Güte, einer der Großen.
»Und du?«, fragte sie.
»WaterPrice«, erwiderte ich, froh darüber, dass wir auch nicht ganz ohne waren. Für eine Weile plauderten wir über die Arbeit, tauschten uns über unsere Firmengebäude, Büroräume, Kollegen, Vorgesetzten und Quants aus. Dann runzelte sie die Stirn.
»Hey, hast du das gestern an der Chicagoer Börse gesehen?«
»Klar.«
»Ist dir dieser Ausreißer aufgefallen? Als einen Moment lang alles verrutscht war?« Sie sah meine überraschte Miene und fügte hinzu: »Also ja!«
»Ja«, sagte ich. »Weißt du, was das war?«
»Nein. Ich hatte gehofft, dass du es weißt.«
Ich konnte nur den Kopf schütteln. Die Sache blieb ein Rätsel, auch jetzt, als ich erneut darüber nachdachte. »Vielleicht hat sich da wer zu schaffen gemacht.«
»Aber wie? Ich meine, in China kann so was passieren, hier auch, aber in Chicago?«
»Ich weiß.« Mir blieb nur ein Schulterzucken. »Merkwürdig.«
Sie nickte und nippte an ihrem Drink. »Wenn das länger so gegangen wäre, hätte es ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt.«
»Stimmt.« Etwa so viel wie das Ende der Welt, aber diese Bemerkung verkniff ich mir lieber. Ich wollte nicht zu früh mit den Witzeleien anfangen. »Vielleicht war es aber auch einfach nur ein Flash Bite.«
»Tja, zumindest war es gleich wieder vorbei. Vielleicht hat da nur wer rumprobiert.«
»Vielleicht«, sagte ich und dachte darüber nach.
Nachdem wir so einen Moment lang schweigend überlegt hatten, mussten wir uns über etwas anderes unterhalten. Es war zu laut zum Nachdenken, und über die Arbeit zu reden machte auch nur Spaß, wenn man seinen Gesprächspartner verstehen konnte, ohne dass er brüllen musste. Es war also an der Zeit, auf die einfachen Dinge zurückzukommen, aber andererseits war sie gerade am Austrinken und wechselte in den Ich-will-jetzt-gehen-Modus, zumindest vermittelte mir das ihre Aura. Ich wollte es nicht vermasseln; das würde keine schnelle Nummer werden, und das wollte ich auch nicht, also war etwas Taktgefühl gefragt, und ich kann durchaus sehr taktvoll sein oder es zumindest versuchen.
»Sag mal, hast du vielleicht Lust, an einem Freitag mal Essen zu gehen, um eine gute Woche zu feiern?«
»Klar, wo?«
»Irgendwo auf dem Wasser.«
Das entlockte ihr ein Lächeln. »Gute Idee.«
»Diesen Freitag?«
»Klar.«
Fenster zersplittern die große Hölle der Stadt
In viele kleine Höllchen
– Wladimir Majakowski
Von jetzt an strebt jedes Gebäude danach, eine »Stadt in der Stadt« zu sein.
– Rem Koolhaas
In der Illustration zu Kings »Dream of New York« von 1908 wird die Zukunftsstadt als Ansammlung hoher Gebäude dargestellt, die hoch oben durch Stege verbunden sind. Luftschiffe legen von Ankermasten ab, und Flugzeuge und Ballons schweben am Himmel. Der Blickpunkt liegt südlich und oberhalb der Stadt.
Zu der Zeit, als Dashiell Hammett als Detektiv in New York arbeitete, beauftragte man ihn einmal damit, ein Riesenrad zu finden, das im Vorjahr in Sacramento gestohlen worden war.
d) VLADE
Vlades kleine Wohnung lag hinter seinem Büro beim Bootshaus, am Fuß einer breiten Treppe. Früher, als das Gebäude noch ein Hotel gewesen war, hatte es sich bei diesen Zimmern um Lagerräume gehandelt, und sie befanden sich selbst bei Ebbe unterhalb der Wasserlinie. Vlade störte das nicht. Die Abdichtung der Bereiche unterhalb der Wasserlinie war seine Hauptarbeit, eine Arbeit, die ihn vor interessante Aufgaben stellte und für die ihn die Bewohner des Gebäudes schätzten, auch wenn sie sie, solange es keine Probleme gab, für selbstverständlich nahmen. Aber in Sachen Wasser war nie Feierabend, und es ging immer ums Ganze. Deshalb war er sogar ein wenig stolz darauf, unterhalb der Wasserlinie zu schlafen – als würde er tief im Rumpf eines Ozeanriesen als Schiffszimmermann arbeiten.
Von Tag zu Tag gab es bessere Methoden, um das Wasser auszusperren. Vlade arbeitete derzeit mit einem Team der örtlichen Wassergesellschaft zusammen, die auf der Madison-Square-Seite des Gebäudes eine Senkwand ins Wasser gelassen hatte, um die Außenwand und den alten Bürgersteig neu zu versiegeln. Dabei mussten sie Abstand zu den Aquakultur-Käfigen am Boden des Bacinos halten, wodurch es ziemlich eng wurde, doch die neuesten Materialien aus den Niederlanden ließen sich schräg einziehen und wie eine Ziehharmonika stauchen, sodass sie genug Platz zum Arbeiten hatten. Dann kamen neue Pumpen, Trockner, Sterilisatoren, Abdichtungen – alle besser denn je, obwohl derselbe Arbeitstrupp erst vor vier Jahren durchmarschiert war. Das war nur logisch, wie Ettore, der Supervisor des Flatiron Buildings, feststellte; diese Arbeit war für die Gebäude im überfluteten Bereich von New York wichtiger als alles andere. Trotzdem dachte Vlade immer wieder, dass es doch irgendwann einmal gut sein musste. Ettore und die anderen lachten ihn aus, wenn er diesen Gedanken aussprach. So bist du eben, Vlade. Sie waren eine gute Gruppe. Die Supervisors der Gebäude in Lower Manhattan bildeten eine Art Klub, eng verbunden mit den Genossenschaften und Kooperationen, die die Gezeitenzone zu einer ganz eigenen Art von Gesellschaft machten. Da war vieles, worüber sie sich gemeinsam aufregen konnten, zum Beispiel, dass man sie in Wetbits und Blockhalsbändern bezahlte. Letztere wurden von einigen auch als Halsringe bezeichnet, weil sie letztlich eine Art Leibeigenschaftsverhältnis gegenüber einem Gebäude zum Ausdruck brachten, eine aufgemotzte Version von Kost und Logis gegen Arbeit – unentwegt beschwerten sie sich, aber trotz des Gejammers waren sie rege und halfen Vlade, sich über Wasser zu halten.
An diesem Tag war es beinahe stockdunkel, als er erwachte. Das grüne Licht der Uhr konnte das Zimmer kaum erhellen. Er lauschte eine Weile. Kein Rauschen von Flüssigkeit – mit Ausnahme des Blutes, das ihm träge durch die Adern strömte. Innere Gezeiten. Da drinnen herrschte Ebbe, wie meistens am Morgen.
Er zog sich hoch und schaltete das Licht an. Der Gebäudebildschirm verkündete, dass alles in bester Ordnung war. Trocken bis zum Fundament: sehr zufriedenstellend. Im Nordgebäude sah es genauso aus oder zumindest beinahe – drüben sickerte durch einen noch nicht georteten Riss Flüssigkeit ein. Sehr ärgerlich, aber Vlade würde das Problem schon lösen.
Wie üblich hatte er vier Stunden geschlafen. Mehr Zeit gaben ihm das Gebäude und seine bösen Träume nicht. Auch das gehörte zu seiner persönlichen Ebbe. Da war nichts zu machen – außer aufzustehen und sich in die Arbeit zu werfen. Hoch ins Bootshaus, um Su dabei zu helfen, die Dämmerungsstreife zum Tor hinaus und auf die Kanäle zu verfrachten. Im Bootshaus gab es sechs Hebevorrichtungen, und der Bootshauscomputer verfügte über einen guten Algorithmus zur Ermittlung der Reihenfolge. Menschliches Feingefühl brauchte es eigentlich nur, um die über eine verzögerte Abfahrt verärgerten Bootsbesitzer zu beschwichtigen. Schon wegen einer Minute konnten die Reaktionen sehr unschön ausfallen. Ach ja, tut mir sehr leid, Doktor, ich weiß, Sie haben eine wichtige Konferenz, aber am Bug der James Caird ist eine Leine verrutscht, das ist halt so eine Nussschale. Nicht, dass das Boot des Doktors nicht genau so ein Kahn gewesen wäre, aber darauf kam es nicht an; es brauchte einfach ein wenig besänftigendes Gerede und die Versicherung, dass alles gut werden würde. Wer wirklich ohne Stress zur Tür rauswollte, schaffte das auch. Und dann gab es natürlich auch Leute, die sich einmal am Tag streiten mussten, weil es sie juckte, aber Vlade sorgte dafür, dass sie sich anderswo kratzten.
Su war froh, ihn zu sehen, da Mac einen Anruf für ihr Wassertaxi bekommen hatte und den Auftrag gerne annehmen wollte. Dadurch änderte sich die Reihenfolge, in der sie die Boote zu Wasser ließen, und sie mussten ein bisschen herumsuchen, um eine Alternative zu finden, die Macs Anliegen mit Antonios Wunsch, jeden Tag vor 5 Uhr 15 draußen zu sein, vereinte. Solche Kleinigkeiten machten Su nervös; er war der gewissenhafte Typ.
Dann tauchte Inspektorin Gen auf. Sie war schon ziemlich lange beim NYPD, und wenn sie Uptown arbeitete, galt sie als große Fürsprecherin von Downtown. Normalerweise ging sie zu Fuß über die Hochbrücken bis zur Polizeiwache auf der Twentieth, und noch gestern hatte sie den Anschein erweckt, nicht mal zu wissen, wer er war. Sie hatten zuvor noch nie miteinander geredet, aber beim Abendessen hatte sie ihn wegen der Sicherheitssysteme des Gebäudes ein Loch in den Bauch gefragt. Sie kannte die hiesige Genossenschaft, die die Systeme in Vlades Auftrag eingebaut hatte, und im Großen und Ganzen erfasste sie schnell, wie kompliziert es war, ein Gebäude zu überwachen. Keine Überraschung hier.
Sie begrüßten sich, und Gen sagte: »Ich wollte Ihnen noch einige Fragen über die beiden Verschwundenen stellen.«
Vlade nickte unglücklich. »Ralph Muttchopf und Jeff Rosen.«
»Genau. Haben Sie häufig mit ihnen geredet?«
»Hin und wieder. Sie klangen, als stammten sie aus New York. Und sie haben immer auf ihren Pads rumgehämmert, wenn ich dort oben war. Schwer beschäftigt.«
»Schwer beschäftigt – und trotzdem haben sie in einem Hotello gewohnt?«
»Habe nie erfahren, was es damit auf sich hatte.«
»Also hat Ihnen niemand im Vorstand je etwas über sie erzählt?«
Vlade zuckte mit den Schultern. »Mein Job ist es, das Gebäude in Schuss zu halten. Die Bewohner sind nicht meine Angelegenheit. So habe ich Charlotte jedenfalls bisher verstanden.«
»Okay. Aber lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas von diesen Typen hören.«
»Mach ich.«
Die Inspektorin ging wieder, und Vlade verspürte eine gewisse Erleichterung, als er ihr hinterher sah. Eine hochgewachsene Schwarze, so groß wie er, ziemlich kräftig, mit durchdringendem Blick und reserviert – und er musste ihr erklären, warum seine Sicherheitskameras seltsamerweise ausgefallen waren. Auf jeden Fall musste die Sicherheitsgesellschaft, die das System installiert hatte, vorbeikommen und es überprüfen. Wie bei so vielen Dingen brauchte er technische Unterstützung, wenn er erst einmal bis zu einem gewissen Punkt vorgedrungen war. Als Supervisor musste man eben die Arbeit anderer beaufsichtigen, und er hatte achtundneunzig Leute, die für ihn arbeiteten. Das verstand sie doch sicher. Bei ihr war es bestimmt nicht anders.
Er trat durch das hohe Bootshaustor auf den Steg, der vom Met Life Tower auf das Bacino hinausragte. Das Wasser lag noch im morgendlichen Schatten des Gebäudes, und es überraschte ihn nicht, eine kleine Hand zu sehen, die sich über den Rand des Stegs tastete und sich etwas von dem trockenen Brot schnappte, das er dort hingelegt hatte.
»Hey, ihr Wasserratten! Hört auf, den Enten das Brot zu klauen!«
Zwei Jungen, die er oft auf dem Bacino rumhängen sah, spähten über die Kante. Sie saßen in einem kleinen Zodiac-Schlauchboot, das genau in die Lücke zwischen den Pontons passte, sodass sie sich unter den Planken des Stegs verstecken konnten.
»Was für Ärger habt ihr euch heute wieder eingehandelt, Jungs?« Er war zu dem Schluss gelangt, dass sie auf ihrem Boot lebten. So wie es viele Wasserraten taten, junge wie alte.
»Hi, Mr. Vlade. Wir haben heute keinen Ärger«, sagte der Kleinere zwischen den Planken hindurch.
»Noch nicht«, fügte der andere hinzu.
Ein Komikerduo.