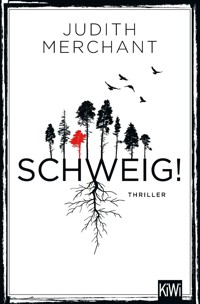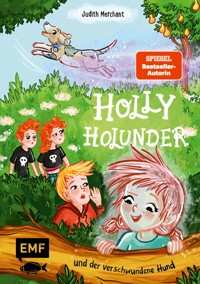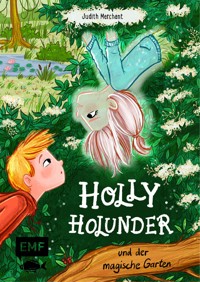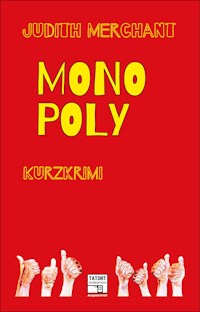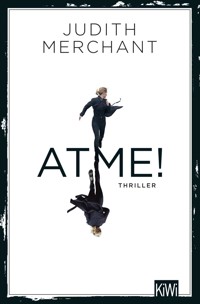6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rheinkrimi-Serie
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreiche Rheinkrimi-Serie von Glauser-Preisträgerin Judith Merchant! In einer der sagenumwobenen Höhlen des Siebengebirges, wo Siegfried einst den Drachen tötete, wird eine Frauenleiche gefunden. Noch am selben Tag wird in Königswinter die Ehefrau des Notars vermisst. Hat die Geliebte des Notars, die exzentrische Künstlerin Romina, ihre Widersacherin kaltblütig aus dem Weg geräumt? Als sich Kriminalhauptkommissar Jan Seidel die Bilder der Künstlerin anschaut, sieht er das Mordmotiv förmlich vor sich: Verzerrte Frauenfratzen kämpfen um einen strahlenden Helden. Aber nicht nur Jan Seidel, sondern auch seine eigenwillige Großmutter Edith erkennt, dass die Lösung des Falles weitaus komplizierter ist ... Kriminalhauptkommissar Jan Seidel ermittelt mit seiner ebenso neugierigen wie scharfsinnigen Großmutter Edith - ein ebenso origineller wie ortskundiger Reihenstart: "Ein Romandebüt mit Star-Qualität!" Berliner Kurier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Judith Merchant
Nibelungenmord
Kriminalroman
Knaur e-books
Jede vermeintliche Ähnlichkeit der Figuren des Buches mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.Die Übersetzungen des Nibelungenliedes stammen von der Autorin.
Für Käthe Happe und Edith Freidank
in dankbarer Erinnerung
Prolog
Als sie wieder zu sich kam, war es dunkel. Nässe kroch ungehindert durch ihr wollenes Kostüm, und kurz dachte sie an die Reinigung und daran, was sie wieder einmal kosten würde. Sie konnte nicht wissen, dass ihr der Ärger darüber erspart bleiben würde.
Der Boden, auf dem sie lag, war hart und sandig, aber draußen befand sie sich nicht, denn das Prasseln des Regens klang gedämpft. Und da war noch etwas. Sie lauschte. Plätscherndes Wasser. Das Gurgeln eines Baches.
Sie versuchte, etwas zu sagen. Ein gutturales Stöhnen hallte durch den kleinen Raum, vielfach zurückgeworfen. Es klang so fremdartig, dass es unmöglich von ihr stammen konnte. Plötzlich zuckte eine Erinnerung durch das Dunkel wie ein Blitz, und sie wusste, wo sie war.
Die Drachenhöhle. Sie war hier gefangen, ein ungerufener, fremder Fötus im steinernen Bauch dieses bösen alten Berges.
Die Höhle maß vielleicht sechs mal vier Meter, man konnte aufrecht darin stehen, und die Wände waren hart und rauh. Das wusste sie, weil sie schon einmal hier gewesen war. Damals war sie staunend ringsum gegangen und hatte einen zweiten Ausgang, eine Spalte, irgendetwas gesucht, aber da war nichts gewesen außer der undurchdringlichen Wand aus Tuffgestein, jahrtausendealt, geformt aus der erstarrten Asche längst erloschener Vulkane.
Jetzt konnte sie nicht mehr ringsum gehen, denn ihre Schädeldecke war zerschmettert, aber das ahnte sie nicht, denn sie spürte keinen Schmerz.
Sie versuchte, sich zu konzentrieren. Da war etwas gewesen, etwas, das sie nicht vergessen durfte. Sie suchte jemanden, nur wen? Hier in der Höhle war niemand. Oder doch?
Sie horchte.
Da war etwas.
Ein dumpfes Grollen, das den Boden vibrieren ließ, noch ehe es auf ihr Trommelfell traf.
Der Drache. Das musste der Drache sein.
Natürlich, dachte die Frau und roch das Blut. Die Pfütze, in der sie lag, war Blut, ihr eigenes, und der Geruch, süß und metallisch, musste dem Drachen in die Nase gestiegen sein. Er war aus seinem tausendjährigen Totenschlaf erwacht und hatte seine Schlafstätte tief unter dem Berg verlassen, um nach ihr zu suchen.
In ihr war keine Angst, als er näher kam. Seine Kälte ging ihm voraus, drang durch die felsigen Wände und ließ die Frau frösteln.
Vermutlich sind Drachen Reptilien, überlegte sie. Wechselwarm. Er bringt die Kälte mit, die tief unter dem Berg herrscht, bald werde auch ich so kalt sein.
Etwas in ihr wehrte sich, ein vages Erinnern ließ sie gegen den Tod aufbegehren. Es gab irgendjemanden, den sie vor diesem Drachen schützen musste, doch wer war es?
Kaum tauchte die Frage im warmen Nebel ihres Bewusstseins auf, erschienen weitere. Wie war sie in diese Höhle gelangt? Wen hatte sie gesucht? Und was hatte sie gefunden?
Drache, bitte tu mir nichts, dachte sie, und ihre Hände schlossen sich wie zu einem Gebet. Konnte sie überhaupt etwas sehen, hier, in dieser dunklen Höhle?
Sie konnte.
Ihr Blick, der vorher nur Hell und Dunkel unterschieden hatte, wurde plötzlich klar.
Etwas näherte sich ihr, groß und gewaltig.
Und erst als ihr Herz einen letzten schweren Schlag tat, erkannte sie, dass es der Drache war.
Er war da.
Und er war wunderschön.
Der erste Tag
Noch weiz ich an im mêre daz mir ist bekant:
einen lintrachen den sluoc des heldes hant.
er bádete sich ín dem bluote; sîn hût wart húrnîn.
des snîdet in kein wâfen. daz ist dicke worden schîn.
Ich weiß noch mehr von Siegfried zu berichten:
Nämlich, dass er mit eigener Hand einen Drachen erschlug.
Er badete in seinem Blute, seine Haut wurde zu Horn,
nun kann keine Waffe ihn mehr verletzen.
Irgendwo hinter der grünlackierten Tür im Inneren des Hauses erklang ein melodischer Klingelton.
Janina Scholz wartete. Sie war es gewohnt zu warten. Bei den meisten alten Leuten dauerte es eine Weile, ehe sie an die Tür kamen. Sie nestelte ihre Perlenkette zurecht – Perlen versprachen Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, und das war genau der Eindruck, den sie hinterlassen wollte – und fuhr sich noch einmal durch den silberblonden Pagenkopf.
»Ja bitte?« Die Stimme klang dünn und zittrig. Eine echte Oma-Stimme.
Janina näherte ihren Mund der Gegensprechanlage und setzte ein gewinnendes Lächeln auf. Sie wusste, dass man ihrer Stimme anhörte, wenn sie lächelte. Sie hatte sich coachen lassen müssen, ehe sie anspruchsvolle Fälle wie diesen übernehmen durfte. »Scholz ist mein Name, vom Gerlinde-Bauer-Haus, wir hatten telefoniert. Kann ich kurz hochkommen?«
Statt einer Antwort das Schnarren des Türöffners. Auch gut, dachte Janina und trat ein. Ein bisschen leichtsinnig, die Dame.
Im Inneren des Treppenhauses war es dunkel. Sie hielt sich am geschnitzten Geländer fest, als sie die polierten Holzstufen hochstieg. Schönes Haus, dachte sie, Jahrhundertwende. Kein Wunder, dass unsere Kundin ihre Mutter hier raushaben will, der Marktwert ist bestimmt ganz anständig, und wenn man vermietet … Hier wohnen doch mindestens drei Parteien drin. Das macht an Kaltmiete …
Vor ihr öffnete sich eine Wohnungstür, und eine alte Dame steckte ihren Kopf heraus. In der Hand hielt sie ein Taschenbuch, den Zeigefinger hatte sie als Lesezeichen zwischen die Seiten geklemmt. »Könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen?«, fragte sie anstelle einer Begrüßung geschäftsmäßig.
Janina setzte ihr süßestes Lächeln auf. So kann man sich täuschen, dachte sie und wühlte in ihrer Handtasche. Doch nicht so arglos, die gute Frau.
Die alte Dame betrachtete den Ausweis argwöhnisch, warf Janina einen forschenden Blick zu und nickte. »Kommen Sie doch herein«, sagte sie und ging mit wackeligen Schritten voran. Das Buch in ihrer Hand schwang dabei hin und her.
In der Wohnung war es warm und stickig. Ein grünes Sofa stand unter dem zweiflügligen Fenster. Auf dem mächtigen Ohrensessel lag eine Wolldecke. Vermutlich hatte Edith Herzberger gerade ein Nickerchen gemacht.
»Möchten Sie Tee? Ich habe mir gerade eine Kanne gekocht.«
»Ja, gerne.« Janina nahm auf dem Sofa Platz und sah sich unauffällig um, während die Alte in hektische Betriebsamkeit ausbrach, Tasse, Untertasse und Löffel holte, die in ihren zittrigen Händen in lautes Geklapper verfielen.
»Schön haben Sie es hier.« Das gehörte zu ihren Standardsätzen. So etwas musste man sagen, wenn man das Vertrauen alter Damen gewinnen wollte. Ebenso wie die Fragen nach Enkeln und Urenkeln, das stundenlange Betrachten von Familienfotos und der Verzehr von staubtrockenem Gebäck, das lange in der Speisekammer darauf gelauert hatte, dass endlich, endlich ein Gast kam und es aß. Und weil die Kinder und Enkel und Urenkel nicht kamen, mussten bezahlte Besucher wie Janina alles aufessen. Brrrr.
Edith Herzberger war jedoch weit davon entfernt, ihrem Gast Gebäck anzubieten. »Darf ich fragen, was Sie zu mir führt? Ich kann mich nämlich gar nicht erinnern, dass wir telefoniert haben«, sagte sie, sobald sie sich in den Sessel hatte sinken lassen. Ihr liebreizendes Alte-Damen-Gesicht nahm der Frage ein wenig an Schärfe.
Janina schickte ein trillerndes Lachen in den Raum. »Man erinnert sich ja nicht an alles. Das geht selbst mir so, muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen.«
Edith Herzberger musterte sie, als schätze sie ihr Alter. »Ich vergesse viel. Deswegen notiere ich mir Telefonate immer ganz besonders sorgfältig. Und mit Ihnen habe ich nicht telefoniert.«
Na, du bist ja eine ganz Schlaue, dachte Janina. Haben wir auch nicht. Das ist nur ein Spruch, der bei den meisten alten Leuten gut ankommt. Und wenn sie denken, sie hätten ein Telefonat vergessen, habe ich schon einen Fuß in der Tür, denn dann muss ich sie nicht mehr davon überzeugen, dass sie bald dement werden.
Sie räusperte sich. »Ich komme vom Gerlinde-Bauer-Haus in Oberkassel. Ich bin Außendienstmitarbeiterin, das bedeutet, ich sehe bei den Seniorinnen in der Gegend von Zeit zu Zeit nach dem Rechten. Wir wollen uns vergewissern, dass es ihnen gutgeht.«
Der Blick der alten Dame wurde wachsam. »Ist das ein Altenheim?«
»Aber nein! Wir bieten alle möglichen Dienstleistungen für Senioren an, von Freizeitaktivitäten über betreute Busreisen bis hin zu Mahlzeiten auf Rädern, wenn Ihnen das etwas sagt.«
Die alte Dame nickte und trank einen winzigen Schluck von ihrem Tee. Sie sah aus, als warte sie auf etwas.
»Ich habe Ihnen hier«, Janina zog mit einer fließenden Bewegung mehrere Hochglanzbilder aus der Handtasche und verteilte sie routiniert wie ein Croupier auf dem Couchtisch, »einige Bilder mitgebracht, damit Sie sich einen Eindruck machen können.«
»Von Ihrem …« Die alte Dame blickte in ihre Tasse und lächelte still, als habe sie etwas verstanden.
»Von unserem Seniorenzentrum, ja.« Janina visualisierte einen Schalter, wie sie es im Coaching gelernt hatte. Ein Regler, der ihre Stimme noch ein wenig werbender klingen ließ. Sie drehte ihn ganz nach oben. Dies war der kritische Moment. Sie nahm den zweiten Packen Bilder in die Hand und gab sich selbst die Stichwörter.
»Sehen Sie, unsere Wellness-Oase.« Knallblaues Wasser, fröhliche Seniorengesichter, Palmen im Hintergrund, die extra für dieses Bild in großen Kübeln ins Schwimmbad gerollt worden waren.
»Unsere Zimmer.« Kirschholzmöbel, Blumensträuße auf dem Tisch. Hoffentlich traf sie damit den Geschmack von Edith Herzberger, es war manchmal schwierig, das richtige Bild auszuwählen. Manche Leute bevorzugten Eichenfurnier, andere dagegen helle, moderne Möbel. Selbstverständlich durften die Bewohner ihre eigenen Sachen mitbringen, aber in dieser sensiblen Phase der Anwerbung ging es darum, den potenziellen Kunden einen spontanen Anreiz zu vermitteln, den optimalen Eindruck, ein »Hier-will-ich-Leben«.
Janina Scholz war gut in ihrem Job. Sie wurde auf die schwierigen Fälle angesetzt. Bei vielversprechenden Kandidaten, die sich hartnäckig weigerten, ihr Zuhause zu verlassen, und deren Angehörige einen Batzen Geld auf den Tisch legten, damit jemand alle Register zog. Na ja, fast alle. Wobei sie vorerst ja noch beim angenehmen Teil war. Natürlich gelang es nicht immer, den Auftrag auszuführen. Aber der Versuch lohnte sich. Zusätzlich zu ihrem Stundenhonorar winkte bei erfolgreicher Vermittlung eine fette Prämie, da sie, anders als sie behauptete, an keine Institution gebunden war. Scherzhaft nannten ihre Freunde sie eine Kopfgeldjägerin der Altenheime. Was soll’s?, dachte Janina. Das ist freie Marktwirtschaft. Unglaublich, worauf sich Angehörige einließen, um ihre alten Verwandten loszuwerden.
Hier würde es jedenfalls schwierig werden. Man sah, dass die alte Dame sich wohl fühlte. Das Wohnzimmer wirkte gemütlich, zahlreiche golden gerahmte Bilder nahmen die Fläche über dem Esstisch ein, dunkle Regale zogen sich bis über die Tür, vollgestopft mit Büchern.
Stimmt, überlegte Janina, Edith Herzberger war Buchhändlerin gewesen, das stand in den Unterlagen. Und offenbar war sie nicht so technikfeindlich wie viele Menschen ihres Alters, denn an einer Wand hing ein moderner Flachbildschirm.
Janina stockte. Ein Flachbildschirm? Ihr Blick wanderte durch den Raum, und plötzlich sah sie einige Details, die ihr längst hätten auffallen müssen. Ein zusammengeklappter Laptop auf dem Esstisch. Eine Lederjacke, die über einem Stuhl hing.
Hier wohnte noch jemand. Ein Mann. Vermutlich kein Mann in Edith Herzbergers Alter, denn die besaßen meist weder Laptop noch Lederjacke.
»Dürfte ich jetzt erfahren, was Sie von mir wissen möchten?«, fragte die alte Dame.
Janina setzte routiniert ihr strahlendstes Gesicht auf und trank, um ihre Verwirrung zu überspielen, von dem Tee. Unauffällig musterte sie ihr Gegenüber. Schneeweiße Haare, porzellanblaue Augen, rosige Wangen. Und ein süßes Lächeln, das sie nun nicht mehr täuschen konnte. Diese Dame hatte es faustdick hinter den Ohren. Ließ ihre Tochter nicht in die Wohnung und hielt stattdessen einen Mann aus. Wie alt mochte er sein? Was lief wohl zwischen den beiden? Und vor allem: War sie verpflichtet, ihre Kundin darüber zu informieren?
Während sie nachdachte, flossen die Worte wie von selbst über ihre sorgfältig geschminkten Lippen. »Natürlich möchten wir vom Gerlinde-Bauer-Haus Sie gerne für uns gewinnen, liebe Frau Herzberger. Und deswegen habe ich Ihnen eine ganz besondere Überraschung mitgebracht.« Sie zog den Umschlag mit der Satinschleife aus ihrer Handtasche. »Unser Geschenk für Sie: ein Gutschein für ein Gratis-Wochenende in unserem Haus! Lassen Sie sich doch einmal so richtig verwöhnen!« Die schon so oft gesprochenen Sätze halfen ihr, die Fassung wiederzufinden. Auch wenn es ihr schwerfiel. Ein Mann! Und diese alte Frau! Das war ja pervers!
Die alte Dame indes verzog keine Miene. »Ich gehe nicht in ein Altenheim«, sagte sie.
»Aber Frau Herzberger! So können Sie unser schönes Haus wirklich nicht bezeichnen.« Es gehörte zu den Kunstfertigkeiten der Gesprächsführung, das Wort »Altenheim« zu vermeiden, und diese Strategie war Janina im Laufe der Jahre so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie automatisch zusammenzuckte, wenn jemand das Wort in den Mund nahm.
Es war, als hätte sie gar nichts gesagt. Die andere ignorierte ihren Einwand einfach.
»Hat meine Tochter Sie geschickt?«
Alarmglocken schrillten in Janinas Kopf. Niemals den Auftraggeber preisgeben!, lautete die oberste Parole. Wir treten auf als freundliche Mitmenschen der Gemeinde, am besten erwecken wir den Eindruck, wir seien von der Kirche.
»Aber, aber!« Sie zeigte ihre weißen Zähne und spürte dabei genau, dass ihr das Lächeln heute besondere Mühe bereitete. Ihrer Chefin würde sie einiges zu erzählen haben. Normalerweise wurden diese sensiblen Gespräche nur mit Kandidaten geführt, bei denen eine gewisse Aussicht auf Erfolg bestand. Also solche, die für Suggestion empfänglich waren. Die Kunden wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht zweckmäßig war, das hohe Honorar für ein Gespräch mit Kandidaten zu bezahlen, die, nun, intellektuell noch in Form waren.
»Sie können meiner Tochter ausrichten, dass ich um nichts in der Welt ausziehe. Da muss sie mich schon selbst raustragen. War das alles, weswegen Sie gekommen sind? Ich soll für ein Wochenende bei Ihnen zur Probe wohnen?«
Es war Zeit, andere Geschütze aufzufahren. Das tat Janina nicht gerne, aber sie machte sich an dieser Stelle immer klar, dass das, was sie vorhatte, im Sinne der alten Leute war. Alte Menschen sollten unter ihresgleichen wohnen. »Liebe Frau Herzberger, ist Ihnen denn bewusst, was Ihnen hier alles Mögliche passieren kann, so ganz allein? Was, wenn Sie stürzen und niemand Sie rufen hört?« Falsches Stichwort, dachte sie im selben Moment. Für jemanden mit jugendlichem Lover dürfte das ein schwaches Argument sein.
»Mir passiert schon nichts«, sagte die alte Dame halsstarrig.
Janina verzog die Lippen zu einem schmalen, überlegenen Grinsen. Dann beugte sie sich vor, bis ihre Nase nur noch Zentimeter vom Gesicht der alten Dame entfernt war.
»Und was«, zischte sie, »wenn eines Tages ein Verbrecher hier hereinspaziert, so wie ich eben? Er muss noch nicht einmal klingeln. Er könnte im Hausflur gewartet haben und dann …«
Sie brach ab, als sie spürte, wie sich etwas Kaltes in ihre Rippen bohrte. Was war das?
»Er soll nur kommen«, sagte die alte Dame mit vor Erregung bebender Stimme und lehnte sich zurück in ihren Ohrensessel. In der Hand hielt sie eine glänzende Pistole. »In meinem Alter ist man für jede Abwechslung dankbar.«
Janina brach der Schweiß aus.
Die Mündung zeigte genau auf sie.
Alle Typen in der Klasse 10 a standen auf Lara, echt alle. Selbst der coole Paul aus der Elf bekam Stielaugen, wenn sie über den Schulhof ging. Sie war eindeutig das hübscheste Mädchen der Klasse, mindestens. Wenn nicht das hübscheste Mädchen der ganzen Schule. Für ihn war sie das schönste Mädchen der Welt.
Es musste, überlegte Sven, während er rechts in Richtung Rhein abbog, irgendwas mit ihrer Haut sein. Die strahlte so. Sie glänzte nicht wie von Make-up oder Puder oder was auch immer sich all die anderen Tussen an Glitzer draufschmierten. In Laras Gesicht leuchtete es. Von innen.
Und ihre Augen, die waren echt der totale Wahnsinn. Ganz blau, hellblau, und so klar, als ob man ins Wasser guckte. Und in der Iris waren dann so ein paar dunkelblaue Punkte, da wurde einem schwindelig, wenn man da reinschaute, in diese Wahnsinnsaugen.
Sven bremste scharf, als zwei Mütter mit Buggys den Radweg überquerten, ohne nach links und rechts zu sehen. Die breite Promenade, die sich von Niederdollendorf bis nach Königswinter zog, schien den Spaziergängern nicht zu genügen, ständig liefen sie unvermittelt auf den Radweg. Irgendwann würde er einfach weiterfahren, ganz egal, wer ihm im Weg stand. Wumm!
Er stieg ab, während die Mütter ihm missbilligende Blicke zuwarfen und ihren Weg wieder aufnahmen.
Lara war noch nicht da. Inzwischen hatte er sie so oft von der Fähre abgeholt, dass ihm die Bank vertraut vorkam. Heute saßen keine Touristen darauf, die ihn in seiner Vorfreude stören konnten. Er schloss sorgfältig sein Rad ab. Einmal hatten sie es ihm schon geklaut. Beim zweiten Mal hatte er es selbst vertickt, fünf Hunderter hatte er dafür bekommen, dabei hatte es locker das Doppelte gekostet. Diesmal hatte die Versicherung nicht gezahlt, aber sein Vater hatte ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, ein neues gekauft. Er würde ihm bestimmt auch noch ein weiteres bezahlen, doch Sven hatte keinen Bock mehr auf den Stress, und deswegen achtete er jetzt auf sein Rad. Die Leute filzten echt wie verrückt. So war halt das Leben. Tat er ja auch.
Sven hatte ein megacooles Rad. Sein Vater hatte beim Neukauf sogar ein bisschen was draufgelegt für einen besseren Rahmen. Einen noch besseren. Freust du dich, hatte er gesagt. Er fragte nicht, sondern sagte das einfach vor sich hin, es klang wie eine Bitte, fast weinerlich. Sven hasste es, wenn sein Vater diese Stimme hatte. Deswegen hatte er auch nicht geantwortet, und sein Vater hatte natürlich wieder nicht nachgehakt, sondern stumpf vor sich hin auf den Boden geglotzt, wie er es immer tat.
Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn er ihm mal geantwortet hätte. Ja klar, Alter, hätte er sagen sollen. Ich freu mich zu Tode. Ich flipp gleich aus. Du kriegst gleich fünf Punkte mehr auf der Wer-ist-der-beste-Vater-Skala, das wolltest du doch. Also lach mal, Alter, und freu DU dich darüber, dass du mir ein neues Rad gekauft hast. Los, freu dich! Freu dich endlich mal! Sonst muss ich dir noch was Dope in den Kaffee tun, damit du mal besser draufkommst.
Aber Sven wusste, er würde nie etwas sagen. Das war wie mit den Hunden. Seine Biolehrerin hatte das mal erzählt. Wenn Hunde echt fertig sind, dann legen sie sich auf den Boden und bieten dem Feind ihre Kehle dar. Das bedeutete dann, hey, guck mal, wie fertig ich bin, du kannst mich ruhig umbringen! Aber der Witz war eben, dass die anderen Hunde das dann nicht taten. Denn wer will schon jemanden umbringen, der nur darauf wartet? Und genau so war das mit seinem Vater. Ganz genau so.
Ganz schön bescheuert von ihm, jetzt an seinen Vater zu denken, während er hier auf Lara wartete. Da es doch nichts Schöneres gab, als auf Lara zu warten. Das klang schon so geil: auf Lara warten. Sie verabredeten sich immer hier, denn Lara wohnte auf der anderen Rheinseite.
Noch vor zwei Monaten hätte er nicht im Traum daran gedacht, dass er mal hier am Rhein sitzen und auf sie warten würde. Ausgerechnet er, der Freak mit den abgebissenen Fingernägeln, der letztes Jahr mit Karacho sitzengeblieben war und nur deswegen auf der Schule hatte bleiben können, weil irgendwelche Scheißlehrer auf der Konferenz einen von schwierigen Familienverhältnissen gefaselt hatten.
Auf ihn war sie zugekommen. Sie hatte sich die blonden Haare aus dem Gesicht gepustet, so wie sie das immer machte, voll süß, und hatte gefragt, ob sie zusammen für Mathe lernen wollten. Einfach so.
Er hatte garantiert einen total roten Kopf bekommen und blöde rumgestottert. Hätten die anderen ihn gesehen, wäre er wochenlang damit aufgezogen worden, aber Lara hatte ihn abgepasst, als er in der großen Pause mutterseelenallein in der Nische zwischen Fahrradständer und Sportplatz hockte. Das war nämlich echt ätzend, auf den Raucherschulhof durfte er nicht, weil er ja erst in der Mittelstufe war, und so musste er hierhin, wo man meist vor den Blicken der Pausenaufsicht sicher war. Manchmal waren auch andere hier, meist aber saß er allein da. Auch an dem Tag, als Lara kam. Er hatte dagesessen wie immer, geraucht und auf den Boden gespuckt. Richtige Rotzinseln hatte er um sich herum verteilt, die reinsten Tretminen, und eigentlich fand er das cool, doch als Lara dann plötzlich vor ihm stand, hatte er tierische Angst bekommen, dass sie das sehen und sich ekeln würde, so wie Mädchen eben alles eklig fanden. Aber sie hatte gar nicht auf den Boden geguckt. Die ganze Zeit hatte sie ihm direkt ins Gesicht gesehen mit diesen Wahnsinnsaugen, und dann hatte sie noch gesagt, »Okay, wir sehen uns also morgen«, und war gegangen, einfach so, und er hatte ihr wie ein Idiot hinterhergestarrt, wie sie wieder zu ihren Freundinnen ging. Ihre Haare hatten gewippt und dieser komische rosa Rucksack mit dem Frosch auch. Echt süß. Selbst den komischen Rucksack fand er süß.
So war das gewesen, vor zwei Monaten. Und jetzt waren sie so was wie Freunde, und er wartete auf sie.
Die Fähre legte an, aber sie war nicht unter den Passagieren. Komisch. Sonst war sie immer pünktlich.
Sein Handy klingelte, doch die Nummer im Display war nicht Laras Nummer. Schon wieder sein Vater. Sven drückte den Anruf weg, wie er es mit allen Anrufen seines Vaters getan hatte. Sechs waren es gewesen seit heute Mittag.
Soll er doch Angst haben, dachte er. Soll er sich selber fragen, was seine Frau macht. Und warum sein Sohn nicht mit ihm sprechen will, heute, wo sie das Haus voller Gäste haben, um wieder so einen scheißverlogenen Trubel zu veranstalten. Eine Geburtstagsfeier mit Kapelle und haufenweise Essen auf silbernen Platten.
Es war besser, nicht an seine Eltern zu denken und daran, warum aus der Party heute wohl nichts werden würde. Er würde ab jetzt gar nicht mehr an seine Eltern denken. Nur noch an Lara.
Sein Herz hüpfte, als er hinter sich eine Fahrradklingel hörte. Sie klingelte immer, wenn sie ankam, wie ein aufgeregtes kleines Mädchen.
Als er sich nach ihr umdrehte, versuchte er, sein glückliches Grinsen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.
»Hallo«, sagte er. »Warst du gerade auf der Fähre? Hab dich gar nicht gesehen.«
»Sorry«, sagte sie und lächelte ihn zur Begrüßung an, dass ihm ganz warm wurde. »Wartest du schon lange? Ich war noch gar nicht zu Hause. Ich habe in der Bahn Paul getroffen und mich ein bisschen verquatscht.«
Paul? Nun erst sah er die Gestalt hinter ihr. Stachelig gegelte Haare, ein blauer Kapuzenpulli.
»Hallo«, sagte Sven nur. Paul! Wie konnte sie ausgerechnet Paul mitbringen?
Paul sah an ihm vorbei und verzog den Mundwinkel zu etwas, das beim besten Willen nicht als Lächeln durchgehen konnte.
Lara bemerkte nichts, oder sie tat zumindest so. »Ich hätte gerne ein Spaghettieis beim Venezia. Habt ihr Lust?«
»Klar«, sagte Sven. Und betete, dass Paul nach Hause fahren oder sich in Luft auflösen würde.
»Klar«, sagte Paul. »Total.« Und er warf Sven einen Seitenblick zu, der fies war. Richtig fies.
Der Regen hatte aufgehört. Vier Stunden lang waren gleichmäßige Schauer auf das Siebengebirge niedergegangen und hatten den Tatort systematisch in ein Matschfeld verwandelt. Irgendjemandem hatte der Regen einen unschätzbaren Gefallen getan. Jemandem, dessen Fußabdrücke jetzt verwischt und dessen Spuren in den Boden gespült worden waren, einen Boden, der locker und krümelig war von verrotteten Buchenblättern.
»Schlimmer hätte es nicht kommen können«, sagte Markus Reimann. Der Name Markus war im Dezernat inflationär verbreitet, so dass ihn jeder beim Nachnamen nannte. Er saß im Polizeibus und qualmte. Er tat es mit Konzentration und Hochgenuss, wohl deswegen, weil er es nirgends sonst mehr durfte. »Die von der KTU sind schon an der Arbeit. Ich rauch hier noch fertig, geh du ruhig schon mal vor, Jan.«
Von der Bundesstraße war der Fußweg, der am Mennesbach entlang ins Nachtigallental führte, kaum zu sehen. Da das Tal unter Naturschutz stand, hatte man den Polizeibus auf der asphaltierten Straße abgestellt.
Typisch, dachte Jan, dessen Mini direkt dahinter parkte. Was sollte dieser Kniefall vor dem Naturschutz? Polizeiliche Ermittlungen hatte immer Vorrang, besonders bei Mord.
Jan Seidel war ein wenig zu spät. Das lag an der verdammten Lederjacke, die er sich am Wochenende gekauft hatte. Ein Kriminalhauptkommissar musste einfach eine Lederjacke tragen, hatte er gedacht. Und als er heute im Präsidium angekommen war und sich in den spiegelnden Scheiben gesehen hatte, war ihm aufgegangen, wie lächerlich das war.
Er war kein Typ für Lederjacken. Seine eher schmale Gestalt, die in gut geschnittenen Jacketts adrett aussah, verschwand in der neuen Jacke. Und so hatte er auf dem Weg zum Tatort einen Umweg gemacht und sich schnell umgezogen.
Albern, klar. Aber wenigstens fühlte er sich jetzt wieder wie er selbst. Und das war wichtig, denn noch nie war ihm bei der Arbeit so unwohl gewesen wie jetzt.
»Auch schon da, Herr Kollege?«, fragte Elena Vogt, und wenn dies ein Vorwurf war, so verbarg sie ihn gut hinter dem scherzhaften Ton. »Komm mit, ich zeige dir den Weg.«
Er schloss sich ihr an, obwohl er lieber allein gegangen wäre oder mit Reimann. Er hasste es, neben Elena zu gehen. Sie war einfach viel zu groß. Sie war größer als jede andere Frau, und ihn überragte sie um eine Haupteslänge. Keine Frau sollte so groß sein, vor allem nicht, wenn sie mit ihm zusammenarbeitete.
»Ach, Jan …«
»Ja?«
»Wie war es denn eigentlich?«
»Wie war was?«
»Die Hochzeit.«
»Gut. Danke, danke.«
Elena grinste wissend. »Meinen Glückwunsch noch mal. Dann grüß mal deine Frau von mir.«
»Klar.« Jan versuchte, den Schritt nicht allzu sehr zu beschleunigen. Es sollte nicht nach der Flucht aussehen, die es war.
Elena war schon die Vierte, die fragte. Und es würden noch mehr kommen. Das hatten Hochzeiten so an sich. Jeder interessierte sich dafür, vor allem natürlich die, die ein Geschenk geschickt hatten. Und dabei gab es auf der ganzen Welt nichts, an das er weniger denken wollte als an diese Hochzeit, die nicht stattgefunden hatte. Aber wie sagte man das den Kollegen, die man erst ein knappes Jahr kannte und die für ein Fondueset aus Edelstahl zusammengelegt hatten? Unmöglich, ohne Fragen zu provozieren. Und auf Fragen hatte er verständlicherweise keine Lust.
Zum Glück gab es die Leiche, über die man sprechen konnte.
»Was haben wir denn?«, fragte er.
»Eine weibliche Leiche«, klärte Elena ihn auf, während sie mit langen Schritten neben ihm über den weichen Waldweg schritt. Eigentlich war es eher eine Schlucht als ein Tal. Steil aufragende Hänge, die immer höher in den Himmel zu wachsen schienen, je tiefer die beiden Polizisten vordrangen. Die Bäume hatten ihr Laub längst abgegeben, es lag auf dem Boden wie ein dicker rotbrauner Teppich, aus dem hin und wieder Efeu oder ein paar einsame Farnwedel herausragten.
»Sie lag in einer der kleinen Höhlen. So wie es aussieht, ist sie an Ort und Stelle mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden, vielleicht mit einem der Steinbrocken.«
»Eine Touristin?«
»Sie sieht nicht wie eine typische Touristin aus.«
»Wie sieht denn eine typische Touristin aus?«
»Holländisch, du weißt schon. Mit Hut, festen Schuhen und Steppweste.« Sie schwiegen beide. In den Sommermonaten und im Frühherbst war Königswinter regelrecht besetzt von Touristen. Nicht nur aus Holland kamen sie, um mit sommerlichen Strohhüten und zahlreichen Plastiktüten in der Hand die Hauptstraße auf und ab zu laufen, in einem der zahlreichen Souvenirshops billige Mitbringsel zu erstehen oder aber den Weg zum Drachenfels einzuschlagen, wo sie sich dann entweder mit der ächzenden Zahnradbahn oder von Eseln hinauf zur Ruine schaffen ließen. Meist waren es Gruppen, bevorzugt Rentner, deren laute, fröhliche Zurufe durch die Straßen schallten und die Anwohner seufzen und das Ende der Saison herbeisehnen ließen.
Jetzt war Spätherbst. Darum war es unwahrscheinlich, dass eine Touristin sich ins Tal verirrt hatte. Das Nachtigallental war vor allem bei Läufern und Hundebesitzern beliebt, und natürlich bei den Kindern, für die die verträumte Schlucht ein Paradies war mit ihren Kletterbäumen und dem mehrfach gestauten Bach. Und den Höhlen.
Er erinnerte sich noch gut an die Höhlen, auch wenn es lange her war. »Wer hat sie gefunden?«
»Jimmi.«
»Jimmi. Und weiter?«
»Nichts weiter. Jimmi ist ein Labrador. Sein Herrchen ist sicher, dass der Hund nicht an der Leiche dran war. Wuttke ist mit ihm ins Präsidium gefahren, weil ihm so kalt war.«
»Wem, Hund oder Herrchen?«
Offenbar hatte Elena das Frage-und-Antwort-Spiel satt, denn sie blieb stehen, bohrte die Fäuste in die Taschen ihres braunen Filzmantels und sah Jan forschend an. »Warum kommst du eigentlich jetzt erst?«
»Ich hatte noch was zu erledigen.«
»Aha. Na, dann kann ich ja froh sein, dass du damit fertig bist.«
»Kannst du.«
»Gut. Eigentlich ist es richtig hübsch hier, oder?«
»Geht so.« Jan legte den Kopf in den Nacken. Im Sommer mochte es idyllisch sein, wenn das Licht durch die Buchenblätter fiel, aber jetzt war es bedrohlich und kalt. Hübsch war auf jeden Fall das falsche Wort. Schön war es vielleicht. Mystisch. Wild.
»Ist das da unsere Höhle?« Auf der anderen Seite des Bachs klaffte ein Loch in der Felswand. Eine knorrige Wurzel verbarg es, die so dick war wie ein Baumstamm.
»Nein, wir müssen noch ein Stück höher, bis zum Ostermann-Denkmal. In dieser hier haben die Kollegen immerhin eine Windel gefunden, die jemand einfach reingeworfen hat. Unfassbar, dass die Leute so ein schönes Tal verschmutzen.« Ihre Bemerkung umfasste auch die Leiche, die jemand hier hatte liegen lassen und die jetzt den Frieden dieses verzauberten Ortes störte.
Schon von weitem signalisierte das rot-weiße, flatternde Absperrband den Tatort. Mit wenigen Schritten kletterte Jan zum Eingang der Höhle. Sie war grell ausgeleuchtet vom Schein der Baulampen, die die Leute von der Spurensicherung aufgestellt hatten. Jan zögerte unwillkürlich, dann trat er näher. Das musste er. Das war sein Job.
Die Frau lag in einer Blutlache, das Gesicht nach unten. Verklebtes Haar hing ihr wirr um den Kopf, das in gewaschenem Zustand vermutlich blond war.
Er war froh, dass er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Wenigstens diese Leiche würde keine Gelegenheit bekommen, unerwünschte Bilder heraufzubeschwören. Er starrte auf den zertrümmerten Hinterkopf und war erleichtert, dass nichts ihn daran hindern würde, heute seine Arbeit zu tun. Ein befreiender Gedanke.
»Sind die Kollegen fertig?«, vergewisserte er sich, ehe er Handschuhe überstreifte, nach dem Arm der Toten griff und den Ärmel hochschob. Die Totenflecken ließen sich wegdrücken, und es gab noch keine Anzeichen von Starre. Die Kälte mochte dazu beigetragen haben, aber selbst wenn man das berücksichtigte, war die Frau erst seit kurzem tot, wahrscheinlich erst wenige Stunden. Genaueres würde der Rechtsmediziner Georg Frenze garantiert auch nicht sagen, er tat sich mit klaren Zeitangaben sehr schwer. Nie wollte er sich festlegen.
Jan taxierte den dunkelroten Hosenanzug, die eleganten schwarzen Stiefel. Die Frau war auffallend gut gekleidet. Für die Arbeit, vielleicht auch für einen Besuch, aber ganz sicher nicht für einen Spaziergang auf Waldboden.
»Wo ist ihre Handtasche?«
»Fehlanzeige. Entweder sie hatte keine dabei, oder der Täter hat sie verschwinden lassen.«
»Handy, Papiere? Wissen wir, wer sie ist?«
»Nichts. Einen Ehering trägt sie, aber da müssen wir auf Frenze warten, der kann ihn abmachen.«
»Sie ist ein bisschen dünn angezogen, findest du nicht? Hatte sie keinen Mantel dabei?«
»Anscheinend nicht.«
Es musste an den Felswänden liegen, die Kälte speicherten wie ein Kühlakku. Hier im Tal war es um einiges kälter als auf den Straßen. Ohne triftigen Anlass würde niemand so dünn bekleidet ins Tal spazieren. Vielleicht war die Frau verabredet gewesen und hatte ihr Auto auf der Asphaltstraße stehen gelassen in dem Glauben, gleich zurück zu sein. Oder sie hatte nur rasch etwas holen wollen und keinen Mantel dabeigehabt. Oder der Täter hatte den Mantel verschwinden lassen, weil er irgendetwas verriet. Wenn er Handy und Papiere mitgenommen hatte, lag ihm offenbar daran, dass die Leiche nicht gleich zu identifizieren war. Vielleicht hatte der Mantel ein Monogramm gehabt.
Elena beobachtete ihn, das Gesicht halb unter ihrem Strickschal verborgen, und er hätte schwören können, dass sie sich fragte, wo seine schicke Lederjacke geblieben war.
»Wo bleibt Frenze denn?« Vielleicht konnte der sich einmal nützlich machen und ihnen wenigstens sagen, ob jemand dem Opfer den Mantel ausgezogen hatte.
»Er steckt im Stau. Mir ist kalt. Gehen wir zurück in den Bus?«
Ihm war auch kalt. Es fühlte sich an, als quöllen Schwaden von Eiseskälte aus der Höhle und breiteten sich im gesamten Tal aus. Der Tag war doch mild gewesen. Oder?
Wortlos überließen sie den Tatort den Kollegen von der Spurensicherung und gingen zurück. Gern hätte Jan das bedrückte Schweigen vertrieben, aber wie immer nach dem Anblick einer Leiche war sein Kopf wie leergefegt. Als habe der tote Körper alle frohen Gedanken, alle flotten Sprüche absorbiert.
Mühsam rang er sich zu ein paar sachlichen Bemerkungen durch.
»Haben wir eine Vermisstenmeldung?«
»Bisher nicht. Die Frau ist ja noch nicht lange tot, kann sein, dass sie noch gar nicht vermisst wird. Ich habe im Präsidium Bescheid gegeben, dass die sofort anrufen, wenn eine Meldung eingeht.«
»Okay.«
»Der Chef will, dass wir ins Präsidium fahren und warten, dass die Mordkommission einberufen wird.«
»Okay.«
»Und, Jan? Willst du dich vorher noch mal umziehen?«
»Ha, ha.«
Er schnitt ihr eine Grimasse und ließ sie vorangehen, während er sein Handy aufklappte. Da war jemand, den er jetzt sprechen wollte, von dem er wissen wollte, dass alles in Ordnung war. Er führte seine Fürsorglichkeit auf den Anblick der Leiche zurück.
Es klingelte dreimal, ehe jemand abnahm. »Ja bitte?«
»Ich bin es. Wie geht es dir, Edith?« Er hatte sich angewöhnt, seine Großmutter beim Vornamen zu nennen. Das fiel ihm nicht leicht. Es klang in seinen Ohren beinahe respektlos, aber es schützte ihn ein wenig vor dem Spott der Zuhörer. Die meisten Menschen fanden es eigenartig genug, wenn ein Kriminalkommissar von dreißig Jahren in einer Wohngemeinschaft mit seiner Großmutter lebte. In einer vorübergehenden Wohngemeinschaft, korrigierte er sich, denn irgendwann würde seine Wohnung ja wohl fertig renoviert sein.
»Jan! Mir geht es gut, so weit.«
Ihre Stimme klang unsicher, als überlege sie, wie viel sie am Telefon erzählen sollte.
»Ist etwas passiert?«
»Eine Frau war da, aber ich bin sie wieder losgeworden.«
»Was denn für eine Frau?«
»Deine Mutter hat sie geschickt. Eine Frau von einem Altenheim. Sie hat mir erzählt, was mir alles zustoßen kann, so ganz allein.«
»Und was hat Henny damit zu tun?«
»Nun ja.« Er hörte sie hüsteln. »Ich erzähle dir das später. Wann kommst du denn nach Hause?«
»Wahrscheinlich spät. Wir haben hier eine tote Frau, die erst noch identifiziert werden muss. Sie hat keine Papiere und so, das kann dauern.«
»Oh.« Ihrer Stimme war die Faszination anzuhören. Sie las zu viele Krimis, und immer wieder musste Jan sie darauf hinweisen, dass es in seiner Arbeit anders ablief als an den Sonntagabenden im Fernsehen.
»Tschüss dann, Edith.«
»Warte, Jan! Du hast deine Dienstwaffe hier vergessen.«
»Ich habe was?«
»Sie vergessen. Tschüss!«
Er klappte das Handy zu und runzelte die Stirn. Nach einem raschen Blick auf Elena griff er unter seine Jacke.
Tatsächlich. Er hatte beim Umziehen seine Dienstwaffe abgelegt und im Wohnzimmer liegen gelassen, griffbereit für seine Großmutter. Das war vermutlich schlimmer, als wenn er sie direkt vor eine Schule gelegt hätte.
Na super, dachte er. Noch ein Umweg.
»Elena? Ich muss noch mal nach Hause. Fahr schon mal vor.«
»War mir klar«, sagte sie. »Mach dich hübsch für den Chef. Und grüß deine liebe Frau von mir, unbekannterweise.«
Das hat sie schon mal gesagt, dachte Jan. Elenas wissendes Grinsen folgte ihm noch, als er in den Wagen stieg.
Die Torte war ein Meisterwerk. Vier Etagen saftiger Mandelsplitterbiskuit, mit Orangenlikör getränkt und umhüllt von einer lockeren Vanillecreme. Zarte Tuffs aus Baiser, leicht gebräunt und mit silbernen Zuckerperlen garniert, verliehen ihr einen Hauch von barocker Eleganz. Gekrönt wurde dieses Wunder der Konditorkunst von einer kandierten Rosenblüte, die von Zuckerkristallen glitzerte.
Cecilia Thomas hielt unwillkürlich den Atem an, als der Lieferant der Konditorei Dix, in der das Kunstwerk bestellt worden war, die Torte vorsichtig auf der Mitte der leinengedeckten Tafel absetzte. Man hätte sie für eine Hochzeitstorte halten können, wären da nicht die Geburtstagskerzen gewesen, die rundum auf den Etagen verteilt waren. Schmale, apricotfarbene Kerzen. Es war unmöglich, ihre exakte Zahl zu erfassen, wenn man nicht unhöflich den Finger zu Hilfe nahm und nachzählte. Und das, dachte Cecilia, war sicher Absicht, denn welche Frau machte bei einer Party schon ihr Alter zum Thema?
Immerhin feierte Margit Sippmeyer heute ihren vierzigsten Geburtstag, und das war für jede Frau hart. Vor allem für die, die reich und schön waren. Cecilia selbst hatte ihren vierzigsten Geburtstag in der Großküche verbracht, in der sie damals noch gearbeitet hatte, und abends war sie so müde, und ihre Füße waren so schwer gewesen, dass sie vor dem Fernseher eingeschlafen war. Auch wenn sie ohne Gesellschaft gewesen war und kaum Zeit zum Nachdenken gehabt hatte, hatte sie wehmütig registriert, dass irgendetwas zu Ende ging.
Nun, Margit Sippmeyer würde heute jedenfalls nicht einsam vor dem Fernseher einschlafen. Die Einladungen für die Party waren seit beinahe zwei Monaten verschickt, und der gigantische Nachmittagskaffee würde nur den Auftakt bilden für eine Party mit Live-Musik, kaltem Büfett und einer Gartenbeleuchtung, die vermutlich den Partyschiffen auf dem Rhein Konkurrenz machte. Ganz buchstäbliche Konkurrenz übrigens, denn vom Pavillon aus hatte man einen wunderbaren Blick auf den Rhein, und umgekehrt könnten die Schiffsreisenden die Tausenden bunten Lämpchen bewundern, die bei Einbruch der Dunkelheit den riesigen Garten in ein Lichtermeer verwandeln würden.
Cecilia sah zum hundertsten Mal an diesem Tag auf die Uhr. Fast zwei. Es war nicht mehr viel Zeit. Gegen drei würden die Gäste erscheinen. Komisch, dass die Hausherrin noch nicht aufgetaucht war. Heute Vormittag hatte sie Termine beim Friseur und bei der Kosmetikerin gehabt, so etwas zog sich natürlich oft hin, aber inzwischen hätte sie doch eintreffen und einen letzten Blick auf die gedeckten Tische werfen sollen.
Nun, eigentlich war nichts mehr zu tun, alles war perfekt vorbereitet. Mehr um sich abzulenken, zählte Cecilia die Sektgläser, die spiegelblank poliert auf den Tabletts auf der Anrichte warteten. Zweiundneunzig waren es, das müsste reichen. Zur Not musste sie zwischendurch spülen. Aber würden die Likörgläschen ausreichen? Likör tranken doch eigentlich nur die älteren Herrschaften. Oder?
Wo waren weitere Likörgläschen? Cecilia erhob sich. Sie war sicher, in einem der Schränke im Gästezimmer kürzlich beim Aufräumen noch einen Karton gesehen zu haben. Leise ächzend stieg sie die Treppe hinauf. Das Gästezimmer lag im zweiten Stock.
Nach kurzem Suchen hatte sie den Karton mit den Gläsern gefunden. Er stand hinter einer umfangreichen Sammlung von Pfeffer-und-Salz-Streuern. Unglaublich, wie viel Geschirr diese Familie besaß! Das machten die vielen Verwandten von Margit. Im vergangenen Jahr waren zwei ihrer Tanten gestorben. Niemand hatte sich die Mühe machen wollen, den Nachlass zu regeln, und so hatte Margit die vollständigen Tafelservice verkauft und die Einzelteile mit nach Hause genommen. Nun, heute profitierten sie davon. Wie sonst sollte man ausreichend Geschirr für nahezu siebzig Gäste bereitstellen? Margit Sippmeyer lieh nicht gern Geschirr, denn das war meistens spülmaschinentauglich und hatte nicht die Qualität, die sie gewohnt war. Und schließlich wollte man gerade dann, wenn Gäste da waren, nicht schlechter speisen als sonst.
Als Cecilia, den Karton unter dem Arm, die Treppe wieder hinunterging, fiel ihr Blick auf die Tür zu Margits Zimmer im ersten Stock. Einen Moment zögerte sie. Was, wenn sie eingeschlafen war? Das war nicht wahrscheinlich, aber ebenso ungewöhnlich war es, dass sich ihre Arbeitgeberin nicht endlich blicken ließ. Was, wenn sie plötzlich krank geworden war?
Cecilia klopfte einmal, zweimal. Drückte langsam die Klinke hinunter und öffnete zögernd die Tür.
Und erstarrte. Das Fenster stand weit offen, kalte Novemberluft strömte herein, und die hellen Vorhänge blähten sich im Wind. Der Stuhl lag umgestürzt auf dem Boden, und das Bett war unberührt. Es sah ganz so aus, als habe Margit heute Nacht gar nicht darin geschlafen.
Mit wenigen Schritten war Cecilia beim Telefon. Beinahe jedes Zimmer des weiträumigen Hauses hatte einen eigenen Apparat. Kaum hatte sie Margit Sippmeyers Handynummer gewählt, klingelte es neben ihr. Tatsächlich, dort stand Margits Handtasche. Cecilia legte auf. Wann war Margit jemals ohne Handtasche aus dem Haus gegangen?
Erst als sie mit lautem Zischen die Luft ausstieß, wurde ihr bewusst, dass sie den Atem angehalten hatte. Vor Schreck. In ängstlicher Vorahnung. Die Ahnung, dass etwas Furchtbares geschehen würde. Oder bereits geschehen war. Und während sie die Handynummer des Hausherren wählte und sich fragte, warum der an einem Tag wie diesem eigentlich auf sich warten ließ, geriet der Karton unter ihrem Arm in Schieflage, entglitt ihren Händen, und die Likörgläser zerschellten, eines nach dem anderen, auf den eleganten Steinfliesen.
»Wer von euch Pappnasen hat eigentlich was von einer Drachenhöhle gesagt?«, fragte Elena und biss krachend in ihr Brötchen.
»Was?«
»Im Bericht steht Drachenhöhle. Ich will wissen, warum.«
Jan war es gewesen, der den Bericht geschrieben hatte. Er schrieb immer die Berichte. Manchmal kam es ihm so vor, als sei es das Einzige, was er richtig gut konnte. Und jetzt wurde auch daran gemäkelt.
»Drachenhöhle ist nicht ganz der richtige Terminus«, sagte er und trat zum Kaffeepadautomaten, um Zeit zu gewinnen.
»Ach nein?«, fragte Elena ironisch und hielt inne, ihr Brötchen vorm Mund. Krümel und irgendwelche vollwertigen Körner rieselten durch die Luft. »Was ist denn der richtige Terminus?«
Jan unterdrückte ein Seufzen. »Streng genommen ist es nicht die Drachenhöhle. Das, was im Touristeninfo als Drachenhöhle verkauft wird, ist was anderes.«
»Schade, dass unsere Leiche nicht da gefunden wurde, dann wäre der Bericht ja zutreffend«, sagte Elena. Heute war sie noch schlimmer als sonst.
»Im Nachtigallental sind viele Höhlen, in denen früher Basalt abgebaut wurde und die teilweise vertieft oder verbreitert wurden, entweder, um sie als Weinkeller zu nutzen, oder weil sie im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzkeller dienten. Die Anwohner nennen diese Höhlen aber trotzdem Drachenhöhlen, um auf die Sage von Siegfried dem Drachentöter anzuspielen.«
»Oha.«
»Den Kindern hier in der Gegend wird die Geschichte von Siegfried, der den bösen Drachen tötet, in seinem Blut badet und in der Drachenhöhle den Schatz findet, so oft erzählt, dass sie wahrscheinlich bei jeder Höhle automatisch an Drachen denken. Vor allem, weil Königswinter praktisch mit Drachen gepflastert ist.«
»Ich dachte, du kommst aus Frankfurt«, sagte Elena und musterte ihn neugierig mit ihren hellen Augen. Sie selbst wohnte in Köln und mied das Rentnerparadies Königswinter, wie sie es nannte, so gut sie konnte.
»Stimmt«, sagte Jan einsilbig. Er war in den ersten fünfundzwanzig Lebensjahren so oft umgezogen, dass er selbst nicht hätte sagen können, woher er kam.
»Dafür kennst du dich aber gut aus. Wie ein echter Einheimischer.«
»Ich wohne erst seit ein paar Wochen hier. Das war reine Recherche«, sagte Jan und spürte, wie kühl seine Stimme klang. Er sagte nicht, wie genau er sich an die Besuche bei seiner Großmutter erinnerte, an krümeligen Sandkuchen, den sie ihm zuliebe mit einer dicken Schicht Schokoladenglasur und bunten Streuseln verziert hatte, an die Nächte, die er neben ihr auf der Bettseite seines längst verstorbenen Großvaters gelegen hatte, an das viel zu dicke Kopfkissen, das seinen Kopf unbequem in die Höhe zwang, und an die Spaziergänge, die sie unternommen hatten, obwohl er lieber vor dem Fernseher geblieben wäre und das Ferienprogramm geguckt hätte. An regenfeuchte Waldwege, den stechenden Geruch im dämmrigen Reptilienzoo und dessen schwüle Wärme. Und an die Höhlen.
»Ob wir wohl heute den Drachen finden?«, hatte sie ihm ins Ohr geflüstert, und der lange schneeweiße Zopf, den sie damals noch trug, hatte ihm dabei im Nacken gekitzelt. Und schlotternd vor Angst, war er in den dunklen Eingang der Höhle getreten, einen Stock in der Hand, und hatte »Buh!« gerufen, bereit, jedem Drachen eins überzuziehen, der es wagen sollte, ihn und seine Großmutter anzugreifen.
Zum Glück war der Drache nicht erschienen, nie. Seine Großmutter musste den Stein plumpsen gehört haben, der ihm vor Erleichterung darüber, dass der Drache wieder einmal ausgeflogen war, vom Herzen gefallen war. Und während sie ihm etwas über die Farne und Pilze erzählte, waren seine Gedanken zu dem zu Hause wartenden Sandkuchen mit Schokolade und Streuseln gewandert und dem milchigen Kakao, den sie ihm dazu kochen würde.
Sie hatte ihn immer aufgenommen, wenn seine Mutter wieder einmal in die Welt gezogen war. Kein Wunder, dass er auch jetzt bei ihr untergekrochen war. Sie half ihm auch heute noch, wo sie über achtzig war und um beinahe die Hälfte geschrumpft, wie es ihm schien.
»Die von der KTU haben noch nichts für uns.« Reimann trat zu ihnen und hob die leeren Hände wie zum Beweis.
»Und Frenze?«
»Frühestens morgen Mittag, sagt er. Ansonsten nur das, was wir schon wussten: Die Frau wurde wahrscheinlich erschlagen und war noch nicht lange tot. Fundort gleich Tatort, beziehungsweise wurde sie am Eingang der Höhle niedergeschlagen und hat sich dann wohl hineingeschleppt. Über ihre Identität haben wir noch nichts.«
»Wir werden natürlich sämtliche Wirte vom Drachenfels befragen, ebenso die Mädchen, die an dem Tag die Touren mit den Eseln unternommen haben. Und dann habe ich einen Trupp geordert, der die Umgebung absucht. Vielleicht liegen Handy und Handtasche ja doch irgendwo herum«, sagte Elena.
Jan dachte an den Ehering der Toten, aber er schwieg. Warum, hätte er nicht sagen können.
Der Rauch einer brennenden Zigarette stieg ihm in die Nase, und im gleichen Moment kreischte Elena los.
»Geht’s noch, Reimann? Mach das Ding aus, sofort!«
»Ich hab doch das Fenster aufgemacht.«
»Aus damit!«
»Reg dich ab. Früher war das doch auch kein Problem.«
»Früher hatten wir auch noch kein Rauchverbot im Präsidium.«
»Man darf echt nirgendwo mehr rauchen!«
»Dann bleib halt zu Hause.«
»Da darf ich auch nicht mehr.«
Etwas geschah. Elena hielt in der Bewegung inne, warf Reimann einen ungläubigen Blick zu, der senkte seinen. Sekundenlang hing etwas zwischen ihnen in der Luft, greifbarer als die dünne graue Rauchschlange, die sich bereits verzog, dann fauchte Elena »Verstehe!« und tauchte unter ihren Schreibtisch.
Reimann hob die Achseln, betrachtete seine ausgedrückte Zigarette und warf Jan einen Blick zu. Frauen!, besagte dieser Blick.
Ja, Frauen, dachte Jan.
Er konnte gerade noch verhindern, dass ihm ein Seufzer entschlüpfte.
Körpersprache verriet manchmal viel. Viel zu viel, dachte Sven, als er Pauls lässig aufgestützte Ellbogen mit seinen eigenen schlaksigen Armen verglich, die immer wieder wie von selbst den Weg unter den Tisch fanden und dort unruhig herumzuckten.
Hier im Eiscafé war es wie auf dem Schulhof. Man konnte auf einen Blick erkennen, wer auf der Gewinner- und wer auf der Verliererseite stand. Und er gehörte leider zu Letzterer.
Paul war das Selbstbewusstsein in Person. Er hatte eine richtig coole Frisur, bunt gestreifte Stacheln, die vom Kopf abstanden. Er trug lässige Markenjeans, offene Sneakers und einen Kapuzenpulli. Sven hingegen hatte wie ein gehorsames Kind auf das Wetter geachtet und seine Jacke angezogen. Natürlich war es eine gute Jacke, sie war richtig teuer gewesen, aus so einem Laden für Trekkingmode. Sven hatte an den Nähten rumgefummelt, damit sie ein bisschen abgerissen aussah, aber cool? Nee, neben Paul sah sie nicht cool aus. Schwarz gekleidet, unfrisiert und schmuddelig, das war Svens Stil. Und Ohrlöcher, haufenweise. Nichts, was Mädchen gut fanden, das wurde ihm in diesem Moment bewusst.
Bisher war es ihm egal gewesen, ob er cool war oder nicht. Hauptsache, er hatte seine Ruhe. Doch bisher hatte er auch nie neben Paul an einem Tisch gesessen und Lara dabei zugeschaut, wie sie begeistert einen Eisbecher aufaß. Wenigstens hatte er genug Geld dabei, um sie einzuladen.
Er könnte gleich morgen losrennen und sich neue, richtig coole Klamotten zulegen. Und einen anständigen Haarschnitt verpassen lassen. Oder war es peinlich, wenn man sich von einem Tag auf den anderen neu einkleidete? Zu offensichtlich? Als wäre man Gast in so einer dämlichen Styling-Sendung gewesen?
Cool wurde man nicht von einem Tag auf den anderen. Es war echt zu blöd. Er hatte sein ganzes Geld in Musik, Computerspiele und DVDs investiert und das Klamottenkaufen seiner Mutter überlassen, unter der Bedingung, dass es schwarze Sachen waren. Das Einzige, was er selbst bestellt hatte, waren seine Metal-Shirts.
»Wollt ihr echt nichts abhaben?«, fragte Lara und betrachtete versonnen die zusammengeschmolzenen Reste ihres Eisbechers.
»Nee«, sagte Sven.
»Nee danke«, sagte Paul. Die beiden tauschten einen stummen Blick.
Fall tot um, dachte Sven. Fall tot um oder löse dich von mir aus in Luft auf, aber verschwinde. Hör auf, Lara deine tollen Geschichten zu erzählen von irgendwelchen Discos und Partys und dem ganzen Kram, mit dem man Mädchen beeindruckt, die noch nicht sechzehn sind. Lara interessiert sich nicht für so was.
Das war nämlich das Besondere an Lara. Sie war nicht so oberflächlich wie die Mädchen, die immer nur an ihr Aussehen dachten und an Serien und Germany’s Next Topmodel. Sie hatte echt was im Kopf. Sie machte sich Gedanken.
Ihr hatte er sogar von der blöden Sache mit seinen Eltern erzählen können, ohne dass es peinlich wurde. Sie hatte einfach zugehört, und manchmal hatte sie eine Frage gestellt. Und er hatte genau gewusst, dass sie ihn verstand. Sie hatte sich die Haare aus der Stirn gepustet und …
Lautes Gelächter unterbrach seine Gedanken, und er musste sich zusammenreißen, um sich zurechtzufinden. So lief das oft. Das war das Blöde am Kiffen. Man blieb ständig auf seinen eigenen Gedanken sitzen.
»Ich glaub’s nicht«, kicherte Lara.
»Doch, ich schwöre! Pass auf …« Paul beugte sich vor und hob einen Zeigefinger. Er würde gleich die nächste superwitzige Geschichte aus dem Ärmel ziehen, und dann noch eine, und dann … Sven merkte, dass seine Hände zitterten.
»Wann lernen wir denn wieder Mathe, Lara?«, fragte er, und als ihm die beiden ihre Gesichter zuwandten, hatte er das unangenehme Gefühl, sie zu stören.
Allmählich machte sich die vergangene Nacht bemerkbar. Ihm ging es nicht gut. Gar nicht. Er hatte kaum geschlafen und zu viel gekifft, und ein bisschen Pep hatte er auch gezogen. Dann war da noch der ganze Mist, an den er im Moment nicht denken wollte, und sein Vater, der ständig anrief …
»Bis nach Weihnachten haben wir ja jetzt Ruhe, schätze ich«, sagte Lara. »Heute war nämlich die wichtige Arbeit«, setzte sie mit einem erklärenden Blick zu Paul hinterher.
»Aber wir können ja trotzdem lernen«, sagte Sven. Seine Stimme kam ihm ganz leise vor. Hörte man ihn überhaupt?
»Was ist los mit dir?«, fragte Lara. Sie musterte ihn aufmerksam, und er wünschte, er könnte die Augen schließen in der Gewissheit, dass sie da sitzen bleiben würde, ihm gegenüber.
»Du siehst echt beschissen aus«, sagte Paul. »Geh doch nach Hause und leg dich ins Bett.«
»Geht schon.«
»Soll ich dich nach Hause bringen?« Lara klang besorgt.
»Geht schon«, wiederholte er. Er setzte sich aufrecht hin und legte seine Hände nebeneinander auf den Tisch. Sie zuckten.
Paul sah ihn an, und in seinem Blick war so viel Verachtung, dass sie sogar den Nebel in Svens Kopf durchdrang. »Hör doch endlich auf mit dieser Mitleidsmasche, die zieht nicht mehr.«
»Mit welcher Mitleidsmasche?«
»Halt die Klappe, Paul«, sagte Lara, und ihre Stimme klang sehr scharf.
»Mit welcher Mitleidsmasche?«, äffte Paul ihn nach. »Guck dich doch an, du jammerst rum, du bist schlecht drauf, und weil nette Mädchen wie Lara eine soziale Ader haben, gehst du ihnen auf den Keks.«
»Ich geh niemandem auf den Keks«, sagte Sven. Ihm war richtig übel plötzlich. Kotzschlecht.
»Nein?«, fragte Paul gedehnt und knackte mit den Fingergelenken. »Meinst du etwa, Lara ist scharf darauf, den Babysitter für dich zu spielen?«
»Das reicht jetzt, Paul«, sagte Lara und stand auf. Sie griff nach ihrem rosa Rucksack, wühlte hastig in ihrer Hosentasche nach Geld und knallte einen Fünf-Euro-Schein auf den Tisch.
»Wir sind Freunde«, sagte Sven. Er sah zu Lara hin, aber sie wich seinem Blick aus und hielt Ausschau nach dem Kellner.
»Freunde?«, höhnte Paul. »Frag sie doch! Ein Sozialfall bist du! Und wenn Laras Mutter nicht Lehrerin bei euch wäre, müsste sie sich nicht mit dir abgeben! Sie redet nur mit dir, um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun!«
Manchmal wünschte Sven, sein Leben wäre ein Computerspiel. Dann müsste er jetzt nicht um Worte ringen, sondern könnte Paul einfach in seine dumme Visage ballern, mitten rein, und dann wäre er ihn los.
Das wäre leichter, als sein wattiges Hirn nach einer passenden Antwort zu durchsuchen und dabei Lara zu beobachten, die peinlich berührt in ihrem Rucksack kramte.