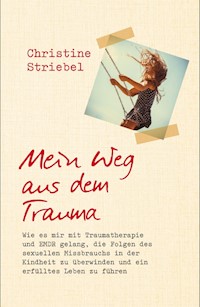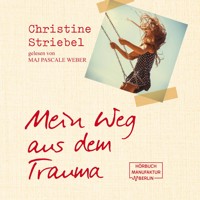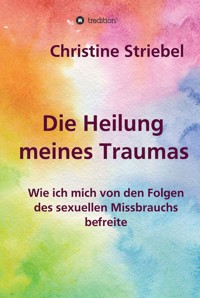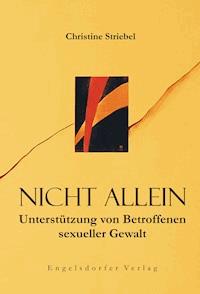
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nicht allein. Unterstützung von Betroffenen sexueller Gewalt ist die überarbeitete und erweiterte Zweitauflage des bewährten Selbsthilfebuches von Christine Striebel. Sie reicht damit Menschen nach sexueller Gewalt die Hand, um sie ein Stück ihres weiteren Weges zu begleiten.Nicht allein beinhaltet Anregungen und Erfahrungsberichte betroffener Frauen. Dennoch ist dieses Buch Hilfestellung für alle Betroffenen, sowohl Frauen als auch Männer. Es vermittelt Erkenntnisse die eigene Situation besser verstehen zu können, sich anzunehmen und ganz behutsam lieben zu lernen. Gleichzeitig ermuntert es den Weg der Heilung zu gehen und auch Hilfe von außen anzunehmen. Für Freunde, Angehörige und alle am Thema interessierten Menschen bietet es Einblick in die Folgen sexueller Gewalt und zeigt auf, wie sie Betroffene unterstützen können. Gemeinsam mit anderen »Weggefährten« vermittelt die Autorin Christine Striebel Missbrauchsüberlebenden Möglichkeiten der Selbsthilfe u. a. im Umgang mit Panikattacken, Sucht, Schlafstörungen, Scham, Selbstverletzungen und dem inneren Kind. Rückmeldung einer Leserin zur 1. Auflage von »Nicht allein«: Das Buch ist eine »Liebevolle Unterstützung und Begleitung durch die schwersten Jahre des Erwachsenenlebens in eine glückliche, bessere Zukunft.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Striebel
Nicht allein
Unterstützung von Betroffenen sexueller Gewalt
Engelsdorfer Verlag
2010
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86901-767-9
Copyright (2010) Engelsdorfer Verlag
2. überarbeitete und erweiterte Auflage
Lektorat: Klaus Striebel und Steffen Striebel
Coverbild in Öl: Dr. h. c. Klaus Buchinger-Wohlgemuth
Cover Fotografie: Lichteffekte Aliki Konstantas
Alle Rechte bei der Autorin
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
14,00 Euro (D)
Inhalt
Widmung
Dieses Buch widme ich meinem Mann Klaus, der mir immer liebevoll und treu zur Seite steht. Ich bin glücklich und dankbar, dass es Dich gibt!
Wie es zu diesem Buch kam
Der 23. Juni 1993 ist für mich ein ganz besonderer Tag. Dieses Datum markiert das Erwachen aus meinem schützenden Dornröschenschlaf. Damals hatte ich bereits zehn Jahre Therapie hinter mir. In diesen Jahren ging es mir zwar immer wieder recht gut, doch es hielt sich das bedrückende Gefühl, dass mit mir irgendetwas nicht stimmte. Deshalb hatte ich auch nach fünf Fehlversuchen erneut eine Therapie begonnen.
In dieser Therapie arbeiteten wir mit Träumen. Ein Traum, in dem mein Auto brannte und ich nur meinen Teddybär retten konnte, schien meiner Therapeutin besonders gut zu gefallen. An jenem Tag, es ging mir sehr gut, stellte sie mir erneut Fragen zu diesem Traum. Da wurde ich wütend und sagte: „Mich nerven diese Fragen. Ich habe das Gefühl, Sie glauben, dass ich in meiner Kindheit irgendein Trauma erlebt habe. Und weil es gerade modern ist, denken Sie womöglich, ich sei als Kind sexuell missbraucht worden!“ Kaum waren mir diese Worte entschlüpft, drückte sich mein Brustkorb zusammen und presste das Wort »Gräbele«[1] heraus. Mir wurde schlecht. „Wo ist das »Gräbele«?“ fragte meine Therapeutin. Und ich antwortete wie in Trance: „Bei meiner Oma.“ Gehorsam legte ich mich dann in dieses »Gräbele« auf den Boden. Das, was dann geschah, war der reinste Horrortrip. Ich spürte brennende Hände auf meinem Körper, mir war speiübel und ich schrie innerlich! Ich war mir sicher, nun wirklich wahnsinnig geworden zu sein. Oma hatte Recht. Ich musste für immer eingesperrt werden. Als ich wieder zu mir kam, lächelte mich meine Therapeutin liebevoll an und sagte: „Sie sind nicht verrückt. Sie haben sich nur endlich daran erinnert, was Ihnen früher einmal passiert ist. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass Sie ihr Trauma erinnern können.“ Ich hatte das Gefühl, ihr glauben zu können und gestattete mir selbst fürs erste, meiner Erinnerung zu trauen. All meine „seltsamen“ Verhaltensweisen kamen mir wieder ins Gedächtnis. Und plötzlich ergab das alles einen Sinn, ich konnte mich verstehen.
Völlig erschöpft ging ich nach Hause, stellte eine Flasche Sekt kalt und wartete auf meinen Mann. Als er von der Arbeit kam, erzählte ich ihm, was geschehen war, und bat ihn, mit mir auf diesen »Durchbruch« ein Glas Sekt zu trinken. Ich war sicher, dass nun, da ich wusste, weshalb ich solche Probleme hatte, alles gut würde.
Doch leider hielt meine Euphorie nur kurz an. Weitere Erinnerungen folgten. Und ich stürzte, stürzte und stürzte in ein tiefes Loch. Gleichzeitig stellten sich Trotz und Kampfgeist ein und ich beschloss, allen zu zeigen, dass man auch dieses Trauma überleben konnte. Ich wollte ein Buch darüber schreiben, um der ganzen Welt zu vermitteln: Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Dieser Vorsatz hielt mich am Leben und sechs Jahre später löste ich mit dem Schreiben dieses Buches mein Versprechen ein.
Der Weg von der ersten Zeile bis zum fertigen Buch war manchmal sehr beschwerlich. Besonders schwierig gestaltete sich die Suche nach geeigneten Interviewpartnerinnen. Doch schließlich gelang es mir, dank der Idee einer Freundin, die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Medien zu nutzen, um genügend Interviews zusammen zu bekommen.
Ein Problem während des Schreibens war meine eigene Seele. Oft fragte ich mich, ob ich mein Vorhaben verwerfen sollte, stürzte ich doch selbst durch die Lebensgeschichten meiner Interviewpartnerinnen immer wieder in den Abgrund eigener Erinnerungen. Meine Worte wurden schwer und traurig und mein Vorhaben, mein Augenmerk auf konkrete Hilfestellung für Betroffene und deren Angehörige zu richten, schien mir nicht mehr realisierbar. So gab es Phasen, in denen ich beschloss, dieses Buch nicht zu beenden, da das, was mich so belastete, wohl kaum anderen helfen konnte.
Als ich wieder einmal einen Tiefpunkt erreicht hatte, schenkte mir eine Freundin das Buch Wahre Kraft kommt von innen von Louis L. Hay[2]. Beim Lesen erinnerte ich mich wieder daran, mit welcher Leichtigkeit ich trotz eigener Schwere und Betroffenheit mit meinem Buch begonnen hatte. Und dann ermunterten mich auch meine Interviewpartnerinnen, dieses für sie so wichtige Buch zu schreiben.
Das Buch, das sich aus dem ersten „Nicht allein“ entwickelt hat, hältst du heute in Händen. Es wurde durch neue Erfahrungen, Geschichten und Impulse von Lesern erweitert.
Ein praktischer Ansatz
Da ich selbst erlebt habe, dass mich »Dramenberichte« eher belasten als entlasten, möchte ich mit diesem Buch einen anderen Weg beschreiten. Ich möchte Klarheit in das böse Verwirrspiel des sexuellen Missbrauchs und seiner Folgen bringen. Dabei habe ich Unterstützungsmöglichkeiten gesammelt, die sowohl für Frauen als auch für Männer hilfreich sind. Themen, die speziell Männer betreffen habe ich nur teilweise berücksichtigen können, da ich mich in diesem Bereich für zu wenig kompetent halte.
In der Aufarbeitungsphase meines Traumas spürte ich, wie hilflos mein Mann und ich dieser Situation ausgeliefert waren. Wir wollten sprechen und wagten es nicht. Wir wollten handeln und wussten nicht wie. Viele Betroffene haben mir ähnliche Probleme beschrieben. Deshalb wendet sich dieses Buch sowohl an Menschen, die in der Kindheit sexueller Gewalt ausgesetzt waren, als auch an die Menschen in ihrem familiären Umfeld sowie an ihre Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Ziel ist es, Überlebenden[3] dabei zu helfen, ihre Situation besser zu verstehen, sie anzunehmen und heilend aktiv werden zu können. Da es für viele Betroffene schwer ist, über ihr Schicksal zu sprechen und sich zu erklären, bieten die Beispiele anderer Betroffener die Möglichkeit, Worte zu finden.
Angehörigen und Therapeuten möchte ich mit diesen Gedanken Tipps und Anregungen geben, damit sie Überlebende besser verstehen und begleiten können. Damit soll die Kommunikation untereinander erleichtert und Handeln möglich werden.
Beim Schreiben habe ich mich darum bemüht, weitestgehend auf Fachbegriffe zu verzichten, damit das Buch auch für Leserinnen und Leser ohne psychologische Vorkenntnisse zugänglich ist. Zur Vereinfachung der Ausdrucksweise wähle ich für »Betroffene«, »Partner«, »Ärzte« und »Therapeuten« die allgemeine Form. Gemeint sind damit sowohl weibliche als auch männliche Personen.
All den Frauen, die mich durch ihre Offenheit bei den Interviews unterstützten, möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen. Ihnen verdanke ich, dass ich dieses Buch so vielfältig gestalten konnte. Zu ihrem Schutz sind alle Namen geändert. Mit einigen stehe ich auch heute noch in liebevollem, respektvollem Kontakt. Leider erhielt ich von betroffenen Männern keine Interviews.
Christine Striebel, im November 2009
Danksagung
Dankbar und voller Liebe blicke ich auf die letzten Jahre zurück. Durch wundervolle Wegbegleiter konnte ich mich weiter entwickeln und mein Vertrauen in die Menschen und das Leben zurückgewinnen. Ich danke dem Universum für diese menschlichen Begegnungen im gestern, heute und morgen und ihre Unterstützung an diesem Buchprojekt.
1 Einstimmung
1.1 Das Thema sexueller Missbrauch
Das Thema sexueller Missbrauch gehört heute zu unserem Alltag. Fast täglich wird in irgendeiner Form darüber in den Medien berichtet. Sowohl Berichte über von Fremden missbrauchte Kinder, die dann zum Schweigen gezwungen oder getötet werden, als auch Inzestberichte nehmen ständig zu. Auch wenn spektakuläre Nachrichten den Eindruck vermitteln, dass derartige Straftaten hauptsächlich außerhalb der Familie stattfinden, bestätigen die Interviews und Beratungsgespräche, die ich geführt habe, das Gegenteil. Die wesentlich größere Anzahl von sexuellen Übergriffen findet in der Familie oder im nahen Umfeld der Familie statt. Und dies scheint auch plausibel, denn wo kann ein Täter ungestörter agieren als in einem vertrauten Umfeld, in dem er sich auf bestimmte Tagesabläufe verlassen kann und das Opfer ständig unter Kontrolle hat. Auch wenn mich die Art der Berichterstattung in den Medien gelegentlich wütend macht, empfinde ich gleichzeitig Dankbarkeit, dass sexuelle Gewalt inzwischen ein öffentliches Thema ist. Diese Öffentlichkeit bricht mit einem Tabu und bietet Kindern und Jugendlichen eher als zuvor die Möglichkeit, sich bei sexuellen Übergriffen an eine Vertrauensperson zu wenden. Damit besteht die Hoffnung, dass sie das Trauma und die Verletzungen nicht erst verdrängen müssen, sondern gleich bearbeiten können und ihnen so möglicherweise schwerwiegende seelische Krankheiten erspart bleiben.
Die positivste Auswirkung des Medienrummels um sexuelle Gewalt ist, dass heute immer mehr Prävention betrieben wird. Des Weiteren ermöglicht die Konfrontation mit dem Thema Frauen wie mir und Männern, verdrängte Erlebnisse ganz allmählich zu erinnern und schrittweise aufzuarbeiten. Betroffene, die bisher nicht über ihre Erlebnisse sprechen konnten, können durch die Berichterstattung in den Medien eher den Mut finden, ihr Schweigen zu brechen.
Mit entsprechender Unterstützung und genügend Zeit für den Heilungsprozess haben alle Betroffenen die Chance, ihre Zukunft heiler und glücklicher zu erleben als sie erwartet hätten. Für Menschen auf diesem oft schweren Weg möchte ich Verständnis wecken und allen Beteiligten Hilfestellung anbieten.
Die Art der Thematisierung sexuellen Missbrauchs in den Medien hat leider auch ihre Nachteile. Beispielsweise führen Sensationalismus und Panikmache nicht selten dazu, dass auch Menschen, die behutsam und liebevoll mit Kindern umgehen, als Täter/innen abgestempelt werden. Hetzjagden auf vermeintliche Kinderschänder und Schauprozesse, bei denen schließlich die Täter/innen als Opfer dastehen, machen es den wirklich Betroffenen schwer, glaubhaft zu erscheinen. Gleichzeitig fügen sie den fälschlich Beschuldigten einen schweren seelischen Schaden zu. Und bei allem öffentlichen Rummel um das Thema sexuelle Gewalt sollte nicht vergessen werden, dass bis heute die wenigsten sexuellen Straftaten letztendlich geahndet werden.
1.2 Die Opfer-Täter-Situation
In der Sensationslandschaft wird der Täter bestraft und abgelehnt und das Opfer kurzfristig bedauert. Die verheerenden Auswirkungen, die die Tat auf das ganze Leben der Opfer und ihrer Familien hat, werden jedoch oft totgeschwiegen.
Erst beim Drama der Tochter von Josef Fritzl aus Amstetten (Österreich 2008) wurde bekannt, wie unendlich tief die Verletzungen Betroffener sind. Sonst heißt es meist nur: „Das Opfer ist in therapeutischer Behandlung!“
Bei der Verurteilung des Angeklagten werden die einzelnen Delikte zusammengetragen und zu Haftjahren addiert. Der Täter wird, wenn es gut läuft, für einige Jahre inhaftiert oder in eine Psychiatrie eingewiesen und damit hat das Opfer Genugtuung erhalten. Hiermit scheint das Thema für die Gesellschaft erledigt zu sein.
Doch hat sie hiermit wirklich ihre Schuldigkeit getan? Ich denke nicht. Auch heute noch ist es oft schwierig, den richtigen Arzt, eine geeignete Therapeutin oder eine psychosomatische Einrichtung zu finden, die die Heilung unterstützt. Und wenn diese Hürden endlich genommen sind, kann ein erbitterter Kampf mit der zuständigen Krankenkasse beginnen, um die notwendigen Therapiestunden bezahlt zu bekommen. Denn mit 25, 50 oder auch 75 Therapiestunden ist Menschen, die ein solches Trauma überlebt haben, nicht genügend geholfen. Es ist gut, dass sich die Versorgungslandschaft hier allmählich zu verändern beginnt. In der Zwischenzeit gibt es immer mehr geeignete Tageskliniken und psychiatrische Einrichtungen, die auf Traumatisierung u. a. durch sexuelle Gewalt spezialisiert sind und neben der »Aufbewahrung« und »Ruhigstellung« auch konkrete therapeutische Hilfen anbieten. So bleibt die Zuversicht, dass es trotz der Einsparungen im Gesundheitswesen immer mehr geeignete Unterstützung für Betroffene und ihre Familien geben wird.
Um das Bild dieser Ausgangssituation abzurunden, bedarf es auch einer kurzen Betrachtung des Täters bzw. der Täterin. Auch sie waren einmal ein Kind, das durch ihr Lebensschicksal zum Täter wurde. Sicher stellen sich jetzt bei einigen von euch die Nackenhaare auf. Ihr werdet wütend, weil ich so dreist bin und den Täter nun auch noch in Schutz nehme. Doch meine heutige Sicht der Dinge, nach der Heilung meiner tiefsten Wunden, lässt mich auch Mitgefühl für die Täter haben. Das ändert nichts daran, dass Traurigkeit, Wut und andere Gefühle von uns Betroffenen berechtigt sind! Viele Täter wurden als Kinder selbst Opfer von Gräueltaten. Vorwiegend weibliche Opfer gehen in die Depression und Selbstzerstörung und suchen sich therapeutische Hilfe. Männer dagegen wandeln ihre Verletzungen eher in gezielte oder ungezielte Aggression um. Therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, fällt ihnen extrem schwer. Sie haben ja oft schon ein Problem damit bei einer Autofahrt nach dem Weg zu fragen. Das liegt vermutlich daran, dass Männer in unserem Kulturkreis stark zu sein haben. Erleben sie in der Kindheit sexuelle Gewalt entstehen bei ihnen neben der Scham auch Angst, wie z.B. schwul zu sein oder SM leben zu müssen. Das führt zu massiven Aggressionen, die sie in Autoaggression oder Selbstaufgabe umwandeln oder in Täterverhalten ausleben.
Können sich Betroffene nicht aus dieser Situation heilend befreien, können sie selbst zu Gewalttätern werden, um zu zeigen, wie viel Macht sie haben. Je jünger die Täter sind um so eher kann davon ausgegangen werden, dass sie selbst sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Für mich bedeutet dies in letzter Konsequenz, dass auch die Täter und ihre Angehörigen dringend therapeutische Hilfe brauchen. In der Zwischenzeit ist es so, dass für einen verurteilten Sexualtäter eine psychotherapeutische Heilbehandlung ohne Einwilligung des Verurteilten angeordnet werden kann, so lange sie mit keinen körperlichen Eingriffen verbunden ist.[4] Denn nur so kann auf Dauer die Spirale der sexuellen Gewalt unterbrochen werden.
In der Zwischenzeit gibt es immer mehr Möglichkeiten, Hintergrund-Informationen zum komplexen Thema der sexuellen Gewalt zu erhalten. Dieses Wissen gibt Sicherheit und zeigt Wege aus der Hilflosigkeit auf, die es Überlebenden und ihrem Umfeld im Miteinander leichter machen.
Gleichzeitig setzen sich immer mehr Organisationen für die Aufklärung und Stärkung unserer Kinder ein. Bereits in Kindergärten wird dieses Thema angegangen. Denn Vorsorge ist besser als Schadensbewältigung.
Wie groß die Informationslücken trotz allem noch immer sein können, zeigt das Beispiel eines Arztes, der eine betroffene Frau fragte, warum sie ihre Vergangenheit denn nicht einfach abhaken könne. Als sie ihn dann fragte, wie sie das denn machen solle, blieb er ihr die Antwort schuldig. Wenn das Abhaken so leicht wäre, würden die meisten Betroffenen liebend gern diesen Weg gehen, um endlich ein neues, unbeschwertes Leben zu führen. Aber so leicht ist es eben nicht und wenn sie mit solchen Fragen konfrontiert werden, entsteht bei den Opfern entweder das Gefühl nicht verstanden zu werden oder sie fühlen sich unter Druck gesetzt, mehr an sich zu arbeiten. Ihre innere Verunsicherung steigt und der Selbstwert sinkt weiter.
Mein Anliegen ist es, mit diesem Buch viele der bestehenden Informationslücken zu füllen, sodass missbrauchten Frauen und Männern mit liebevollem Verständnis und mehr Menschlichkeit begegnet werden kann.
Jeder Mensch handelt, denkt, fühlt, sieht und hört so, wie er es in seiner Kindheit gelernt hat. Sein bisheriges Leben prägt seine innere Landkarte, sein Bild von der Welt. Studieren wir andere Landschaften und Lebensweisen, erweitert sich unser Horizont und unser Verständnis und Selbstverständnis bekommen neue Strukturen.
1.3 Definition des sexuellen Missbrauchs
Es ist sicher jedem klar, dass ein erzwungener Geschlechtsakt ein sexueller Übergriff ist. Doch die Definition sexuellen Missbrauchs ist wesentlich umfassender. Ein sexueller Übergriff liegt bereits vor, wenn ein Erwachsener ein Kind mit sexuellen Hintergedanken ansieht oder berührt. Ein Kind hat feine Antennen und wird bereits hierbei in seinen Gefühlen verunsichert sein. Dies hat Auswirkungen auf sein weiteres Leben. Deshalb sollten wir Kinder dazu anhalten, über ihre Gefühle zu sprechen, auch wenn sie anfangs nur sagen können, dass sie ein »komisches Gefühl« bei etwas hatten. Indem wir unsere Kinder anleiten, die unendlich große Bandbreite ihrer Gefühle zu erkunden und zu benennen, lernen auch wir neue Gefühle kennen, die uns bereichern. Liebevoller und aufmerksamer Umgang mit den uns anvertrauten Kindern und behutsame Aufklärung schützen und stärken sie.
Beachte[5]:Es gibt absolut keine einvernehmlichen, sexuellen Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Denn Kinder und Jugendliche sind nicht in der Lage sexuellen Handlungen frei und informiert zuzustimmen oder die Tragweite der Handlungen voll zu erfassen.
1.4 Die Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs
Statistiken belegen, dass mindestens jede dritte Frau der Nachkriegsgeneration als Kind gelegentlich oder regelmäßig sexuell missbraucht wurde und dies meist in häuslicher Umgebung. Ich gehöre dazu. Dies bedeutet, dass wir, ohne es zu wissen, täglich Menschen begegnen, die dieses Schicksal erlitten haben. Wir sehen Frauen, die sich in ihrem Erscheinungsbild stark unterscheiden können, starke und schwache Frauen, Frauen, die sich feminin oder eher androgyn kleiden. Jede dieser Frauen, die sich Strategien angeeignet haben, um zu überleben, könnte ein »Opfer« oder ein ehemaliges Opfer sein.
Wie mir heute bewusst ist, gibt es auch erstaunlich viele Männer, die sexuelle Übergriffe erlebt haben. In der aktuellen Literatur[6] fand ich die folgenden Zahlen:
„… in Deutschland kann man davon ausgehen, dass jedes 8. Mädchen und jeder 12. Junge mindestens einmal Opfer sexueller Übergriffe mit Körperkontakt wird.“
Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer besonders bei Männern größer als bei Frauen sein dürfte, da Männer viel seltener therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Sie »müssen« nach gängigem Rollenbild eines Mannes stark sein.
In der oben genannten Literatur fanden sich auch Zahlen zu der Täterverteilung. 5%-20% der sexuellen Übergriffe werden durch Frauen verübt.
Die Polizei in Deutschland sprach 2004 von 20 000 neuen sexuellen Straftaten jährlich und rechnete mit einer um ein Vielfaches höheren Dunkelziffer.
2. Überlebensstrategien
2.1 Die Situation des kindlichen Opfers
Sexuelle Übergriffe sind zu 70% bis 90%[7] Beziehungsstraftaten in Familie und Umfeld. Fremdtäter sind eher seltener, werden aber in den Medien viel häufiger erwähnt. Viele sexuell missbrauchte Erwachsene sind in Familien aufgewachsen, die von außen betrachtet völlig intakt schienen. Das, was hinter verschlossenen Türen stattfand, wurde geschickt, oft sogar vor dem anderen Elternteil, Geschwistern und Verwandten, verborgen. Doch jedes Familienmitglied, egal ob direkt oder indirekt betroffen, spürt, dass irgendetwas nicht stimmt, oft ohne es benennen zu können. Und dies hat Auswirkungen auf die ganze Familie.
Kinder sind völlig abhängig von ihren Eltern. Die Familie ist der Raum, in dem das Kind Sicherheit, Liebe, Geborgenheit und Förderung erleben soll, um gesund reifen und wachsen zu können. So hat jedes Kind den Wunsch, den Eltern nahe zu sein. Selbst nach sexuellem Missbrauch und anderen Misshandlungen bleibt dieser Wunsch bestehen, da das Kind instinktiv weiß, dass es alleine nicht überleben könnte. Es wird deshalb Möglichkeiten suchen, trotz der großen körperlichen und seelischen Qualen der sexuellen Gewalt in der Familie zu überleben. Diese Überlebensstrategien können sehr unterschiedlich sein.
Auch Kinder, die außerhalb der Familie missbraucht werden, tragen bleibende Schäden davon, allerdings kann ihnen die Geborgenheit der Familie wenigstens erhalten bleiben, falls sich das Kind einem Familienmitglied anvertrauen kann und die Straftat geahndet wird. Auch schnelle therapeutische Hilfe ist wichtig. Kann sich dieses Kind zu Hause niemandem anvertrauen, ist es einsam und verlassen und muss sich automatisch Überlebensstrategie zulegen.
Um die Not sexuell missbrauchter Kinder besser verständlich zu machen, scheint es mir wichtig, das gesamte Szenario eines Missbrauchs in der Familie zu beschreiben. In einer intakten Familie hat ein Kind durch die Fürsorge seiner Eltern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Diese so wichtigen Gefühle werden durch den sexuellen Übergriff schlagartig völlig in Frage gestellt und erschüttert. Plötzlich ist alles anders als es bisher war. Ein Erwachsener macht im Geheimen etwas mit dem Kind, das ihm weh tut und es fürchterlich ängstigt. Die Handlungen und Worte sind dem Kind völlig fremd, unverständlich und es erlebt den sonst oft eher zurückhaltenden Täter als zudringlich und häufig sogar gewalttätig. Es kann diese Erlebnisse nicht benennen und fragt sich, warum der Erwachsene sich plötzlich so verhält, oder ob es für etwas bestraft wird. Fragen sind verboten. Der Zwang zur Geheimhaltung unter Androhung massiver Strafen, der in der Regel mit sexueller Gewalt einhergeht, nimmt dem Kind jegliche Chance, aus dem Alleinsein mit dem Problem auszubrechen. Denn welches Kind möchte schon den Vater in den Knast bringen, die Familie zerstören oder schuld daran sein, dass die gesamte Familie getötet wird? Für das Kind sind diese Drohungen real, obwohl sie Gott sei Dank nur in den seltensten Fällen in die Tat umgesetzt werden.
Das Dilemma, in dem sich das Kind befindet, ist meist um so größer, je jünger das Kind ist und je häufiger die Übergriffe stattfinden. Es ist plötzlich völlig isoliert und hat Angst, sich zu verplappern, obwohl es sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich aus dieser schrecklichen Situation befreit zu werden. Gleichzeitig weiß das Kind nicht, ob die Annäherung des Erwachsenen eine Form ist, ihm Zuneigung zu zeigen. Stimmt sein Gefühl nicht, dass daran etwas »falsch« ist? Das Kind ist verunsichert, denn es wünscht sich ja auch Liebe und Zärtlichkeit von den Eltern. Viele Täter sind im Alltag eher distanziert zu ihren Kindern, so dass der Übergriff oft die einzige Form körperlicher Nähe ist, die sie zu ihnen herstellen.
Ich habe bei anderen Betroffenen und mir festgestellt, dass die Verunsicherung der eigenen Gefühle, die Hilflosigkeit und der Schweigezwang den sexuellen Missbrauch potenzieren. Hinzu kommen Gefühle wie Schuld, Scham und manchmal eine vage Erinnerung daran, dass es auch schön war, Nähe zu erfahren. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen einmaligen Übergriff oder häufige Missbrauchssituationen handelt. Traumatisiert sind alle Betroffenen.
Zu den oben aufgeführten Denkstrukturen gesellen sich noch Probleme, die besonderen Einfluss auf Jungen haben. Denn: „Ein richtiger Junge ist kein Opfer!“
Es entsteht absolute Verunsicherung, weil die Jungen fürchten, nun kein richtiger Mann mehr zu sein. Dies kann dazu führen, dass sie sich mit dem Täter identifizieren und bewusst aggressiv und machohaft auftreten.
Die leider noch immer falsch verbreitete Meinung, dass:
- sich Jungen wehren könnten wenn sie nur wollten;
- sie bei jeder sexuellen Handlung Spaß hätten;
- missbrauchte Jungen eine homosexuelle Ausstrahlung hätten;
belasten männliche Betroffene ganz besonders.
2.2 Was sind Überlebensstrategien?
Ein Kind das sexuelle Gewalt erfahren hat oder auf andere Weise traumatisiert wurde wird in der Regel mit seinen Ängsten und Nöten allein gelassen. Deshalb sucht es unbewusst nach Möglichkeiten mit dieser Situation fertig zu werden; es passt sich an und funktioniert. Damit wird der Grundstein für spätere körperliche und seelische Krankheitssymptome und großes Leid gelegt.
Die allgemeine Tabuisierung von Sexualität, die Angst vor den angedrohten Strafen oder schrecklichen Ereignissen und die fehlende Sprache, für das, was da geschieht, machten es dem sexuell missbrauchten Kind früher ganz besonders schwer, sich jemandem anzuvertrauen.
Mit der zunehmenden Thematisierung sexueller Gewalt in den Medien, wird es Kindern heute einfacher gemacht, sich an eine Vertrauensperson zu wenden. Doch es bleibt noch immer viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um möglichst viele betroffene Kinder und Jugendliche zu erreichen. Je früher der Missbrauch aufhört und das Trauma bearbeitet werden kann, umso weniger Auswirkungen wird er auf das weitere Leben der Betroffenen haben.
Beiseite geschobene traumatische Erlebnisse, die unbearbeitet bleiben, entwickeln ein Eigenleben und können sich zu schweren psychischen Erkrankungen ausweiten. Hatte das betroffene Kind beispielsweise »nur« Angst vor der Bierfahne und der Gewalt des Täters, können sich bei dem Jugendlichen - besonders in der Pubertät - allgemeine Ängste vor Biergeruch und Berührungen entwickeln (Generalisierung). Die Betroffenen ziehen sich verstärkt zurück, um solche Situationen zu vermeiden. Die Probleme nehmen zu und die Frau bleibt in der Opferrolle, während der Mann eher aggressiv wird. Das wirkt sich wiederum auf die Ausstrahlung der Frau aus. Sie scheint Signale auszusenden, die Täter gerade zu anlockt. Eine Retraumatisierung findet statt.
2.3 Wie kommt es zu Überlebensstrategien?
Stell dir vor, du hast seit kurzer Zeit deinen Führerschein und fährst im Alltag schon recht sicher. Auf der Autobahn kommt dir nachts plötzlich ein Geisterfahrer entgegen. Er nähert sich schnell. Du musst spontan reagieren. Du handelst nach den dir zur Verfügung stehenden Verhaltensmustern. Für Überlegungen ist keine Zeit. Du willst diese Situation einfach nur überleben. Wie, ist dabei völlig unbedeutend. Für Überlegungen nach Konsequenzen bleibt keine Zeit. Du willst nur überleben. Du fährst in einen Graben und verletzt dich schwer.
Wie durch einen Nebel nimmst du völlig irritiert wahr, dass sich ausgerechnet der Unfallverursacher um dich kümmert. Doch er will dir nicht wirklich helfen, sondern nutzt die Gelegenheit, dich massiv unter Druck zu setzen. Er droht dir eine drakonische Strafe an, wenn du irgendjemandem von seinem Fehlverhalten erzählst. Das macht dir Angst. Gleichzeitig bist du dir in der Schocksituation nicht ganz sicher, ob du deine Verletzungen hättest verhindern können, wenn du »das Richtige« getan hättest. Aus Angst, Scham und schlechtem Gewissen schweigst du also und versuchst die Tatsachen zu verdrängen. Dann erfindest du eine glaubhafte Geschichte, die deinen Unfall erklärt.
Wenn du dir nun vorstellst, dass das Unfassbare und völlig Unwahrscheinliche dir fast täglich, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr passiert, was ginge in dir vor? Was würde passieren, wenn dir immer wieder Geisterfahrer begegnen würden, so als ob sie nur auf dich gewartet hätten? Glücklicherweise schaffst du es immer wieder, mit dem Leben davonzukommen.
Du überlegst dir also Strategien, um Geisterfahrer zu meiden. Vielleicht erfindest du Ausreden, um nicht mehr mit dem Auto fahren zu müssen. Oder du brichst dir einen Arm oder ein Bein. Eventuell suchst du dir auch eine neue Arbeitsstelle, die du zu Fuß erreichen kannst, auch wenn sie schlechter bezahlt ist. Gleichzeitig wirst du immer erfinderischer darin werden, deine Unfälle und gerade noch verhinderten Unfälle zu verbergen oder dir Geschichten auszudenken. Denn wer würde dir schon glauben, dass ausgerechnet du so häufig Kontakt mit Geisterfahrern hast.
Durch die vielen schrecklichen Erlebnisse und das Aufbauen deiner Fantasiegeschichten verändert sich deine Wahrnehmung der Welt immer mehr. Du versuchst die Ereignisse zu vergessen oder zu verdrängen und bemühst dich, so normal wie möglich weiter zu leben. Denn niemand anderes berichtet von regelmäßigen Begegnungen mit Geisterfahrern. Vielleicht glaubst du sogar eines Tages daran, dass du dir das alles nur einbildest. Du glaubst immer fester daran, dass mit deiner Wahrnehmung irgendetwas nicht stimmt. Allmählich bist du total geübt darin, dir Ausreden und Ablenkungsmanöver auszudenken, damit du normal wirkst. Je länger du dieses Spiel betreibst, umso schwieriger wird es, das Schweigen zu brechen, selbst wenn du es wolltest. Denn wer würde dir deine häufigen Begegnungen mit Geisterfahrern nach so langer Zeit glauben, wenn du selbst nicht mehr daran glaubst.
Irgendwann hast du so große Angst vor Autos, dass du weder als Fahrerin noch als Beifahrerin am Straßenverkehr teilnehmen kannst. Du fühlst dich der Situation völlig hilflos ausgeliefert, denn egal wo und wie du fährst: Es begegnen dir Geisterfahrer. Auch Zug-, Bus- und Straßenbahnfahrten werden dir unmöglich, da du überall Gefahr witterst. So ziehst du dich immer mehr in dich und deine vier Wände zurück, denn deine Welt wurde im wahrsten Sinne des Wortes »verrückt«.
Genau so ein Horrorszenario erlebt ein Kind, das fast täglich, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr sexuell missbraucht wird. Es lebt in einer so »verrückten« Welt wie die oben beschriebene Autofahrerin.
Ist die erste Überlebensstrategie geboren, wird sie sich im Laufe der Zeit ausweiten und vielleicht auch weitere Strategien notwendig machen. Viele Kinder machen irgendwann gegenüber Erwachsenen Andeutungen oder stellen Fragen zu dem, was ihnen passiert ist. Ein Glücksfall für sie, wenn die angesprochene Person aufmerksam ist und nachfragt, bis sie verstanden hat, was das Kind mitteilen möchte. In Ruhe und Besonnenheit sollten Überlegungen angestellt werden, wie dem Kind geholfen werden kann. Werden diese ersten Andeutungen übergangen oder mit „du lügst“ oder „was hast du nur für eine schlechte Fantasie“ abgetan, verstummen die Kinder und müssen nach anderen Wegen suchen, um zu überleben. Hinter vielen Verhaltensänderungen bei einem sexuell missbrauchten Kind verbirgt sich der Wunsch, die Erwachsenen mögen erkennen, dass etwas nicht stimmt. Früher wurde die Not des Kindes meist nicht erkannt, doch inzwischen achten Eltern, Erzieherinnen, Lehrer, Freunde und Ärzte/innen viel stärker auf die Zusammenhänge zwischen körperlichem und seelischem Leid.
2.4 Beispiele für Überlebensstrategien
2.4.1 Verhaltensänderungen
Die häufigsten ersten Reaktionen von Kindern auf sexuelle Gewalt sind Verhaltensänderungen, die sich bis zur Verhaltensauffälligkeit steigern können. Lebhafte Kinder werden plötzlich ruhig und brave Kinder aufsässig. Manche Kinder entwickeln Ängste vor Dunkelheit, Einbrechern, vor bestimmten Tieren oder bestimmten Situationen. Von der wirklichen Angst kann oder darf nicht gesprochen werden. Deshalb wird eine andere Angst entwickelt, die formulierbar ist und durch die sich das Kind Aufmerksamkeit verschafft. Das ist eine völlig normale Reaktion auf traumatische Erlebnisse. Doch nicht jedes Kind, das sich vor Dunkelheit fürchtet, hatte traumatische Erlebnisse. Tatsächlich gibt es viele Gründe für Verhaltensänderungen bei Kindern, die weniger dramatisch sind und zu bestimmten Entwicklungsphasen dazugehören. Ein offenes Ohr und vertrauensvolle, aufmerksame Zuwendung können darüber Aufschluss geben.
Die Pubertät ist die nächste Phase, in der erneut besondere Probleme auftreten können. Die Zeit der Frau- bzw. Mannwerdung ist für viele junge Leute recht problematisch, doch bei Betroffenen verläuft diese Phase oft besonders heftig. Mädchen wollen keine attraktive Frau werden, die von Männern begehrt wird. Sie wollen entweder knabenhaft schlank bleiben (und das nicht nur, weil dies einem Schönheitsideal entspricht) oder fressen sich einen Schutzpanzer an, damit ja kein Mann Lust bekommt, sie zu berühren. Krankheitsbilder wie Ess-Brechsucht, Magersucht oder Esssucht können sich in dieser Zeit entwickeln.
Junge Männer[8] neigen eher zu aggressiven Phantasien, Drogen- und Alkoholmissbrauch.
2.4.2 Körperliche Erkrankungen
Treten bei einem Kind plötzlich häufig Krankheiten auf, so kann dies auch eine Folge von sexuellem Missbrauch sein. Der Körper macht so darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmt. Gleichzeitig wird ein krankes Kind in der Regel mehr umsorgt und geschützt, so dass zumindest in dieser Zeit weniger Übergriffe stattfinden.
Viele Interviewpartnerinnen berichteten von den unterschiedlichsten, meist chronischen Krankheiten, die sie seit ihrer Kindheit hatten. Am häufigsten wurden Kopfschmerzen und Migräne, Blasenprobleme, Magen-Darmbeschwerden und Unterleibsprobleme bis hin zur späteren Kinderlosigkeit beschrieben. Manche Frauen erzählten auch von häufigen grippalen Infekten in der Kindheit und im Erwachsenenalter. Da die Krankheiten nur symptomatisch behandelt wurden, prägten sie sich mit zunehmendem Alter immer mehr aus.
2.4.3 Das Trennen der Gefühle vom Körper
Das Trennen der Gefühle vom Körper, auch Dissoziation[9] oder »Aussteigen« genannt, ist eine Möglichkeit des Kindes, sich während des Übergriffs zu schützen. Während Yogis und Fakire jahrelang dissoziieren üben müssen, greifen Menschen, die traumatischen Erlebnissen ausgesetzt sind, oft automatisch auf diese als Schutzmechanismus zurück. Das Kind bleibt zwar physisch notgedrungen in der Gewaltsituation, ist aber psychisch/geistig an einem völlig anderen Ort. Auf körperlicher Ebene handelt und reagiert es automatisch. Je häufiger ein Kind dissoziieren muss, umso mehr setzt sich dieser Mechanismus in seiner Persönlichkeit fest. Irgendwann setzt er dann bei ähnlichen Situationen automatisch ein. Das kann sich auch auf spätere Liebesbeziehungen auswirken. Betroffene, die sexuelle Gewalt erlebt haben, wünschen sich einerseits oft nichts sehnlicher als Geborgenheit, auch in der Sexualität, doch die Angst vor erneuten Verletzungen bringt sie dazu, wieder auszusteigen.
„Während meiner Aufarbeitungsphase wurde mir erst bewusst, was beim Sex mit mir passierte. Mein Körper wurde gestreichelt, ich streichelte den anderen und ich bekam Orgasmen. Meist war ich froh, wenn meine Pflichtübung vorbei war. Während mein Körper im Liebesspiel war, schrieb mein Kopf Einkaufszettel oder plante den bevorstehenden Tag. Dies geschah meist dann, wenn mein Mann und ich in meiner Aufwachphase miteinander schliefen. Meine Missbrauchserlebnisse hatten im Halbschlaf stattgefunden. Wenn wir tagsüber miteinander schliefen und wenn wir dafür einen anderen Ort als dem Bett wählten sowie ganz bestimmte Handlungen ausließen, so konnte ich meist auch gedanklich dabei bleiben und die Berührungen spüren.
Noch heute liege ich oft so lange wach, bis mein Mann auch zu Bett geht. Höre ich dann seine Schritte auf der Treppe, erstarre ich. Inzwischen wage ich es, die Augen kurz zu öffnen, wenn er ins Zimmer kommt. Ich weiß dann, dass er es ist. Doch mein Körper entspannt sich erst, wenn ich höre, wie er im Schlaf ruhig und gleichmäßig atmet.“ Veronika, 50 Jahre
Manche Frauen beschreiben den Zustand des Aussteigens auch als ein Verlassen des Körpers. Ihr Körper liegt weiter im Bett, während sie sich von oben betrachten.
„Wenn ich mit meinem Freund zärtlich bin, passiert es manchmal, dass ich plötzlich nichts mehr empfinde. Alles läuft dann wie ein Stummfilm ab. Ich bin eine Beobachterin, die alles von außen sieht. Den Auslöser dafür habe ich leider noch nicht gefunden.“ Indra, 26 Jahre
Neben dem Aussteigen beschreiben manche Frauen auch eine Starre, die sie bei sexuellen Aktivitäten ergreift. Aktives Handeln ist ihnen in dieser Situation nicht möglich. Sie haben sich als Kinder in der Übergriffssituation tot gestellt. Sie hofften, dass der Täter sie dann in Ruhe ließe beziehungsweise die Sache dadurch schneller vorbei wäre.
Das Getrennt sein von den eigenen Gefühlen kann bei Betroffenen einerseits zur absoluten Ablehnung von Sexualität führen oder andererseits die Sucht nach Sexualität nach sich ziehen. Überlebende sexueller Gewalt, die als Erwachsenen sexsüchtig sind, erlebten die Übergriffe oft als einzige Form von Zuwendung beispielsweise des Vaters: „Du bist jetzt meine Frau, die ich über alles liebe.“ Sie interpretierten den Missbrauch als Liebesbeweis und setzen als Erwachsene Liebe mit sexuellen Handlungen gleich. Hinter ihrer Sexsucht verbirgt sich der Hunger nach Liebe.
Ich habe schon oft überlegt, ob viele Prostituierte nicht unbewusst ihren Hass auf Missbraucher und/oder eine große Sehnsucht nach Liebe in ihrem Beruf ausleben. Das antrainierte Abschalten von Gefühlen könnte hierbei sehr hilfreich sein. Eine Bestätigung meiner Überlegungen, konnte ich bei Interviews allerdings nicht bekommen.
2.4.4 Verdrängung
Eine weitere Überlebensstrategie ist die Verdrängung. Diese kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Manche Betroffene wissen zwar von ihrer Vergangenheit, beachten sie aber nicht und schieben sie beiseite. Andere Überlebende löschen die Gewaltmomente ihrer Vergangenheit ganz oder teilweise aus ihrem Gedächtnis. Und manchmal werden sogar alle Erlebnisse dieser Zeit komplett aus dem Bewusstsein gelöscht. Trotzdem sind alle Informationen im Unterbewusstsein gespeichert.
Durch Verdrängen schützt sich das Kind zunächst vor Überlastung. Zu einem späteren Zeitpunkt können entsprechende Impulse von außen die Erinnerungen wieder hervorbringen. Menschen, die traumatische Erlebnisse verdrängt haben, funktionieren im Alltag oft bestens, bis sie irgendwann immer häufiger erkranken. Dies erklären sie mit beruflicher oder familiärer Überlastung, eigener Schwäche oder angeborener Anfälligkeit. Dauern diese seelischen und körperlichen Symptome an, spricht man von einer PTBS[10].Viele beschreiben auch, dass sie sich »komisch« fühlen oder ahnen, dass etwas mit ihnen »nicht stimmt« und begeben sich auf die Suche nach den Ursachen. Diese Suche kann sehr langwierig sein, denn das Unterbewusstsein entscheidet über den richtigen Zeitpunkt und die Anzahl der Informationen, die es preisgibt. Damit schützt es die Betroffenen vor erneuter zu großer Belastung. Dies erklärt, weshalb die Erinnerungen meist nur etappenweise zurückkehren. Hierbei ist es wichtig, dass jeder sein eigenes Aufarbeitungstempo erkennt und sich nicht zu schnellerem Tempo drängen lässt.
2.4.5 Borderline-Störung
Eine Folge des sexuellen Missbrauchs kann die Borderline-Störung sein. In der folgenden Beschreibung dieser Störung beziehe ich mich auf einen Vortrag von Dr. Grabe, vom Juni 1999.[11]
Menschen mit einer Borderline-Störung haben nach einem oder mehreren traumatischen Erlebnissen sehr früh für sich die Lösung darin gefunden, sich von schlimmen und belastenden Ereignissen abzuspalten. Sie nehmen sich aus der Situation heraus: »es ist alles nicht wahr«, »es passiert nicht wirklich mir«. Deswegen kann es vorkommen, dass sie kurze oder längere Amnesien[12] haben. Dies sind Zeiträume, an die sie sich nicht mehr erinnern können, weil sie in dieser Zeit »abwesend« waren.
Im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Trauma entwickeln viele Borderline-Persönlichkeiten eine strikte Trennung in »gut« und »böse«, die sich im realen Leben nicht bewähren kann, weil es eben nicht nur das absolut Gute oder absolut Böse gibt. Kleine Kinder kennen die Ambivalenzen noch nicht, und die Trennung ist ihr einziger Schutz, um Gewalt, Missbrauch oder andere unerträgliche Situationen zu überleben. Sie entwickeln eine Strategie der Bewältigung, an der sie und ihr Umfeld im späteren Leben leiden.
Eine Borderlins-Störung ist zu vermuten, wenn mindestens fünf der nach genannten Symptomen zutreffen:
unbeständige oder unangemessen intensive zwischenmenschliche Beziehungen;
- Impulsivität bei potenziell selbst schädigenden Verhaltensweisen, dazu zählen beispielsweise Drogen- und Alkoholmissbrauch, willkürliche Auswahl von Sexualpartnern, Ladendiebstahl, rücksichtsloses Fahren, übermäßiges Essen, usw.
- starke Stimmungsschwankungen;
- häufige und unangemessene Wutausbrüche;
- wiederholte Selbstmorddrohungen oder -versuche bzw. Selbstverstümmelungen;
- Fehlen eines klaren Identitätsgefühls;
- chronische Gefühle von Leere oder Langeweile;
- verzweifelte Bemühungen, eine reale oder eingebildete Angst vor dem Verlassenwerden in den Griff zu bekommen;
- vorübergehend paranoide[13] Ausbrüche oder ähnliche Symptome.
„Im Prinzip habe ich alle Symptome, die zu einer Borderline-Störung gehören. Am meisten belastet mich der Zwang, meine Freundschaften zu zerstören. Ich sehne mich so sehr nach Freunden und Freundinnen, doch wenn ich dann endlich jemanden gefunden habe, beginne ich spätestens nach einem Jahr, die Freundschaft zu zerstören. Ich verletze meine Freundin dann so lange mit Worten, bis sie mich verlässt. Und ich bin wieder allein.“ Ilka 40 Jahre
2.4.6 Multiple Persönlichkeitsstörung
Wie oben schon angeführt, ist eine weitere Form des Schutzes vor extrem belastenden Erlebnissen die Dissoziation. In besonders schweren Fällen kann das die Abspaltung einer oder mehrerer Persönlichkeitsanteile zur Folge haben und wird DIS[14] genannt. Diese Spaltung tritt meist bei Betroffenen auf, die die sexuellen Übergriffe als lebensbedrohlich erlebten und in der Regel vor dem 7. Lebensjahr traumatisiert wurden. Sie haben sich in mehrere Personenanteile gespalten, damit ein oder mehrere Anteile das Leid ertragen, während andere Stärke zeigen, sich schützen und die Probleme des Alltags meistern. Die Anzahl der Anteile, die sich abspalten, hängt mit der Vielfalt der Bedrohungen oder auch mit dem Zeitraum der Qualen zusammen. Die verschiedenen Persönlichkeitsanteile sind oft so alt wie das Kind oder der Jugendliche war, als sie entstanden.
Was mich bei den Interviews überraschte, war, dass viele multiple Frauen es trotz dieser Überlebensstrategie über einen langen Zeitraum schafften, einen völlig »normalen« Lebensalltag mit Beruf und Familie durchzuhalten. Sie begründeten das damit, dass sie diese Überlebensstrategie bereits früh erlernt hatten und es deshalb für sie völlig alltäglich war, Zeitverluste zu haben.
In der Regel wissen die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile innerhalb eines Persönlichkeitsystems lange nichts voneinander. Multiple sind Meister darin, Handlungen und Begebenheiten, die sie nicht erklären oder erinnern können, sich selbst und anderen gegenüber logisch und einfach darzustellen. Deshalb bleibt dieser Schutzmechanismus selbst Therapeuten lange verborgen. Oft liegen bis zu drei anders lautende Diagnosen vor der wahren Entdeckung einer DIS.
In dem 1866 erschienen Buch Dr. Jekyll und Mr. Hyde[15] von Robert Louis Stevens wird die multiple Persönlichkeitsstörung sehr anschaulich dargestellt. Es ist die erste literarische Auseinandersetzung mit diesem Phänomen. Es ist allerdings zu vermuten, dass dieser Fall der Fantasie des Autors entsprang. Während bei Stevens eine Droge dazu führt, dass der Protagonist sich in eine andere Persönlichkeit »verwandelt«, ist es bei der Multiplen Persönlichkeitsstörung der »Auslöser«, der einen anderen Persönlichkeitsanteil zum Erscheinen bringt.
Frances Howland beschreibt in ihrem Buch Ich bin viele[16] an einem Beispiel, wie sich das Multipel sein äußern kann:
Sie hatte einen Patienten namens Tony. Unter anderem beherbergte er einen Persönlichkeitsanteil, dessen Aufgabe es war, niemals Schmerz zu empfinden. Eines Tages kam Tony zu ihr in die Praxis, nachdem ihn gerade einige Bienen gestochen hatten. Eines seiner Augen war rot und geschwollen. Frau Howland vereinbarte sofort einen Termin bei einem Augenarzt. Bevor sie Tony zu dem Arzt schickte, fragte sie ihn, ob sie mit dem Anteil sprechen könne, die nie Schmerz empfindet. Dies gelang ihr. Dann ging Tony zu seinem Arzttermin. Eine Stunde später rief der Augenarzt bei Frau Howland an, um ihr irritiert und verärgert mitzuteilen, er habe absolut keine Spur von Rötung oder Schwellung bei Tony feststellen können. Als Tony am nächsten Tag zur Therapie kam, war das Auge erneut zu geschwollen. Die Therapeutin schickte ihn sofort wieder zu dem Augenspezialisten, ohne vorher den anderen Persönlichkeitsanteil zum Erscheinen zu ermutigen. Kurz darauf meldete sich der Arzt, um fassungslos zu fragen, wie sie denn gestern hätte wissen können, dass dieser Mann heute von Bienen gestochen würde.
„Viele Jahre war ich völlig verwirrt und verängstigt. Manchmal stand ich vor der Wohnungstür meiner Freundin und wusste nicht, wie ich da hingekommen war. Im Kleiderschrank fand ich Kleidungsstücke, die mir zwar passten, aber nicht gehörten. Auf der Straße sprachen mich Menschen freundlich an, ohne, dass ich sie kannte. Heute weiß ich, was mit mir los ist. Ich bin multipel. Ganz langsam beginne ich, mich mit dem Gedanken anzufreunden. Und manchmal gibt es sogar Situationen, die mich amüsieren.
Auf der Suche nach einem neuen Job musste ich einen Fragebogen zu meinen Interessen, Wünschen und Fähigkeiten ausfüllen. Da sich einige meiner anderen Persönlichkeiten am Ausfüllen beteiligten, ergab sich ein sehr vielfältiges Bild von mir. Das verwirrte Gesicht des Berufberaters, bei der Durchsicht meines Fragebogens, werde ich wohl nie vergessen. Er meinte nur kurz: „Eine so vielseitig interessierte und informierte Frau hatte ich noch nie hier.“ Susi, 21 Jahre
Neben den oben aufgeführten Überlebensstrategien gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Auswirkungen, die bei in ihrer Kindheit traumatisierten Menschen auftreten. Durch die Zerstörung ihrer kindlichen Seele haben Überlebende Probleme, ihrer Umwelt und der eigenen Wahrnehmungen zu trauen, denn ihr Selbstwertgefühl ist in den Grundfesten erschüttert. Weitere Folgen sexueller Gewalt können sein: Entwicklungsverzögerung oder -beschleunigung, Essstörungen, nächtliches Einnässen und Einkoten, Männlichkeitswahn, Flucht in Fantasiewelten, Suchtverhalten, Zwänge und körperliche Erkrankungen. Ebenso treten häufig Depressionen, Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken auf.