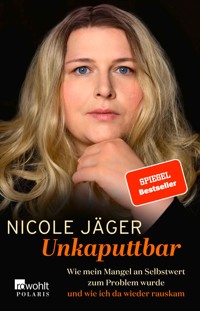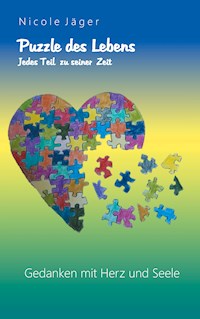Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die nackte Wahrheit übers Frausein Warum scheitern Frauen immer wieder an den eigenen Ansprüchen? Und warum ziehen sie alle beim Sex den Bauch ein? Dies ist ein Buch über alle Facetten der Weiblichkeit: die schönen, weniger schönen und manchmal auch absurden. Ein Buch über Beziehungen, Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Body Shaming, Besuche beim Frauenarzt, Diät-Shakes, Dating-Plattformen, das eigene Spiegelbild – und über das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein. Nicole Jäger findet: Jede Frau ist mehr als eine Zahl auf einer Waage und hat ein Recht auf ein gutes Körpergefühl, auf Weiblichkeit und darauf, verdammt glücklich zu sein – und auf all die Katastrophen, die ihr auf dem Weg dahin passieren. Ein Blick auf Weiblichkeit aus der Sicht einer dicken Frau – witzig, unverblümt und schonungslos ehrlich. «Nicole Jäger ermuntert dazu, sich ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen und absurde Schönheitsideale zu vergessen. Bewundernswert.» Stern
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicole Jäger
Nicht direkt perfekt
Die nackte Wahrheit übers Frausein
Über dieses Buch
Die nackte Wahrheit übers Frausein
Warum scheitern Frauen immer wieder an den eigenen Ansprüchen? Und warum ziehen sie alle beim Sex den Bauch ein?
Dies ist ein Buch über alle Facetten der Weiblichkeit: die schönen, weniger schönen und manchmal auch absurden. Ein Buch über Beziehungen, Sex, Sieben-Achtel-Hosen, Body Shaming, Besuche beim Frauenarzt, Diät-Shakes, Dating-Plattformen, das eigene Spiegelbild – und über das permanente Gefühl, nicht perfekt zu sein.
Nicole Jäger findet: Jede Frau ist mehr als eine Zahl auf einer Waage und hat ein Recht auf ein gutes Körpergefühl, auf Weiblichkeit und darauf, verdammt glücklich zu sein – und auf all die Katastrophen, die ihr auf dem Weg dahin passieren.
Ein Blick auf Weiblichkeit aus der Sicht einer dicken Frau – witzig, unverblümt und schonungslos ehrlich.
«Nicole Jäger ermuntert dazu, sich ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen und absurde Schönheitsideale zu vergessen. Bewundernswert.» Stern
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung und Motiv Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Foto Antonina Gern
ISBN 978-3-644-40163-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
I’ve made a lot mistakes in my life,
but if every single one had to happen to make sure I was right here,
right now, to meet you, then I forgive myself for them all.
K. Towne Jr.
Für meine Muse.
Sie ist mein Grund für alles.
Prolog – Es fickt sich schlecht mit eingezogenem Bauch
Er ist größer als ich. Das sind sie meistens, die Männer, mit denen ich aktuell etwas habe. «Etwas haben.» Ein toller Ausdruck; klingt auch irgendwie netter als «eine dieser Fickbeziehungen». Anständiger. Gehaltvoller.
Er ist Ende 30. Glaube ich zumindest. Ich habe nicht so ganz genau zugehört – musste ich auch nicht, denn es ist eine dieser typischen Geschichten.
Ein Club, ein Abend, ein angekratztes Ego, ein paar Gin, und plötzlich war er da. Mr. «Hey, ganz alleine hier?»
Das, was an mir bei klarem Verstand ist, verdreht schon die Augen, als er nur zum Sprechen ansetzt. Aber was soll’s.
«Hey! Ja, in der Tat bin ich allein hier, du auch, wie ich sehe!»
Wenn das mal nicht schlagfertig war, Nicole. Wahnsinn.
Ich hasse Smalltalk. Vermutlich, weil ich es einfach nicht kann. Aber diese Gespräche sind immer so vorhersehbar! Ein Austausch von Belanglosigkeiten, die einem bestimmten Schema folgen.
Also halte ich mich an meinem Glas fest und lehne mich an den Tresen der viel zu überfüllten und viel zu lauten Bar. Ich könnte mich auch setzen, aber ich sitze grundsätzlich nicht auf Barhockern. Mein Hintern ist dafür viel zu breit, und ich mache mir Gedanken darüber, wie das wohl von hinten aussieht. Bei meinem Gewicht.
Ich mache mir immer Gedanken darüber, wie ich wohl gerade aussehe.
Immer.
Jetzt stellt er sich gleich vor, denke ich. Sagt mir seinen Namen, den ich, noch während er ihn ausspricht, sofort wieder vergessen werde. Das ist eines meiner nutzlosesten Talente: Ich kann alles, was mich langweilt, vergessen, noch während ich es höre. Und ich bin schnell gelangweilt.
Er heißt «Irgendein Männername». Er wird ihn im Laufe des Abends noch zwei- bis dreimal wiederholen, bis es mir zu peinlich wird, nachzufragen.
Zwei Finger zum Gruß an den Barmann. Er schenkt Gin nach. Mit Schweppes anstatt irgendeines anständigen Tonicwater. Belangloses Tonic zu belanglosem Typen. Passt.
Gleich erzählt er mir, dass er neu ist in Hamburg oder schon ewig nicht mehr in diesem Club war. Ich werde nicken und lächeln. Das kann ich gut. Interessiert wirken und dabei freundlich gucken. Nicht, dass mein Lächeln meine Augen erreichen würde, aber das sieht man bei diesem schummrigen Licht ohnehin nicht. Ich mag schummriges Licht, das lässt mich irgendwie weichgezeichneter wirken und schmaler. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Nicht schmal genug für einen Barhocker, aber doch etwas weniger von allem.
Er arbeitet irgendwo. Es interessiert mich nicht, und als er fragt, was ich so mache, lüge ich. Irgendwas, das keine lange Erklärung braucht. Keine Nachfrage.
Er brüllt mich an. Warum er gerade hier ist und was seine Freunde so machen. Er kann nicht anders, es ist zu laut für eine Unterhaltung in normaler Lautstärke, was ihm zupasskommt, so kann er näher rücken. Also rückt er. Er trinkt Guinness. Ich mag kein Bier, aber Guinness ist schon okay. Wenigstens kein Becks.
Er studierte Informatik. Aha, sage ich. Guinness riecht im Atem übrigens auch nicht viel besser als Becks, denke ich, während er Anstalten macht, mit mir irgendwohin zu gehen, wo es ruhiger ist. Nach draußen. Eine wahnsinnig gute Idee, möchte man meinen. Allerdings meint man das auch nur, wenn man den Kiez nicht kennt. Die Reeperbahn. Oder den Hamburger Berg, der auch mitten auf dem Kiez liegt. Dieser Club hier liegt inmitten anderer Clubs; einer heißt origineller als der andere. Hip. Ein bisschen fancy. All das, was ich noch nie war und hoffentlich auch nie werde. Fancy. Ein Wort wie «Boy» oder «Body».
Der Body von dem Boy auf der anderen Straßenseite ist voll nice. Ich möchte in meinen Gin kotzen, wenn ich so etwas höre, und muss doch grinsen, als ich es denke. Der Boy neben mir ist auch nice, das muss ich ihm lassen, und so wie er guckt, werde ich schon bald herausfinden, wie sein Body aussieht. Er ist schlank, ganz im Gegensatz zu mir. Und er gibt sich Mühe. Das tut er wirklich, und bestimmt ist er auch ganz nett und sogar sehr charmant.
Die Nacht ist lau, die Straße voll und dreckig, und ich mag das irgendwie. An uns zieht eine Horde Kerle vorbei, ich glaube, es ist der 23. Junggesellenabschied, den ich heute Abend zähle. Ein Typ in einem Plüsch-Peniskostüm, der Kondome gegen Geld und «Kurze» gegen «Küsschen» tauscht. So zumindest steht es auf dem Schild, das um seinen Hals hängt.
Ich will das blöd finden. Ich will heute Abend alles blöd finden, aber es amüsiert mich irgendwie. Schlechter Humor und ich – uns verbindet eine lange Beziehung.
Ich erkaufe mir einen Kurzen, mein Begleiter ein Kondom. Subtil wie ein Vorschlaghammer, der Gute. Wenn er mir jetzt noch zuzwinkert, muss ich wieder reingehen und durchs Klofenster verschwinden. Er zwinkert nicht. Dafür holt er mir «noch einmal das da?» und zeigt auf meinen halbvollen Plastikbecher. Ich trinke nicht gern aus Plastikbechern, aber auf dem Kiez herrscht seit einiger Zeit Flaschenverbot, und so füllt man jedes Getränk um, wenn man einen Laden verlässt.
Er fragt kurz, ob er mich eben allein lassen kann. Ich nicke und lächle und sage irgendwas wie «Aber nur, wenn du auch gleich zurückkommst!», woraufhin er mit einem Strahlen in die Menschenmenge im Club eintaucht.
Die Anmerkung war nur halb scherzhaft gemeint, denn tatsächlich frage ich mich, ob er zurückkommen wird. Gar nicht mal, weil er so nett oder vielleicht sogar ein klein wenig sexy ist, das ist er ohne Zweifel, sondern vielmehr, weil es da etwas in mir gibt, das im Gegensatz zu meinem Auftreten gar nicht so selbstbewusst, tough und divenhaft ist. Und dieser Teil von mir fragt sich, warum er mich angräbt und nicht eine der anderen Frauen hier. Eine jüngere, schönere oder vor allem – natürlich – schlankere.
Ich drehe mich zur Seite und betrachte verstohlen mein Spiegelbild in der dunklen Scheibe des Clubs. Eine Hand auf den Bauch. Haltung korrigieren. Ich bilde mir ein, ein wenig schlanker auszusehen als noch heute Morgen vor dem Spiegel zu Hause, und natürlich ist mir klar, dass das Unfug ist.
Ich sehe gut aus. Das finde ich zumindest. Tatsächlich finde ich mich hübsch und an den meisten Tagen sogar attraktiv. Trotz meiner breiten Hüften. Manchmal sogar gerade wegen dieser. Ich bin eine dicke Frau. Unbestritten. Und das ist meistens okay. Heute Abend aber irgendwie nicht. Heute Abend ist nichts okay. Außerdem habe ich dicke Beine, und dieses Kleid, es trägt bestimmt auf, und Hunger habe ich auch, und Bad Hair Day, und der Typ, er steckt vermutlich im Klofenster fest, während ich mich hier zum Affen mache.
Es dauert keine fünf Minuten, dann ist er zurück, mit zwei Bechern und einem Grinsen, das breit und hell ist und «Du bist ja noch da» zu sagen scheint. Natürlich bin ich noch da. Ich warte auf den Alkohol, mit dem ich versuche, diese Mischung aus angeknackstem Selbstwertgefühl und Minderwertigkeitskomplex zu ertränken, die mich heute Abend überhaupt erst hat losziehen lassen. Bisher mit mäßigem Erfolg, Gefühle sind ziemlich gute Schwimmer.
Es war eigentlich gar keine große Sache, das mit dem anderen und mir. Und am Ende war ich es, die ging, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Irgendwie war ich wohl doch verknallter, als ich es habe sein wollen.
Ich bin verletzt. Weniger von der Trennung selbst, als von dem Grund dafür.
Wir standen in seiner Wohnung, ich mit einem Glas Wein in der Hand, er mit Rum Cola. Ich sollte das mit dem Wein lassen, davon bekomme ich Wadenkrämpfe, aber es steht mir, und ich wollte hübsch, anziehend und sexy sein. Für ihn. Klar.
Wir gingen schon eine Weile miteinander. Klassisches Miteinander-Ausgehen, tatsächlich. Restaurants, Clubs, Kinos, Küsse, Händchenhalten. Ein bisschen mehr.
Kein Sex.
Nun denk bitte nicht, dass ich immer so anständig bin. Irgendwo zwischen Bienchen, Blümchen und meinem 30. Lebensjahr ging mir mein Sinn für Anstand und Moral in Sachen Sex verloren, und so warte ich selten eine Ewigkeit auf Sex, nur weil es schicklich wäre, das zu tun.
Nein, es ging von ihm aus, und da ich nur selten aufdringlich sein möchte, ließ ich ihm Zeit. Keine Ahnung, an wie vielen Abenden ich irgendwo stand und mir vorkam wie in einem verschissenen Highschool-Musical – gemeinsam zum Abschlussball, aber bloß nie weiter, denn unsere Eltern lungern zu Hause herum! Nur dass ich noch nie auf einer Highschool war und schon vor über 15 Jahren daheim ausgezogen bin.
An diesem Abend war es anders. Wir knutschten rum. Eines kam zum anderen, wir landeten im Bett, und er landete in meinem Mund. Das ist okay, ich stehe auf Oralsex, und ich stand auf ihn, also fand ich das ziemlich sexy. Er auch.
Mehr aber auch nicht.
«Weißt du …», begann er, als ich ein wenig näher rückte, «… es ist nicht so, dass ich dich nicht mögen würde …»
Autsch. Kennst du diesen Moment, wenn du dir am liebsten deine Finger durch die Ohren direkt ins Hirn bohren möchtest, weil du genau weißt, dass du auf keinen Fall hören willst, was jetzt kommt?
Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem beschämendsten Herzschmerzmoment aller Zeiten.
«… Ich möchte nicht mit dir schlafen. Ich habe da lange drüber nachgedacht und auch überlegt, ob ich mich da irgendwie doch fügen kann. Wir verstehen uns toll, du bist smart, hübsch und meine Traumfrau, und ich bin auch total traurig, dass das so ist, wie es ist, aber …»
Ich setzte mich aufrecht hin, legte die Beine über die Bettkante, schloss kurz die Augen, bevor ich aufstand, und atmete noch einmal tief durch. Den Schlag, mit dem er mich gleich auf die Matte schicken würde, konnte ich nicht gut parieren. Er hatte darüber nachgedacht, ob er sich irgendwie fügen könne. So als überlegte er, ob und wie er seinen Ekel vergessen könnte während der Zeit, in der er mich nackt sehen müsste. Was im Übrigen noch nie der Fall gewesen war.
«… Ich meine das nicht böse, du bist mir nur einfach zu dick.»
Ich stand auf, stellte mich neben das Bett und schaute ihn an. Mir fehlen nur sehr selten die Worte, aber in diesem Moment bekam ich nicht viel anderes heraus als: «Und das fällt dir jetzt auf …?!»
Er erklärte sich, als würde er über ein Kuchenrezept sprechen: «Du musst das verstehen …»
Einen Scheiß muss ich, dachte ein Teil von mir, während der andere Teil in Gedanken schon eine Liste mit all den Dingen erstellte, die an mir nicht perfekt genug sind. Und diese Liste ist lang. Das war sie schon immer.
«… Ich habe eine lange Beziehung hinter mir und danach beschlossen, bei Frauen keine Kompromisse mehr zu machen.»
Cellulite. Dünnes Haar. Brüchige Nägel. Tatsächlich um die 80 Kilo zu viel Gewicht. Noch immer. Nach all den Jahren und all den verlorenen Kilos. Hängende Haut.
«… das ist echt alles toll mit dir …»
Meine Brüste könnten größer sein. Ich bin zu blass. Ich müsste größer sein bei meinem Gewicht. Mein linkes Bein ist dicker als das rechte und nicht so beweglich. Fettschürze. Knubbelige kleine Zehen. Zu viel von allem.
Plötzlich fühlte ich mich klein. Hässlich und gedemütigt.
«… und du bist total süß, und ich mag es, wie du dich um uns kümmerst und so …»
Und so.
«Aber ich will keinen Geschlechtsverkehr mit dir. Also, blasen ist okay, aber mehr auch nicht …»
Oh! OH! Das war natürlich sehr großzügig von ihm.
Ich hatte sofort einen Ohrwurm im Kopf: «I am to fat to fuck, all I can do is suck.» Eigentlich wäre das lustig gewesen. In einem Film oder so. Hier, an der Bettkante, die uns für alle Zeiten voneinander trennen würde, war es alles andere als lustig.
«Aber hey, lass uns doch einfach erst mal so weitermachen! Wir verstehen uns doch toll …»
Wenn er jetzt gesagt hätte, dass wir doch Freunde bleiben können, hätte ich ihm den Kopf abgebissen. Wie viel Kalorien hat wohl ein Kopf?
«Du willst doch noch weiter abnehmen, oder? Mach das doch. 60 Kilo oder wie viel trennen dich von einer guten Figur? 100? Etwa? Du hast doch schon so viel geschafft. Und wenn du dann schlank bist …»
Ich atmete tief ein, um den Kloß im Hals zu unterdrücken und um zu verhindern, dass sich die Schleusen meiner Augen öffneten. Hier würde ich keine einzige Träne vergießen.
«… und dich hast operieren lassen, wegen der vielen Haut, das ist ja auch irgendwie nicht so schön, das musst du einsehen, aber das kannst du ja auch selbst nicht schön finden oder? Na, jedenfalls nach der Operation …»
Ich hielt den Atem an. Den Blick starr auf ihn gerichtet. Ich blinzelte nicht. Ich sagte kein Wort, während mein Herz mir bis zum Hals schlug und sich mit jedem Schlag einen Kratzer holte an den scharfen Kanten seiner Worte.
«… da würde ich mir dann überlegen, ob wir es mal miteinander probieren.»
Mir entglitt meine Mimik, ich konnte es spüren, mich aber kaum bewegen.
Vor Scham, und vor Wut über ihn und über mich und noch mehr Scham.
Ich fühlte mich nackt, obwohl ich, im Gegensatz zu ihm, angezogen war. Ich fühlte mich vorgeführt, dumm, fett und wertlos, und sagte ich schon dumm?
Es war ja nicht so, dass ich es nicht bereits geahnt hätte; seine Körpersprache und sein Handeln hatten mir längst verraten, dass er irgendwie nicht so recht auf mich stand, auch wenn er sich durchaus gerne bedienen ließ. Ich bin übergewichtig, nicht bescheuert oder ohne jedes Gespür.
Ich atmete aus.
«… Okay für dich?»
Okay für mich? In meinem Kopf begannen Sirenen zu heulen. Wild und durcheinander. Wüste Beschimpfungen, miesester Art. Nicht unter der Gürtellinie, sondern unter der Erdoberfläche. Was bildete sich dieser hässliche Kackvogel ein? Denn attraktiv war er tatsächlich nicht. War mir egal, ich mochte ihn, scheiß drauf, dass er nicht mein Typ war. Man sieht nur mit dem Herzen gut und all diesen Quatsch.
Alter, du bist selbst zu dick, hast du jemals in den Spiegel geguckt?! Zu klein, du UND dein bester Freund! Beschissen gekleidet übrigens auch! Wer zieht dich eigentlich an? Deine blinde Großmutter? Warum wechselst du so selten dein Shirt? Und diese bekackte Sonnenbrille, mit der du aussiehst wie ein dekorierter Blumenkohl! Mann. Nein, du bist NICHT interessant, und dein Beruf ist es erst recht nicht. Meine Freunde hassen dich übrigens, wusstest du das? Ist echt wahr. Die lachen dich aus, ich verteidige dich mit den Worten, man müsse dich erst einmal richtig kennenlernen, dann wisse man dich besser zu schätzen. Ich Idiotin, denn das Einzige, was man dann von dir erfährt, ist, dass du noch langweiliger bist als deine Inneneinrichtung. Wer zeigt denn bitte meinen Freundinnen, die mit mir bei dir zu Besuch sind, wie schön leise die Schubladen in der Küche zugehen?! Du tust das! Und bist dann auch noch mächtig stolz darauf, dass du weder Freunde noch ein Hobby hast oder gar ein richtiges Leben. Du stehst schief, und du gehst, als hättest du Magenkrämpfe, und deine Hose sitzt nie. Einfach nie. Du bist nicht einmal richtig witzig, und vor allem bist du nicht sonderlich schlau und …
«… Hey, alles gut?»
Ich sagte nichts von alldem. Aus Tausenden Gründen. Weil ich Angst hatte, nicht mehr aufhören zu können, gemein zu sein, weil ich mir selbst kindisch und albern vorkäme und mir nicht die Blöße geben wollte, aus meiner Verletzung heraus zu reagieren. Ich wollte ihm diesen Moment nicht gönnen. Diesen intimen, schmerzlichen Augenblick, in dem ich mich wie ein Wegwerfprodukt fühlte. Wenn ich losgeschrien hätte, hätte ich angefangen zu heulen, weil ich immer heule, wenn ich wütend bin. Und das wirkt dann allenfalls verzweifelt, aber sicher nicht mehr würdevoll. Ich fühlte mich komplett bescheuert, aber das musste er ja nicht wissen. Rosarote Brillen können einem also tatsächlich aus dem Gesicht geschlagen werden. Fühlt sich an wie Pflaster abreißen. Ein sehr großes Pflaster, das aus Versehen direkt auf der Wunde klebt.
Ich atmete noch einmal tief ein und lächelte, während ich meine Schuhe aufhob. Langsam und mit Bedacht. Zum einen, weil das Adrenalin in meinem Blut mich schwindelig machte, zum anderen, weil ich so gleichgültig wie möglich wirken wollte. The Queen is not amused, aber sie trägt es mit Fassung.
Irgendwo hier unten muss sich auch meine Würde aufhalten, dachte ich, denn die ist mir irgendwo zwischen dem Lutschen seines Schwanzes und seiner Ansprache aus dem Bett gefallen. Was soll’s. Sie ist anhänglich, die findet schon den Weg nach Hause.
Ohne ein Wort drehte ich mich um und ging. Raus aus dem Schlafzimmer. Ich musste hier weg. Weg von diesem Ort, weg von diesem Mann, am liebsten weg von mir und nur raus, raus aus dieser so entsetzlich stickigen Situation. Im Flur nahm ich meine Tasche, griff meinen Mantel vom Haken, ging zur Tür, öffnete sie und warf sie hinter mir ins Schloss.
Ich konnte hören, wie er mir hinterherlief in einer dieser schlabberigen Shorts, die er immer trägt. Liebevoll spleenig nannte ich seinen schlechten Geschmack und sein ungepflegtes Erscheinen. Das Geräusch meiner nackten Füße auf den Treppenstufen passte zum Rhythmus meiner Gedanken: Idiotin, patsch, Idiotin, patsch, Idiotin …
«Hey, nun bleib doch. Lass uns doch reden. Wo willst du denn jetzt noch hin? Es ist mitten in der …»
In dem Moment übertönte das Quietschen der Haustür seine Worte.
Ich stand im Freien, barfuß. War vielleicht auch besser so, auf den elend hohen Absätzen läuft es sich eh nicht so gut. Aber ich wollte ja sexy sein für ihn. Atemberaubend in diesem Kleid, hatte ich noch am frühen Abend gedacht. Ein Elefant auf Stelzen, dachte ich jetzt. Idiotin.
Ich eilte zum Wagen, warf alles wie immer auf den Beifahrersitz, kramte meinen Schlüssel aus der Tasche, startete den Motor und setzte rückwärts aus der Parklücke.
Wenn du dir an dieser Stelle wünschen solltest, dass ich ihn dabei aus Versehen über den Haufen gefahren habe, während er halb nackt und mit einem Bouquet an Entschuldigungen hinter mir herlief, dann mag ich die Art, wie du denkst – aber leider war das Drama mehr in meinem Kopf und weniger auf der Straße.
Es wurden keine heiseren Liebesschwüre in die sternenklare Nacht gerufen, niemand hielt mich auf, keine Geigen spielten «unser Lied».
Ein paar Kilometer weiter bog ich in einen Feldweg ein, blieb stehen, zog die Handbremse an und schrie mir laut und obszön schimpfend die Seele aus dem Leib, während ich mir die Fäuste am Lenkrad wund schlug. Und dann, dort, allein und weit genug weg von allem, heulte ich wie ein Baby.
Egal. Oder auch nicht egal, aber jetzt ist es vorbei. Schon seit einigen Wochen, und ich bin es leid, das alles in mich hineinzufressen. Das genau tue ich nämlich, ich esse Gefühle weg, ich tröste mich über gescheiterte Beziehungen mit Sex hinweg, und ich schiele auf alle reflektierenden Oberflächen, um zu kontrollieren, wie ich gerade aussehe. Er hingegen erzählt mir gerade von seiner Ex, einer frischen Trennung und wie hart das alles war. Das beste Thema für ein Kennenlernen, aber es klärt die Fronten. Er will Ablenkung von ihr, ich will Ablenkung von mir. Ja, schon klar, dass das kein schönes Ende nehmen kann. One-Night-Stands sind nur selten gut, und ich bin noch nicht einmal der Typ dafür. Aber er sieht gut aus, ich will mich begehrt fühlen, und jetzt sag mir nicht, du hättest das noch nie gemacht!
Wir landen bei mir. Wir landen im Bett. Er reißt sich und mir die Kleider vom Leib, und wir treiben es wie zwei Verliebte in einem Hollywoodstreifen, während er mich dabei die geschwungene Wendeltreppe hinauf in den Westflügel des Anwesens trägt.
Nicht.
Durchaus werden wir an diesem Abend noch miteinander im Bett landen. Er wird vögeln, wie er ist, nett, bemüht, lauwarm und angetrunken, während ich mir Gedanken darüber mache, wie ich wohl gerade aussehe. Beim Sex? Aber natürlich, gerade dabei! Denn das ist die beste Gelegenheit, um sich zu fragen: Habe ich eigentlich ein Doppelkinn, wenn ich auf dem Rücken liege und die Beine anziehe, und wenn ja, sieht er das? Also strecke ich den Kopf etwas nach hinten. Vermutlich sehe ich dadurch nun aus wie eine dicke Schildkröte, nur ohne Panzer und in Rosa.
Er wird sich übrigens als Showficker erweisen. Einer dieser Kerle, die sich selbst enorm unwiderstehlich finden, wenn gerade reichlich Blut in die Lendengegend schießt. Es würde für einen Hochglanzporno reichen, und hätte ich einen Spiegel an der Decke, würde er unten liegen und sich selbst dabei zusehen. Ich sitze übrigens nie oben, aber dazu kommen wir später.
Er kompensiert den fehlenden Spiegel durch Akrobatik. Als Kunstturner bekäme er vermutlich Bestnoten, ich hingegen habe gleich einen Knoten in den Beinen und frage mich, ob er eigentlich weiß, dass ihm zwei Haare aus der Nase sprießen. Vermutlich ist es gerade nicht der günstigste Augenblick, ihn darauf anzusprechen, oder?
Er wechselt die Stellung. Mal wieder. Dieses Mal in eine für mich sehr günstige. «Hündchenstellung», wie er es eben nannte. Oh Mann, echt jetzt, Hündchen? Wer hat den denn aufgeklärt, die Bravo? Ein Gedanke, der mich zum Kichern bringt, denn mich klärte tatsächlich die Bravo auf. Von der weiß ich auch, dass man als Frau niedlich, schmal, zurückhaltend und begehrenswert sein soll. Okay. Okay! Ich versuch’s ja, ich versuche es wirklich, und während er beherzt meine Hüften umklammert, ziehe ich reflexhaft den Bauch ein. Für den Bruchteil eines Augenblicks denke ich tatsächlich, es würde mich schmaler aussehen lassen, schlanker, zierlicher, wenn weder Bauch noch Brüste nach unten hängen, während er sich hinter mir abrackert. Brüste kann man übrigens nicht einziehen, und wenn ich auf dem Rücken liege, dann stehen die auch nicht so hübsch ab, sondern machen irgendwie, was sie wollen. «Megaheiß aussehen» wollen sie anscheinend nicht.
Das sind die Gedanken, die ich mir mache. Ob es unansehnlich ist, wenn ich auf allen vieren in der Matratze versinke, und ob eigentlich mein Hintern beim Vögeln im Weg ist, oder meine Oberschenkel, und überhaupt und sowieso kenne ich mein Spiegelbild. Sieht er mich gerade genauso, wie ich mich heute sehe? Na, dann gute Nacht.
Am Ende werde ich mir die Decke vorhalten, während ich kurz ins Bad entschwinde. Oder ein Handtuch. Egal, Hauptsache, irgendwas. Mir wird klar sein, wie albern es ist, sich verstecken zu wollen, obwohl man es gerade eben noch getrieben hat. Meine guten, alten Freunde, die Körperkomplexe, sind einfach ein wenig lichtscheu.
Ich könnte mich natürlich auch galant in seinem Herrenhemd im fahlen Schein des Mondes an den Türrahmen lehnen und verführerische Dinge sagen, aber die Wahrheit ist viel banaler: Ich muss Pipi, meine Mascara brennt in den Augen, er hat kein Hemd, und in seinem Shirt würde ich aussehen wie eine Presswurst mit Brüsten.
Die Nacht endet still. Er möchte zum Frühstück bleiben. Ich möchte vor dem ersten Kaffee des Tages nicht reden, also komplimentiere ich ihn aus dem Haus. Wir tauschen Nummern. Sinnlos, denn niemand wird die des anderen wählen. Wir werden uns nie wiedersehen. Das ist okay so.
Nicht sonderlich rühmlich, dieses Kapitel meines Lebens, aber dennoch ein sehr wichtiges, denn es markiert einen Wendepunkt. Ich war jahrelang schwer damit beschäftigt, mich um mein Gewicht zu kümmern, bis ich irgendwann feststellte, dass ich noch ein wenig mehr bin als irgendeine Zahl auf irgendeiner Waage. Ich bin nämlich auch ein Mädchen, eine Frau, eine Geliebte, eine Schwester, eine Drama Queen, ein Desastermagnet, ein Beziehungsmonk und ein Date-Verpatzer. Ich bin die, die in Umkleidekabinen ausrastet und vom Badewannenrand kippt, wenn sie versucht, sich so zu rasieren, wie die Tanten in der Werbung es tun. Mal im Ernst, kann das irgendjemand, der nicht zehn Jahre auf einer Akrobatenschule war?
Was heißt es denn nun, eine Frau zu sein? Eine dicke Frau in meinem Fall, aber das ist nur ein Detail. Und was bleibt von mir übrig, wenn ich nicht den ganzen Tag darüber nachdenke, wie ich wohl aussehe – und denke ich eigentlich mal einen Tag lang nicht darüber nach?
Mein Name ist Nicole Jäger, ich bin Mitte 30, übergewichtig, katastrophenerprobt, führe eine eigenartige Beziehung mit meinem Selbstwertgefühl, die man auf Facebook wohl mit «Es ist kompliziert» umschreiben würde, und auch wenn ich ein Weib aus Leidenschaft bin, so habe ich mir das mit dem Frausein irgendwie einfacher vorgestellt.
Was ich gern mit Anfang 20 über das Leben gewusst hätte
Einen Spätzünder. So nannte man Mädchen wie mich damals. Hochgewachsen, schon recht früh Brüste, sehr introvertiert und keine Ahnung, was die ganze Aufregung um das Erwachsenwerden eigentlich soll. Außer, dass plötzlich alles komplizierter wurde mit dem Einsetzen dessen, was meine Eltern immer recht abfällig als «die rebellische Phase» bezeichneten. «Die Phase» bezeichnete den Zeitraum vom 12. bis zum 19. Lebensjahr, und «rebellisch» war an mir alles, was nicht in den Erziehungskodex oder das Weltbild meiner Altvorderen passte.
Die Pubertät. Eine schreckliche Zeit, in der Väter und Mütter mit aller Macht anfangen, ihren Kindern auf den Keks zu gehen, und man felsenfest davon überzeugt ist, dass alle anderen plötzlich durchdrehen, nur man selbst nicht. Der eigene Körper schlägt merkwürdige Kapriolen, überall wachsen Haare, alles schwillt an, man ist den ganzen Tag müde und könnte nachts Bäume ausreißen, Jungs sind nicht mehr bäh, sondern irgendwie spannend, und nichts funktioniert mehr so, wie es eigentlich sollte. Kurzum, es ist fürchterlich.
Ich war da keine Ausnahme. Ich war immer verliebt, und ich hatte immer Liebeskummer. Beides meistens zeitgleich. Ich fühlte mich gänzlich unverstanden von ausnahmslos jedem, außer von meinen Freunden natürlich, und alles, was mich interessierte, war nicht länger nur spannend, sondern absolut überlebensnotwendig.
Ich ließ mich piercen, ich ließ mich tätowieren, ich färbte mir die Haare in allen erdenklichen Farben, ich schnitt mir beinahe die Beine ab beim ersten Versuch, mich zu rasieren, und das Thema Jungs war in meinen jungen Jahren ein wahres Elend. Und in den nicht mehr ganz so jungen auch.
Meinen ersten Kuss erlebte ich im Alter von 14. Beim Flaschendrehen. Ich hatte nicht gewonnen – ein Junge hatte verloren und musste alle anwesenden Mädchen küssen. Ich war eine von vieren und würde gern behaupten, an diesem Kuss sei nichts Besonderes gewesen. Aber warum kann ich mich dann bis heute so gut daran erinnern?
Er hieß Johannes, war groß, dunkelhaarig und der Schwarm aller Mädchen.
Kennt ihr diese entzückenden Jugendfilme, in denen das hässliche Entlein mit dem sehr süßen, aber auch zurückhaltenden Jungen im Kleiderschrank eingesperrt wird, weil beide eine Wette verloren haben? Anfangs schüchtern, später forscher, küssen sie sich, und nur wenige Tage später nimmt sie die Brille ab, löst ihr Zopfgummi, und schon sieht sie aus wie der feuchte Traum aller Jungs unter 17.
Eine Brille hatte ich damals auch. Eine lilafarbene Brille mit dünnem Rand, die eigentlich zu klein war für mein Gesicht. Generell war mein Stil damals atemberaubend gruselig. Aber hey, was erwartest du? Ich bin in den frühen 80ern geboren – auszusehen, als sei man von einem Betrunkenen gestylt worden, war damals Pflicht, und Pflichten nehme ich sehr ernst, weswegen meine 80er-Phase anhielt, bis ich Ende 20 war. Aber dazu später mehr.
Ich war genauso groß wie mein damaliger Kusspartner, was Jungs schon immer ganz besonders anziehend fanden, hatte mittellanges, straßenköterfarbenes Haar und trug stets und ständig einen grünen Haarreif aus Plastik, dessen Farbe an den Rändern schon ein wenig abgeschabt war.
Meine Pullover waren meist lang und weiß, meine Leggings lila oder gerne auch mal schwarz-weiß kariert, sodass ich aussah wie die dicke Cousine eines Harlekins. Meine Turnschuhe wirkten selbst in neuem Zustand abgetragen und müffelten, wenn ich sie auszog, was an den dicken, weißen Socken gelegen haben könnte, die ich unabhängig von Wind und Wetter trug. Angeblich, so der elterliche Rat, verhinderte das «Stinkefüße». Joah, hat hervorragend funktioniert.
Zum krönenden Abschluss trug ich um meinen Bauch – weil das damals alle taten – einen breiten Gürtel mit einer pizzatellergroßen Gürtelschnalle. Irgendwas in Gold.
Ich war groß für mein Alter, ich war schwer für mein Alter, ich war ein modisches Desaster auf zwei Beinen, und ich hatte ein Rückgrat von der Stabilität eines Gummiwurms.
Am Kuss-Tag trug ich einen grünen Pullover, der ein wenig zu kurz war, besonders an den Ärmeln, und dazu eine Thermojeans mit Bündchen. Thermojeans, das sind Kleidungsstücke, die nur Eltern aussuchen, und ich bin überzeugt, dass sie das aus zwei Gründen tun: entweder aus Angst vor dem drohenden Kältetod des Kükens. Besonders im Frühling.
Oder – und das halte ich für weitaus wahrscheinlicher – um sich den ganzen Tag darüber totzulachen, dass ihr Sprössling wirklich auf jeden Scheiß hereinfällt. In die gleiche Kategorie gehören übrigens auch Feinripp-Unterhemden, «damit die Nieren nicht frieren, Kind», diese enorm warmen Ganzkopf-Mützen, bei denen nur das Gesicht herausguckt, in meinem Fall selbst gestrickt von Oma in «Vor 10 Jahren war das noch modern»-Braun-Orange, sowie alle Kleidungsstücke, die mit den Worten «Das ist doch noch gut», «Die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie so was anziehen könnten», «Ich habe da einen Flicken draufgenäht» oder «Das ist eigentlich Papas, aber …» angepriesen werden.
An diesem Tag dort im Hinterhof einer Klassenkameradin hatte ich also zum ersten Mal die Chance, einen Jungen zu küssen. Hätte ich gewusst, dass es auch für lange Zeit die letzte bleiben würde, hätte ich mich vielleicht ein wenig mehr ins Zeug gelegt. Oder mir zumindest die Haare gekämmt.
«Wahrheit oder Pflicht» hieß das Spiel, und die Regeln waren einfach. Zeigt die Flasche auf dich, kannst du dir überlegen, ob du eine peinliche Geschichte preisgibst, über die dann alle lästern, oder ob du dich vor versammelter Mannschaft bei irgendeiner blödsinnigen Aufgabe zum Vollhorst machst, worüber dann ebenfalls alle lästern. Es gab durchaus die Regel, dass kein Geheimnis die Runde verlassen würde. Alles, was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas. Eine gute Regel, eine wichtige Regel – eine, an die sich selbstverständlich niemand hält.
Ich war aufgeregt, als die Flasche auf Johannes zeigte, denn insgeheim war ich ein bisschen verknallt in diesen Jungen. Kunststück, ich war in jeden dritten Jungen verknallt, bis ich Abitur machte, und ich glaube, es hat nie zurückgeknallt.
Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen. Anna, Sarah, Marie und ich, und dann löste Johannes seine Flaschendreh-Schulden ein, indem er uns der Reihe nach küsste.
Mit Zunge.
«Mit Zunge» war als Begriff für uns damals in etwa so pornoesk wie heute das Wort Analsex. Man hört es, und alle kichern.
Ich war die Letzte in der Reihe und malte mir noch aus, wie spannend das alles sein würde, als es auch schon vorbei war. Johannes kam nah an mich heran, kräuselte die Nase und schob mir seine Zunge so tief in den Mund, dass es sich anfühlte, als würde eine sehr hektische Scholle versuchen, in meinen Hals zu gucken. Dann rührte er einmal großzügig speichelnd um, und schon war es vorbei. Mein erster Kuss. Mit Zunge.
Wie alle Mädchen beschwerte auch ich mich danach lautstark darüber, wie eklig und peinlich das gewesen sei. In Wirklichkeit fand ich es toll. Irgendwie. Immerhin war es mein erster Kuss! Erst einige Jahre später fand ich heraus, dass man beim Küssen nicht zwangsläufig ertrinkt, dass die Scholle nach Schmetterling schmecken kann und dass auch dicke Mädchen gern geküsst werden. Sehr gern sogar. Aber an diesem Tag hatte ich davon noch keine Ahnung. Ist vielleicht auch besser so, denn sonst hätte ich es wirklich eklig finden müssen.
Wir trafen uns übrigens Jahre später wieder, Johannes und ich. Auf einem Balkon, auf irgendeiner Party, er hatte die Flasche dieses Mal in der Hand und sah noch genauso aus wie einst, nur ein paar Jahre älter. Dieses Mal fragte er mich und musste nicht erst ein Spiel verlieren, um mich zu küssen. Aus der Scholle war ein Guppy geworden, und nach Schmetterling schmeckte er nicht.
Hätten wir dieses Spiel nie gespielt, hätte Johannes mich vermutlich das erste Mal auf dem Abschlussball wahrgenommen – vorausgesetzt, ich hätte ihn mit Bowle übergossen.
Ich verfüge über eine ganze Reihe unnützer Talente, und über viele Jahre war eines davon, unsichtbar zu sein. Unfreiwillig trug ich eine Tarnkappe, die dafür sorgte, dass ich für Jungs schlicht nicht sichtbar wurde.
Diese Tarnkappe nannte sich Übergewicht.
Nun war ich natürlich auch sonst in diesen Jahren eine echte Augenweide.
Ganz besonders in der Zeit, in der eines meiner Augen mit einem hautfarbenen Pflaster verklebt wurde; das wirkte auf Jungs wie der Lichtkegel einer Taschenlampe auf einen Schwarm Kakerlaken, und ich vermute, dass meine «Doppeldecker-Zahnspange», dieses miese Teil, auch nicht sonderlich half. Und da ich mit mir und meinem Äußeren ebenso wenig zurechtkam wie mit allen anderen um mich herum, gab ich mich so unkompliziert, wie es nur ging. Ich war still, versuchte, es jedem recht zu machen, und wurde deshalb schnell von allen gemocht, jedoch «mehr so als Kumpel, weißt du?!».
Bei dem Wort Kumpel bekomme ich bis heute sofort nässenden Ausschlag – denn in einen Kumpel verliebt man sich nicht, den küsst man auch nicht, und erst recht fängt man nichts mit ihm an. Mit Kumpels betrinkt man sich, schaut Filme an oder geht aus; man hat aber sicher kein Date, und schon gar nicht hält man Händchen auf dem Schulhof.
Und so war ich bis kurz vor dem Abi der Kumpel von Daniel, von Jan und Fabian, von Benjamin ein wenig, von Timo und Max und Henning und sogar etwas mehr als ein Kumpel von Hannes, der mit mir Händchen hielt und dabei erwischt wurde, was ihm wohl derart peinlich war, dass ich einen Tag später dann wieder sein Kumpel wurde. Für immer.
Zur Erklärung: «Für immer» war ein Zeitraum, der stets mit dem Beginn der Sommerferien endete. Freunde für immer, Liebe für immer, diese eine Band – für immer.
Ich war die, auf die man sich verlassen konnte, von der man Hausaufgaben abschrieb, die zuhörte und Zeit hatte, den Geschichten von verschmähten Gefühlen und verheulten Nächten zu lauschen. Ich zeichnete Herzen auf alle Unterlagen, die ich finden konnte, und schrieb meinen Namen vor den Nachnamen desjenigen, der gerade meine große Liebe war.
Kurzum, ich war ein stinknormales dickes Mädchen mit fehlendem Rückgrat und einem Mangel an Bewusstsein für Styling oder gar meinen eigenen Körper.
Gegen all das, was «diese Phase» so mit sich bringt, war meine Kindheit im wahrsten Sinne ein Kinderspiel. Erwachsen zu werden ist aber auch ziemlich kompliziert.
Bei uns zu Hause hieß Erwachsenwerden vor allem, dass man ein paar ganz grundlegende Dinge zu verstehen hatte. Und so lernte ich, dass man bitte und danke zu sagen hat, dass man niemals unpünktlich sein sollte, weil sonst «was passiert», ich weiß bis heute nicht, was. Dass man still ist, wenn Erwachsene sich unterhalten, und dass man am besten unsichtbar ist, wenn Papa Kopfschmerzen hat, und dass nichts und niemand Spaß haben darf, sobald «deine Schwester schläft».
Ich erfuhr im Laufe der Jahre, wie wichtig es ist, Strom zu sparen, wie unerlässlich das Wissen um das ordnungsgemäße Einräumen der Spülmaschine, dass man nach 20 Uhr nicht mehr telefonieren und nach 21 Uhr nicht mehr duschen darf und dass sowieso niemand, ausnahmslos niemand, länger als maximal 10 Minuten duschen sollte. Und dass man nach dem Zubettgehen nicht mehr aufs Klo geht – egal, was die Blase dazu sagt.
Ich lernte, dass man als Frau «seinen Scheiß» bekommt, also einmal im Monat blutet. Über die Periode einer Frau gibt es viel Wichtiges zu wissen, und so lernte auch ich die drei entscheidenden Dinge:
«Du weißt doch, dass Papa das eklig findet.»
«Du bist so schlecht drauf, hast du mal wieder deinen Scheiß, oder was?»
«Das ist keine Krankheit, sondern normal, also stell dich nicht so an.»
Ich entwickelte im Handumdrehen eine Abscheu gegenüber meiner eigenen Monatsblutung und eine diffuse Scham gegenüber allem, was damit zu tun hatte. Alle drei Frauen unter unserem Dach taten stets so, als wäre es peinlich und ginge niemanden etwas an, dass wir regelmäßig bluteten. Und wenn in diesem Zusammenhang auf jemanden Rücksicht genommen werden sollte, dann doch vor allem auf Papa, der das alles abscheulich fand und nicht müde wurde zu versichern, dass das allen Männern so ginge. Hygieneartikel wurden deshalb fein säuberlich im Schrank versteckt, weil ihn wohl schon der Anblick von «Verpackungsmaterial» ekelte.
Dass es Tampons gibt, erfuhr ich dann aus der Werbung. Wie man sie richtig einsetzt und dass sie in Wirklichkeit gar nicht weh tun müssen, wenn man sich bewegt, erfuhr ich durchs Ausprobieren einige Jahre später, da lebte ich schon nicht mehr zu Hause.
Dementsprechend viel wusste ich über Sexualität. Wer blutet, kann Kinder bekommen – mehr muss man nicht wissen.
Aufgeklärt hat mich das Dr.-Sommer-Team der Bravo und ein wenig der Sexualkundeunterricht in der Schule. Zu Hause fand «die Aufklärung» an einem Dienstagabend statt. Papa saß mit Kopfhörern am PC