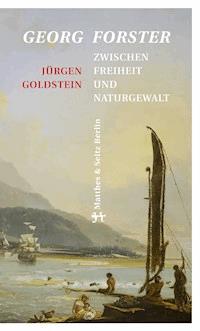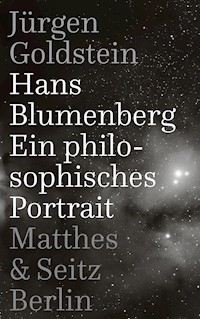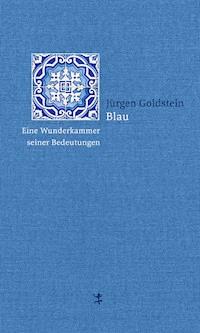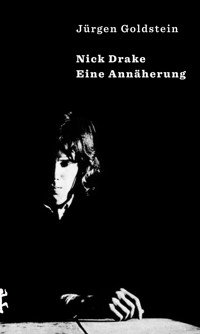
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Philosoph Jürgen Goldstein geht in diesem zärtlichen Porträt seiner lebenslangen Faszination nach, dem jung verstorbenen und doch durch seine Musik unsterblich gewordenen Nick Drake. Er begibt sich auf die Reise durch Zeit und Raum an das Grab und die Wirkungsstätten Drakes und versucht, dessen Genie der Verhaltenheit auf die Spur zu kommen. Dabei weiß er, dass auch er das Wirkliche nicht in den Griff bekommen wird: »Wir werden eine Person nicht ergründen können, sondern haben das Bild von ihr in der Schwebe zu halten. Was sich an Fakten ihres Lebens ermitteln lässt, darf nicht zu Gewichten verkommen, die unsere Imagination auf dem Boden der Tatsachen halten.« So setzt er an, Leidenschaft, Hingabe und Fantum verstehen zu lernen, zu ergründen, warum man sich unerklärlicherweise zu einer Sache, einem Menschen, einer Musik hingezogen fühlt – und sich dem Rätsel des Lebens wie der Musik anzunähern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Goldstein
Nick Drake
Eine Annäherung
Matthes & Seitz Berlin
Inhalt
Midlands, Juli 2019
CBGB, backstage, Ende der siebziger Jahre
Night Flight, 27. August 1979
Flug 2353 nach London Stansted, 24. Juli 2019
Arbeit am Mythos
Der Klang eines alten Landhauses
Eine Frage der Typographie
Englishness
Tanworth-in-Arden, Friedhof, Juli 2019
Von weit her
Far Leys, Notenblätter auf dem Flügel
Bates Lane, Tanworth-in-Arden, Juli 2019
Berühmt in Marokko, Frühjahr 1967
Cambridge, 1967 bis 1969
»River Man«
William Blake
Island Records
Joe Boyd, Winter 1968
John Wood, Sound Techniques Studio, 46a Old Church Street, London
Der Reiz der Open Tunings
»Ich kenne da jemanden in Cambridge«: Robert Kirby
Morgan Crucible Factory in Battersea, 16. April 1969
»And no one asks why I am standing here«
»Day Is Done«
Five Leaves Left, Juli 1969
John Peel Session, 5. August 1969
Abgang von der Bühne, 25. Juni 1970
Bryter Layter, März 1971
Zwei Nächte im Oktober 1971
Pink Moon, Februar 1972
Ein surrealistisches Missverständnis
Hampstead Heath, Ende 1971
Existenzielle Depression
Entwürfe und Einspielungen für ein viertes Album, Februar 1973
508 Park Avenue, Dallas, Texas, 20. Juni 1937
»Black Eyed Dog«
Far Leys, 25. November 1974
Requiem für einen Freund: »Solid Air«
Vashti Bunyan und ihre Pilgerfahrt in das einfache Leben, 1968 bis 1969
USA, 15. November 2000
4 Minuten und 22 Sekunden
St. Mary Magdalene, 27. Juli 2019
Joe Boyd: »Nick, der Normanne«
Die Verheißung der Nostalgie
London Stansted
Ein Traum
Midlands, Juli 2019
Ich fahre in die englischen Midlands, um das Grab von Nick Drake zu besuchen. Er ist auf einem Friedhof in Tanworthin-Arden beigesetzt, einem Dorf südlich von Birmingham, in der Grafschaft Warwickshire. Auf dem Weg vom Flughafen London Stansted in den Norden höre ich im Auto »Highlands« von Bob Dylan, immer und immer wieder. Die Highlands gehören zu Schottland, und zu dessen Hochland zählen auch die Cairngorm Mountains im Nordosten, über die Robert Macfarlane sagt, sie seien die Arktis Großbritanniens. Einst höher als die heutigen Alpen, haben die Elementarkräfte der Natur die aus Vulkanen geborenen Berggipfel abgetragen. Noch im Sommer beherbergen die tiefsten Bergkessel Schnee. Wer von dort stammt, kommt von weit her. Die Highlands haben mit der gemäßigten Landschaft der englischen Midlands nichts zu schaffen. Das Ungefähre ist meinem Versuch, Nick Drake näherzukommen, von Beginn an eingeschrieben.
»Feel like I’m drifting, drifting from scene to scene«, singt Dylan. Er spielt mir damit ein Motto für meine Reise zu, eine Reise, die mich nach Tanworth-in-Arden, nach Cambridge und London, nach Aix-en-Provence und Marokko führen wird, in der Wirklichkeit und in der Phantasie – doch immer um Jahrzehnte zu spät, um jenem Singer-Songwriter auch nur ein einziges Mal begegnet sein zu können, als er in französischen Cafés ein paar Songs zum Besten gab, sich im Londoner Park Hampstead Heath fotografieren ließ oder im Aufnahmestudio Sound Techniques in der Old Church Street in Chelsea seine drei Alben aufnahm. Drake hat sich in der Nacht zum 25. November 1974 das Leben genommen. Da war ich zwölf Jahre alt. Mit sechzehn habe ich ihn entdeckt, bei einem britischen Radiosender wurden nachts Songs von ihm gespielt. Eine Reise also nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Ich weiß nicht, wonach ich suche, nur dass die Zeit mich abträgt. Einen Blick auf seinen Grabstein zu werfen, wird etwas zu einem Abschluss bringen und ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt, wofür auch immer. Ein Blick zurück, ein Blick voraus. Wer sich auf Nick Drake einlässt, kann sich selbst nicht aus dem Spiel halten.
Das ungewohnte Linksfahren strengt mich an. Ich komme kaum dazu, einen Blick auf die vorbeigleitende Landschaft zu werfen. Endlich nehme ich die Ausfahrt nach Tanworth und schlage mich auf schmalen Straßen ins Landesinnere durch. Der Verkehr lässt nach, mir kommt auf dem Weg kaum noch jemand entgegen. Ich bin überrascht: Die Midlands, dieses Mittelland, das Nord- und Südengland trennt oder verbindet, je nachdem, ist kein Gebirge – habe ich mir ein Mittelgebirge vorgestellt? –, sondern eine nur leicht hügelige Ebene.
Auf der Broad Lane und über den Pfarrhaushügel Vicarage Hill fahre ich auf Tanworth zu. Wie aus dem Nichts taucht am Straßenrand das Ortsschild auf. Ich halte an und mache ein Foto, als brauchte es eines Beweises, der die Existenz dieses Ortes bezeugt. Wie überwältigend es doch ist, wenn das in Gedanken Abgetastete plötzlich fassbar wird.
Von hier sind es nur wenige Minuten und ich komme vor dem einzigen Hotel des Städtchens zu stehen, The Bell, einem dreihundert Jahre alten ehemaligen Pub mit weißer Fassade und Sprossenfenstern, in dem ich ein Zimmer reserviert habe. Schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite, liegt die Kirche St. Mary Magdalene, umsäumt von einer hüfthohen Steinmauer, an der Stockrosen aufragen und in prachtvollen Farben blühen. Der massive Turm der aus grauem Sandstein gebauten Kirche mit seiner achteckigen Spitze ist von Weitem zu sehen, wenn nicht Bäume den Blick verstellen. Die Kirche markiert den höchstgelegenen Ort in Tanworth, vom Kirchplatz aus fallen alle Straßen ab wie kleine Bäche, die den Hügel hinunterfließen. Der Kirchturm ragt in den Himmel, als sei an ihm das ganze Dorf aufgehängt.
In Tanworth-in-Arden scheint die Zeit stillzustehen. Nie zuvor ist mir diese Phrase so stimmig erschienen. Der Geburtsort Shakespeares, Stratford-upon-Avon, keine Autostunde von Tanworth entfernt, ist dem Touristenrummel erlegen. Ganze Heerscharen von Besuchergruppen folgen den in die Luft gehaltenen Regenschirmen der Fremdenführer durch die Attraktionen vermeintlicher Authentizität. Ein Taxiunternehmen namens ›Othello‹ bietet sich jenen an, die den Weg vom Geburtshaus zum Grab Shakespeares rasch hinter sich bringen wollen. Der Friedhof von Tanworth beherbergt dagegen nur drei Verstorbene, deren Ruhm die Zeit überdauert hat: Mike Hailwood, ein Motorradfahrer, der als neunmaliger Weltmeister in die Annalen des Rennsports eingegangen ist, »Gentleman« Jack Hood, ein erfolgreicher Boxer in den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und eben Nick Drake. Shakespeare zieht selbst jene an, die kaum einen Vers von ihm kennen, das Grab von Drake wird nur von denen aufgesucht, die bis ins Mark von ihm berührt worden sind.
Schon als die Familie Drake in Tanworth lebte, machte die Nähe zu Birmingham die Attraktivität dieses Dorfes aus. Die Industriestadt bietet Arbeit, und die Besserverdienenden aus den Chefetagen lassen sich nach wie vor gerne im ländlichen Tanworth nieder. Den Ortskern säumen kleine Häuschen, die den geschwungenen Straßenläufen folgen. Von ihnen heben sich große Villen ab, auf deren Schottereinfahrten Bentleys und Jaguare zu großzügigen Garagen gefahren werden.
Ich gehe nicht gleich auf den Friedhof. Etwas lässt mich zögern. Also beziehe ich zuerst mein Quartier für die nächsten Tage und nehme im The Bell ein Mittagessen zu mir. Auf dem Fensterbrett, in Griffnähe von meinem Tisch, steht eine Ausgabe des Prachtbandes Nick Drake. Remembered For A While. Sie sieht kaum benutzt aus. Direkt daneben finden sich ein Buch von Martin Fido über True Crime und eine Autobiographie von Michael Palin über seine Zeit bei Monty Python. Man kann aber auch zu Peter Cross greifen, der in seinen Lebenserinnerungen They call Me Mr England von seinem Einsatz für den Rugby-Sport erzählt. Für jeden etwas. Auf dem Weg durchs Haus stoße ich auf ein gerahmtes Bild von Drake. Es hängt etwas verlegen im Flur, als hätte man nicht recht gewusst, wohin mit dem großen Rahmen. Ich komme mit der Inhaberin ins Gespräch. The Bell ist über das Jahr kaum ausgebucht, aber sie halten sich mit Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten über Wasser. Sicher, es kämen hin und wieder Leute, um das Grab aufzusuchen. Ich bekomme den Eindruck: Sie hat nicht einen Song von ihm gehört.
Zu Drakes Grab gelangt man, indem man durch eines der in die Kirchmauer eingelassenen Tore geht und St. Mary Magdalene auf einem Pfad umrundet, der durch gepflegte Rasenflächen führt. Im Jahr 1558 ist der erste Verstorbene hier begraben worden, der älteste erhaltene Grabstein ist von 1762. Die Kirche wurde zwischen 1330 und 1340 erbaut. Der Turm ist für seine dicken Mauern berühmt und beherbergt sechs Glocken aus dem Jahr 1707, wie ich einem Faltblatt entnehme, das in der Kirche ausliegt.
Die ersten Meter auf dem Friedhof bieten nur die Schmuckseite, die von der Hauptstraße aus einzusehen ist. Der Rasen ist frisch gemäht, das Unkraut im Zaum gehalten. Sobald man die Kirche hinter sich gelassen hat, ändert der Friedhof mit einem Mal seinen Charakter. Bäume ragen zwischen den Gräbern auf. Ein leichtes Durcheinander der Grabsteine verweist auf das Alter des Friedhofs, so wie das krumme Holz eines Fachwerkhauses für seine lange Geschichte steht. Manche der Inschriften sind bereits verwittert, verwaschen vom Vergehen der Zeit. Zwischen den Begräbnisstätten wächst wildes, hohes Gras. Der Boden ist uneben und einige Denkmäler der Verstorbenen stehen bedenklich schief. Ich ahne, wo das Grab zu finden ist, denn schon von Weitem sehe ich die alte Eiche, die mit ihren ausladenden Ästen leicht auszumachen ist. Unter ihr ist die Asche von Nick Drake beigesetzt, sein Grabstein nah beim dicken Stamm. Wenige Schritte, und ich stehe vor ihm.
CBGB, backstage, Ende der siebziger Jahre
Sein Name ist wie ein geheimes Codewort, das man austauscht, um sich einer Gemeinsamkeit zu versichern. Man lässt ihn nie unbeteiligt fallen, so, wie man sonst seine Kennerschaft in der Welt der Musik ausweist, indem man rasch Namen aufzählt, um die eigenen Vorlieben zu markieren und das Terrain des Gekannten abzustecken. Nick Drake ist etwas Besonderes. Ihm wird von jenen, die sein schmales Werk kennen, Achtung, Verehrung, ja Liebe entgegengebracht. Popularität ist für diesen Musiker keine Währung, wenngleich er unter dem Ausbleiben des Erfolgs gelitten hat. Dabei erfüllen die besten seiner einunddreißig zu Lebzeiten und fünf postum veröffentlichten Aufnahmen – die Demo-Versionen nicht mitgerechnet – den Gold-Standard, der für diese Kunstform den gültigen Maßstab setzt.
Das englische Musikmagazin Mojo titelte ihn in seiner Ausgabe vom Januar 2000 einen »millenium hero«. Der deutsche Rolling Stone erklärte ihn zur »Legende«. Und guitar acoustic verstieg sich sogar dazu, ihn ein vergessenes »Fingerpicking-Genie« zu nennen. Seine Wirkung geht zudem über den Kreis der Musiker hinaus: In der von der BBC auf Radio 2 am 3. Januar 2005 ausgestrahlten Dokumentation »Lost Boy: In Search of Nick Drake« übernahm der amerikanische Hollywood-Schauspieler Brad Pitt die Rolle des Moderators. Und auf der Summer Playlist 2024 von Barack Obama findet sich Drakes Song »One Of These Things First«.
Der Rang seiner Kompositionen wird inzwischen auch genreübergreifend anerkannt. Allein vom Song »River Man« gibt es über 80 Einspielungen, darunter wegweisende vom Jazz-Pianisten Brad Mehldau, dem es gelungen ist, die Aufmerksamkeit für Drake im Jazz durch seine nobilitierenden Adaptionen zu wecken. Mehldau hat zudem »Things Behind The Sun« und »Day Is Done« aufgenommen und sogar ein ganzes Album nach dem letztgenannten Song betitelt. Der Trompeter Jason Parker aus Seattle hat mit seinem Quartett sämtliche Stücke von Drakes Debütalbum Five Leaves Left als Jazz-Versionen vorgelegt, und von seinem englischen Trompetenkollegen Nick Smart stammen ebenfalls Coverversionen einer Auswahl von Drake-Stücken im Gewand des Jazz. Doch auch Boy George hat »River Man« gemeinsam mit dem Quartett des Geigers Nigel Kennedy eingespielt. Und Chrissie Hynde, Sängerin der Rockband The Pretenders, hat sich des Stückes gleichfalls angenommen.
Legendär sind die Interpretationen von Drakes Vorlagen, die der Gitarrist Scott Appel auf seinem Album Nine of Swords vorgelegt hat. Noch rarer als diese Einspielungen sind die von Elton John. Für ein Promotion-Album ließ die Plattenfirma den damals noch unbekannten Pianisten und Sänger im Juli 1970 vier Songs von Five Leaves Left als Coverversionen aufnehmen. Sie wurden in einer Auflage von 99 Stück mit weißem Label gepresst und in Umlauf gebracht, um Drake als Komponisten der Songs bekannter zu machen. Elton John erlebte noch Ende des Jahres mit der Vertonung des Textes von »Your Song«, geschrieben von seinem Kollegen Bernie Taupin, den Durchbruch; Drake haben die blassen Darbietungen des angehenden Popstars hingegen nicht geholfen. Auch Norah Jones hat mit ihrer großen Popularität das Augenmerk auf ihn zu lenken versucht, als sie für eine CD-Sonderedition mit zwei Fassungen des Songs »River Man« im Jahr 2004 zusammen mit dem Charlie Hunter Quartet eine Version von »Day Is Done« als Zugabe beisteuerte. Die Zahl der Tribute-Alben, die verschiedenste Interpretationen von Folk über Pop bis Rock versammeln, hat ein Dutzend überschritten und nimmt stetig zu.
Wie sehr sich die Musik von Drake auf Gegenwärtigkeit stimmen lässt, hat Gina Schwarz mit ihrem Ensemble Multiphonics 8 ausgelotet. Für einen Kompositionsauftrag näherte sich die Bassistin der Musik und den Texten an, indem sie sie nicht einfach gecovert, sondern zum Ausgangspunkt für Eigenkompositionen gemacht hat. Sie sei, erzählt sie in einem Interview mit Michael Rüsenberg, über Mehldaus Einspielung von »River Man« und »Day Is Done« auf Drake aufmerksam geworden und vor allem von »Way To Blue« beeindruckt gewesen. Wenn sie Drake höre, fühle sie sich »wie auf einem anderen Planeten«, »wie in einer anderen Welt«. Während Gina Schwarz Drake aus den späten sechziger und frühen siebziger Jahren holt und in die Klang- und Musikästhetik unserer Tage überträgt, hat der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen mit seinem Ensemble Phoenix Munich die Songs in das elisabethanische Zeitalter zurückversetzt und dadurch den traditionellen Kern von Drakes Ästhetik freizulegen gesucht.
Aber Bekenntnisse zu Drake kommen auch aus jenen Randbereichen der Musik, wo man sie nicht vermutet. Der New Yorker Punkmusiker Tom Verlaine brachte in den siebziger Jahren im berühmt-berüchtigten Club CBGB im Süden von Manhattan die Wände zum Schwitzen. Mit dem Debütalbum Marquee Moon seiner Band Television stellte er im Jahr 1977 ein unübersehbares Ausrufezeichen auf, legte er doch den Beweis vor, wie majestätisch und zugleich filigran unbändige Kraft sein kann. Als Verlaine nach einem seiner lautstarken Konzerte im Epizentrum des New Yorker Underground hinter der Bühne auf den Tontechniker John Wood traf, der für Island Records ikonische Alben aufgenommen hatte, erwies sich der Punker zu Woods Überraschung als ein exquisiter Kenner jener Platten. Er habe sie immer schon verehrt, die von Wood auf Band festgehaltenen Aufnahmen von John Martyn oder Fairport Convention. »But you know«, fuhr er fort, »the very best of all is Nick Drake.«
Night Flight, 27. August 1979
In einer noch ferneren Zeit, vor mehr als einem halben Jahrhundert, in den frühen sechziger Jahren, fuhr John Ravenscroft mit dem Auto von New Orleans nach Dallas. John F. Kennedy war Präsident, eine neue Ära brach an, aber das alte Amerika war noch greifbar. Ein Vierteljahrhundert war damals schon vergangen, seit der mythenumrankte Robert Johnson, der King of the Delta Blues Singers, gestorben oder ermordet worden war, wer weiß das schon. Doch der Blues war noch präsent. Im Radio liefen Songs, die so archaisch wie populär waren. John Ravenscroft, der später unter seinem Geschäftsnamen John Peel ein berühmter englischer Radio-DJ werden sollte, hörte verwundert und begeistert, wie der Radiosender KLIF aus Dallas die alten Bluesmusiker im Programm laufen ließ: »Als Beispiel dafür, wie klasse KLIF war«, wendet er sich an die Leser seiner Autobiographie, »kann die Tatsache gelten, dass Lightnin’ Hopkins mit ›Mojo Hand‹ Nummer eins der KLIF-Charts war. Falls Ihnen das nichts sagt, ist es Zeit, dass Sie Ihr Leben grundsätzlich überdenken.«
Auch auf der Fahrt von New Orleans nach Dallas, tief in der Nacht, ließ er das Autoradio eingeschaltet. Eigentlich hatte er zusammen mit Freunden aufbrechen wollen, doch als seine Kumpels sich entschieden, noch in New Orleans zu bleiben, fuhr er allein. »Dafür bin ich ihnen ewig dankbar, auch wenn ich damals wenig erfreut war, doch auf der Fahrt zurück erlebte ich einen der großartigsten musikalischen Augenblicke meines Lebens. Ich war bereits eine Weile gefahren, und es muss wohl so zwischen zwei und drei Uhr morgens gewesen sein, als ich in die dicht bewaldete Region von Westtexas kam, die unter dem Namen Piney Woods bekannt ist. Es herrschte kaum Verkehr, und die Straße wand sich in leichtem Auf und Ab zwischen den Bäumen hindurch und an winzigen Dörfern vorbei, die meistens aus kaum mehr als ein paar schmuddeligen Hütten bestanden, während der Mond genau vor mir am Himmel stand und den Asphalt in einen silbernen Glanz tauchte. Ich hörte, so vermute ich zumindest, Wolfman Jack auf XERB, der von jenseits der mexikanischen Grenze sendete, und als ich gerade über einen Hügel kam und vor mir ein weiteres von diesen kleinen Dörfern liegen sah, spielte er Elmore James’ ›Stranger Blues‹. ›I’m a stranger here, just drove in your town‹, sang Elmore, und ich wusste, dass ich niemals vergessen würde, wie perfekt Ort, Stimmung und Musik in diesem Augenblick zueinanderpassten.«
Die Formel von der Musik als dem ›Soundtrack unseres Lebens‹ erscheint vielleicht abgegriffen, behauptet aber ihre Geltung. Es ist oftmals schwer, sich an die Chronologie des eigenen Lebens im Detail zu erinnern, schrumpfen doch die durchlebten Zeiträume im Rückblick zusammen, und die Daten verblassen aufgrund ihrer erodierenden Bedeutsamkeit. Ein in seiner ganzen Fülle erfahrener Augenblick dagegen vermag über Jahrzehnte hinweg im Gedächtnis lebendig zu bleiben – »written in my soul«, wie Bob Dylan in »Tangled Up In Blue« singt. Es gibt ein Erleben des Flüchtigen, das für uns von größerer Dauer ist als all die Unumstößlichkeiten, die wir als biographische Fakten in einen Lebenslauf schreiben. Eindringlich ausgekostete Erfahrungsmomente sind solche spots of time, Erlebnisspitzen, die in Erinnerung bleiben. Sie erlauben Tiefenbohrungen in unsere empfindsame Persönlichkeit und können noch nach Jahrzehnten ein Gefühl zutage fördern, das vergangenes Leben wachruft: als affektive Leitfossilien unserer selbst. In diesen Schnappschüssen der eigenen Geschichte bleibt das damalige Gestimmtsein aufbewahrt: Ich erinnere den unendlich weit erscheinenden Abendhimmel und die milde Luft des Frühlings über einem Vorort von Paris, als wir die Metropole während einer Klassenfahrt unserer Schule besuchten; ich erinnere die Fahrt früh morgens durch Quito in Ecuador im Taxi, das uns zum Flughafen brachte, dabei kein Mensch auf den Straßen, das Leuchten der Innenarmaturen und den schweigsamen Fahrer.
Musik vermag diese Lebensstimmungen einzufangen. Jeder von uns kennt, was man etwas rüde als Konditionierung bezeichnen könnte: Ohne mein Zutun verbindet sich ein Musikstück unauflösbar mit einer Lebenssituation. Fortan ist es der Auslöser einer Erinnerung an das Erlebte, ob ich das will oder nicht. So lassen die Hits eines vergangenen Jahrzehnts, die jeder kennt, der es durchlebt hat, die damalige Zeit wiederauferstehen, ganz gleich, wie scheußlich sie schon damals waren und noch heute klingen.
Die andere Art, wie Musik unser Leben begleiten kann, ist deutlich schwerer zu fassen: Musik bietet einen Ausdruck für etwas, das wir so in Form zu bringen aus eigener Kraft kaum in der Lage gewesen wären. Wohl niemand von uns hätte die mitreißende und erotische Kraft des Rock’n’Roll entfesseln oder die Entspanntheit des Reggae erfinden können. Beide sind uns aber bis in die leibliche Resonanz hinein so vertraut, als wäre nur etwas offenbar gemacht worden, das schon in uns geschlummert hat. In Zeilen wie »You don’t need a weatherman / To know which way the wind blows« findet sich das jugendliche Aufbegehren der sechziger Jahre mit seiner neuen Unabhängigkeit und dem erwachenden Zutrauen zum eigenen Urteil in einer schlaksigen Selbstgewissheit auf den Punkt gebracht. Gute Songs sind nicht nur Produkte ihrer Zeit, sie sind ihre Verdichtung.
Darum ist es eine beglückende Erfahrung, wenn ein Song und eine Begebenheit so aufeinandertreffen, als wären sie füreinander gemacht. Sie steigern sich gegenseitig. Der Song wird mit biographischer Bedeutsamkeit angereichert, und das Erlebte bleibt mit ihm verbunden. Songs sind Hohlformen, die wir mit unserem Leben füllen. Sie sind geborgte Erzählungen, ein geliehener Ausdruck für Erfahrungen. In Songs, mitunter in einzelnen Liedzeilen, vermag man sich wiederzufinden, oder ein Lied gestaltet unsere Wahrnehmung und eröffnet neue Empfindungsweisen. Mitunter trifft uns ein Song genau zur rechten Zeit. Nach meinem ersten Bewerbungsgespräch mochte ich mir noch nicht eingestehen, dass ich dem mit ihm einzuschlagenden Berufsweg nicht folgen wollte. Als auf der Rückfahrt im Autoradio »Into The Great Wide Open« von Tom Petty &The Heartbreakers lief, wurde mir in 3 Minuten und 42 Sekunden schlagartig klar, welchen Weg ich zu wählen hatte.
Werner Herzog hat in diesem Zusammenhang von der ekstatischen Wahrheit gesprochen. Unser Sinn für Realität sei heutzutage umfassend in Frage gestellt, aber »in der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur und dem Kino ist eine tiefere Schicht der Wahrheit möglich, eine poetische, ekstatische Wahrheit, die mysteriös und nur schwer fassbar ist und die man nur durch Imagination, Stilisierung und Fabrikation erreichen kann«. In einer durchrationalisierten Welt öffnet Musik, die sich als Kunst versteht, eine emotionale Falltür, die uns des vertrauten Bodens beraubt und in eine tiefere Schicht unseres Bewusstseins fallen lässt.
Ich erinnere mich noch genau, wann ich das erste Mal Songs von Nick Drake gehört habe. Weit nach Mitternacht spielte Alan Bangs in seiner Sendung Night Flight beim Radiosender BFBS, der ein Programm für die in Deutschland stationierten englischen Soldaten ausstrahlte, vier Stücke von ihm. Für bestimmte Musik ist the night time the right time. In den small hours zwischen den Tagen gewinnt das Gehörte eine mystische Intensität, die nicht ganz von dieser Welt ist.
Es war der 27. August 1979. Das genaue Datum muss ich nachschauen, aber der Moment ist mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben. Mit Kopfhörern saß ich vor dem Radiorekorder, die Empfangsantenne penibel justiert. Während sich die Spulen der eingelegten Kassette zur Aufnahme gleichmäßig drehten, hörte ich diese Songs von Nick Drake, die wie von weit her klangen, aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Land. Es war ein harter Einstieg in seine Musik. Bangs spielte vier bis dahin unveröffentlichte Songs, die erst postum auf der gerade und zunächst nur in England erschienenen LP-Box Fruit Tree. The Complete Recorded Works veröffentlicht worden waren – das bis dahin letzte künstlerische Lebenszeichen dieses Musikers. Die sechste Seite der drei LPs enthält, nach der B-Seite von Pink Moon, die Songs »Voice From The Mountain«, »Rider On The Wheel«, »Black Eyed Dog« und »Hanging On A Star«; der letzte von Drake eingespielte Song, »Tow The Line«, wurde erst später entdeckt. Es gibt gefälligere Stücke als das an die Nieren gehende »Black Eyed Dog«.
Alan Bangs ließ die Stücke damals hintereinander laufen, ohne zwischen ihnen ein Wort zu verlieren. Fügten sich die ersten beiden Songs noch in das ein, was ich unter Folk verstand, waren die letzten beiden geradezu verstörend, vor allem der Song über den Hund mit den schwarzen Augen. Mit Robert Johnson war ich noch nicht vertraut, die Landschaft der ursprünglichen Bluesmusik noch ein weißer Fleck auf meiner musikalischen Landkarte. Was ich da zu hören bekam, war anders als alles, was ich kannte, einnehmend schön und fremd zugleich, mit einem eigentümlich dunklen Glanz und von einer Schärfe wie nicht entgratetes Metall an der Schnittkante.
Alan Bangs hatte Drake Jahre zuvor selbst in einer Radiosendung für sich entdeckt: »Es war während eines von John Donnes Nachtprogrammen, ich hockte in der Küche, das Radio gegen das Ohr gepreßt, denn meine Familie schlief längst den Schlaf der Gerechten, und ich wollte sie nicht aufwecken, als ich zum erstenmal eine Scheibe von Nick Drake hörte.« So hat es ein Radiohörer vom anderen.
An die vier Songs war schwer heranzukommen. Wer sie auf Schallplatte besitzen wollte, hatte die Box mit den drei schon veröffentlichten Alben zu kaufen. Die kostete seinerzeit 10 Pfund, eine Menge Geld, das ich nicht hatte. Und eine Bestellung aus England war aufwendig und teuer, wie ich von anderen Käufen wusste. Aber ich besaß nun meinen Mitschnitt der Radiosendung. Ich hatte den magischen Moment aus dem Äther gefischt und gebannt – auf das Magnetband einer AGFA Super Ferro Dynamic I-Kassette, »rauscharm, extrem hoch aussteuerbar«, wie es auf der Rückseite der Kassettenhülle heißt.
Flug 2353 nach London Stansted, 24. Juli 2019
Am 19. Juni 1948 wurde Nicholas Rodney Drake in Rangun im heutigen Myanmar geboren.
Ich schreibe keine Biographie. Ich schreibe eine Annäherung. Ich schreibe über jemanden, den ich nur durch seine Musik kenne, seine Songs, seine Alben. Die Fotos, die ihn zeigen, habe ich vor Augen, ich brauche sie kaum noch anzuschauen, um sie vor mir zu sehen. Seine Stimme ist mir durch die Aufnahmen bekannt wie die eines Freundes. Doch das alles ist aus zweiter Hand. Ich weiß nicht, wer er war.
Seine Mutter, geboren als Mary Lloyd, wurde Molly gerufen, sein Vater trug den Namen Rodney. Die Schwester, eine Schauspielerin, die sich heute um den Nachlass ihres Bruders kümmert, heißt Gabrielle.
Auf dem Flug nach London lese ich die vierte Biographie über Nick Drake. Legt man sie übereinander wie Scherenschnitte eines Lebens, kommen die prägenden Konturen zum Vorschein: die Stationen seiner Kindheit und die Etappen seines Schaffens als Künstler, die Abfolge der drei zu Lebzeiten veröffentlichten Alben, die oftmals identischen Auskünfte derer, die mit ihm vertraut waren. Ich habe den Verdacht, dass sie mir Nick Drake nicht nur näherbringen, sondern ihn mir bei aller Akribie auch fernrücken. Schon die korrekte Nennung seines Taufnamens, auf die uns die Genauigkeit bei der Vermessung seines Lebens zumindest einmalig verpflichtet, irritiert durch die Distanz, die sich einstellt – wer hat ihn jemals bei seinem zweiten Namen Rodney gerufen, wer nennt ihn Nicholas?
Wir verdanken den Biographen wertvolle Einsichten und Darstellungen, die das Bild bereichern, das wir uns von diesem Menschen machen können. Drake selbst war nicht auskunftsfreudig. Richard Thompson hat auf die Schweigsamkeit seines Musikerkollegen hingewiesen: »In an era when a lot of people didn’t say much, myself included, Nick stood out at that end of the spectrum.« Außer der Musik, einigen Fotos und den wenigen veröffentlichten Briefen an seine Eltern haben wir keine privaten Dokumente, die Aufschluss über ihn geben könnten. Das Meiste wissen wir nur vom Hörensagen, eingefärbt durch die Erinnerungen der Beteiligten. Sein damaliger Tontechniker John Wood warnt mich in einer Mail, »that so far all the biographies of Nick are not only poor but inaccurate and full of speculation«.
Je mehr aber Nick Drake als Person unfassbar geworden ist und sich dem Zugriff entzogen hat, desto emsiger und detailversessener wurde die Arbeit an dem fein gesponnenen Netz aus biographischen Details vorangetrieben, in dem er sich verfangen soll, gerade so, als hätten wir ihn, sobald alle Tatsachen über ihn gesichert sind: Er war kurzsichtig, trug aber selten Brille, sondern nutzte Kontaktlinsen; am Fitzwilliam College in Cambridge bewohnte er das Zimmer A2 im Erdgeschoss; seine Telefonnummer in dem Haus Danehurst in Haverstock Hill in London lautete 7223145. Noch das Sammeln dieser an sich bedeutungslosen Fakten verrät unser Verlangen nach Annäherung an den schwer Greifbaren, als hafteten den nackten Daten Spurenelemente des Bedeutsamen an. Drake-Raritäten steigen zu Devotionalien auf. 1972 wurde für den Musikunterricht an Schulen eine LP produziert, Interplay One, an der Drake auf drei Stücken beteiligt war. Im Urteil seines Biographen Richard Morton Jack war sein Beitrag simpel und sollte nicht zu seinem Werk gezählt werden, dennoch ist das Album ein begehrtes Sammlerstück, für das auf eBay 2013 beinahe 2500 Pfund gezahlt wurde – dabei fehlte das Booklet.
Wir können uns über die Erinnerungen seiner Freunde und Begleiter glücklich schätzen, sind sie doch oftmals Perlen aus den Tiefen des Gedächtnisses, die eine Erzählung verdienen. Das flüchtige Leben haftet an solchen erlebten Momenten, die sich erst im Rückblick als Kostbarkeiten erweisen. Alle, die etwas zu Drake zu sagen haben, sind von seinen Biographen in den vergangenen Jahrzehnten umso ausführlicher befragt worden, je mehr die Bedeutsamkeit desjenigen, über den sie Auskunft gaben, gewachsen ist. Aber behalten wir im Blick, was uns entgleiten wird. Nur die wenigen, die Drake gekannt haben, schreibt Amanda Petrusich in ihrem Büchlein über Pink Moon, haben das Glück, unmittelbar seine Stimme, seine leibliche Erscheinung, seine seltenen Live-Auftritte im Gedächtnis aufrufen zu können. Wir anderen haben keine Gegenwart mit ihm geteilt, die es uns erlaubt hätte, mit seiner Person Witterung aufzunehmen oder dem nahe gekommen zu sein, was sich kaum einfangen und ausdrücken lässt.
Ein 12 Sekunden langer Filmausschnitt macht daher im Internet Furore. Er zeigt eine schlanke und hoch aufgeschossene Person in Rückansicht, die langsamen Schrittes aus dem Bild geht. Es handelt sich um eine Aufnahme vom Krumlin Festival, das vom 14. bis 16. August 1970 in Yorkshire stattfand. Ist es Nick Drake, den man dort sieht? Auch wenn sich das nie klären lassen wird, ist die Bedeutsamkeit bemerkenswert, die wir diesem Filmschnipsel beimessen. Wir suchen nach Zeitkapseln, die uns eine vergangene Gegenwart näherbringen. Dabei ist besonders die Lautlosigkeit jener Filmsequenz frappierend. Die Stille übertönt alles und macht die Unnahbarkeit dessen, der da gemächlich aus dem Rahmen des Bildes geht, offenbar. Bis auf kurze Szenen, die ihn als Kind zeigen, gibt es keine Filmaufnahmen von Drake. Ein Auftritt im Fernsehen für die Sendung Octopus, 1970 in Farbe für Granada TV in Manchester produziert, ist nicht erhalten geblieben.
Ich verehre Nick Drake nicht. Ich hätte ihm bloß einmal gerne die Hand gereicht, ihm beim Reden zuhören und ihn beim Schweigen nicht stören wollen, dabei zusehen mögen, wie er Gitarre spielt und singt. Der sinnliche Eindruck der Präsenz einer Person ist durch nichts zu ersetzen. Ein einziges Mal bin ich Joseph Beuys begegnet. In der Fußgängerzone meiner Heimatstadt stellte er sich nachmittags hin, um über Kunst und Politik zu reden; es war Wahlkampfzeit und Beuys setzte sich für die Partei der Grünen ein. Ich stand mit einem Freund mehrere Stunden neben ihm, noch Schüler am örtlichen Gymnasium, durch meinen Kunst-Leistungskurs bestens vorbereitet. Weder mein Freund noch ich trauten uns, den Mann mit der Anglerweste und dem Filzhut anzusprechen, das war auch nicht nötig. Er redete ohne Unterlass, und ich sah ihm dabei zu, schaute in sein ausgemergeltes Gesicht, nahm den Geruch seiner Kleidung in mich auf, hielt dem Blick seiner Augen stand. Die Einmaligkeit der Begegnung macht mir die Erinnerung kostbar. Das war ein Mensch, der von weit her kam, aus einer anderen Welt, die nichts mit der gut behüteten Kleinstadt gemein hatte, in der ich aufgewachsen bin. Diese Welt zog mich an, versprach Weite und Intensität. Man könnte von der Aura einer Person sprechen, von der Ausstrahlung, die sich erleben, aber nur schwer beschreiben lässt.
Seit ich als Jugendlicher Peter Härtlings Roman Hölderlin verschlungen habe, hat sich in mir ein Misstrauen gegenüber Biographien festgesetzt, die so souverän durch das Leben ihrer Protagonisten führen, als handelte es sich bei ihnen um Marionetten und der Erzähler halte alle Fäden in der Hand. Der nur mäßig im Zaum gehaltenen Suggestion, so sei es gewesen, traue ich nicht über den Weg. Härtling spielt dagegen mit offenen Karten und setzt den Roman an die Stelle eines Gestrüpps aus Fakten. Nicht dass es ihm an Genauigkeit fehlte, was die Kenntnis dessen angeht, was man über seine Hauptfigur wissen kann. Aber Härtling lässt weder sich noch seine Leser im Unklaren über die Grenze, die wir zu überschreiten nicht in der Lage sind: »Ich bemühe mich, auf Wirklichkeiten zu stoßen. Ich weiß, es sind eher meine als seine. Ich kann ihn nur finden, erfinden, indem ich mein Gedächtnis mit den überlieferten Erinnerungen verbünde. Ich übertrage vielfach Mitgeteiltes in einen Zusammenhang, den allein ich schaffe. Sein Leben hat sich niedergeschlagen in Poesie und Daten. Wie er geatmet hat, weiß ich nicht.«
Es gibt im Portrait eine Präzision der belassenen Unschärfe, eine Genauigkeit des im Vagen Gehaltenen. Der Dichter John Keats hat in einem Brief an seine Brüder George und Thomas im Dezember 1817 die Eigenschaft, »wenn jemand fähig ist, das Ungewisse, die Mysterien, die Zweifel zu ertragen, ohne alles aufgeregte Greifen nach Fakten und Verstandesgründen«, als »Negative Befähigung« bezeichnet. Wir bekommen das Wirkliche nicht in den Griff. Wir werden auch eine Person nicht vollständig ergründen können, sondern müssen das Bild von ihr in der Schwebe halten. Was sich an Fakten ihres Lebens ermitteln lässt, darf nicht zu Gewichten verkommen, die unsere Imagination auf dem Boden der Tatsachen halten.
Die Unfassbarkeit von Nick Drake dokumentiert daher kein Versagen der biographischen Vergewisserungen, dem durch eine Steigerung der Anstrengungen beizukommen wäre. Seine Freunde berichten, er habe sich in ihrem Kreis nur dann wohlgefühlt, wenn er sich jederzeit, ohne ein Wort, hätte davonmachen können. Von den anderen unbemerkt, war er plötzlich fort. Die Zimmer, die er in Cambridge und London bewohnte, vermittelten den Besuchern den Eindruck, er sei nur auf Durchreise. »There is so little that Nick left behind, apart from the legacy of his music«, so beschrieb seine Mutter den Charakter ihres Sohnes. »He never wrote anything down, never kept a diary, hardly ever wrote his name in his own books … it was as if he didn’t want anything of himself to remain except his songs.«
Gabrielle, seine Schwester, hat angemerkt, dass jene, die über ihren Bruder geschrieben haben, nahezu immer mehr über sich selbst verraten hätten als über ihren Gegenstand. Nick sei wie ein Spiegel, der das Bild dessen zurückwerfe, der in ihn hineinschaue. Diese Erfahrung hat auch sein Biograph Trevor Dann gemacht. Nick Drake sei so schwer fassbar und mysteriös, »he’s anything you want him to be«. Er ist der Inbegriff des Verschwindens eines Künstlers hinter seinem Werk. Mark Plummer hat seinerzeit im Melody Maker das gerade erschienene Album Pink Moon rezensiert und bekannt, je mehr man Drake höre, desto fesselnder werde seine Musik, »but all the time it hides from you … It could be that Nick Drake does not exist at all.«
Ich bin kein Biograph. Als ich den Nachlassverwalter von Nick Drake, Cally Callomon, darüber in Kenntnis setze, dass ich an einem Buch über Drake arbeite, bekomme ich die freundliche Auskunft, weder er noch Nick Drakes Schwester stünden für biographische Auskünfte zur Verfügung. Ich bin erleichtert. Ermutigend fügt er an: »I hope you make this a book you are proud of« – die Messlatte liegt hoch.
Arbeit am Mythos
»Nick Drake ist ein Mythos!«, ruft ein Freund aus, als ich ihm von meinem Vorhaben erzähle, ein Buch über Drake schreiben zu wollen. Wir sitzen nach einer gemeinsamen Veranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse zu viert in einem Fischrestaurant. Er hatte nach meinem nächsten Buchprojekt gefragt und ich ließ ihn raten, hatte nur angedeutet, es ginge um einen Musiker, einen Singer-Songwriter, der aber nicht aus Amerika stamme. Dylan schied somit aus. Nach kurzem Zögern, er hatte zunächst an John Martyn gedacht, sagte er mir auf den Kopf zu: »Nick Drake!«
Wie kommt es, dass dieser zu Lebzeiten unbeachtete und noch heute wenig populäre Musiker in wachsenden Ringen seine Kreise zieht und an Bedeutung gewinnt? Die Geschichte seiner Nachwirkung ist ungewöhnlich. Drei Alben mit 31 Aufnahmen sind alles, was zu Lebzeiten von ihm erschienen ist. Die Platten verkauften sich schlecht, die Kritiken waren durchwachsen, und als Drake im Alter von 26 Jahren starb, bestand die Trauergemeinde, die sich zu seiner Beerdigung eingefunden hatte, aus nicht mehr als fünfzig Gästen. Man trug keinen Popstar zu Grabe. Auch sein Name schien in Wasser geschrieben zu sein, wie es auf dem Grabstein von John Keats heißt. Drake ist die Kultfigur des Scheiterns eines empfindsamen Melancholikers an den harten Realitäten des Lebens.
Vielen Heroen der populären Kultur seiner Zeit ist es gelungen, sich mit einem Song oder gleich mehreren in die Musikgeschichte und deren allgemeines Gedächtnis einzuschreiben: Donovan etwa mit »Catch the Wind« oder »Universal Soldier«, oder Ralph McTell mit »Streets of London«. Aber allmählich wandelte sich das Glück, den Zeitgeist getroffen zu haben, in den Fluch, an ihn gebunden zu bleiben, und ihre Bedeutung verblasste. Drake hat nicht ein einziges Mal den Nerv der Zeit getroffen. Seine Musik bleibt daher aber auch nicht an sie gekettet. Jüngere Hörer können Drake für sich entdecken, ohne die nostalgischen Erinnerungen ihrer Eltern teilen zu müssen. Dadurch ist diese Musik immer gegenwärtig. Amanda Petrusich hörte Pink Moon nach den Anschlägen vom 11. September 2001 über Monate in der U-Bahn auf dem Weg von ihrem Zuhause nach Manhattan und zurück, »because it was the only record I owned that still made sense to me«.
Während die Popmusik mit ihrer Aufmerksamkeitsökonomie um die Gunst der Hörer buhlt, gleicht Drakes wachsender Ruhm der Schwerkraft. Seine Musik kommt einem nicht entgegen, sie zieht einen an. Dabei spielt sie unterhalb des Radars jedes Mainstreams. Oft bedarf es eines Anstoßes, einer Empfehlung, oder aber man entdeckt sie zufällig. Der amerikanische Pianist Christopher O’Riley, der 2006 ein ganzes Album mit Songs von Drake eingespielt hat, hörte ihn während eines Essens in einem Restaurant in Minneapolis zum ersten Mal im Hintergrund. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, um welchen Song es sich gehandelt habe, aber plötzlich habe der Klang von Drakes Stimme und Musik ihn in seinen Bann gezogen, ein völlig unerwarteter Sound. Die Wirkung sei nicht von dem Song selbst ausgegangen, sondern von der Kombination verschiedener Facetten der Musik.
Drake wirkt stets als Ganzes. Trotz seines exquisiten Gitarrenspiels, der Intimität erzeugenden Stimme, der Raffinesse seiner Kompositionen oder des Sogs seiner Texte macht erst das unerklärliche Zusammenwirken all dieser Aspekte die Wucht des ersten Eindrucks aus. Als Ashley Hutchings, der Gründer und Bass-Spieler von Fairport Convention, Nick Drake nachts um drei auf einer Londoner Bühne das erste Mal hörte, fühlte er sich sofort angezogen »by this very hypnotic sound« – und von Drake als Person: »I felt he was magnetic«.
Nick Drake gehört zu jenen Künstlern, die sich für eine Mystifizierung besonders eignen, weil sie sich entziehen. Er war ein großer Schweiger. Er hat niemals Kommentare zu seinen Songs abgegeben. Die Hüllen seiner Alben, die Cover, bieten zwar den Abdruck einiger Lyrics, aber keinen erläuternden Text dazu, weder von ihm noch von jemandem, der etwas über ihn zu sagen gehabt hätte – das hätte, wie Joe Boyd anmerkt, in jenen Jahren als uncool gegolten. Während seiner Konzerte richtete er kaum ein Wort ans Publikum. Jede Floskel den Zuhörern gegenüber war ihm fremd, kein einziges Mal konnte er sich überwinden, etwas Einleitendes zu einem der Songs sagen. Die zunehmende Abwesenheit hat seine Anziehungskraft noch gesteigert. Drake verkörpert den Mythos des scheiternden und depressiven Künstlers. Doch diese mythische Prägnanz ist durch Einseitigkeit erkauft. Will man sich der Musik von Nick Drake nähern, sollte man um die verengende Wirkkraft dieses Mythos wissen.
Denn der Mythos, den wir kultivieren, hat längst den Blick auf Drake und seine Musik verstellt. Drake ist zu einer Ikone der Melancholie geworden, die, krank an der Seele, früh den Tod gefunden hat. Mitunter scheint es, wie Nathan Wiseman-Trowse spitz kommentiert, als sei er vor allem dafür berühmt geworden, jung gestorben zu sein, weniger für irgendetwas von dem, was er auf Platten gebannt hat. Wir gleichen dem Chor in der griechischen Tragödie, der dem Protagonisten auf der Bühne bei seinem Fall zuschaut. Wenig habe sich seit den Tagen des Sophokles daran geändert, so bringt es Robin Frederick auf den Punkt, dass es in unserer Natur liege, vom Scheitern der Großen und Begnadeten durch tragische Umstände gefesselt zu sein. Drakes Biographie lässt sich leicht als Drama erzählen. Vom sicheren Standpunkt aus schauen wir dem Schiffbruch eines Künstlers zu.