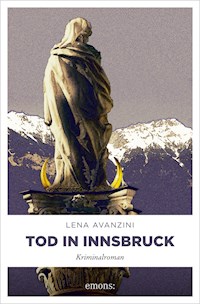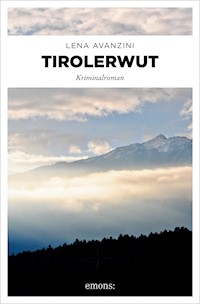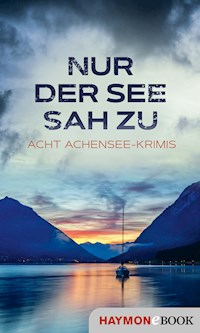Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Carla-Bukowski-Krimi
- Sprache: Deutsch
NIEMAND KENNT IHR GEHEIMNIS - BIS ZUM ERSTEN MORD! TOTE HASEN. GRÜNE BLITZE. KLARER FALL FÜR CARLA BUKOWSKI. Zwei tödliche Autounfälle innerhalb weniger Tage. Und in beiden Fällen fehlen die Bremsspuren. Erweiterter Selbstmord, tragischer Unfall? Glauben zumindest die zuständigen Polizeibeamten. Eindeutig Mord!, ist sich Gruppeninspektorin Carla Bukowski sicher. Nur: Sie darf nicht ermitteln. Beurlaubt. Wegen einer blöden Kurzschlussreaktion. Also zieht sie im Alleingang los. Und stößt auf immer mehr Ungereimtheiten: Eine verwirrte Alte erzählt vom grünen Finger Gottes. Im Garten einer jungen Mutter liegen die Hasen tot im Stall. Und die zwei Verunglückten sind ehemalige Klassenkameraden. LÜGE. IRRSINN. WETTLAUF. MORD. Die Indizien verdichten sich. Und Carla Bukowski gerät immer tiefer hinein in einen packenden Strudel aus Lügen und Geheimnissen im Schatten der Vergangenheit. Was hat es mit dem Kleeblatt auf sich, dem Vierergespann, von dem zwei sterben mussten? Ist das nächste Opfer schon vorprogrammiert? Aber: Der einzige denkbare Mörder ist doch selbst schon lange tot! Die Ermittlungen werden immer zäher. Und Bukowski muss sich wohl oder übel fragen, ob sie sich den Fall nicht doch nur zusammengesponnen hat … "Dieser Krimi macht süchtig! Carla Bukowski ist eine geniale Ermittlerfigur, auch wenn man im echten Leben nicht unbedingt mir ihr befreundet sein möchte." "Ein äußerst packender Krimi, fast schon ein bisschen wie ein Thriller." "Virtuos bis zum Schluss, mit einem mehr als spannenden Finale. Mich hat der Krimi nicht mehr losgelassen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lena Avanzini
Nie wieder sollst du lügen
Carla Bukowskis erster Fall
Lena Avanzini
Nie wieder sollst du lügen
Für Eva, das Leben und seine Kellerjochantworten
Dying is a wild night and a new road.
Emily Dickinson
1
4. August
Ihre Fußsohlen brennen. Sie schwitzt. Sie versucht, in den stechenden Schmerz hineinzuatmen, der ihr wie ein Messer zwischen die Rippen gefahren ist, weil sie schon viel zu lange viel zu schnell rennt. Carla Bukowski ist am Ende, sie kann nicht mehr, aber in ihrem Nacken sitzt die Angst, eine bucklige Alte, die mit ihren fetten Schenkeln Bukowskis Hüfte umklammert und die Fingernägel wie Widerhaken in ihre Schultern bohrt. Die Schenkel der Alten sind stärker als Schmerz und Erschöpfung zusammen, sie treiben Bukowski an, holen die letzten Reserven aus ihr heraus.
Bukowski rennt noch schneller. Sie keucht. Sie streckt die Arme vor, als könnte sie ihn im nächsten Moment erreichen; als müsste sie nur zupacken und ihn von dort zurückreißen. Vom Abgrund.
Aber sie ist zu weit weg. Noch fünfzig Meter bis zur Klippe, die wie die Nase eines versteinerten Monstrums in den Nachthimmel ragt. Milchiges Mondlicht lässt den verkrüppelten Baum, der auf der äußersten Nasenspitze wächst, einen Schatten werfen. Vor dem Schattenschwarz hebt sich schemenhaft die Gestalt eines Jungen ab.
Wie klein er ist, denkt Bukowski. Viel zu klein für sein Alter. Samuel!, will sie schreien, aber sie bekommt nicht genügend Luft und formt den Namen tonlos mit den Lippen, während sie weiter den steilen Pfad hinaufkeucht.
Sie sieht, wie er den Oberkörper vorbeugt und in die Tiefe starrt, wie sein rechter Fuß vorkriecht, sich einem tastenden Fühler gleich ins Nichts streckt. Mit Schaudern sieht sie es, ahnt, dass sie zu spät kommen wird, so schnell sie auch laufen mag, und hört die bucklige Alte in ihrem Genick hysterisch auflachen.
„Samuel!“ Als heiseres Krächzen schlüpft das Wort über ihre Lippen, und obwohl er es eigentlich nicht gehört haben kann, dreht er sich um.
Weiß wie frisch gefallener Schnee schimmert sein Gesicht. Je näher Bukowski kommt, umso mehr Details kann sie erkennen. Das T-Shirt mit dem skateboardfahrenden Bart Simpson – noch dreißig Meter, das Haarbüschel unter der feuerwehrroten Schildkappe – noch zwanzig, das spitze Kinn, das Samuel ebenso von ihr geerbt hat wie das undefinierbare Graugrün der Augen – noch fünfzehn.
Zwölf Meter, aber die Farbe von Samuels Augen ist nicht graugrün, sondern angstschwarz.
Zehn, Löcher sind an die Stelle der Augen getreten, von Panik bewohnte Löcher. Sie sind auf Bukowski gerichtet, nein, sie starren durch Bukowski hindurch, starren auf einen Punkt hinter ihr.
Neun, und Samuel hebt den Arm, streckt ihn in Richtung dieses Punktes, in dem sich seine Angst manifestiert hat. Die Angst, der er Einhalt gebieten will.
Bukowski bleibt abrupt stehen, als hätte die bucklige Alte an unsichtbaren Zügeln gezerrt. Sie dreht den Kopf, späht hinter sich, um zu erkennen, wovor Samuel sich fürchtet. Aber da ist nichts. Keine Menschenseele, kein Tier, nur der steinige Pfad, der sich in Serpentinen abwärts windet und vom nebelverhangenen Wald geschluckt wird. Einen Herzschlag lang meint sie, einen Schatten auszumachen, der sich aus dem Nebelwald schält, aber sie hat sich getäuscht. Kein Schatten, keine Bedrohung. Nichts.
Rasch wendet sie sich wieder dem Jungen zu, der Klippe, den letzten Metern, die sie im Sprint zurücklegt.
Bleib stehen, schreit es aus jeder ihrer Poren, ich bin gleich da, beweg dich nicht, alles wird gut.
Sechs, und in den schwarzen Löchern explodiert die Angst.
Fünf, Samuel öffnet kurz den Mund, als wolle er Bukowski eine stumme Warnung zurufen.
Vier, seine Hand löst sich vom Baumstamm.
Drei, er wendet sich dem Abgrund zu.
„Nein!“
Anderthalb Meter, eine Kinderbettlänge, und Samuel tritt mit einem einzigen Schritt hinaus und verschwindet im Nichts, während Bukowskis Finger vorschnellen, zupacken und sich um dünne Luft schließen.
Sie erwachte von ihrem eigenen Schrei. Ihr Herz raste, als wäre sie tatsächlich gerannt, dabei war sie an ihrem Schreibtisch eingeschlafen, mitten im Tippen eines Berichts über eine Schlägerei mit Todesfolge in Ottakring. Sie öffnete die oberste Schublade, kramte nach einem Taschentuch und wischte sich damit den Schweiß von der Stirn. Kopfschüttelnd starrte sie auf den Bildschirm. Sie war beunruhigt. Nicht wegen der geschätzten siebzig U, die sich auf der letzten Seite des Berichts tummelten und ein Ergebnis ihres Headcrashs auf die PC-Tastatur waren, sondern wegen des Albtraums, den sie schon so lange nicht mehr geträumt hatte. Über drei Monate nicht. Sie hatte gehofft, ihn für immer los zu sein. Und jetzt suchte er sie ausgerechnet tagsüber heim. Im Dienst.
Wie sie diesen Traum hasste! Obwohl ihr bewusst war, dass sie träumte, konnte sie nicht ausbrechen oder seinen Verlauf ändern. Er spulte sich jedes Mal gleich ab. Sie rannte, Samuel sprang, sie erwachte schreiend. Und noch Stunden danach zitterten ihre Finger und in ihrem Kopf breitete sich Hoffnungslosigkeit aus, eiskalt, dunkelgrau, zähflüssig.
Wie oft hatte sie schon über die Bedeutung des Traums nachgedacht, über die verschlüsselte Botschaft, die ihr Unterbewusstsein ihr zukommen lassen wollte. Denn wozu sonst sollte ein immer gleicher Albtraum gut sein, wenn nicht zum Übermitteln einer Botschaft?
Sie löschte die siebzig U und wischte den letzten Gedanken weg. Tief im Innersten wusste sie natürlich, dass Träume sinnlos waren. Unfug. Eine Fehlfunktion des menschlichen Gehirns, während es sich im Schlafmodus befand. Das Gedöns von verschlüsselten Botschaften war nur Geschwätz von halbseidenen Psychologen, die nach Bukowskis Einschätzung in dieselbe Schublade gehörten wie Wahrsager und Tischrücker.
Wie hatte ihre Großmutter immer gesagt, wenn die kleine Carla mitten in der Nacht weinend aufgewacht war und nicht mehr einschlafen konnte?
„Träume sind Schäume.“
Genau, dachte Bukowski und fühlte einen Stich, wenn sie sich das Lederapfelgesicht unter den bläulichen Omalöckchen vorstellte, das jetzt im Pflegeheim vor sich hin schrumpelte; das sie schon so lang nicht mehr gesehen hatte, weil sich das Pflegeheim in Tirol befand und zwischen ihrem Wiener Schreibtisch und ihrer alten Heimat nicht nur 480 Kilometer lagen, sondern eine unüberwindliche Barriere, mit Stacheldraht umwickelt.
Bukowski schob das Lederapfelgesicht in die Schublade zurück, in die es gehörte. Nur der Traum ließ sich nicht wegschieben. Sie griff zu ihrer Tasse und stürzte den kalten Kaffeerest hinunter. Fast sofort antwortete ihr Magen mit einem Brennen. Dabei hatte sie heute erst sechs Tassen getrunken. Oder waren es sieben? Vielleicht sollte sie in Zukunft besser auf ihre Ernährung achten? Mehr Obst, mehr Gemüse und regelmäßige Mahlzeiten statt Würstelstand am späten Abend.
Einen Versuch wäre es wert, dachte sie und wusste zugleich, dass der zum Scheitern verurteilt war. Kategorien wie „gesund“ und „regelmäßig“ ließen sich nicht mit ihrer Wesensart vereinbaren. So sah es nun einmal aus.
Besser, sie nahm sich vor, nicht mehr im Büro einzuschlafen. Kein Schlaf, kein Traum, so einfach war das.
Zum Glück hatte Manni, mit dem sie sich das Büro teilte, nichts von ihrem Lapsus mitbekommen, weil er zum Zahnarzt gegangen war.
Bukowski tippte den Bericht fertig und druckte ihn aus. Ihr Herz schlug noch immer wie nach einem Sprint mit Gewichtsweste. Und als sie die Blätter aus dem Drucker zog, zitterten ihre Finger so sehr, dass sie sich eine Pause verordnete.
Sie sperrte sich in der hintersten WC-Kabine ein, öffnete das Fenster und rauchte. Schon der ersten Zigarette gelang es, den Puls zu normalisieren und das innere Frösteln, das der Traum heraufbeschworen hatte, auszuräuchern. Nach der zweiten beschloss Bukowski, dass es ihr wieder gut ging. Nur das Gesicht, das sie aus dem Spiegel über dem Waschbecken anstarrte, belehrte sie eines Besseren: Es war weiß wie Schnee, in dem sogar die Sommersprossen versanken. Die Augenringe stachen dunkel hervor, die Wangenknochen warfen Schatten und die Fältchen um Mund- und Augenwinkel erinnerten an die Sprünge in der Glasur ihrer Lieblingstasse.
Einundvierzig und ein Wrack, dachte sie und sagte laut zu ihrem Spiegelbild: „Kein Grund zum Jammern, du Auslaufmodell.“
Als sie ins Büro zurückkehrte, wippte Manni auf seinem ergonomischen Hocker vor und zurück und beendete ein Telefonat mit dem vielsagenden Satz: „Sind schon unterwegs!“ Er nuschelte ein bisschen, was vermutlich mit seinen asymmetrisch geschwollenen Lippen zu tun hatte. Der Zahnarzt hatte also gebohrt.
„Wohin?“, fragte Bukowski und schnappte sich ihre Jacke. Frische Luft und ein neuer Fall würden sie hoffentlich auf andere Gedanken bringen.
„Hernals, Höhenstraße, meine schöne Jadis“, flötete Manni. „Ein Autounfall. Drei Tote, eine Schwerstverletzte.“ Die Akne auf seinen Wangen erblühte rot, als freue er sich nach der Zahnbehandlung über jede Abwechslung, und sei sie noch so blutig.
„Und was geht uns das an?“
„Unsere uniformierten Kollegen vermuten, dass es sich um erweiterten Selbstmord handelt.“
„Dann lass uns fahren“, sagte Bukowski. Sie versuchte, lässig zu klingen, obwohl der Begriff „erweiterter Selbstmord“ eine Alarmglocke in ihrem Inneren angeschlagen hatte. Ihre Finger zitterten wieder und sie musste schlucken, um den galligen Geschmack loszuwerden, der immer mit bösen Ahnungen verbunden war.
Als sie wenig später vor dem rotweiß gestreiften Absperrband parkten, kam ihnen Czerny entgegen, ein altgedienter, mit allen Wassern gewaschener Polizeiinspektor, der sich selbst stets als Kiwara bezeichnete. Er führte sie zum Wrack eines halb ausgebrannten Golf. Der Wagen hatte – von oben kommend – die Kurve nicht gekriegt und war zuerst mit einem Betonpoller kollidiert, der dabei in mehrere Teile zerbrochen war und vermutlich den Unterboden des Fahrzeugs aufgerissen hatte. Dann hatte der Golf das kurze Stück Leitplanke weggefegt, war in eine Baumgruppe gekracht und in Flammen aufgegangen.
„Keine Bremsspur“, sagte Czerny. „Der hat nur das Steuer herumgerissen. Wenn er es geplant hat, hätte er sich keine bessere Stelle aussuchen können.“
„Aha“, sagte Bukowski und trat näher.
Es war der Geruch, der sie warnte und die Alarmglocke in ihrem Kopf schriller klingen ließ. Es roch nach verbranntem Menschenfleisch – eine Duftnote, die sie seit sieben Jahren zu vergessen versuchte. Trotz der sommerlichen Nachmittagshitze war ihr, als hätte man sie in Eiswasser getaucht. Die Härchen an ihren Armen sträubten sich und ihr rechtes Lid begann zu zucken.
Auf den Anblick war sie nicht vorbereitet, Ahnungen und Alarmglocken hin oder her. Als das Bild der verkohlten Kinderleiche im zusammengeschmolzenen Kindersitz in ihrem Gehirn ankam, taumelte sie, als hätte ihr jemand einen Faustschlag in den Magen verpasst. Ohne Vorwarnung, quasi aus dem Hinterhalt heraus.
Alles wurde rot.
Bukowski sah Feuer, zuckende Flammen, dichten Rauch. Sie blinzelte, aber die Brandbilder verschwanden nicht, sie verbanden sich zu einem Film, der gnadenlos vor ihren geschlossenen Augen ablief.
Ihr Magen zog sich zusammen. Sie krümmte sich und übergab sich auf Czernys Schuhe.
Was danach passierte, konnte sie sich später nur bruchstückhaft aus verschiedenen Zeugenaussagen zusammenreimen. Es war, als befände sich Carla Bukowski plötzlich allein in einem geschlossenen System, in dem es keine Möglichkeiten gab, mit Außenstehenden zu kommunizieren. Sie war die Heldin eines Computerspiels, die aufgrund strategischer Misserfolge in einen niedrigeren Level katapultiert worden war. Sie fühlte nichts. Ihre Sinne funktionierten nicht. Sie bemerkte weder Mannis erschrockene Blicke noch hörte sie Czernys besorgte Fragen. Die Fernbedienung, mit deren Hilfe sie normalerweise den Alltag meisterte, war ihr entglitten, und eine Frau, die ihr aufs Haar glich und doch eine völlig fremde war, hob sie auf. Die rätselhafte Doppelgängerin drückte auf einige Knöpfe und Bukowski, zur willenlosen Marionette degradiert, stolperte zum Dienstwagen, startete und fuhr los.
Manni versuchte sie aufzuhalten.
Sie sah ihn nicht. Mit quietschenden Reifen raste sie auf ihn zu. Nur ein Sprung zur Seite konnte ihn davor bewahren, überrollt zu werden.
Bukowski bekam es nicht mit. Auch die Flüche, die er ihr hinterherbrüllte und die so gar nicht zum charmanten Revierinspektor Manfred Pribil passten, entgingen ihr.
Später sollte sie sich nicht mehr an den Vorfall erinnern. Von ihrer gesamten Amokfahrt durch Hernals, Döbling, die Brigittenau, Leopoldstadt und Simmering, bei der sie fünf oder sechs rote Ampeln überfuhr, drei parkende Autos schrammte, einen Zaun und ein abgestelltes Moped verschrottete und nur um ein Haar niemanden verletzte, blieb kein Eintrag in ihrem Gedächtnis zurück.
Ihre Erinnerung setzte in dem Moment ein, als ihr ein älterer Herr mit Walrossschnauzer seine Hand auf die Schulter legte und sie wie aus einem Fieber erwachte. Zu diesem Zeitpunkt dämmerte es bereits, ein Gewitter mit sintflutartigem Regen und vereinzelten Blitzen ging über Simmering nieder. Sie war nass bis auf die Haut. Mit klappernden Zähnen stand sie vor einem schmiedeeisernen Grabkreuz mit der Inschrift: Hier ruht Wilhelm Töhn. Ertrunken durch fremde Hand am 1. Juni 1904 im 11. Lebensjahr. Die Inschriften der Nachbargräber bestanden dagegen nur aus einem einzigen Wort: Unbekannt.
Das Walross entpuppte sich als ehrenamtlicher Friedhofswärter. Er behandelte Bukowski wie ein rohes Ei, führte sie ins nahe Gasthaus, organisierte trockene Kleidung und bestellte einen Fiaker – üblicherweise ein gezuckerter Mokka mit einem Schuss Kirschwasser, in diesem Fall ein dreifacher Slibowitz mit einem Fingerhut voll Kaffee.
Die Stimme des Walrosses klang väterlich. Er wollte wissen, was eine Frau wie Bukowski bei so einem Wetter und kurz vor Einbruch der Dunkelheit ausgerechnet an diesem Ort suche. Vielleicht das Grab eines Angehörigen? Aber hier, im Friedhof der Namenlosen, in dem früher die von der Donau angeschwemmten Leichen von Selbstmördern und Ertrunkenen beigesetzt worden waren, deren Identität man nur in den seltensten Fällen kannte, sei seit 1940 niemand mehr begraben worden. Der Friedhof werde als stillgelegt geführt. Niemand kümmere sich um die Gräber, nur er, in seiner Freizeit, der letzte aus einer ehemaligen Familie von Totengräbern.
Bukowski nickte und schwieg. Es wäre ihr vermessen vorgekommen, den freundlichen Herrn zu korrigieren. Er konnte ja nicht ahnen, dass sein Friedhof die Asche von zwei weiteren Toten beherbergte. Asche, die sie selbst vor sieben Jahren über dem Grab des Wilhelm Töhn ausgestreut hatte. Dort, wo jetzt die Schwertlilien so üppig wucherten.
„Als mein Sohn klein war, hat er diesen Platz geliebt“, sagte sie nur und zwang ihre Lippen zu einem Lächeln.
Der ehrenamtliche Friedhofswärter strich über seinen Walrossbart. Er gab sich mit der Antwort zufrieden und lächelte zurück.
2
7. August
Nowak starrte auf den Bildschirm. Ameisen, nichts als Straßen verschwommener Ameisen. Es ärgerte ihn, dass er es wieder nicht geschafft hatte, eine neue Lesebrille zu besorgen. Er rückte an seiner alten, schob den Laptop eine Handbreit von sich weg und kniff die Augen zusammen. Endlich verwandelte sich die Insektenschar in scharfe Buchstaben. Während er Mannis Bericht über den Unfall in der Höhenstraße überflog, rieb sein Zeigefinger über den Rand des Kaffeebechers, als könnte er ihn zum Klingen bringen.
Drei Tote, eine Schwerverletzte; so schwer verletzt, dass die Opferbilanz vermutlich bald auf vier erhöht werden musste. Die Kriminaltechniker hatten keinerlei Mängel oder Manipulationen am Fahrzeug feststellen können. Der Autolenker, ein gewisser Fritz Hirmer, Besitzer einer alteingesessenen Antiquitätenhandlung in der Hernalser Hauptstraße, wohnhaft im Eigenheimweg der Siedlung Hügelwiese in Neuwaldegg, keine dreihundert Meter vom Unfallort entfernt, war zum Zeitpunkt des Crashs weder alkoholisiert gewesen noch unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Der gerichtsmedizinische Schlussbericht bescheinigte ihm vollkommene Gesundheit – bis er mit 64 km/h ungebremst gegen einen Betonpoller und schließlich in eine Gruppe von Bäumen gekracht war und in Folge mehrfache Rippenbrüche mit Lungenanspießung und einen Aortenriss davongetragen hatte. Zum Glück verblutete er, bevor der Wagen in Flammen aufging.
Bei seiner Frau Lisa ging es noch schneller. Aufgrund einer falsch eingestellten Kopfstütze erlitt sie einen Genickbruch. Schnipp und aus, Ende, keine Schmerzen, kein Kampf, vermutlich nicht einmal Todesangst.
Die beiden Kinder hatten es weniger gut getroffen: Die achtjährige Emilia war nicht angeschnallt gewesen. Bereits bei der Kollision des Wagens mit dem Betonpoller flog sie durch die Windschutzscheibe, wurde über die Böschung geschleudert und landete in einem Dickicht aus Brombeerbüschen und Haselnussstauden. Dadurch entging sie zwar dem Feuer, erlitt aber eine Schädelfraktur – neben unzähligen Schnitt-, Schürf- und Rissquetschwunden, mehreren Wirbelbrüchen, einem Trümmerbruch des linken Oberschenkels und zahlreichen kleineren Knochenbrüchen. Noch kämpfte sie in der Intensivstation einen wenig aussichtsreichen Kampf um ihr Leben, wenigstens bekam sie vom Ausmaß der Tragödie nichts mit, weil die Ärzte sie in künstlichen Tiefschlaf versetzt hatten.
Der Einzige, der den Aufprall mit heilen Knochen überstanden hatte, war Emilias kleiner Bruder. Jonas war noch am Leben gewesen, als seine Kleidung Feuer gefangen hatte, das folgerten die Gerichtsmediziner aus den Rußablagerungen in den Atemwegen und aus der im Blut befindlichen Menge an Kohlenmonoxid-Hämoglobin. Ob der Sechsjährige bei Bewusstsein gewesen war, konnte die Obduktion nicht klären.
Zum Glück nicht, dachte Nowak. Bestimmte Details nicht zu kennen, war manchmal eine Gnade. Das Wissen, dass es sich beim Verbrennen um die schmerzhafteste aller Todesarten handelte und dass Niki, der jüngste Sohn von Nowaks Schwester und sein Patenkind, nur um ein halbes Jahr älter war als Jonas, reichte ihm vollkommen.
Er scrollte weiter zum letzten Absatz, zur Beurteilung des Unfallgeschehens durch Revierinspektor Manfred Pribil. Die gestelzten Formulierungen entlockten ihm ein Grinsen. An seinem Stil musste der gute Manni noch feilen, aber in der Sache hatte er zweifellos recht: Nach Pribils Einschätzung handelte es sich nicht um einen Unfall, sondern um erweiterten Suizid durch den Lenker Fritz Hirmer, der in der Höhenstraße und in unmittelbarer Nähe seines Wohnsitzes mit 64 km/h – und damit immerhin um 34 km/h zu schnell – das Lenkrad verrissen hatte, als hätte er sich extra die Stelle mit den vielversprechendsten Hindernissen ausgesucht. Pribil untermauerte seine These mit den hohen Schulden Hirmers und der Flaute, in der der Antiquitätenhandel im Allgemeinen und Hirmers Geschäft im Besonderen steckte. Gemäß einer Aussage von Hirmers Schwiegervater hatte es zuletzt auch in der Ehe heftig gekriselt.
Klarer Fall, dachte Nowak, auch wenn ein Abschiedsbrief fehlt und wir es nicht beweisen können. Er überlegte, der wievielte erweiterte Suizid das in diesem Jahr war, allein in Wien. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Mann die Mutter seiner Kinder und sich selbst erschossen, auf offener Straße, am helllichten Tag, mitten in Favoriten. Und obwohl Nowak sich für einen abgebrühten Kriminalbeamten hielt, den nach dreißig Dienstjahren eigentlich nichts mehr aus der Fassung bringen konnte, beunruhigte ihn die Vorstellung, dass immer mehr Menschen diese Art des Ausstiegs aus ihrem verkorksten Leben wählten. Selbstmord schön und gut. Aber warum genügte es ihnen nicht, ihr eigenes Lebenslicht auszublasen? Warum mussten sie andere mitnehmen, Menschen, die sie angeblich liebten oder zumindest einmal geliebt hatten, Verwandte, Lebensgefährten, Kinder? Aus Angst, „drüben“ – wie auch immer man sich das vorstellen musste – allein zu sein? Oder weil sie ihren Angehörigen nicht zutrauten, ohne sie zurecht zu kommen?
Vermutlich liegt es eher daran, dass die meisten Leute das Lieben mit dem Besitzen verwechseln, dachte er. Bevor er sein Gewissen erforschen konnte, ob auch er zu dieser Spezies Mensch zählte, klopfte es.
Er musste nicht hinsehen, um zu wissen, wer den Raum betrat, mit federnden Schritten, leichtfüßig und lautlos wie eine Indianerin auf dem Kriegspfad.
„Setz dich“, knurrte er und nahm die Lesebrille ab. Natürlich war Knurren kindisch. Aber etwas Besseres fiel ihm nicht ein, um sich gegen sie zu wappnen; gegen die einzige Untergebene – er erschrak ein bisschen und ersetzte das Wort „Untergebene“ in seinem Kopf durch „Kollegin“ –, die ihm je Paroli geboten hatte; die einzige Frau, deren bloße Anwesenheit ihm immer noch an die Nieren ging, obwohl er längst nicht mehr mit ihr …; kurz, die ihm zusetzte; mehr, als er sich eingestehen wollte.
Ohne sie zu beachten, starrte er weiterhin auf den Bildschirm, auch wenn es dort nichts Neues mehr zu lesen gab und die Buchstaben sich wieder in Ameisen zurückverwandelt hatten. Aus dem Augenwinkel registrierte er, wie sie den Stuhl zu sich zog und Platz nahm. Er rief sich noch einmal ins Bewusstsein, was er längst beschlossen hatte, und nahm sich vor, nicht nachzugeben. Keinen Millimeter. Dann atmete er tief durch und wandte sich ihr zu.
Bei ihrem Anblick erschrak er. Nicht, dass er rosige Wangen erwartet hätte. Oder blühende Lippen. Aber das Ausmaß ihrer Blässe, die Breite der dunklen Ringe unter den Augen und der strähnige Zustand ihrer Haare versetzten ihm einen Stich.
„Du wolltest mich sprechen?“ Ihre Stimme klang, als würde rostiges Eisen mit einer Feile bearbeitet.
Alte Erinnerungen stiegen in ihm auf, Bilder von früher, von ihrem ersten Dienstjahr an der Außenstelle West, als immer etwas Sprühendes in ihrem Blick gelegen hatte. Wie sehr hatten ihn diese Augen fasziniert, obwohl sie zu groß und zu hell waren, um als schön zu gelten.
Heute hockten sie tief in ihren Höhlen, als gehörten sie einer Greisin, und es gab nur Müdigkeit in ihnen.
„Du siehst scheiße aus.“
„Dein Charme ist überwältigend, wie immer.“
Wenigstens ihre Schlagfertigkeit hatte sie nicht eingebüßt, aber die Antwort klang lahm.
„Im Ernst, Carla. Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen? Oder geschlafen?“
„Ich war krank.“ Kantig wie Vorwürfe stachen Kinn und Wangenknochen aus ihrem schmalen Gesicht heraus. Das Gesicht einer Spitzmaus auf einem Schwanenhals.
„Und welcher Arzt hat dich gesundgeschrieben?“ Nach allem, was passiert war, hatte Nowak mit einem mehrwöchigen Krankenstand gerechnet.
„Meine Hausärztin. Wieso?“
„Hast du sie mit deiner Dienstwaffe bedroht?“
„Deine Witze haben auch schon bessere Zeiten erlebt.“ Nicht der Hauch eines Lächelns verzog ihre Mundwinkel. Stattdessen musterte sie ihn eindringlich und ein bisschen herablassend.
Er fühlte sich wie ein seltener Käfer unter der Lupe einer Insektenforscherin. Fühlte ihren Blick über sein Doppelkinn gleiten, das er sich in den letzten Jahren angefressen hatte, über die teigigen Wangen und die Tränensäcke, die das Ergebnis regelmäßigen Rotweinkonsums waren. Die Folge ihrer Inspektion war ein Schweißtropfen, der im Zenit seiner Glatze entsprang, der Schwerkraft folgte und sich seinen Weg über die Stirn bahnte. Wütend wischte er ihn weg.
„Alles in Ordnung. Mir geht’s gut“, sagte sie endlich und schnippte eine Haarsträhne aus der Stirn.
„Was am Montag passiert ist …“
„Wird nicht wieder vorkommen.“
Nowak schüttelte den Kopf. „Hör mir zu, Carla. Ich … wir alle haben Verständnis. Aber du darfst das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du brauchst Hilfe. Professionelle Hilfe. Mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kann man nicht allein fertig werden.“ Er wusste nicht mehr genau, wie viele Jahre seit dem tragischen Ereignis vergangen waren, dachte aber, dass es mehr als fünf sein mussten. Jedenfalls hatte er geglaubt, dass sie die Geschichte verarbeitet hatte. Vielleicht nicht endgültig verarbeitet, das war vermutlich gar nicht möglich. Aber dass sie gut damit umgehen konnte, belastbar war und im Alltag funktionierte. Was für ein Irrtum! Offensichtlich hatte sie ihm die ganze Zeit etwas vorgespielt.
„Posttraumatische Belastungsstörung also.“ Sie lachte auf. „Danke für die Diagnose, Herr Doktor. Hast du Tante Wikipedia bemüht?“ Für einen Sekundenbruchteil zerriss der müde Schleier und ein bissiges Grün blitzte in ihren Augen auf. „Das mit der Couch und dem Seelenklempner habe ich schon hinter mir. Wenn du denkst, dass ich mir das noch einmal antue, hast du dich geschnitten.“
Er ignorierte ihren Tonfall, der einem Vorgesetzten gegenüber unpassend war. Auch wenn man mit diesem Vorgesetzten gevögelt hatte. Vor einer halben Ewigkeit. „Kein Klempner.“ Aus seiner Brusttasche zog er eine Visitenkarte und gab sie ihr.
„Clarissa Leinweber, diplomierte Psychotherapeutin – Existenzanalyse und Logotherapie nach Viktor Frankl – Systemische Familientherapie – Termine nach Vereinbarung.“ Sie las mit gerunzelter Stirn, dann riss sie das Papier in winzige Stücke. „Mir ging es am Montag nicht gut. Ich war krank und der Anblick des verbrannten Jungen – er war in Samuels Alter!“
„Deshalb sag ich ja …“
„Es war eine Ausnahme. Wird nie wieder passieren. Es ist sieben Jahre her und ich bin damit fertig.“
Ratlos starrte er auf die Papierschnipsel. Sieben Jahre also. Wie die Zeit verging! „Du meinst, du hast es jahrelang verdrängt und in Arbeit erstickt.“
„Eine Therapie hilft nur Menschen, die dafür empfänglich sind. Ich halte aber nichts von Familienaufstellungen und ähnlichem Hokuspokus.“
„Wie du meinst. Aber ich bestehe darauf, dass du Urlaub nimmst.“ Zufrieden stellte er fest, dass seine Stimme entschlossen klang. Souverän. „Ab sofort.“
„Urlaub? Wozu? Zu Hause fällt mir bloß die Decke auf den Kopf.“
„Dann fahr weg. Aufs Land. Auf eine Insel. Irgendwohin, wo du zur Ruhe kommen und dich entspannen kannst.“
„Ich entspanne mich am besten, wenn ich arbeite. Ich kann arbeiten. Ich will arbeiten. Bitte, Hanno!“
Ein „Bitte“ aus ihrem Mund in Verbindung mit seinem Vornamen war nicht nur eine Seltenheit, es bewies, dass sie ihre Felle davonschwimmen sah. Trotzdem war er auf der Hut. Er stand auf, schlenderte zum Fenster und schaute hinaus. Beobachtete eine gehbehinderte Frau, die, ohne auf den Verkehr zu achten, die Ottakringer Straße überquerte, in aller Seelenruhe. Nicht einmal durch das wütende Bimmeln der Straßenbahn ließ sie sich aus dem Takt bringen. Er schwieg lange. Beschloss, erst recht mit harten Bandagen zu kämpfen, wenn Carla mit einem „Bitte“ auffuhr. Nein, diesmal würde er nicht nachgeben, um keinen Preis. Ein Gefühl edler Entschlossenheit breitete sich in seinem Inneren aus und vertrieb die letzten Reste des Alt-und-schwammig-Feelings.
Er vollführte eine halbe Drehung und sah ihr in die Augen. „Nach allem, was du dir am Montag geleistet hast, kann ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“ Obwohl es ihm leichtfiel, die richtige Mischung aus väterlicher Strenge und geschäftsmäßiger Distanz in seine Stimme zu legen, spürte er ein leichtes Ziehen hinter den Schläfen wie einen Vorgeschmack auf kommende Kopfschmerzen. „Du warst vollkommen außer Kontrolle. Hast den Dienstwagen entwendet, hast um ein Haar Manni niedergefahren, hast gegen ein Dutzend Verkehrsregeln verstoßen, mehrere parkende Autos beschädigt, ein Moped und einen Zaun. ‚Amokfahrt einer Kripobeamtin‘, stand in der Zeitung. Der Dienstwagen ist Schrott. Bloß ein Wunder, dass niemand verletzt wurde.“
„Das hätte nicht passieren dürfen. Es tut mir wirklich leid.“
„Und was, wenn es wieder passiert? Beim nächsten Mal gibt es vielleicht Tote. Glaubst du, da hilft uns deine nachträgliche Entschuldigung?“
Es war so still im Büro, dass er sie atmen hörte.
Sie flüsterte: „Es wird nicht wieder …“
„Ist dir überhaupt klar, dass ich alle Hebel in Bewegung setzen musste, um den Vorfall herunterzuspielen?“
„Danke dafür.“
„Lass stecken. Im Gegenzug erwarte ich, dass du endlich deinen angesammelten Urlaub nimmst, wenn du dich schon nicht krankschreiben lässt. Drei Wochen Minimum! Und denk zumindest über eine Therapie nach. Ich kann nicht riskieren, dass du beim Anblick von verkohlten Leichen jedes Mal durch die Decke gehst.“
„Ist angekommen. Darf ich mir aussuchen, wo ich die drei Wochen verbringe? Oder hast du schon in einer geschlossenen Anstalt gebucht?“
Ihr Zynismus bohrte sich wie ein Splitter unter seine Fingernägel. Doch als er die Müdigkeit in den grüngrauen Augen sah, schluckte er den aufkeimenden Zorn hinunter. „Warum fährst du nicht nach Tirol, zu deiner Familie?“
„Fantastische Idee! Urlaub mit Mami und Papi in den Bergen. Familienaufstellung in echt …“
„Dann eben nicht!“, brüllte er. Sekunden später ärgerte er sich darüber, dass ihn doch noch der Zorn übermannt hatte. „Jedenfalls will ich dich hier drei Wochen lang nicht sehen.“
Eines musste man ihr lassen: Sie wusste, wann sie verloren hatte. Stumm und hoch erhobenen Hauptes segelte sie zur Tür hinaus wie ein zutiefst gekränkter Schwan. Halb im Korridor drehte sie sich noch einmal um, hob die Rechte und salutierte. „Zu Befehl, Herr Major!“ Als die Tür ins Schloss fiel, klang es wie das Zusammenschlagen von Hacken.
Nowak schluckte den Affront hinunter. Er atmete auf, wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und wunderte sich, dass man seine Erleichterung nicht hören konnte. Diesmal hatte er ihr gezeigt, wo Barthel den Most holte. Aber die Freude darüber verflog rasch. Zurück blieb ein schaler Nachgeschmack. Es war viel zu leicht gegangen. Sie hatte zu schnell nachgegeben. Was bedeutete, dass sie bereits resigniert hatte. Dass nicht das kleinste Quäntchen Kampfgeist mehr in ihr steckte. Und dass er sich jetzt erst recht Sorgen um sie machen musste.
3
Jana Pechtold erklärte die morgendliche Gassirunde für beendet, öffnete die Gartentür und ließ Tomlinson von der Leine. Der pubertäre Schnauzer-Beagle-Mischling raste mit flatternden Ohren zum Hasenstall und umkreiste ihn bellend. Er brauchte mehrere Runden, um einzusehen, dass er den Zwergkaninchen keinen Schreck mehr einjagen konnte. Sie knabberten gemächlich weiter an ihren Salatblättern und Karfiolstrünken und scherten sich nicht um den Kläffer. Woraufhin Tomlinson es sich anders überlegte und ein Insekt verfolgte. Er schnappte danach. Entweder hatte er ein stachelbewehrtes Exemplar oder eine kulinarische Niete erwischt, denn er schüttelte sich und rieb seine Schnauze ins Gras. Dann setzte er sich kerzengerade hin und stieß ein schauriges Heulen aus.
Jana lachte. Vielleicht hatte Paulina doch nicht so unrecht gehabt, ihn nach ihrem Lieblingssänger von One Direction zu benennen, weil der Hund wie Louis William Tomlinson über eine sonore Stimme verfügte.
Nachdem Jana zwei Rechnungen, einen Katalog für Kindermode und einen Briefumschlag aus dem Postfach gefischt hatte, ging sie ins Haus. Die Handyrechnung war wie erwartet niedrig ausgefallen, dafür schockierte sie der Betrag, den sie für das Feriencamp ihrer Töchter hinblättern musste. Der würde ein Riesenloch in ihre Finanzen reißen. Aber einen Ausweg gab es nicht, sie hatte es den beiden versprochen. Eine Woche Zirkusworkshop hatten Sophie und Paulina sich in seltener Einigkeit gewünscht und Jana war heilfroh, dass die Zwillinge etwas gemeinsam unternahmen, aus freien Stücken, und dass es mit Bewegung zu tun hatte. Paulina wollte unbedingt Jonglieren lernen, während Sophie sich mehr fürs Einradfahren interessierte.
Seufzend legte Jana die Rechnungen in den Ordner mit der Aufschrift „Banking“ und öffnete den Briefumschlag. Zum Vorschein kam ein Zeitungsausschnitt mit einer Todesanzeige. Sonst enthielt der Umschlag nichts, keine handgeschriebene Botschaft, kein Kärtchen, keinen Absender. Merkwürdig.
Ein Ziehen im Unterbauch ließ sie zusammenzucken. Wie immer, wenn sich finanzielle Probleme in den Vordergrund drängten, blieb ihre Monatsblutung aus. Also ziemlich oft. Dann plagten sie tagelang krampfartige Bauchschmerzen. Sie ignorierte die Kontraktionen ihrer Gebärmutter und betrachtete die Todesanzeige genauer.
Zuerst fiel ihr Blick auf den Namen Hirmer, der ihr nichts sagte. Nein, sie kannte niemanden, der so hieß, und auch die Gesichter auf dem Foto weckten keine Erinnerung. Allerdings war es unscharf und sehr klein. Es zeigte einen lockigen Mann mit Brille, eine lächelnde Frau mit einem Baby im Arm und ein kleines Mädchen mit Zöpfen, das den Blick ernst – fast ein bisschen vorwurfsvoll – auf den Betrachter richtete. Darunter war ein Gedicht von Rilke abgedruckt.
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
Jana las weiter.
Durch einen tragischen Verkehrsunfall müssen wir Abschied nehmen von unseren Lieben:
Fritz Hirmer, Antiquitätenhändler, 16. 8. 1976 – 4. 8. 2014
Lisa Hirmer, geborene Silberstein, Kunsthistorikerin, 15. 5. 1983 – 4. 8. 2014
Jonas Hirmer, 24. 2. 2008 – 4. 8. 2014
Es dauerte mehrere Sekunden, bis der Name Silberstein in Janas Bewusstsein sickerte. Lisa Silberstein.
Um Himmels willen. War das etwa die Lisa? Ihre Schulkollegin und Banknachbarin? Ihre allerbeste Freundin im Alter von sieben bis siebzehn?
Unmöglich. Oder?
Sie las die Namen noch einmal. Kontrollierte das Geburtsdatum.
Es war Lisa. Zweifel ausgeschlossen. Die Gebärmutterkrämpfe wurden heftiger. Jana presste eine Hand auf den Bauch.
Bilder flitzten durch ihr Hirn, Erinnerungsfetzen. Die blonde, fröhliche Lisa. Immer zu Späßen aufgelegt. Temperamentvoll. Klug. Beliebt. Wann hatte sie sie zum letzten Mal gesehen? Bei der Maturafeier? Nein, ein Jahr später, flüchtig, an der Uni. Schon damals hatten sie keinen Kontakt mehr gehabt. In der siebten Klasse war die Freundschaft zerbrochen. Besser gesagt, sie war langsam in sich zusammengefallen. Wie verunglückte Salzburger Nockerl. Oder wie die Hüpfburg, die die Silbersteins zur Geburtstagsparty von Lisas Bruder ausgeliehen und in die Lisa und sie ein Loch gebrannt hatten, mit dem Grillanzünder. Jana hatte weder gewusst, dass Lisa ihren Traum, Medizin zu studieren, für Kunstgeschichte aufgegeben, noch, dass sie ihre ungezähmte blonde Mähne gegen einen dunkel gefärbten Bob getauscht und einen Mann geheiratet hatte, der mit alten Bildern und Möbeln handelte. Und jetzt waren beide bei einem Unfall gestorben, zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn. Nur das Mädchen mit den Zöpfen war übrig geblieben. Was für ein Schicksal!
Jana fragte sich, was sie empfand. Trauer? Oder Mitleid? In Anbetracht ihrer langjährigen Freundschaft wäre wenigstens ein gewisses Maß an Betroffenheit angebracht gewesen. Aber so sehr sie in sich hineinhorchte, da war nichts. Außer einer erschreckenden Leere konnte sie keinerlei Emotionen aufbringen. Höchstens Verwunderung darüber, wer ihr die Todesanzeige geschickt hatte. Noch dazu nicht wie üblich als Parte, sondern als Zeitungsausschnitt. Lisas Eltern bestimmt nicht. Erstens entsprach das nicht dem Stil der Silbersteins. Zweitens waren sie mit ihren Eltern befreundet und hatten Jana, die missratene Tochter, entweder aus Überzeugung oder aus Solidarität zur „persona non grata“ erklärt, wie Lisas Vater, der alte Lateinprofessor, sich ausdrücken würde.
Sie musterte den Briefumschlag. Die Adresse war mit Füllfeder geschrieben, in einer altmodischen, nach rechts geneigten Handschrift, die ihr nicht bekannt vorkam. Der Stempel auf der Briefmarke sagte: Neusiedl. Seltsam. So viel sie wusste, lebten Lisas Angehörige alle in Wien. Aber was wusste sie schon?
Sie zerbrach sich den Kopf, erkannte aber bald, dass das nichts brachte. Mit Grübeln konnte sie das Rätsel nicht lösen und Lisa würde davon auch nicht mehr lebendig werden. Außerdem hatte Jana genug zu tun, um ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. Schließlich legte sie die Todesanzeige zum Katalog für Kindermode und stopfte beides in den Altpapiereimer. Aus den Augen, aus dem Sinn, hoffte sie.
Sie brühte grünen Tee auf, um ihren Kopf frei zu bekommen, und stellte sich vor die Magnettafel in der Küche, ihr wichtigstes Hilfsmittel zum Strukturieren des Alltags. Die gelben Notizzettel „Hasen füttern“ und „Hundespaziergang“ nahm sie ab, auch „Nudeln kochen für Nudelauflauf“. All das hatte sie bereits erledigt. Wie jeden Tag zerknüllte sie die abgearbeiteten Zettel genüsslich und warf sie mit Schwung in den Papierkorb. Wie jeden Tag traf sie nicht und musste sich bücken. Ein lieb gewonnenes Ritual.
Leider wartete die Tafel für heute mit acht weiteren Zetteln auf. Drei der Aufgaben wollte Jana am Vormittag absolvieren: „Einkaufen“, „Gynäkologin“ und „Glückskekse.“ Ein Blick auf die Uhr überzeugte sie davon, dass das nicht zu schaffen war. Sie beschloss, das Einkaufen auf den späten Nachmittag zu verschieben, bevor sie nach Purbach fuhr, um Paulina und Sophie abzuholen. Die beiden hatten bei einer Freundin übernachtet, deren Eltern ein eigenes Bootshaus besaßen, und wollten den ganzen Tag am Neusiedler See verbringen.
Die gynäkologische Untersuchung war zwar überfällig, aber Jana hatte überhaupt keine Lust dazu. Die lästigen Krämpfe und Unregelmäßigkeiten im Zyklus würde sie auch noch ein paar Wochen länger aushalten. Sie rief an und verschob den Termin auf September. Wieder ein Zettel weniger auf der Pinnwand und mehr Zeit für ihr wichtigstes Vorhaben, den neuen Auftrag. Bis morgen musste sie fünfzig Sprüche für Glückskekse abliefern. Wenn sie den Wünschen ihres Auftraggebers entsprachen, hatte sie das Geld für den Zirkusworkshop in der Tasche. Sie würde ohne Kontoüberziehung über die Runden kommen und ohne Lili anpumpen zu müssen. Großzügig wie sie war, würde Lili ihr zwar bestimmt unter die Arme greifen, aber Jana wollte die Gutmütigkeit ihrer Freundin nicht überstrapazieren.
Entschlossen setzte sie sich an den Laptop. Normalerweise ging ihr das Erfinden von Glückskeks-Sprüchen leicht von der Hand und machte Spaß. Außerdem war es lukrativer als ihre übliche Arbeit als Werbetexterin. Sprüche im Stil chinesischer Weisheiten fielen ihr eigentlich immer ein: „Auch ein Marathon beginnt mit einem Schritt“, zum Beispiel. Oder: „Glück ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es verschenkt.“
Doch diesmal wünschte sich der Marketingchef des größten deutschen Glückskeksherstellers etwas Besonderes. Etwas Abgehobenes. Glückskekstexte mit Hiobsbotschaften sollten es sein. Das hörte sich einfach an, aber Jana wollte nichts einfallen. Sie starrte minutenlang auf das leere Word-Dokument auf ihrem Bildschirm und wartete auf eine Eingebung. Irgendetwas in ihr sträubte sich dagegen, negative Prophezeiungen und pessimistische Sprüche zu erfinden, und sie fragte sich, ob es mit der Nachricht von Lisas Tod zu tun hatte. Nach einer Viertelstunde verlor sie die Geduld. Sie schnappte sich Stift und Notizblock und begann, in der Küche auf und ab zu laufen. Hieß es nicht, dass Bewegung die Kreativität förderte?
Sie stellte sich vor, wie der Besucher eines chinesischen Restaurants reagieren mochte, wenn er in seinem Glückskeks die Botschaft las: „Du steckst bis zum Hals im Schlamassel.“ Hoffentlich hat er Humor, dachte sie, überwand ihr ungutes Gefühl und notierte den Spruch. Ein Anfang war gemacht.
Als sie auf ihrer nächsten Küchenrunde am Fenster vorbeikam und hinausschaute, entdeckte sie Tomlinson, der gerade ein Loch in ihr Kräuterbeet grub. Die Petersilie war schon Geschichte. Jana riss das Fenster auf. „Pfui, Tomlinson! Aus!“
O Wunder. Der Hund hörte tatsächlich auf sie. Beleidigt trottete er davon, mit hängendem Kopf, die weiße Schwanzspitze lustlos nach unten geknickt.
„Heute ist ein guter Tag, um ein Grab auszuheben“, schrieb Jana auf ihren Block. Wieder kam ihr Lisa in den Sinn, die Todesanzeige, der schreckliche Unfall. Sie schob den Gedanken weg und nahm einen Schluck Tee.
„Jeder Schritt bringt dich dem Tod näher“, schrieb sie. Das Gefühl, dass der Knoten sich gelöst hatte, breitete sich als angenehme Wärme in ihrem Bauch aus. „Das Unglück hat lange Beine. Du kannst ihm nicht entkommen.“
Draußen kläffte Tomlinson hysterisch, als würde er jemanden verbellen. Aber Jana hatte keine Zeit, sich um den Hund zu kümmern. Die nächste Idee war beinahe greifbar. „Das Leben …“ Nein. „Die Zeit ist …“ Das schnöde Fiepen ihres Handys ließ den Einfall zerplatzen wie eine Seifenblase. Weg war er, bevor sie ihn formulieren konnte.
Unbekannte Nummer, zeigte das Display. Schon wieder zog sich Janas Gebärmutter schmerzhaft zusammen, so schmerzhaft, dass sie aufkeuchte. Eine Vorahnung?
Unsinn, dachte sie, du bist doch sonst kein bisschen abergläubisch. Sie nahm den Anruf an. „Hallo?“
„Jana, bist du’s?“
Sie zuckte zurück, als hätte sie einen elektrischen Schlag bekommen. Diese Stimme hätte sie unter Tausenden erkannt. Vor Schreck setzte ihr Herz für ein oder zwei Schläge aus, um anschließend doppelt so schnell weiterzuklopfen.
„Hier ist Jo. Jo Fuchs.“
Sie schwieg. Umklammerte den glitschigen Fisch, in den sich ihr Handy verwandelt hatte, weil sie so stark schwitzte.
„Jana? Erinnerst du dich an mich?“
Was für eine blöde Frage! Als ob sie ihn je hätte vergessen können. Dabei hatte sie wirklich alles versucht, ihn sich aus dem Kopf zu schlagen, seit der Trennung damals, vor fünfzehn Jahren. Sie sah noch die Bernsteinsprenkel in seinen Honigaugen tanzen, als er ihr die Mitteilung gemacht hatte, dass es schön gewesen sei mit ihr, sehr schön sogar, aber jetzt sei es leider vorbei; dass es eben doch nicht die große Liebe gewesen sei, weil es diese große Liebe nicht gebe, natürlich nicht, nur in literarischen Dramen, Hollywoodschinken und pubertären Hirnen. Sie beide seien doch viel zu erwachsen für solche Märchen. Leichthin hatte er es gesagt, mit einem Lächeln, und ihr ganzes Leben danach – so schien es ihr – war vom verzweifelten Versuch geprägt gewesen, diesen Augenblick aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Und ihn, Jo Fuchs.
Ein vergeblicher Versuch. Ein verpatztes Leben.
„Sag doch was, Jana!“
Sie lauschte und schwieg, während ihr Herz einen wahnwitzigen Galopp hinlegte. Kein Wunder. Zuerst die Todesanzeige von Lisa. Dann Jos Anruf. Hatte er den Zeitungsausschnitt geschickt? Wusste er mehr über Lisa und diesen Unfall?
Und wenn schon, dachte sie plötzlich, ich will davon nichts hören. Schließlich habt ihr euch aus meinem Leben gestohlen, nicht umgekehrt. Außerdem hatte sie selbst genug Probleme, auch ohne die Jos und Lisas dieser Welt. Rasch zog sie eine Mauer um ihr Herz, mit einbetonierten Glasscherben und Stacheldraht obendrauf, unerklimmbar wie die Zäune, die Europa gegen Flüchtlinge errichtete.
„Hör zu, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Hast du …“
Schluss. Jana drückte den Anruf weg und schleuderte das Handy in die Obstschale, als hätte sie sich verbrannt. Eine Schar Fruchtfliegen flog von einem angefaulten Apfel auf und ließ sich Augenblicke später auf den überreifen Bananen nieder.
Erst nach sieben Runden um den Küchentisch beruhigte sich Janas Puls wieder. Sie besann sich, schnappte sich das Handy und speicherte Jos Nummer ein. Für alle Fälle. Wenn er nochmals anrufen sollte, würde sie sich gar nicht erst melden.
„Wer an ewige Liebe glaubt, ist selbst schuld“, kritzelte sie auf ihren Block, und: „Blinde Verliebtheit ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung.“
Sie schrieb mit einem Lächeln, das sich grimmig anfühlte. Ein Jetzt-erst-recht-Lächeln. Wenn ihre Einfälle so weiterflössen, könnte sie bald einen weiteren Zettel auf der Pinnwand zerknüllen. Vielleicht sollte sie Jo dankbar sein? Er hatte sie zwar aus der Fassung gebracht, aber ihre Kreativität beflügelt. Worüber er auch immer mit ihr sprechen wollte, es interessierte sie nicht.
„Der Weg zur Hölle ist mit den Ratschlägen guter Freunde gepflastert“, notierte sie und wechselte ins Arbeitszimmer, um ihre Notizen in die Word-Datei zu übertragen. Als sie sich später eine weitere Tasse Tee gönnte und dabei durchs Küchenfenster blickte, war Tomlinson schon wieder im Kräuterbeet zugange. Im ehemaligen Kräuterbeet, denn das Loch maß inzwischen einen halben Meter in der Breite und war so tief, dass nur mehr die Kruppe des Hundes herausschaute. Erdklumpen flogen in alle Richtungen und die weiße Schwanzspitze beschrieb Kreise wie ein Pendel, das Begeisterung kurz vor dem Überschnappen anzeigte.
„Aus!“, brüllte Jana.
Diesmal reagierte das Miststück nicht. Da nahm sie den faulen Apfel aus der Obstschale und warf. Sie verfehlte Tomlinson nur knapp, aber er musste den Luftzug der vorbeifliegenden Frucht gespürt haben, denn er hörte auf zu graben und hetzte dem vermeintlichen Ball hinterher.
Jana lief hinaus, um vielleicht doch ein paar von ihren Kräutern zu retten. Als sie am Hasenstall vorbeikam, stutzte sie. Im Gitter klaffte ein Loch. Doch die beiden Kaninchen waren nicht ausgebüxt, wie sonst bei jeder Gelegenheit, sie lagen friedlich nebeneinander. Zu friedlich.
Sie waren tot.
„Tomlinson!“, brüllte sie. „Wenn ich dich erwische!“
Dann besann sie sich. Betrachtete das Loch im Gitter näher. Die Drähte waren fein säuberlich durchtrennt worden. Und den Hasen hatte jemand den Hals umgedreht. Wenn der Hund zugebissen hätte, wäre Blut geflossen.
Etwas Eisiges rann ihren Rücken hinab, als ihr bewusst wurde, dass nur ein Mensch dafür verantwortlich sein konnte. Ein kranker, perverser Mensch. Während sie Hiobsbotschaften getextet hatte, musste er in den Garten eingedrungen sein und die harmlosen Karnickel abgemurkst haben. Und das am helllichten Tag. Am Stadtrand von Eisenstadt, dem friedlichsten und spießigsten Kaff, das man sich vorstellen konnte. Jetzt erinnerte sie sich auch daran, dass Tomlinson wild gekläfft hatte.
Mist! Sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie viele Tränen das geben würde. Sophie würde am Boden zerstört sein. Ausgerechnet ihre Schmusehäschen! Dabei war die Anschaffung schon ein Kompromiss gewesen, denn natürlich hätte sich auch Sophie einen Welpen zum zehnten Geburtstag gewünscht, genau wie ihre Zwillingsschwester. Oder wenigstens eine Katze. Aber Jana hatte auf Sophies Vernunft gesetzt. Sophie würde schon einsehen, dass sie nicht zwei Hunde halten konnten, hatte sie gedacht. Von Hund und Katze ganz zu schweigen. Und so war es auch gekommen. Nach einer kurzen Phase der Enttäuschung, des Maulens und der bitteren Tränen hatte Sophie sich mit den Hasen angefreundet. Inzwischen liebte sie Flocke und Fluffel abgöttisch. Das grausame Ende der kuscheligen Freunde konnte Jana ihrer Tochter nicht zumuten.
Sie ging ins Haus und heftete zwei weitere Notizzettel an die Pinnwand: „Truhe“ und „Lentsch“.
Zuerst packte sie die kleinen Körper in einen Plastiksack, den sie gut verschloss und zuunterst in der Tiefkühltruhe versenkte. Dann schnappte sie sich den Autoschlüssel und ihre Geldbörse und machte sich auf den Weg zu Sigisbert Lentsch, dem Biobauern und Hasenzüchter.
Hoffentlich hat er zwei junge Zwerghasen, die Flocke und Fluffel aufs Haar gleichen, dachte sie. Hoffentlich merkt Sophie nichts. Aber je weiter sie sich von Eisenstadt entfernte, umso lächerlicher kam ihr dieser Gedanke vor. Selbst wenn sie Klone von Flocke und Fluffel auftreiben könnte, Sophie würde sich nicht täuschen lassen. Sie war ein hellhöriges Kind. Eines, das alles hinterfragte; das man nicht so leicht hinters Licht führen konnte.
Am Verhalten der Hasen und vor allem an Janas eigenem Verhalten würde sie merken, wie der Hase lief. Den Rest würde sie sich zusammenreimen und noch ein bisschen schrecklicher ausmalen, als es sich tatsächlich abgespielt hatte.
Nein, Jana musste ihr die Wahrheit sagen. Und hoffen, dass zwei hilflose, zitternde Fellknäuel, die Liebe und Aufmerksamkeit brauchten, Sophie über Trauer und Enttäuschung hinweghelfen konnten. Vielleicht würde es sie auch trösten, ein schönes Grab für Flocke und Fluffel auszusuchen. Zum Beispiel das Kräuterbeet, das Tomlinson so vorsorglich in eine Grube verwandelt hatte.
Was für ein Tag, der mit Todesanzeigen, Hiobsbotschaften und ermordeten Zwerghasen beginnt, dachte Jana. Wie wird erst der Nachmittag aussehen?
„An manchen Tagen geht alles schief, dafür klappt an anderen gar nichts.“ Sie beschloss, den Spruch ihrer Glückskekstextsammlung hinzuzufügen, sobald der Hasenkauf erledigt war.
4
8. August
Ein monotones Geräusch weckte sie. Ein Geräusch, das sie nicht gleich einordnen konnte, obwohl es ihr bekannt vorkam. Sie hatte lange und tief geschlafen, traumlos, den kleinen gelben Kapseln sei Dank, die ihr vor sieben Jahren verschrieben worden waren; die angstlösend, muskelentspannend und schlaffördernd wirken sollten. Sie hatte sie ganz hinten im Apothekerschrank gefunden, vermutlich waren sie längst abgelaufen.
Ihr Mund war trocken und das Gehirn funktionierte noch nicht. Sie brauchte mehrere Minuten, bis sie dem Geräusch einen Namen geben konnte: Gurren. Das Gurren von Tauben.
Fast gleichzeitig fiel ihr die Stille im Hintergrund auf. Wenn man sich die Vogellaute wegdachte, herrschte absolute Ruhe. Kein Verkehrslärm von der Straße, kein Pressluftgehämmer von der Baustelle schräg gegenüber, kein Babygeschrei aus der Nachbarswohnung, kein Gezänk aus der Wohnung darüber. Sonnenlicht fiel schräg durch die hölzernen Lamellen der Jalousien in ein Zimmer, das nicht das ihre war.
Wo bin ich, dachte Bukowski. Was ist passiert?
Einen Augenblick später setzte die Erinnerung ein und mit ihr heftiger Kopfschmerz.
Die Bilder überfielen sie mit Wucht. Bilder von den verbrannten Unfallopfern in der Höhenstraße und Bilder vom Wohnungsbrand vor sieben Jahren. Sie vermischten sich, sie überlagerten sich, die älteren Bilder verdrängten die jüngeren und blieben hängen: eine schwarze Männerleiche mit grotesk angewinkelten Armen und Beinen, daneben die verkohlten Reste eines Kinderkörpers.
Die Bilder löschten das Sonnenlicht aus, das gelbe Kringel auf den Parkettboden gemalt hatte. Sie brachten eine qualvolle Trostlosigkeit mit, die sich als zähe graue Flüssigkeit in Bukowskis Kopf ausbreitete und dabei in die geheimsten Ecken ihres Gehirns vordrang, sie flutete, als wollte sie alles Helle darin für immer auslöschen.
Bukowski war schlecht. Sie taumelte aus dem Zimmer – wo verdammt war hier das Klo? –, fand es nicht, fand stattdessen ein fröhlich-türkis gefliestes Badezimmer und übergab sich ins Waschbecken.
Als sie nach einer ausgiebigen Dusche auf der Pergola saß, unter dem wuchernden Grün Wilden Weins und zwischen gigantischen Hortensienstauden, zitterten ihre Finger noch immer, aber Kopfschmerzen und Übelkeit waren verflogen. Sie biss in eine Scheibe Schwarzbrot, das ihre Freundin Kim Newrkla gebacken hatte. Das Brot war warm, die Rinde knackte unter Bukowskis Zähnen. Es schmeckte nach Fenchel und Koriander und erinnerte sie an die Tiroler Krustenwecken, für die Opas Bäckerei berühmt gewesen war.
Kim kam barfuß über den Rasen gelaufen und brachte ein voll beladenes Tablett mit. Bukowski roch schon von Weitem das betörende Aroma ihres zweitwichtigsten Lebenselixiers. „Kaffee!“, rief sie erleichtert und nahm eine dampfende Tasse entgegen. Unter der zimtbraunen Crema hatte das Gebräu die Farbe von flüssiger Lakritze. „Heißt das, du hast deine Kamillenteephase überstanden?“
Kim strich sich eine ihrer widerspenstigen Locken aus dem Gesicht. „Alles zu seiner Zeit.“ Sie runzelte die Stirn. „Und nenn ihn bittschön nicht Kaffee. Du hast es hier mit einem ganz speziellen Espresso à la Newrkla zu tun.“