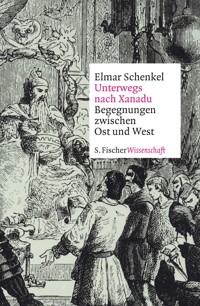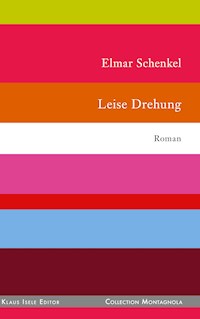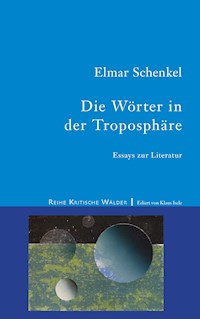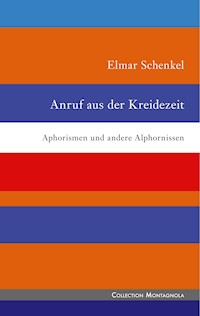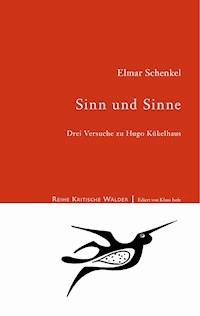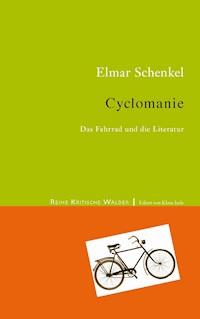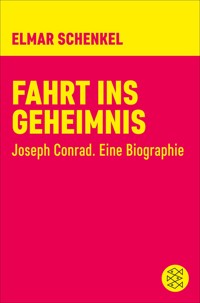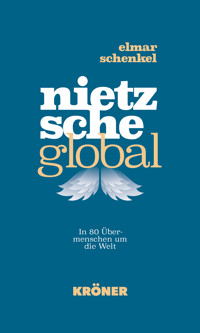
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was hat eine Selbstmordwelle in Japan mit Nietzsche zu tun, ein Comic-Held, der moderne Tanz aus den USA – oder Pippi Langstrumpf? Warum berufen sich ausgerechnet Feministinnen immer wieder auf ihn – oder Diktatoren, ebenso wie ihre Gegner? Ein britischer Krimiautor schickt einen Amateurdetektiv auf die Fährte des verhassten Übermenschen, während ihm andernorts ganze Kompositionen gewidmet werden. Seit zehn Jahren ist Elmar Schenkel an der Nietzsche-Gedenkstätte in Röcken tätig und wundert sich über die Menschen aus aller Welt, die dorthin pilgern: die Australierin, die Familie aus Argentinien, die Frauen im koreanischen Bus … Kein anderer Philosoph scheint eine solche intellektuelle, vor allem aber emotionale Anziehungskraft zu besitzen wie Friedrich Nietzsche. Der ganze Globus hat sich an ihm abgearbeitet: die ganz Großen ebenso wie die Kleinen, Künstlerinnen ebenso wie Poeten, Politiker, Philosophinnen oder Popstars. Und so ist dieses Buch auch keine akademische Abhandlung, sondern eine Spurensuche, ein Rundblick über die Nietzsches, die den letzten 150 Jahren in vielen Kulturen der Welt entstanden sind. Indem jeder Zentrales verrät über die Menschen und Gesellschaften der jeweiligen Länder, ist das Buch auch eine kleine Weltkulturgeschichte – mit dem Blick auf Nietzsche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elmar Schenkel war bis 2019 Professor für Englische Literatur an der Universität Leipzig. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Vergleichende Mythologie und Gründungsmitglied des Nietzsche Vereins Röcken. Zahlreiche Veröffentlichungen zu Nietzsche, zuletzt: Wahre Geschichten um Friedrich Nietzsche. Er ist Herausgeber von Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft im Kröner Verlag und hat zudem literarische Werke, Essays und Reisebücher veröffentlicht.
elmar schenkel
nietzscheglobal
In 80 Übermenschen um die Welt
Kröner Verlag
Elmar Schenkel
Nietzsche global
In 80 Übermenschen um die Welt
1. Auflage
Stuttgart, Kröner 2025
isbn druck: 978-3-520-91701-0
isbn e-book: 978-3-520-91791-1
Umschlaggestaltung: Denis Krnjaić
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2025 Alfred Kröner Verlag Stuttgart, Lenzhalde 20, 70192 Stuttgart
[email protected] · Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Nietzsche in den deutschsprachigen Gebieten. Ein Überblick
Nietzsche global. Spuren einer weltweiten Wirkung
Bibliographie Verwendete und weiterführende Literatur
Abbildungsverzeichnis
Register
Vorwort
Ein anderer Name für Widerspruch ist Nietzsche. Nietzsche widersprach – den Erklärungen, mit denen die Menschen sich die Welt zurechtlegten, und er widersprach sich selbst. Es ist kein Zufall, dass, wenn Menschen über Nietzsche reden, es oft zu Streit und Widerworten kommt. Wie Moshe Zimmermann schrieb: »Nietzsche kann auf beiden Seiten stehen und konnte bisher jedes Lager erfolgreich spalten.«
Sein Denken ist brisant, das heißt gefährlich, aber auch eine frische Brise durch die Fenster der Wahrheitsgebäude, in denen sich Glaubensformen, Ideologien und Konventionen nach vorgeschriebenen Bahnen bewegen. »Auf die Schiffe!«, rief Nietzsche einst den Philosophen zu, doch es waren weniger diese als ganz andere, die einem solchen Ruf folgten: Neugierige, Entdeckerinnen, Arbeiter, Feministinnen, Anarchisten, Trinker, Literatinnen, Aussteiger, aber auch jene, die philosophische Rechtfertigung für Gewalt, Machtphantasien und Herrschaft suchten, ob auf der linken oder der rechten Seite des politischen Spektrums. Der Umgang mit Nietzsche, die Zitate, die man vor sich herträgt, sagen entsprechend weniger über diesen selbst als über die jeweiligen Fahnenträger aus. Dabei stehen die Zitate für Einzelne ein, gelten aber auch für Kollektive, gar Nationen. Sie sind medial im eigentlichen Sinne: Sie vermitteln zwischen Gedanken und Taten, zwischen einem Denker und den anderen, die mit ihm etwas anfangen wollen. Nietzsche ist zudem Medium auch in einem anderen Sinne, nämlich Seismograph, messerscharfer Wahrsager, Chef von Séancen, in denen Kulturen dem geisterhaften Wesen begegnen, von dem ihre kollektiven Projektionen und Illusionen herstammen.
Nietzsche steht außerhalb, und für seine Einstellung gilt sicherlich das Karl Valentin (oder Lichtenberg) zugeschriebene Wort: »Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht.« Sein Denken, einsam wie es entstanden ist, hat dabei viele Wirkungen ausgelöst, am eigenen Leib, an der eigenen Seele wie an Gesellschaften oder Nationen. Hat er am Ende mehr Schaden angerichtet als Nutzen und Heil gebracht? Steven Aschheim, Autor eines Buches über Nietzsche und die Deutschen (2000), rechnet ihm mehr Unheil als Gutes zu. Aber die Frage ist schwer zu beantworten, weil sich bei seinen Wirkungen so vieles im Inneren der Menschen abspielt, während von Nietzsche angeregte Morde oder gar Kriege die Presse alarmieren und daraus ein stark negatives Bild entsteht. Wo sich Menschen mit Hilfe von Nietzsche befreit haben, ob als Gruppe oder Einzelne, ob von Dogmen und Konventionen oder Religion und Ideologie, wo er sie beflügelt oder vor der Resignation gerettet hat, bleibt das dagegen oft unsichtbar. Vielleicht ist Nietzsche ja schlicht ein Rauschmittel, das in verschiedene Richtungen wirkt, je nach Gebrauch und Dosis …
Ausgangspunkt dieses Buches ist der Museumsdienst, den ich seit 2015 als Mitglied des Nietzsche-Vereins Röcken zu leisten das Vergnügen habe. Die Begegnungen mit Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt, ob aus Leipzig oder dem Iran, der Ukraine oder Brasilien, ob aus Chemnitz oder Hohenmölsen, sind für mich immer eine Bereicherung. Ich erfahre von ihnen, wie und warum sie zu Nietzsche gekommen sind, welche Rolle die jeweilige Kultur dabei spielte – ob verhindernd oder fördernd – und was Nietzsche ihnen heute bedeutet. Und wie war das mit Nietzsche in der DDR? Schicksale und Zufälle: der Iraner, der aus der Ukraine flüchtet und zuerst nach Röcken will, der Ukrainer, der als Zwangsarbeiter in Mittelbau-Dora mit Hilfe von Zarathustra überleben konnte, der russland-deutsche Junge, der wissen will, was denn dieser Nietzsche überhaupt erfunden habe, die lesbische Chinesin, die sich durch Nietzsche befreit fühlt, die Angestellte aus Bitterfeld, die fragt, wie man aus einer Religion ausbrechen kann. Oder der afghanische Fuhrunternehmer, der mit einem Lastwagen kam und gegen gutes Geld gleich das Grab, die Kirche und die Skulpturen mitnehmen wollte.
Wer nach Röcken kommt, ist meist dem dort Geborenen und Begrabenen gegenüber freundlich gestimmt, aber für viele ist er auch eine kulturelle Erscheinung, die man historisch-soziologisch-psychologisch einzuordnen versucht, ein Spiegelbild, in dem sich wie nirgends sonst in einer Person und deren Nachleben deutsche Geschichte spiegelt, bis weit über den Kalten Krieg hinaus. Manche berauschen sich an diesem geschichtsträchtigen Ort und glauben, mit Nietzsche medial in Kontakt zu kommen. Zum Teil lassen sich diese Gedanken und Stimmungen in den Gästebüchern unseres Museums nachlesen oder klingen in den Geschichten nach, die uns die Menschen im Dorf oder im Pfarrhaus erzählen. Der damalige Außenminister Joschka Fischer etwa schrieb ins Gästebuch »Ein zwiespältiger Eindruck bleibt.« Ein anderer Gästebucheintrag kam von einem Amerikaner: »You have finally reached the most important place on earth.« Daraus wurde der Titel eines Buches der Künstlerin Geeske Janßen (2022), die mit ihren Fotos und Interviews mit Dorfbewohnern eine Brücke zwischen Nietzsche und der globalen Welt spannte.
All dies bewog den Verleger Fayçal Hamouda und mich dazu, 2019 einen Band mit Briefen an Friedrich Nietzsche zu seinem 175. Geburtstag zusammenzustellen, in dem Briefeschreiber und -schreiberinnen aus weiten Teilen der Welt versammelt waren. Mir fiel dabei auf, dass die gängigen Rezeptionsstudien meistens auf wenige Länder fokussiert sind: abgesehen von den deutschsprachigen Gebieten auf Frankreich, Italien, USA, Spanien, Russland, China und die skandinavischen Länder. Auch wenn hier sicherlich die bedeutendsten Nietzsche-Forschungen betrieben werden oder die stärksten Einflüsse sichtbar sind, wird dabei doch eine stark europa- und amerikazentrierte Sichtweise sichtbar. Ich war froh, dass wir viele Briefeschreiber aus anderen Erdteilen rekrutieren konnten: aus den Philippinen, Argentinien, Israel, Tunesien oder Sibirien. Dabei wurde deutlich, wie viel man in jedem einzelnen Fall über bestimmte kulturelle Eigenheiten der jeweiligen Länder lernen kann. Ihnen allen hielt der einstmals junge, jetzt sehr alte weiße Mann aus Röcken einen Spiegel vor, in dem sich Frauen wie Männer, Hochstaplerinnen und Hagestolze, Queere, Nicht-Weiße, Ärztinnen und Ingenieure und viele andere mehr wiedererkennen können, wenn auch manches Mal, indem sie Nietzsche widersprechen oder ihn zurechtweisen. Die Energie aber, und noch die zur Widerrede, kommt von Nietzsche selbst.
Der Titel – Nietzsche global – lässt vermuten, dass es sich um ein unmögliches Buch handelt, um ein Buch der Lücken. Zumindest ist es nur stückhaft vorstellbar, denn der Nietzsche-Globus wächst unaufhörlich. Warum das so ist? Friedrich Nietzsche scheint ein Denker/Dichter zu sein, der trotz seiner vielfältigen Einsamkeit menschliches Dasein so reflektiert hat, dass fast alle Kulturen in seinem Denken fündig werden, und zwar immer auch individuell. Aus den Begegnungen und Briefen wurde deutlich, wie sehr Nietzsche widerspiegelt, und zwar im Sinne eines Rorschachtests. Nietzsches Denken hat eine Universalität, die auch Karl Marx’ Werke haben, jedoch kommt bei Nietzsche eine menschliche Komponente hinzu. Wer das Gästebuch des Karl-Marx-Hauses in Trier durchblättert, wird viel Lob, ob aus China oder Südamerika, für den Deutschen finden, für seine revolutionären Ideen und politischen Einsichten. Was man dort aber nicht findet, ist ein emotionales Echo, ein individuelles Angesprochensein, eine persönliche Geschichte. Genau das findet sich jedoch in den Gästebüchern von Röcken, Naumburg oder Sils Maria. Nietzsche spricht in das Innere der Menschen hinein, zu menschlichen Grundbedürfnissen; in diesem Sinne ist er ›spirituell‹.
Größtmögliche Widersprüchlichkeit ist dazu eine gute Voraussetzung, so wie eine zerfallende Mauer mit all ihren Rissen, Aufsprengungen und Löchern, ihrem Rieseln und Starren, ihren Durchlässigkeiten und opaken Stellen die beste Projektionsfläche bildet für Phantasie, Hypothese, Spekulation, Assoziation und Erinnerung. Oder, wie dies die Pädagogin Stefanie Jung einmal mir gegenüber ausdrückte: Nietzsche wirke wie ein Prisma. Durch das Betrachten und Interpretieren der farbigen Formen und Flecken, die der Kristall auf die unterschiedlichsten Wände und Objekte wirft, gelangen wir an unbewusste Schichten in uns und unserer Kultur.
In diesem Sinne habe ich gesammelt. Vielleicht fällt dabei auf, dass Kunst, Dichtung und Ästhetik eine größere Rolle spielen als die philosophische Vereinnahmung und Auseinandersetzung mit Nietzsche, insbesondere die akademische. Sie ist in ihren Sphären wichtig, aber doch meist nur dort. Der dichtend denkende Nietzsche, der die Menschen in ihrer seelischen Verfassung anspricht, ist jedoch der weitaus wirksamere, und dies gilt insbesondere weltweit. Nietzsches Rückführung des Denkens auf das Leibliche, seine Bejahung des Lebens gegen alle Schwierigkeiten, sein eigenes tragisches Leben bewegt Menschen mehr als die Frage, wo genau er in der philosophischen Tradition steht. Solche Einordnungen mögen Kongresse bewältigen, für den Einzelnen indes bleibt etwas, das pathetisch die existenzielle Berührung durch das Schreiben dieses Einzeldenkers genannt werden darf. Ich gestehe auch, dass mir viele Gedanken zu Nietzsche in der Sekundärliteratur fremd bis unverständlich geblieben sind; oft sind es abstrakte Pflanzen auf einem eigentlich fruchtbaren Boden. Sicherlich zeichnen sich meine Interessen jedoch in den Landkarten ab, die ich mit diesem Buch vorlege, Karten, auf denen ein guter Teil des Spektrums abgebildet sein soll, das weit über die akademischen Felder hinaus in die Künste und die populäre Kultur hineinreicht.
Meine Suche war begleitet von Zufällen und Überraschungen, interessanten Begegnungen und Berichten. Es wurde also nicht mit einer systematischen Überwachungskamera gearbeitet. In Zukunft wird es sicher komplettere Abbilder des globalen Nietzsche geben, in denen digital alles gesammelt sein wird, was auch nur im Entferntesten nach Nietzsche aussieht. Hier können nur Spitzen von Eisbergen abgebildet werden. Zum Beispiel schickte mir meine Beraterin für Ungarn eine Liste von gut hundert ungarischen Intellektuellen, Dichterinnen oder Musikern, die sich mit Nietzsche beschäftigt haben. Oder man kann fragen: Wo sind der portugiesische Pessoa, der rumänisch-französische Cioran, der amerikanische O’Neill, der russisch-amerikanische Maler Rothko, der französische Segalen, der deutsche Komponist Wolfgang Rihm? Für mich ist es schön, dass manches offenbleibt; ich hoffe auf Nachschriften. Aber man darf sicherlich bei manchen der hier Vorgestellten ihre Repräsentativität hinterfragen.
Doch wie ›repräsentativ‹ war Nietzsche denn selbst? Für seine Kultur zum einen, und wie repräsentativ sind Übermensch und Wiederkunft für ihn selbst? Nutzen wir also die Gelegenheit, unvollständig sein zu dürfen, denn das regt das Denken an. Wenn die Landkarte identisch mit dem Land wird, hört das Denken auf. Wie aber gliedern? Nach Ländern und Kulturen oder wie hier geschehen nach Jahreszahlen? Ich habe mich für die Chronik entschieden, weil sie dazu verleitet, nolens volens einen Blick in verschiedene Kulturen zu werfen. Bei einer geographischen Aufteilung wäre man versucht, bei den Ländern zu bleiben, die einen ohnehin interessieren. Aber es geht mir eben um die Ausrutscher – man möge doch einmal in etwas ganz anderes hineingeraten, etwa in kleine Kulturen oder solche, die am Rand stehen. Wie stand es mit Nietzsche denn in Griechenland, in Vietnam oder Mexiko? Schön bis erschreckend ist immer die Überraschung, wenn man plötzlich einen Nikos Kazantzakis nach Röcken pilgern sieht oder den Attentäter, der den Ersten Weltkrieg auslöste, Nietzsche zitieren hört. Was an solch einer Spurensuche besonders auffällt: die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen auf diesem Planeten.
Das vorliegende Buch ist also nur eine Suche, die wichtige Momente und Figuren hervorhebt. Sehr nützlich war für mich eine Konferenz über »Nietzsches Zukünfte« 2024 in Weimar, die mir Gelegenheit gab, mit vielen Menschen aus der ganzen Welt ins Gespräch zu kommen. Wenn ich über Estland schreibe und nicht über Litauen, Chile oder Borneo, so ist das solchen Begegnungen zu verdanken. Es könnte Hunderte andere geben, aber zum Glück durfte ich nicht mehr schreiben.
Schreibweisen: Bei japanischen und chinesischen Namen habe ich grundsätzlich immer den Nachnamen vor den Vornamen gestellt. Die Schreibweise von russischen Namen ist aufgrund der Lesbarkeit der deutschen Konvention angepasst, also keine wissenschaftliche Transkription. Auch bei japanischen Namen habe ich auf Sonderzeichen verzichtet. Bei einigen Texten hat mich ChatGPT bei der Übersetzung unterstützt. Wo nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen der Originaltexte grundsätzlich von mir. Ansonsten standen mir Freunde und Bekannte aus China, Japan, Vietnam, der Ukraine, Rumänien, Ungarn, Polen oder Tunesien bei Fragen hilfreich zur Seite.
Mein Dank für viele Hinweise und Diskussionen geht an: Stephen Brodsky, Vancouver Island; Dai Xianmei, Beijing; Bernard Dupas, Paris; Magdalena Grams, Leipzig; Fayçal Hamouda, Leipzig/Djerba; Helmut Heit, Weimar; Uwe Hinrichs, Leipzig; Beate Hüneburg, Leipzig; Charles August, Bambus, Lena und Stefanie Jung, Röcken; Frau I. Kalojanov, Leipzig/Budapest; Levan Kobakhidze, Tbilisi; Vanessa Lemm, UK/Australien; Sun Lee, Jeonju, Korea; Alejandro Loera, Mexiko City; Sebastian Mandla, Röcken; Nadine Menzel, Leipzig/Bamberg; Vitalii Mudrakov, Kyiv/Bochum; Melanie Reichert, Kiel; Ralf Eichberg und Catarina da Rosa, Naumburg; Corinna Schubert, Weimar; Leonore Sell, Göttingen; Yulia Sineokaya, Moskau/Paris; Andreas Urs Sommer, Freiburg; Matthias Steinbach, Braunschweig; Mihai Stroe, Bukarest; Jaanus Sooväli, Tartu; Tsuneyoshi Takashi, Tokyo; Yulius Tandyanto, Djakarta/Freiburg; Richard Tauché, Kreischau; Reiner Tetzner, Leipzig; Christian Trepte, Leipzig; Mohamed Turki, Münster; Stefan Welz, Leipzig. Und natürlich Ulrike und Jolka für ihre Geduld und Unterstützung!
Friedrich Nietzsche (ca. 1875), Foto: F.H. Hartmann
Nietzsche in den deutschsprachigen Gebieten. Ein Überblick
1870 – 1918
Die Rezeption Nietzsches in den deutschsprachigen Ländern beginnt, zaghaft sicherlich, schon zu einer Zeit vor dessen Zusammenbruch in Turin (Januar 1889). Nietzsche selbst war ambivalent gegenüber Jüngerschaft. So behauptete er, Schüler zu haben, sei verachtenswert (etwa in Zarathustra), nur um privat doch immer wieder stolz darauf zu verweisen, wo man ihn überall lese und diskutiere, ob in Frankreich oder Skandinavien. Aber schon 1876 hatte er aus Wien zwei Briefe erhalten, in denen ihm von einem außergewöhnlichen Interesse an seinen Unzeitgemäßen Betrachtungen in Wiener Universitätskreisen berichtet wurde. 1887 gratulierte ihm ein Zirkel von Wiener Anhängern zum Geburtstag, und zwar aus der Berggasse 19 heraus, in der bald darauf Sigmund Freud wohnen würde. Ein Wiener Freund des Psychoanalytikers, der Arzt Josef Paneth, traf sich 1883 öfter mit Nietzsche in Nizza. Nietzsche war also schon ein wenig bekannt, doch erst die Veröffentlichungen und Vorlesungen des dänischen Literaturkritikers Georg Brandes erweiterten sein Wirkungsfeld nicht nur bis nach Russland und Skandinavien – sie strahlten auch auf das deutschsprachige Gebiet aus. Die wirklich intensive Rezeption beginnt jedoch erst nach Nietzsches Zusammenbruch im Jahr 1889. Zwei Faktoren sind dafür maßgeblich: der Ruhm eines dem Wahnsinn verfallenen Genies und die effiziente Arbeit der Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche am Status ihres Bruders als deutscher Geistesgröße.
Durch den Aufbau des Nietzsche-Archivs in Weimar gelang es ihr, ein großes Netz quer durch Europa aufzubauen und das geistige Erbe ihres Bruders durch eine begleitende Publikationstätigkeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Elisabeth hatte nach ihrer Rückkehr aus dem kolonialen Abenteuer mit ihrem Mann Dr. Bernhard Förster in Paraguay – die Gründung einer »arischen« und antisemitischen Kolonie, die gehörig schiefging und mit dem vermutlichen Selbstmord Försters endete – zunächst in Naumburg, dann ab 1896 in Weimar ihren kranken Bruder gepflegt. Mit Hilfe der Nietzsche-Freundin Meta von Salis konnte sie die Villa Silberblick in der Stadt der Klassik erwerben und dort eine Kultstätte um den Bruder herum installieren, ein kleine Version von Bayreuth, das für die glühende Wagner-Verehrerin eine große Erfahrung gewesen war. Der belgische Architekt und Jugendstildesigner Henry van de Velde sorgte für ein gediegen-elegantes, modernes Ambiente, das Archiv kümmerte sich unter Leitung von Elisabeth um die Herausgabe der Werke des Philosophen. Die Nietzsche-Villa samt Nachlass sollte aus ihrer Sicht als Fortsetzung der Kultur des klassischen Weimar verstanden werden.
Der Diplomat, Pazifist und Kosmopolit Harry Graf Kessler war in den ersten Jahrzehnten ein großer Unterstützer des Archivs und bekam den Auftrag, ein Komitee zu einem Denkmal Nietzsches zu leiten, das zu seinem 70. Geburtstag 1914 enthüllt werden sollte. Kessler plante ein Stadion für Sport, Tanz und weihevolle Veranstaltungen und versuchte so, die neue Sportbewegung mit Nietzsches Philosophie zu verbinden. Eine Arena, athletische Statuen, ein Tempel für den Übermenschen sollten Weimar bereichern und, nach Goethe, vor der Welt ein weiteres Genie manifestieren. Man erinnere sich: 1896 begründete der Sportler und Pädagoge Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Neuzeit, verbunden mit dem hehren Ziel einer Vereinigung von Körper und Geist – ein Ideal für Nietzscheaner wie für Lebensreformer. Mit dieser ›Olympisierung‹ wird der Übermensch zum Athleten, aus dem Willen zur Macht wird der Wille zur Medaille. Kessler hatte Ähnliches mit seinem Gesamtkunstwerk vor: »zum Lobe Nietzsches und zum Ruhm des kompletten Menschen, der Sinnlichkeit und Geistigkeit harmonisch in sich fasst.« Im Komitee saß Europas Avantgarde: André Gide, Max Liebermann, Edvard Munch, Richard Strauss oder Gustav Mahler. Aufbrechende politisch-weltanschauliche Differenzen zwischen Kessler und Elisabeth verzögerten aber das Projekt, bis der Krieg es schließlich unmöglich machte.
Elisabeth Förster-Nietzsche (ca. 1921)
Elisabeth Förster-Nietzsche war ein gnadenloser Motor, der die Nietzsche-Industrie durch Vernetzung, Vorträge, Projekte und vor allem Publikationen in Gang hielt. Ohne ihre Energie und Chuzpe in einer männerdominierten Gelehrten- und Kunstwelt wäre Nietzsche möglicherweise ein kleines Flämmchen geblieben, eine schrullige Anekdote im Reich der philosophischen Subkultur. Immerhin wollte sie sich auch belehren lassen über die philosophische Gedankenwelt ihres Bruders und suchte dabei nach möglichen Herausgebern. 1894 – das Archiv war anfangs noch in Naumburg – lernte sie einen jungen, vielversprechenden Germanisten/Philosophen kennen, der gerade in Weimar Goethes naturwissenschaftliche Schriften herauszugeben begann – es war Rudolf Steiner, der spätere Begründer der Anthroposophie und Waldorfbewegung. Steiner besuchte den kranken Nietzsche und besorgte die erste Bibliographie sowie eine Aufstellung der Bücher in Nietzsches Bibliothek. Bald verfasste der Schnell- und Vielschreiber eine der ersten Monographien über Leben und Werk unter dem Titel Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen die Zeit (1894). Eine weitere Zusammenarbeit mit Elisabeth erwies sich jedoch aufgrund ihrer editorischen Vorstellungen und ihrer Intrigen im Archiv als unmöglich. Auch philosophisch war sie wohl wenig belehrbar. 1900 kam es zum endgültigen Bruch. Dennoch sollte Steiner sich im Laufe seines Lebens immer wieder – ob warnend oder erhellend – auf Nietzsche beziehen. Noch näher an Nietzsche heran kommt jedoch in dieser Zeit das Buch, das Nietzsches einstige große Liebe, Lou Andreas-Salomé, über ihn schrieb: Friedrich Nietzsche in seinen Werken (1894). Es ist erfüllt von sehr persönlichen Erinnerungen, analysiert aber zugleich Nietzsches religiöse Denkstrukturen, seinen Stil, seine Wandlungen und sein »System«. Parallel dazu kann man ihren Roman Im Kampfum Gott (1885) ebenfalls als Auseinandersetzung mit Nietzsche und dem Tod Gottes lesen.
Einen großen Resonanzboden fand Nietzsche bei den Lebensreformern, die um die Jahrhundertwende aus dem bürgerlichen, materialistisch orientierten Leben ausscheren wollten. Sie gründeten Wohn- und Künstlerkommunen von Worpswede bis zum Lago Maggiore, von der Ostsee bis nach Schwabing. Hier wie sonst nirgends war Nietzsche das Gesprächsthema: Umwertung aller moralischen Werte, Züchtung eines Neuen Menschen, Ästhetisierung des Daseins. Letztlich geht es um die Schaffung des Übermenschen, der als Lichtmensch bei Karl May und Sascha Schneider aufflammt oder als Überfrau feministische Visionen beflügelt. In einer frühen Studie von Leo Berg (1889) heißt es hellsichtig: »Nachdem Nietzsche aber sein Zauberwort ausgesprochen hatte, war in Deutschland plötzlich alles Übermensch … Man machte Schulden, verführte Mädchen und besoff sich, alles zum Ruhme Zarathustras.« (Zit. nach: Hillebrand 2000, 58) Erste Romane erschienen, in denen Nietzsche und seine Ideen eher schlagwortartig verarbeitet und popularisiert, bald auch parodiert wurden (etwa: Michael Georg Conrad: In purpurner Finsterniß, 1895; Adolf Wilbrandt: Die Osterinsel, 1895; Paul Heyse: Über allen Gipfeln, 1895; Arno Holz: Sozialaristokraten, 1896; Hermann Conradi: Phrasen, 1887). Höheres Menschentum, Ästhetik jenseits von Gut und Böse, kunstfreudiges Heidentum waren einige der Schlagworte, in denen man Balsam fand für die von Verstädterung und Industrialisierung aufgeriebenen Seelen. Bei Frank Wedekind, Georg Heym, Richard Dehmel oder Christian Morgenstern geben sich die Übermenschen mal pathetisch, mal ironisch die Klinke in die Hand.
Es gibt aber auch ablehnende Stimmen. Eine frühe ist die von Gottfried Keller, nachdem Nietzsche ihn besucht hatte. Gerhart Hauptmann lässt in seinen Memoiren von 1937 vernehmen: »Friedrich Nietzsche war nicht unser Mann.« Er war ihm zu subtil, während der völkische Julius Hart in Nietzsche einen Betrüger von »minderwertiger Rasse« sah. Auch von links kam Kritik, etwa von Franz Mehring, der glaubte, Nietzsche mit Marx und Lassalle aushebeln zu können. Jedoch finden sich auch in der Arbeiterklasse viele Nietzsche-Verehrer, was aus den Ausleihkarten der Bibliotheken ersichtlich ist. 1914 erschienen in A. Levensteins Friedrich Nietzsche im Urteil der Arbeiterklasse Stellungnahmen von Vertretern verschiedener Berufe: In einem Großbetrieb fand der Herausgeber 37 Metallarbeiter, 16 Textilarbeiter und 56 weitere, die sich mit dem Zarathustra beschäftigt hatten. Der Band verzeichnet teils sehr subtile und bildreiche Aussagen zu Nietzsche, ob von Schlossern, Webern, Druckern, Bäckern, Anstreichern oder Tagelöhnern. Pathos, Kritik und Erkundung von Lebenszielen geben einen ungewöhnlichen Spiegel ab für den aristokratischen Denker.
Dieser ersten Welle der Nietzsche-Verehrung, die großenteils mit dem Symbolismus und Expressionismus einherging, sollte eine zweite folgen: Thomas Mann, Gottfried Benn, Hermann Hesse und viele andere stehen dafür. Schon in den 1890ern prägte der Soziologe Ferdinand Tönnies den Ausdruck »Nietzsche-Kultus«. Tönnies hatte sich als Student für Nietzsche begeistert, wurde aber zunehmend kritisch. Der Zarathustra erschien ihm als »Feuerwasser«. Tönnies war mit Lou Andreas-Salomé und Paul Rée befreundet (und Lou hielt ihn nach Nietzsche für den klügsten Mann, der ihr je begegnet war). In seiner Schrift Der Nietzsche-Kultus (1897) betrachtet er differenziert Nietzsches Gesamtwerk. Vor allem dessen herrenmenschliche und aristokratische Allüren erscheinen dem Demokraten fremd und abstoßend. Ähnlich gelagert sind die Schriften von Franz Mehring und Kurt Eisner, die allesamt einmal eine Nietzsche-Phase durchliefen, um den Meister dann jedoch mit kritischen Augen zu betrachten. Auffällig ist, dass Nietzsche immer wieder Geister aller Couleur anzieht, die sich, mindestens eine Zeitlang, von ihm einfärben lassen: der jüdische Anarchist und Mystiker Gustav Landauer (der schon 1893 den Roman Der Todesprediger über Nietzsche verfasste), ebenso wie der spätromantische Aussteiger Hermann Hesse, in dessen Demian (1919) sich viele Spuren wiederfinden, oder der scharfsinnige Robert Musil, der an Nietzsche den Perspektivismus und das experimentelle Denken schätzte. Kafka soll mit 17, also im Jahr 1900, einem geliebten Mädchen abends bei Kerzenschein auf einer Bank regelmäßig Nietzsche vorgelesen haben.
In der Münchner Bohème spielte Nietzsche eine große Rolle und hier fand er auch einen seiner größten, wenn auch später kritischen Verehrer: Thomas Mann. Wohl keine andere Beziehung zu Nietzsche spiegelt den Weg deutscher Politik und Kultur so getreu wider wie diese. In Manns Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) steht Nietzsche noch für den deutschen Sonderweg zwischen West und Ost ein, für deutsche ›Kultur‹ gegen welsche ›Zivilisation‹. In der Weimarer Zeit beginnt er, den psychologisch-analytischen Nietzsche in den Blick zu nehmen, und nennt ihn geradewegs einen Vorläufer von Sigmund Freud. Während des Krieges und im Exil reflektiert er weiter über die Verbindung des Philosophen mit der deutschen Kultur und mit seinem eigenen Denken. Freud, übrigens, hat 1908 gestanden, dass er Nietzsche nie recht zu studieren vermochte, und zwar wegen der Ähnlichkeit zu eigenen Gedanken und wegen des »inhaltlichen Reichtums seiner Schriften«. Sein einstiger Freund Carl Gustav Jung dagegen setzte sich gründlich mit Nietzsche auseinander, wobei er sich selbst vor dem Wahnsinn fürchtete, wie sein Rotes Buch (entst. 1914–30) nahelegt. In Zürich sollte Jung 1934–39 Seminare über den Zarathustra abhalten, in denen es auch um das kollektive Unterbewusste der Deutschen ging: Nietzsche sei ein recht genauer Ausdruck dieses Seelenzustandes, der im Prozess der Individuation an seinen eigenen instinkthaften Ausbrüchen scheitere. Nietzsche hatte immer ebenso viele Kritiker wie Anhänger. Auf der kritischen Seite findet man in dieser Zeit nicht nur Sozialisten und Politiker wie die bereits genannten Kurt Eisner oder Franz Mehring; auch die Kirchen standen gegen Nietzsche auf; Pfarrer schrieben Traktate gegen den Antichristen. Die Kritik wurde munitioniert durch Krankheitsberichte wie den von Paul Möbius Über das Pathologische bei Nietzsche (1902) oder Max Nordaus vernichtendes Buch Entartung (1892/93), das Nietzsche neben Ibsen, Strindberg, Zola oder Wilde zu den Dekadenten und Perversen rechnet und europaweit eine große Ausstrahlung hatte. Hier beginnen die Kulturkonflikte, die Nietzsche immer wieder auslösen sollte und bei denen sich oft Konservative und Fortschrittliche die Hand gaben (vgl. Aschheim 2000, 17–50).
Auffällig ist, dass sich Feministinnen dem oft frauenfeindlichen Nietzsche nicht unbedingt antagonistisch entgegenstellen. Das fing schon zu Lebzeiten an, als er ausgerechnet mit feministisch orientierten Frauen auf Augenhöhe sprechen konnte, so mit Lou von Salomé, Malwida von Meysenbug, Reta Schirnhofer oder Meta von Salis. Bei aller Misogynie in seinen Schriften fanden sie (Lou von Salomé war die Erste) in ihm einen feinfühligen Gesprächspartner, dem es als Außenseiter genauso um Selbstermächtigung ging wie den von Konventionen eingezwängten Frauen seiner Zeit. Die Umwertung aller Werte konnte auch als Umwertung aller patriarchalischen Werte gedeutet werden. Meta von Salis schrieb in ihrem Buch über Nietzsche als Edelmensch und Philosoph (1897), dass sie schlicht über Nietsches Dummheiten habe hinwegsehen können, da diese seiner nicht würdig waren. Die Autorin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm betitelte 1894 ihr Manifest in Anspielung auf Nietzsche: Wie Frauen werden – Werde, die du bist! Auch die Sozialistin Lily Braun fand in Nietzsches Gedanken das sozial befreiende Element, während die prominenteste Frauenrechtlerin der damaligen Zeit, Helene Stöcker, nach 1900 eine neue Sexualmoral im Gefolge Nietzsches einforderte (sie hatte im Übrigen mit dem Nietzscheaner und Übersetzer Alexander Tille eine Affäre; beide hingen zudem der Eugenik an).
In der Lyrik um 1900 lebte sich eher Nietzsches pathetische Seite aus, verbunden mit Mystizismus und der Pose des Dichters als Prophet. Eine große Zuneigung zu Nietzsche empfand Christian Morgenstern, der später ein Anhänger Rudolf Steiners wurde und dem es neben gefühlvollen Texten auch möglich war, Nietzsches Ideen in seinen Galgenliedern und Palmström/Korf-Gedichten zu parodieren. Eher undefinierbar, aber doch prägend ist die Präsenz Nietzsches in den Frühwerken von Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal. Bei Rilke, der ja später mit Lou von Salomé zusammen war, kann man vor allem die Auseinandersetzung mit Gott als einen Kommentar auf Nietzsches Gott ist tot ansehen. Anders Stefan George, der sich gern das goldene Gewand des Sehers anzog, ja, den seine Jünger als die Vollendung Nietzsches ansahen (»Nietzsche«, 1900). In seinem Gedicht »Nietzsche« (1907) heißt es: »sie [die Stimme Nietzsches] hätte singen/Nicht reden sollen diese neue seele!« Und genau dies, das Singen der neuen Seele, übernahm der Dichter-Sänger George, dessen Kreis aus vielen Nietzscheanern bestand, die dann später – wie Ernst Bertram (1929) – Studien zu dem Philosophen vorlegen sollten. Er entsprach ihrem elitären Gestus und ihrem aristokratischen Kulturstandpunkt.
Es gab wohl in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kaum Autoren, Künstler, Schriftstellerinnen, die nicht in irgendeiner Weise von Nietzsche beeinflusst worden wären oder mit seinen Ideen gestritten hätten. Als weiteres Beispiel sei Gottfried Benn erwähnt: Nach Goethe ist Nietzsche der am häufigsten zitierte Autor in seinem Gesamtwerk. Viele seiner Aussprüche und Sentenzen sind kaum von Nietzsches eigenen zu unterscheiden. Die Welt ist beiden einzig als aesthetisches Phänomen gerechtfertigt, das Dionysische, der Rausch ist es, der beide verbindet, und Benn sieht wie Nietzsche den Letzten Menschen als Hülle, die ein Nichts enthält. Nicht nur Gott ist tot, sondern, Foucault vorwegnehmend, mit ihm der Mensch, es gibt nur »noch seine Symptome«. Benn ist ohne Nietzsche kaum zu denken, in seiner Zerebralität, in seinem kalten biologisch-anthropologischen Blick, in seiner desillusionierten Vision des Homo sapiens. Drei Gedichte widmet Benn zwischen 1933 und 1946 dem Denker. 1950 blickt er in einem Rundfunkvortrag auf »Nietzsche – nach fünfzig Jahren« zurück und stellt fest: »[F]ür meine Generation war er das Erdbeben der Epoche und seit Luther das größte deutsche Sprachgenie.« Nietzsche, der so adlerhaft aufstieg, sei am Ende zum Objekt einer »Vorführung für Jenaer Studenten als Fall von Paralyse eines abwegigen Dozenten« und um 1900 »schon mausoleumsreif« geworden. Sicherlich nicht für Benn selbst, der zeitlebens das Erdbeben namens Nietzsche in seiner Lyrik hör- und fühlbar machte.
Hörbar wurde Nietzsche auch in der Musik, zu der er ja ein besonders enges Verhältnis hatte. Seine musikalische Prosa im Zarathustra führte zu Richard Strauss’ sinfonischer Dichtung Also sprach Zarathustra (1896) mit ihrem berühmten Trompetendreiklang als Auftakt. Gustav Mahlers 3. Sinfonie mit ihrem 4. Satz, in dem das »Nachtwandlerlied« aus dem Zarathustra gesungen wird, bezeugt eine tiefe Verbundenheit des Komponisten mit Nietzsche. Der Arbeitstitel der Sinfonie war im Übrigen »Meine fröhliche Wissenschaft« gewesen.
Auch für die Kunst wurde Nietzsche zu einem der größten Anreger, wobei er selbst sich doch eher als Ohren- denn als Augenmensch sah. Was zog also die Künstler an? Es war erneut vor allem der Zarathustra mit seiner bild- und farbenreichen Sprache, mit seinen Tieren, Wüsten und Gebirgen, seinen Visionen vom Übermenschen. Das fügte sich in eine Zeit, die dem Heldenkult huldigte. So finden sich Bilder strahlender Helden, die es zum Licht zieht, nackter Edelmenschen und anderer Geflügelter, wie sie Sascha Schneiders Umschlagbilder von 1904 für Karl Mays Winnetou oder Durch die Wüste zeigen, oder Fidus’ Lichtmenschen und Lichtgebete.
Ein zweiter, wohl noch wichtigerer Grund für die Beschäftigung von Künstlern mit Nietzsche ist dessen tragisches, an Hölderlin erinnerndes Lebensende im Wahn und Geistesverlust, wie um die These von einer Verwandtschaft zwischen Genie und Wahnsinn zu bestätigen. 1920 erklärte Richard Huelsenbeck, das Lachen Dadas habe seinen Ursprung im Lachen Nietzsches, der sich ja selbst als einen der »Hanswürste Gottes« bezeichnet habe. Der Surrealist Max Ernst las Nietzsche mit 18 (1909) und sagte später über Die fröhliche Wissenschaft: »Wenn überhaupt ein Buch in die Zukunft weist, so ist es dieses. Der ganze Surrealismus steckt darin, wenn man es zu lesen versteht.« Die Geburt der Komödie (1947) ist eine deutliche Anspielung auf Nietzsche, wird hier doch eine hohle Maske des Dionysos dargestellt. Otto Dix wird gemeinhin wenig mit Nietzsche assoziiert, doch sind auch in seinem Werk Bezüge zu erkennen. Dix, der vom Dadaismus bis zur Neuen Sachlichkeit und den Alten Meistern alle Richtungen beherrschte, machte sich in der Weimarer Zeit zum scharfen Kritiker einer zerstörten und moralisch korrupten Welt. Er selbst sollte mit Nietzsches (bzw. Elisabeth Förster-Nietzsches) Der Wille zur Macht in den Ersten Weltkrieg ziehen und wollte wie Nietzsche mit einem scharfen Blick die Moderne erfassen. Seine Nietzsche-Büste von 1912 zeigt einen ähnlich kompromisslosen Blick wie seine Selbstporträts von 1913. Otto Dix, schreibt Wieland Schmied, habe die Menschen nach der Natur gemalt, mit all ihrer Gier und ihren dunklen Trieben. Als Motto könnte ein Zitat aus dem Willen zur Macht dienen: »Die Wahrheit ist hässlich. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehen.«
Sascha Schneider: Umschlagbilder für Karl Mays Winnetou und Durch die Wüste (1904)
Mit Nietzsche tief vertraut war Max Klinger. Er war es, der nach der Erstabnahme von Nietzsches Totenmaske diese in mehreren Formen bearbeitete und auch verkäuflich machte: Es ist ein düsterer und heroischer Nietzsche, der in den Abgrund geschaut hat. Alfred Kubin, Edvard Munch, Erich Heckel bemühten sich allesamt um Porträts des kranken oder prophetisch blickenden Philosophen. Arnulf Rainer übermalte 1978 schließlich ein Foto der ursprünglichen Totenmaske. Klingers langjährige Geliebte, die österreichische Schriftstellerin Elsa Asenijeff, war u.a. wegen Nietzsche nach Leipzig gekommen. Ihn noch lebend zu sehen, gelang ihr nicht, aber sie gehörte zu den vielen Feministinnen, die sich schon zu Nietzsches Lebenszeit für den »Weiberfeind« interessierten.
Die Kunstbewegungen Blauer Reiter und Die Brücke sind in ihren Diskussionen über den Sinn von Kunst und des Lebens ohne Nietzsche kaum zu denken: Ob Marc und Kandinsky, Beckmann oder Klee, alle nahmen immer wieder Bezug auf Nietzsche, der sie vor allem in ihrer ästhetischen Freiheit beflügelte. Karl Schmidt-Rottluff schlug den Namen ›Die Brücke‹ vor, weil nach Zarathustra der Mensch »eine Brücke und kein Zweck« sei.
Im Ersten Weltkrieg wurde Nietzsche als Kriegstreiber gesehen, und zwar zu beiden Seiten der Front. Elisabeth schrieb zahlreiche Artikel, die Nietzsches Kriegsbegeisterung unterstreichen sollten, und brachte eine Feldpostausgabe des Zarathustra in einer Auflagenhöhe von 54.000 für Soldaten heraus, um sie mit den berauschenden Sprüchen dieser neuen Bibel ins Artilleriefeuer zu jagen. Derweil war sich die angloamerikanische und französische Presse einig, dass Nietzsche schuld sei an dieser Schlachterei, da er die blonde Bestie auf die Kultur losgelassen habe. Thomas Mann schreibt in seiner vielgelesenen umfangreichen Streitschrift Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) noch über Nietzsche: »Die ungeheure Männlichkeit seiner Seele, sein Antifeminismus, Antidemokratismus, – was wäre deutscher?«
1918 – 1945
Derselbe Thomas Mann wirft in der Weimarer Zeit seine konservativ-nationale Weltanschauung ab und entwickelt sich zu einem Verteidiger der Demokratie. Ein solcher Weg verändert sein Nietzsche-Bild, wie vor allem nach dem Krieg, den er im amerikanischen Exil verbringt, zu erfahren ist. Es ist kritischer, selbstkritischer, aber hebt doch Nietzsches Bedeutung hervor. Anders Gottfried Benn, für den Nietzsche, wie er in seiner Rede zum 50. Todestag sagt, alles ausgesprochen hat, was Benns eigene Generation diskutiert habe: seine »blitzende Art, seine ruhelose Diktion […], die ganze Psychoanalyse, der ganze Existenzialismus, alles dies ist seine Tat.«
Die Weimarer Zeit war insgesamt ein fruchtbarer Boden für eine breite Beschäftigung mit Nietzsche, nachdem er den Ruch des Weltkriegsphilosophen wieder abgelegt hatte. Ernst Bloch etwa versuchte immer wieder, seine sozialistische Denkrichtung mit dem »Wärmestrom« anderer Denker zu verbinden, und zu ihnen gehörte auch Nietzsche, der ihm als Dichterphilosoph, als einer, der poetische Sprache und Intelligenz verband, verwandt war, auch wenn Bloch dies von dessen menschenfeindlichen Gedanken trennen musste. Noch bis in die Zeit seiner Tätigkeit als Professor in der DDR sollte ihn diese Nähe zu Nietzsche bei den orthodoxen Marxisten verdächtig machen.
Das Ende der Weimarer Zeit lässt schließlich eine stärkere Aneignung Nietzsches durch die Rechte erkennen, die ihn ab 1933 zu ihrem Hausphilosophen machte. Elisabeth, immer schon national-konservativ, hatte sich in den 1920ern zunehmend der faschistischen Rechten, also Mussolini und Hitler angedient. 1933 ließ sie Mussolini in einem Telegramm wissen, er sei der »herrlichste Jünger Zarathustras, den sich Nietzsche träumte«, auch wenn dieser faschistische Jünger nie nach Weimar pilgerte. Dafür spendete er und sandte im Krieg noch eine Dionysos-Statue für ein geplantes Denkmal. Harry Graf Kessler war von dieser Anbiederung an die Rechte angewidert und entfernte sich aus dem Dunstkreis des Archivs, zumal mit Elisabeths Cousin Max Oehler ein Nazi reinsten Wassers Vorstandsmitglied geworden war. 1932 notierte Kessler in seinem Tagebuch: »Im Archiv ist alles vom Diener bis zum Major hinauf Nazi […] Man möchte weinen, wohin Nietzsche und das Nietzsche-Archiv gekommen sind.« Am 14. Juni 1934 schrieb Elisabeth begeistert an Mussolini, nachdem dieser sich mit Hitler getroffen hatte: »Die Manen Friedrich Nietzsches umschweben das Zwiegespräch der beiden größten Staatsmänner Europas.« Traurig-peinlicher Höhepunkt ihrer Anbiederung an den Nationalsozialismus waren mehrere Besuche Hitlers im Archiv, wobei er sich einmal vor der nur halb sichtbaren Büste Nietzsches fotografieren ließ, mit starrem Blick, als ginge es um eine Energieübertragung. Bei dieser Gelegenheit schenkte Elisabeth ihm eine Reliquie ihres Bruders, seinen Spazierstock.
Adolf Hitler im Nietzsche-Archiv, ca. 1932
1934 besuchte Hitler das Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen, ein Symbol für Hindenburgs Sieg über die Russen zwanzig Jahre zuvor und unter dem Nationalsozialismus umgestaltet zum »Reichsehrenmal«, das sich dem Totenkult widmete. Hitler ließ dort drei Bücher im Grabgewölbe deponieren: Mein Kampf, natürlich, Alfred Rosenbergs Der Mythus des 20. Jahrhunderts und Nietzsches Zarathustra. Damit schien Nietzsche für die Nationalsozialisten endlich ganz einer der ihren geworden zu sein. An den Hochschulen bemühten sich Philosophen, dies akademisch zu besiegeln. Insbesondere ist hier Alfred Bäumler zu nennen, der den Rassismus in der Erziehungswissenschaft und Lehrerbildung verankerte und den Soldaten als Idealtypus des deutschen Menschen verherrlichte. Bäumler machte Nietzsches Werke ab 1931 populär durch eine Monographie, die Nietzsche in die zeitgenössische Politik projizierte: Nietzsche, der Philosoph und Politiker. Vor allem aber war er der Herausgeber der zwölfbändigen Nietzsche-Ausgabe im Kröner Verlag, die sukkessive durch die von Walter Gebhard herausgegebenen Bände ersetzt wurde. Eine aktuelle Ausgabe erscheint seit 2014.
Vor ihrem Tod im Jahre 1935 wurde Elisabeth Förster-Nietzsche von den eigenen Mitarbeitern Karl Schlechta und Hans-Joachim Mette mit ihren Fälschungen in Nietzsches Briefen konfrontiert, eine Diskussion, die sich in der Nachkriegszeit fortsetzte. Ebenso wurde Elisabeths Zusammenstellung der Texte aus Nietzsches Nachlass unter dem Titel Der Wille zur Macht (1901, 1906) gebrandmarkt als Konstruktion eines Nietzsche-Werkes, das es so nicht gegeben habe. Dennoch beziehen sich bis heute viele Autoren auf eben dieses Werk, nicht zuletzt wegen seines schlagkräftigen Titels. Leni Riefenstahls Propagandafilm Triumph des Willens über den Nürnberger Parteitag der NSDAP 1934 nutzt das Nietzsche-Wort auf seine Weise, nämlich mit blonden und muskulösen Übermenschen. Hitler selbst soll allerdings einmal zu Riefenstahl gesagt haben: »Mit Nietzsche kann ich nicht wirklich viel anfangen […] er ist nicht mein Führer.«
Auch Martin Heidegger gehörte zum Freundeskreis und wissenschaftlichen Komitee des Nietzsche-Archivs, entfernte sich nach Zwistigkeiten aber 1942 von dem Kreis, in dem nun nationalsozialistisches Mittelmaß herrschte. Der Freiburger Philosoph widmete sich fortan nur den Werken Nietzsches. Er hatte Nietzsche schon im Ersten Weltkrieg gelesen; am Ende der Weimarer Zeit wurde er für ihn zum Ausdruck seiner Kritik an der Rationalität, die den Westen so lange geprägt hatte. Der Nihilismus sollte durch eine Entschlussfähigkeit überwunden werden, die Heidegger selbst bald im Nationalsozialismus wiederfand. Auch wenn er später vorgab, sich abzukehren, blieb seine Sprache doch mehrdeutig. In seinem Brief an das Rektorat der Universität Freiburg 1945 stellte er seine Vorlesungen über Nietzsche als subversiven Akt gegen das Regime dar. Seine Ausführungen zu Nietzsche füllen heute fünf Bände der Gesamtausgabe. Zentral sind Nietzsche I und II (1961), in denen er Nietzsches Stellung am Ende der Metaphysik analysiert, in der der Wille zur Macht und der Übermensch in Erscheinung träten und der Seinsvergessenheit des Nihilismus ein Ende machten. Heideggers Philosophie ist komplex und schwer verständlich, seine Sprache ist der von Nietzsche in keiner Weise verwandt, auch wenn beide poetisch denkende Philosophen sind. Der Nationalsozialist Heidegger musste sich gegen die Vulgarisierung Nietzsches durch andere nationalsozialistische Philosophen zur Wehr setzen, etwa Alfred Bäumler, der den Willen zur Macht politisch umdeutete.
Links stehende Bewunderer Nietzsches, wie Ludwig Marcuse oder Walter Benjamin, erkannten die feindliche Übernahme bald und gaben unter anderem dem Archiv und anderen Verfälschern die Schuld. Kurt Tucholsky sprach von den »Analphabeten der Nazis, die wohl deshalb unter die hitlerischen Schriftgelehrten aufgenommen worden sind, weil sie einmal einem politischen Gegner mit dem Telefonbuch auf den Kopf gehauen haben […], und nun Nietzsche beanspruchen.« Es folgt das häufig zitierte »Sage mir, was du brauchst, und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen.« (»Fräulein Nietzsche«, 1932). Der Geistesheroe selbst erschien Tucholsky als »geheimer Schwächling«. Die Emigranten versuchten indes, im Exil ›ihren‹ Nietzsche zu retten, so Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno oder Karl Löwith. Adornos und Horkheimers Hauptwerk Die Dialektik der Aufklärung (1944) verlöre ohne Nietzsches Kritik an der instrumentellen Vernunft eine wichtige Dimension. In Dosio Kofflers Szenenspiel Die deutsche Walpurgisnacht (1941) besucht Nietzsche zusammen mit Goethe und Schiller NS-Deutschland und wendet sich voller Abscheu ab von dem Reich, das sein Erbe zu sein vorgibt. Der Emigrant und Herausgeber der englischen Nietzsche-Ausgabe, Oscar Levy, war sich sicher, dass Nietzsche mit seinen Ansichten im Nationalsozialismus im Konzentrationslager geendet wäre – und, so muss man hinzufügen, als Geisteskranker der Euthanasie anheimgefallen wäre. Dabei war die Beförderung Nietzsches zum nationalsozialistischen Fahnenträger selbst manchen Nazis nicht ganz geheuer. Curt von Westerhagen, Ernst Krieck und manche andere sahen in ihm gar einen Feind. So zitierte etwa Krieck zustimmend einen Artikel aus Le Temps: »Alles in allem: Nietzsche war Gegner des Sozialismus, Gegner des Nationalismus und Gegner des Rassegedankens. Wenn man von diesen drei Geistesrichtungen absieht, hätte er vielleicht einen hervorragenden Nazi abgegeben.«
Ganz anders Georg Lukács, der als Kommunist 1933 in die UdSSR emigrierte. Der in seiner Jugend von Nietzsche beeindruckte Lukács greift nun Nietzsche als frühen Faschisten und Vater des Nationalsozialismus an. Er fügt die Attacke ein in eine Abrechnung mit der deutschen Tradition des Irrationalismus, die er in Die Zerstörung der Vernunft (1954) analysiert: als eine bürgerliche, fortschrittsfeindliche Fahrt in den Abgrund – von Schelling über Nietzsche bis hin zu Hitler. In der DDR, in der Lukács später selbst verfemt war, avancierte Die Zerstörung der Vernunft zum Handbuch für den Umgang mit bürgerlicher Philosophie, während es im Westen etwa von Adorno wegen seiner Spießbürgerlichkeit kritisiert wurde. Mit Lukács’ Werk beginnt jedoch eine Weggabelung, die auch ein politisches Janusgesicht zeigt: Bundesrepublik versus DDR. Wie überlebte also Nietzsche die deutsche Teilung nach 1945?
Nach 1945: der Westen
Thomas Mann arbeitete nach dem Krieg weiter an seiner früheren Faszination namens Nietzsche. 1947 trat er mit zwei wichtigen Texten in Erscheinung, die die Position des Nobelpreisträgers genauer skizzieren: zum einen dem Roman Doktor Faustus, in dem Mann die Legende vom durch das Böse verführten Magister auf einen Komponisten der ersten Jahrhunderthälfte und das ›Dritte Reich‹ bezieht. Dieser Komponist verkörpert, teilweise eins zu eins, Nietzsche, der damit gleichzeitig eine Antwort bietet auf die Frage: Wie hätte sich Nietzsche eigentlich im Nationalsozialismus verhalten? Zum anderen hielt Mann einen wegweisenden Vortrag zu Nietzsche, in dem er sich eingehend mit dem problematischen Anteil von Nietzsches Denken beschäftigte und ihm Kriegsverherrlichung und psychische Defizite vorwarf, die ihn nicht mehr als unschuldig erscheinen lassen. In »Nietzsche’s Philosophie im Lichte unserer Erfahrung« erkennt Mann in seinem früheren Helden nicht mehr den Propheten und Künder eines neuen Testaments, sondern den Ästheten. Nur so ließe sich seine Faszination durch das Böse erklären, das auch die Maske des Schönen tragen kann, aber »wir haben es [das Böse] in seiner ganzen Miserabilität kennengelernt.« Jetzt komme es wieder auf die Herrschaft des Geistes über die (barbarischen) Instinkte an. Gleichzeitig bleibt ihm Nietzsche jedoch als Seismograph und Psychologe unverzichtbar, und hierin trifft sich Thomas Mann mit Theodor W. Adorno, der ja einigen Anteil an der Entstehung des Doktor Faustus hatte.
Im Westen beriefen sich nach dem Krieg Linke ebenso auf Lukács, wie es die offizielle Philosophie in der DDR tat. Doch gab es in der frühen Bundesrepublik auch verschiedene Stimmen, die Nietzsche zu rehabilitieren suchten. Sie fußten teilweise auf den großen Studien von Karl Jaspers oder Karl Löwith aus den 1930ern, in denen ein Nietzsche-Bild umrissen wurde, das sich nicht auf den Faschismus reduzieren ließ. Jaspers’ Monographie von 1936 suchte Nietzsche vor der rechten Ideologie in Schutz zu nehmen. Löwith schrieb aus dem Exil weiter über Nietzsche, nachdem er 1935 eine gewichtige Studie zur Ewigen Wiederkunft veröffentlicht hatte. 1941 erschien sein Hegel und Nietzsche, eine kritische Reflexion über den Weg vom Humanismus in den Nihilismus. Damit wurden Ausgangspunkte für philosophische Diskussionen jenseits ideologischer Zuordnungen bezeichnet. Im Rückblick musste sich Löwith 1961 jedoch eingestehen: »Nietzsche ist und bleibt ein Kompendium der deutschen Widervernunft oder des deutschen Geistes. Ein Abgrund trennt ihn von seinen gewissenlosen Verkündern, und doch hat er ihnen den Weg bereitet, den er selber nicht ging.« So blieb auch der Vorwurf des protofaschistischen Denkens bestehen, nicht nur bei Georg Lukács, Domenico Losurdo, Bernhard H.F. Taureck oder in den Publikationen des Ostblocks. Arno Schmidt brachte diese Einschätzung in seiner Erzählung Leviathan, 1946 entstanden, auf den Punkt: »Sehr schuldig war auch Nietzsche, der Machtverhimmler; er hat eigentlich alle Nazi-Tricks gelehrt (›Du sollst den Krieg mehr lieben als den Frieden …‹), der maulfertige Schuft.«
Karl Schlechta, der die Fälschungen von Elisabeth Förster-Nietzsche aufgedeckt hatte, brachte 1959 eine dreibändige Ausgabe heraus, die bis zum Erscheinen der von Giorgio Colli und Mazzino Montinari herausgegebenen kritischen Gesamtausgabe (ab 1967, Kritische Studienausgabe ab 1980) tonangebend war. In den 1960ern fing die Nietzsche-Forschung jedoch an sich zu bewegen. Das lag vor allem an dem Interesse, das die Existenzialisten in Frankreich, insbesondere Albert Camus, ihm entgegengebracht hatten. Durch Georges Bataille war während des Krieges zudem eine Schneise geschlagen worden, die Nietzsche vom Faschismus wegzuführen versprach. So blieb Nietzsche präsent und man konnte intellektuell an ihn anknüpfen. Das geschah mit der Ankunft der Poststrukturalisten wie Michel Foucault, Jean-François Lyotard oder Gilles Deleuze, die in Nietzsche ungeahnte Denkpotenziale vorfanden, aus denen sie für ihre eigenen Theorien schöpfen oder die sie mit und gegen Nietzsche weiterspinnen konnten, wie etwa Jacques Derrida. Nietzsche wurde in Frankreich, neben Marx und Freud, zur dritten Säule einer modernen Geistesarchitektur, und so hat auch er einen gewissen Anteil an der Studentenbewegung von 1968, allerdings wohl kaum in Deutschland, ob West oder Ost. Viele Intellektuelle, auch außerhalb dieser Bewegungen, arbeiteten an einem französischen Nietzsche, wobei auch dessen eigene Frankophilie eine Rolle spielte: Pierre Klossowski, Sarah Kofman, Philippe Sollers oder Michel Onfray. Die französische Philosophie dieser Jahrzehnte löste in den USA, Italien und weltweit eine Nietzsche-Welle aus, die schließlich auch in den deutschen Sprachraum hineinwirkte: Es wurde in Deutschland wieder möglich, unbefangener von Nietzsche zu sprechen.
Spiegel-Cover vom 8. Juni 1981
In den 1980ern fand im deutschsprachigen Gebiet mit zwei großen Biographien, Opern und Theaterstücken schließlich eine Art Nietzsche-Renaissance statt, wie Rudolf Augstein in einer spektakulären Ausgabe des Spiegel feststellte. Das Cover des Magazins vom 8. Juni 1981 zeigt den Denker Nietzsche und den Täter Hitler wie siamesische Zwillinge – der eine mit wahnhaftem Blick in den Abgrund schauend, der andere mit einer Pistole nach oben zielend. Was noch 1968 Jürgen Habermas, ein Kritiker der Postmoderne, behauptet hatte: Nietzsche sei einmal wichtig und prägend gewesen, habe aber »nichts Ansteckendes mehr«, erwies sich als falsche Prophezeiung. Solche Rede konnte schon mit Blick auf Die Dialektik der Aufklärung (1944) von Adorno/Horkheimer, die zum Theoriegepäck der 1968er Studentenbewegung (Felsch 2022) gehörte, nicht gelten. Verlage wie Merve oder Matthes & Seitz fütterten das neu erwachte Interesse an Nietzsche mit Übersetzungen von französischen Nietzscheanern wie Georges Bataille, Jean-François Lyotard oder Pierre Klossowski; Friedrich Kittler oder Elisabeth Lenk fungierten als wichtige Mittler zwischen französischer und deutschsprachiger Intelligenzija. Spätestens mit Rüdiger Safranskis Nietzsche-Biographie (2000) und dem Streit um Peter Sloterdijks Thesen über Züchtung und Genetik (Regeln für den Menschenpark, 1999) erreichte Nietzsche wieder das bürgerliche Publikum. Nietzsches 150. Geburtstag 1994 sowie der 100. Todestag, der mit der Jahrtausendwende zusammenfiel und den die Post mit einer Briefmarke flankierte, brachten eine Reihe von Literarisierungen hervor: Volker Ebersbachs Nietzsche in Turin (1994), Otto A. Böhmers Der Hammer des Herrn (1994), Jens-Fietje Dwars’ Zarathustras letzte Wiederkehr (2000), Jens Sparschuhs Das Lamadrama (2000) oder Einar Schleefs Nietzsche-Trilogie (2003). Der Spiegel war 1999 mit einer weiteren Schwerpunktnummer zur Stelle.
Der Berg der Nietzsche-Fiktionen wächst unaufhörlich, zumal in Frankreich und den USA, wohl auch deshalb, weil Nietzsches Leben viele dramatisch-psychopathologische Ansatzpunkte bietet. Auch wenn Nietzsche einerseits an den Universitäten im deutschen Sprachraum wenig gelehrt wird – im Vergleich zu Frankreich, Italien, Brasilien oder China etwa –, lebt er weiterhin fort in der Sub- und Populärkultur und erfreut sich auch gewichtiger akademischer Studien. Auf der anderen Seite finden jedoch häufig Konferenzen und Vortragsreihen, so im Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg, in Weimar oder an anderen Nietzsche-Forschungsorten statt, oft mit einer Tendenz zur Interdisziplinarität und zu interkulturellen Fragestellungen, so dass die Künste, die Musik- und Literaturwissenschaft, Philologie, Soziologie oder Theologie mit der Philosophie ins Gespräch treten. Es gibt und gab nie den einen Nietzsche.
Joseph Beuys: Sonnenfinsternis und Corona (1978)
Das wussten die Künstler schon länger und ließen sich daher durch akademische Debatten kaum abhalten. Für sie – von Max Klinger bis Joseph Beuys und Horst Janssen – war und bleibt Nietzsche ein tragischer Vorläufer, Mitdenker, Mitkünstler. Joseph Beuys besuchte als 21jähriger Soldat das Nietzsche-Archiv in Weimar. Wille und Genie zogen ihn, ja spornten ihn an. 1978 fertigte er die Collage Sonnenfinsternis und Corona an: Unter Hans Oldes Radierung von Nietzsche, die 1899 entstand, sieht man das Foto eines verwüsteten Arbeitszimmers mit Blick auf Geschäfte jüdischen Namens. Eine Anspielung auf die Verbindung Nietzsches zum Pogrom vom 9. November 1938, der sogenannten ›Reichskristallnacht‹? Der Titel deutet mögliche Lesarten an und bezieht sich auf sechs wie durch einen Aktenlocher erzeugte Löcher, die hell leuchten und von schwarzen Ringen umgeben sind. Beuys fasst hier das ambivalente Verhältnis zusammen, das das Nachkriegswestdeutschland (und er selbst) zu Nietzsche hatte.
1945 – 1989: der Osten
Während der deutschen Teilung schauten die Nietzsches in verschiedene Richtungen. In der DDR war Nietzsche zum Schweigen verurteilt, galt er doch als Wegbereiter des Faschismus. Wer sich gegen dieses einseitige Bild aussprach, musste es im Untergrund tun, in universitären, studentischen oder künstlerischen Kreisen. Immerhin verbrachte Nietzsche wichtige Jahre zu Beginn und am Ende seines Lebens im künftigen DDR-Gebiet. Kritische Menschen, Dissidenten oder Studentinnen besuchten heimlich das Grab in Röcken, man trank Rotwein und rezitierte, oder man führte wie Friedrich Schorlemmer Theologiestudenten aus Halle oder Merseburg dorthin, um über Nietzsche zu diskutieren. Dass zwei Italiener in Weimar die kritische Nietzsche-Ausgabe vorbereiteten (→ 1958), wurde offiziell still geduldet, doch die Stasi interessierte sich dafür. Der IM war philosophisch nicht auf dem Laufenden und erwähnte in seinem Protokoll ein Buch namens Also sprach Sarah Tustra. Das glorreiche Zitat avancierte zum Titel einer Monographie des Historikers Matthias Steinbach über Nietzsches sozialistische Irrfahrten in der DDR (2020).
Die Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke war die einzige Forscherin, die sich in der DDR über Nietzsche habilitierte, und zwar mit Die anspornende Verachtung der Zeit, Studien zur Kulturkritik und Ästhetik Friedrich Nietzsches. Ein Beitrag zu ihrer Rezeption (1983). Gegen Ende der DDR bereitete sie eine Ausgabe von Die fröhliche Wissenschaft bei Reclam Leipzig vor, die aber erst nach der Wende erschien. Damit man im Westen nicht ein zu enges Bild von Nietzsches Stand in der DDR habe, sei hier eine aufschlussreiche Anekdote von Reschke wiedergegeben: Mitte der 1980er sollte sie an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Vorlesungen über Nietzsche halten. Als sie in den Hörsaal schaute, sah sie dort nur junge Männer in Uniform sitzen:
Ich wollte gehen, einer kam auf mich zu, fragte, ob ich die Nietzsche-Dozentin sei, sie würden auf mich warten. Ich war skeptisch, aber das war unbegründet. Die Soldaten wollten Militärmusiker werden. Sie hatten das Thema Nietzsche selbst gewählt. Auf meine Frage nach dem Warum kam ihre Antwort wie selbstverständlich. Man müsse über einen so bedeutenden Philosophen informiert sein, der zudem selbst ein guter Musiker gewesen sei und komponiert habe. Auf meinen Einwurf, dies sei kaum die allgemeine Meinung über Nietzsche hierzulande und die Frage, worauf sie ihre Auffassung stützten, antwortete einer vieldeutig: ›Wir können selbst lesen. Sogar zwischen den Zeilen.‹ ›Auch wenn es uns wegen der Uniform mancher nicht zutraut‹, ergänzte ein anderer. (Reschke 2021, 6)
In der ehemaligen DDR, so der Nietzsche-Forscher Wolfgang Müller-Lauter 1991 bei der räumlichen Wiedereröffnung des Nietzsche-Archivs in Weimar, habe man »Mit Nietzsche úmgehen« übersetzt in »Nietzsche umgéhen« [meine Akzente]. Zu recht merkt Ralf Eichberg vom Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg dabei an, dass das Umgehen von etwas immer doch das Bewusstsein eines Etwas voraussetze. Spuren Nietzsches in Mitteldeutschland wurden nicht gelöscht, manchmal musste man etwas abkratzen oder geradebiegen, dann waren sie zu sehen, ob in Röcken, Naumburg, Weimar, Jena oder Tautenburg. Um den Philosophen Hans-Martin Gerlach an der Universität Halle-Wittenberg scharten sich Geister, die mehr über Nietzsche wissen wollten; es gab Seminare und Vorträge (z.B. über Tönnies und Nietzsche). Eichberg berichtet von einem Seminar über Nietzsches Lyrik, an dem er zusammen mit Lutz Seiler, dem späteren Autor von Kruso (2014), teilnahm. (Der Seminarleiter Rüdiger Ziemann findet sich als hochgeehrter »Dr. Z.« im Roman wieder.)
Nietzsche hat also die Geistesgeschichte der DDR unterschwellig begleitet, doch kam es am Ende dieses Staates noch zu einer kulturellen Explosion, die von Nietzsche ausging. Wolfgang Harich, der als Reformkommunist und Dissident acht Jahre in Haft war und zuvor noch wie der frühe Lukács von Nietzsche inspiriert gewesen war, begann in den 1980ern Nietzsche als Faschisten zu verfolgen und jene Forscher, die sich mit dem Philosophen auch nur kritisch beschäftigten, zu denunzieren, zumal er die Gefahr sah, dass Nietzsche nun auch wie Bismarck oder Friedrich der Große in das Kulturerbe der DDR aufgenommen werden könnte. Je weniger Gehör er mit seinen Einlassungen bei den Obrigkeiten fand, desto harscher wurde er. 1985 schrieb er an den stellvertretenden Kulturminister Höpcke: »Im sozialistischen deutschen Staat kann es keinen Platz für Nietzsches Erbe oder irgendeine Art von Nietzscheanertum, Nietzsche-Rezeption oder dgl. geben. Friedrich Nietzsche?? Ins Nichts mit ihm!!!« Man müsse ihn zum Schweigen bringen: »Den Mann nicht für zitierfähig zu halten, sollte zu den Grundregeln geistiger Hygiene gehören.« (Sinn und Form 5, 1987) Marxisten wie Manfred Buhr oder Hans Heinz Holz traten ihm vor- und umsichtig entgegen. Das hielt Harich nicht davon ab, Holz, Augstein, Reschke »e tutti quanti als Enkelschüler« der Elisabeth Förster-Nietzsche zu betrachten. Harichs Furor steigerte sich noch, als ihm zu Ohren kam, dass in der DDR eine Publikation von Ecce Homo geplant war. Der Gipfel war erreicht, als Stefan Hermlin Nietzsches »An den Mistral« in einer Lyrikanthologie platzierte, also ein Tanzlied auf den Freigeist, der allerdings auch »Krüppel-Greise« und Kranke aus seinem Paradies vertreiben solle (ebenso »Tugend-Gänse« und »Heuchel-Hänse«). In der Debatte 1987/88, die die Zeitschrift Sinn und Form dokumentierte, meldeten sich neben Hermlin auch der Lyriker Thomas Böhme, der das »inquisitorische« Vorgehen verurteilte, sowie Hermann Kant zu Wort, der Harich auf dem X. und letzten Schriftstellerkongress der DDR (November 1987) in die Schranken wies: Mit derlei »Polpotterien« wolle man nichts zu schaffen haben. Harich forderte weiterhin die Planierung von Nietzsches Grab in Röcken rechtzeitig vor 1994, wenn der 150. Geburtstag anstünde und viele Gäste