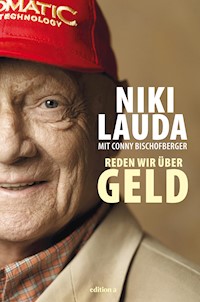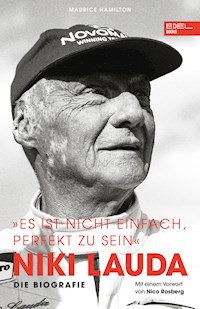
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Österreicher Niki Lauda prägte die Formel 1 über Jahrzehnte wie kein Zweiter - als erfolgreicher Fahrer, aber als auch Manager und Macher hinter den Kulissen. Seine einmalige Lebensgeschichte umfasst sportliche Meilensteine wie zwei Weltmeistertitel mit Ferrari und die weltberühmte Rivalität mit James Hunt in den 70er-Jahren (verfilmt im Kinofilm Rush), aber auch dramatische Wendepunkte wie den fast tödlichen Unfall auf dem Nürburgring, Rücktritt und den Beginn der Unternehmerkarriere sowie die langjährige, erfolgreiche Arbeit als Manager, Medienexperte und Berater in der Formel 1. Der preisgekrönte Autor und Journalist Maurice Hamilton, der Niki Lauda mehr als vierzig Jahre lang begleitete, führte für die erste umfassende Biografie zahlreiche Gespräche mit der Familie, Freunden, Wegbegleitern und Mitstreitern. Entstanden ist ein einmaliges, tiefgehendes Porträt dieser großen Sport- und Unternehmerpersönlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Gedenken an Alan Henry (AH), der mich mit Niki bekannt machte und uns beiden ein treuer Freund war.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort von Nico Rosberg
Vorwort
Einführung
1 Der Wahnsinn der frühen Tage
2 Hilfe von oben
3 Lauda bringt Ferrari zurück in die Erfolgsspur
4 Der Weg zum ersten WM-Titel
5 Und dann kam James
6 Der Ring steht in Flammen
7 Eine Naturgewalt
8 Kampf gegen die Angst
9 Die Messer werden gewetzt
10 Fuji
11 Wieder Weltmeister
12 Bernie und Brabham
13 Auf und davon
14 Hochfliegende Pläne
15 Comeback Nummer zwei
16 Zurück mit einem Streik
17 Ein Auslaufmodell
18 Mehr Power, bitte
19 Offen bis zum Ende
20 Der dreifache Weltmeister
21 Harte Verhandlungen
22 Zum Äußersten entschlossen
23 Auf Biegen und Brechen
24 Flug 004
25 Letzter Aufruf für Lauda Air
26 In Ferraris Diensten
27 Dompteur für die Katze
28 Das wiedergefundene Ohr
29 Der Mercedes-Mann
30 Ein wandelndes Pulverfass mit roter Kappe
31 Rush
32 Es ist alles ganz einfach
33 Erinnerungen
34 Die letzte Runde
35 Söhne des Vaters
36 Der Abschied
Nachwort
VORWORT VON NICO ROSBERG
Ich erinnere mich noch, wie ich Niki zum ersten Mal begegnet bin. Ich muss etwa sechs Jahre alt gewesen sein. Nikis Familie und meine Eltern waren beide oft auf Ibiza und haben sich dort gelegentlich getroffen. Ich war noch sehr klein, aber ich erinnere mich an diesen Moment genau. Wie beeindruckt ich war, als ich dieser großen Rennfahrerlegende gegenüberstand. Ich war schon immer ein Riesenfan der Formel 1 und habe bereits als kleines Kind vor dem Fernseher gesessen, wenn ein Rennen lief, und mit Formelautos gespielt. Die Formel 1 war alles für mich. Nie hätte ich mir damals träumen lassen, dass ich eines Tages selbst in der Königsklasse des Motorsports fahren, eine Weltmeisterschaft gewinnen und dass es Niki Lauda sein würde, der mir anschließend zu meinem Sieg gratuliert. Dieser Moment, als ich aus dem Auto stieg und Niki seine rote Kappe vor mir zog, mir seinen Respekt erwies, das wird für immer ein herausragender Augenblick meiner Karriere sein.
Niki war immer ein großes Vorbild für mich. Er beendete seine Karriere im Jahr 1985, meinem Geburtsjahr. Ich habe ihn selbst nie live auf der Rennstrecke erlebt. Aber ich habe mir als junger Fahrer zahlreiche Videos von seinen Rennen angesehen und mir viel von ihm abgeschaut. Niki war immer sehr kalkuliert, er ging wenig Risiko ein und war unheimlich fleißig. Er ist mit dem Kopf gefahren und wollte stets alles genau analysieren und verstehen. Vorbereitung und Setup waren alles bei ihm. Er hat gezeigt, dass man als Fahrer bei weitem nicht immer gewinnen, nicht immer der Schnellste sein muss. Aber man muss konstant liefern, sollte Dummheiten vermeiden und sich nie auf seinen Erfolgen ausruhen. Diese Herangehensweise hat mich sehr beeinflusst. Später bin ich an meine eigene Karriere ähnlich herangegangen. Nikis unglaublicher Drive und sein Lebensweg hat viele beeindruckt, auch mich. Wenn es jemanden gab, der niemals aufgegeben hat, dann war das Niki. Was er für Rückschläge eingesteckt hat. Wie er sich da wieder herausgekämpft hat. Und schließlich, wie er wieder ganz oben stand. Das ist beeindruckend, das ist riesig. Für diese Inspiration können wir alle dankbar sein, denn wir alle haben etwas von Niki mit auf unseren Weg genommen und werden ihn auch dafür in Erinnerung behalten.
Niki war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Es gab in seinem Leben drei Dinge, die er mit Feuer und Flamme gelebt hat: die Formel 1, das Fliegen und seine Familie. In seinen Interessen war er immer sehr gradlinig, immer aufrichtig, manchmal brutal direkt, aber stets fair und ehrlich. Wenn man eine Antwort haben wollte, gab er sie einem. Auch wenn sie wehtat. In meiner Zeit bei Mercedes gab es viele schwierige Momente, vor allem zwischen Lewis und mir. Niki hat dabei oft als Mediator fungiert und sich mit uns beiden hingesetzt, um unsere Probleme zu besprechen. Da waren auch Momente dabei, in denen die Fetzen flogen. Aber auch in diesen Augenblicken war Niki derjenige, der versucht hat, alle Parteien zu verstehen. Er hat immer als Vermittler agiert, damit wir wieder zueinanderfinden. Das hat er für den Team-Erfolg gemacht. Niki konnte wütend werden, aber er hat auch immer dafür Sorge getragen, dass wir zusammenhalten und uns wieder annähern. Und er war überhaupt nicht nachtragend. Egal, was passiert ist, Niki und ich haben uns immer wieder gefunden. Niki hatte die Stärke, dass bei ihm immer die Tür offen stand und auch für ihn immer alle Türen offen standen. Er hat keine verbrannte Erde hinterlassen. „Man trifft sich immer zweimal im Leben“, das war ein großes Motto nicht nur von Niki, sondern auch von meinem Vater Keke. Dieses Motto habe ich tief verinnerlicht. Auch in dieser Hinsicht habe ich viel von Niki mit auf meinen Weg genommen.
Als ich mich entschieden habe, meine Karriere als Fahrer zu beenden, war Niki zuerst alles andere als begeistert. Für ihn und das Team war mein Rücktritt zunächst ein Rückschritt: Ich war gerade Weltmeister geworden, war ein starker Fahrer und wichtig für das Team. Ich hatte nicht unbedingt Verständnis für seine Reaktion auf meinen Abtritt, aber ich konnte sie zum Teil nachvollziehen. Niki hat einfach alles, was er getan hat, mit unglaublicher Leidenschaft getan. Deshalb hat er es auch abseits der Rennstrecke zu etwas gebracht. Er war einer der wenigen Fahrer, die es geschafft haben, ihren Erfolg aus der Formel 1 zu nutzen und in einem ganz anderen Bereich gewinnbringend einzusetzen. Das ist selten. Heute, wo ich selbst Unternehmer bin, denke ich daher umso häufiger an Niki, auch wenn wir zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze verfolgen. Niki hat sich für das Fliegen begeistert und ein erfolgreiches Airline Business aufgebaut. Ich selbst möchte mit meinen Projekten positiven Wandel vorantreiben und Unternehmertum und Wohltätigkeit vereinen. Dabei bin ich oft mit Herausforderungen konfrontiert, bei denen ich Nikis Rat gebrauchen könnte. Sein ehrliches Feedback hat mir in meiner Formel-1-Karriere immer geholfen. Heute dient mir sein Lebensweg als Inspiration. Und manchmal stehe ich vor Entscheidungen und frage mich, was Niki wohl dazu sagen würde. Dann kann ich seine Stimme immer noch laut und deutlich hören, und sie ist noch genauso direkt und unverblümt wie eh und je.
Ich werde Niki für immer dankbar sein für alles, was er mir für mein Leben gegeben hat. Er hatte einen Riesenanteil an meinem sportlichen Erfolg und hat mein Leben für immer bereichert. Das ist riesig und ich bin sehr, sehr dankbar für seine Unterstützung.
VORWORT
Ich habe nie vorgehabt, ein Buch über Niki Lauda zu schreiben. Ich hatte einfach das Glück, ihn während der vier Jahrzehnte, in denen ich als Motorsportjournalist über die Formel 1 berichtete, persönlich kennenzulernen. Dabei ging es mir wie all den anderen, die seine geradlinige, manchmal scharfzüngige Art schätzten: Es war immer unterhaltsam und anregend mit ihm, er konnte einen stets überraschen.
Auf die Idee, über ihn zu schreiben, kam ich erst in der Woche nach Nikis Tod am 20. Mai 2019. Die immense Anteilnahme an seinem Tod, die von allen Seiten überall auf der Welt bekundete Anerkennung seiner Leistungen und der Respekt vor seiner Person, die in den zahllosen Würdigungen ebenso zum Ausdruck kamen wie die aufrichtige Trauer um einen Mann, dem Sentimentalitäten selbst fremd waren – all das überzeugte mich mehr und mehr davon, dass ein so außergewöhnliches Leben mit einem Buch gewürdigt werden müsse.
Mein Literaturagent David Luxton hatte zu dieser Zeit die gleiche Idee. Von Anfang waren Ian Chapman und Ian Marshall von Simon & Schuster Feuer und Flamme für das Projekt, was es für mich nur umso leichter machte, mich auf diese – wie sich im Nachhinein herausstellen sollte – wundervolle Reise zu begeben (wozu nicht unwesentlich beigetragen hat, dass mir dabei all die schillernden, eigenwilligen und nicht selten umstrittenen Persönlichkeiten wiederbegegneten, die sich damals in der Formel 1 herumtrieben).
Bevor ich mich an die Arbeit machte, war es mir wichtig, dass sich die Familie Lauda mit meinem Vorhaben einverstanden erklärte. Nikis Söhnen Lukas und Mathias bin ich für ihre Unterstützung zu großem Dank verpflichtet. Viele Freunde und Kollegen waren bereit, für dieses Projekt ihre Gedanken und Erinnerungen an Niki mit uns zu teilen, ich hoffe, dass die Familie darin Trost fand in der schweren Zeit nach ihrem großen Verlust.
Zu besonderem Dank bin ich Bradley Lord und Olivier Owen verpflichtet. Ihr Rat war mir in unterschiedlichen Bereichen von unschätzbarem Wert.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch aufrichtig bei allen bedanken, die mich bei der Realisierung dieses Buches unterstützt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Jean Alesi, Pino Allievi, Daniele Audetto, Gerhard Berger, Mike ‚Herbie‘ Blash, Daniel Brühl, Mathias Brunner, Will Buxton, Tim Collings, Vivien Cullen, Stuart Dent, Bernie Ecclestone, Rita Farmer, Mauro Forghieri, Lewis Hamilton, Mark Hamilton, Thorsten Hans, Darren Heath, John Hogan, Mark Hughes, Mario Illien, Eddie Irvine, Tony Jardine, Eddie Jordan, Linda Keen, Florian König, Gerhard Kuntschik, Lukas Lauda, Mathias Lauda, Otmar Lenz, Paddy Lowe, Max Mosley, Giorgio Piola, Alain Prost, Dave Ryan, Michael Schmidt, Nav Sidhu, Marc Surer, Jean Michel Tibi, Herbert Völker, John Watson, Toto Wolff, Karl-Heinz Zimmermann und Helmut Zwickl.
EINFÜHRUNG
Als Niki Lauda die Bühne des internationalen Motorsports betrat, ahnte niemand etwas von der glanzvollen Formel-1-Karriere mit drei Weltmeisterschaftstiteln, die vor dem jungen Österreicher lag. Mallory Park, wo er sein Debüt gab, war allerdings auch ein anderes Kaliber als Silverstone, Monaco oder Monza.
Mallory Park ist so schlicht wie die Adresse auf der inneren Umschlagsseite des fünf Jahrzehnte alten Programmhefts: Mallory Park Circuit, Kirby Mallory, Leicester. Earl Shilton 2631. Wer hier Anfang 1971 anrief und sich nach den bevorstehenden Veranstaltungen erkundigte, erfuhr unter anderem, dass am Sonntag, den 14. März, auf dieser Strecke ein Formel-2-Rennen stattfinden würde, der Eintritt kostete 1,50 £.
Auf der hinteren Innenseite des Programmumschlags war eine Skizze der Rennstrecke abgebildet, die dem Profil eines Golfschlägerkopfs ähnelt – mit einem See in der Mitte. Diese vereinfachte Grafik reicht aus, um eine Vorstellung von Mallory Park zu vermitteln: Ein etwas eingedelltes Oval mit einer angehängten, engen Schlaufe, das mit einer Länge von 2,17 km einem Rennfahrer weder hinsichtlich seiner Merkfähigkeit noch seiner Fahrkünste besonders viel abverlangte.
Obwohl es aufregendere Kurse gab, fand hier eine Art Warm-up für die bevorstehende Formel-2-Europameisterschaft statt, eine prestigeträchtige Rennserie, die Nachwuchsfahrern die Gelegenheit bot, sich mit vielen namhaften Formel-1-Piloten zu messen. Das Rennen in Mallory Park stellte in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Auf der Starterliste fanden sich Namen wie Ronnie Peterson, Henri Pescarolo, Derek Bell, Graham Hill und Jo Siffert, alles Fahrer mit Grand-Prix-Erfahrung, die sich mit Neulingen wie Carlos Reutemann, John Watson und Mike Beuttler (die es allesamt in den kommenden Jahren in die Formel 1 schaffen würden) auseinanderzusetzen hatten.
Dass die Strecke ihre Schwächen hatte, war den britischen Motorsportfans angesichts des hochkarätigen Fahrerfelds ziemlich egal. Mit dieser Veranstaltung endete ein öder Winter ohne Rennen. Alle waren gespannt, was die neue Saison bringen mochte, und so wurde auch im Programmheft spekuliert, ob die Fahrer mit den neuen Formel-2-Rennwagen wohl den alten Streckenrekord von 42,8 Sekunden einstellen könnten – eine absurd kurze Zeit, insbesondere, wenn man sie mit den acht Minuten vergleicht, die eine Runde auf der furchteinflößenden Nordschleife des Nürburgrings dauert. Dort sollte sieben Wochen später das dritte Rennen der Serie stattfinden. Mallory Park bot Fahrern und Teams zum Auftakt vor allem eine Gelegenheit, die Wagen einzufahren und die Vorbereitung auf die anstehende Saison abzuschließen.
Unter den 31 Fahrzeugen der im Heft abgedruckten Starterliste fand sich ein March 712M mit einem Niki Lauda als Fahrer. Er trat an für ein – wie es in der Rennvorschau gedruckt stand – „Team Erste Osterreachsche Spar Casse“, dessen fehlerhafter Name mehr Platz in Anspruch nahm als die beiläufige Erwähnung des Fahrers. Der wurde von den Rennsportfans ohnehin nur als der 22-jährige Österreicher wahrgenommen, der es geschafft hatte, einer Bank den zur Teilnahme am Rennen erforderlichen Kredit aus den Rippen geleiert zu haben. Dieses etwas respektlose Urteil dürfte zu einem gewissen Grad auf Laudas Leistungen in der Anfangsphase seiner Formel-Karriere zurückzuführen sein.
Motorsportinteressierte Briten erinnerten sich daran, dass dieser „N. Lauda“ – wer auch immer das sein mochte – mit seinem Formel-3-McNamara im Juli des Vorjahres beim Rennen in Brands Hatch infolge eines Unfalls ausgeschieden war, wesentlich mehr wusste man nicht über ihn. Lauda versuchte, wie so viele junge Fahrer im Motorsport Fuß zu fassen und sich auf den Rennstrecken der Welt durchzubeißen.
Niki Lauda begann 1968 mit dem Motorsport, als er in einem Mini Cooper S in seiner Klasse gleich einige Bergrennen in Österreich gewann. Ehrgeizig wie er war, tauschte er schon bald den noch nicht abbezahlten Mini gegen einen leistungsstärkeren Porsche 911. Da er das Geld für die monatlichen Raten oft nicht zusammen bekam, musste er immer wieder neue Schulden machen. Das mochte für den Spross aus reichem Hause – der Familie gehörte unter anderem eine Papierfabrik – aufgrund der Sicherheiten zwar einfacher sein als für andere, aber es war tatsächlich so, dass seine Eltern und sein Großvater, der mächtige Patriarch der Familie, für seine Motorsportambitionen keinerlei Verständnis aufbrachten. Finanzielle Unterstützung war von ihnen nicht zu erwarten.
Mit dem Wechsel zu Bergmanns Formel-V-Team 1969 verschärfte sich seine finanziell brisante Situation noch mal. Hinzu kam, dass er sich beim zweiten Rennen mit dem Kaimann-Einsitzer auf dem Asperner Flugplatz überschlug, weil er zu viel riskiert hatte. Lauda, der sich dabei glücklicherweise nicht verletzte, war vor allem daran interessiert, aus seinem Fehler zu lernen – aber er hatte keine grundsätzlichen Bedenken aufgrund des großen Risikos.
Dass er keine Angst hatte, wenn er im Cockpit eines Rennwagens saß, bewies er eindrucksvoll, als er später in dieser Saison als erster Formel-V-Pilot in unter 10 Minuten durch die 170 Kurven des Nürburgrings jagte – eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Lauda gewann in der Formel V zwar nur ein einziges Rennen, aber seine Einstellung imponierte seinem Rennstallleiter Kurt Bergmann. In einem Interview mit dem Lauda-Biografen Herbert Völker sagte Bergmann:
Lauda hatte technisch überhaupt keine Ahnung, aber er hatte Instinkt, ein sehr gutes Gefühl, das er aber nicht erklären und schon gar nicht theoretisch untermauern konnte. Sein Leben war total auf Motorsport ausgerichtet. Er fragte mich, ob er ein guter Fahrer sei, oder ob ich glaube, dass er ein guter Rennfahrer werden würde. Ich hatte das Gefühl, er würde am Finanziellen scheitern, denn Geld war entscheidend für den Aufstieg. Er war ohnedies zu allen Tricks bereit und hatte eine unglaubliche Hartnäckigkeit gegenüber Leuten, von denen er sich irgendetwas erhoffte, aber trotzdem: Ich sah einfach für ihn keine Chance, so viel Geld aufzutreiben, wie damals nötig war, um wirklich rasch weiterkommen zu können. Da half es auch nichts, dass er privat sehr bescheiden lebte, er hatte immer dasselbe Gewand an und leistete sich nichts außer dem Motorsport.
Mit der von Bergmann erwähnten Hartnäckigkeit kratzte Lauda aus allen möglichen Ecken Geld zusammen und kaufte einen Porsche 908. Zwar hatte er nun eines der leistungsstärksten Fahrzeuge in dieser Klasse, aber ihm wurde rasch klar, dass ihn Sportwagenrennen nicht weiterbringen würden. Nur über den Einstieg in die Formel 3, konnte er in die Formel 2 und schließlich in die Formel 1 aufsteigen.
Dank seines Überzeugungstalents und mit einem absoluten Minimum an Sponsorengeldern schaffte er es, sich einen Platz im Formel-3-Team von Francis McNamara zu ergattern. McNamara, der als Leutnant der US Army in Deutschland stationiert war, hatte selbst in der Formel V Rennen gefahren.
Schon beim ersten Training der Saison 1970 hatte Lauda Pech. Auf der Rennstrecke im französischen Nogaro kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden Wagen, als er aus dessen Windschatten ausscherte. Der McNamara wurde in die Luft geschleudert, landete vor einer Leitplanke, an der er 100 Meter entlangrutschte, und verlor sämtliche Räder. Das war allerdings nur ein kleiner Vorgeschmack auf den spektakulären Unfall im Jahr darauf im belgischen Zolder, an den sich Lauda im Gespräch mit Völker später noch gut erinnerte:
Es war der Gipfelpunkt des Verrückten. Dritte Runde: Ein Unfall – Hannelore Werner [eine deutsche Fahrerin] – irgendwo auf der Strecke. Wir kamen in Formation über die Kuppe, mit Tempo 210. Da war plötzlich der Ambulanzwagen mit Tempo 50 vor uns. Die ersten drei haben sich rechts vorbeigezwängt. Dann wollte noch einer rechts vorbei, der hat’s aber nicht mehr geschafft, begann zu kreiseln. Daraufhin wollte ich links vorbei, inzwischen kreiselte der eine Wagen aber nach links, wir kollidieren, ich drehe mich, der nächste Wagen schoss mich volley ab. Alles spielt sich mitten auf der Fahrbahn ab, ich stand da mit meinem zerlemperten Auto, da kam die nächste Gruppe über den Hügel. Inzwischen waren schon die gelben Fahnen draußen, es gab jede Menge Signale, aber die Meute blieb voll am Gas. Ich konnte nur warten, auf welcher Seite sie mich abschießen würden. Einer flog über meine Schnauze, dann sprang ich raus und rannte einfach weg.
Am Ende der Saison hatte Lauda für McNamara elf Rennen gefahren, nennenswerte Platzierungen Fehlanzeige, stattdessen ein Crash nach dem anderen und der Ausritt in Brands Hatch im Juli.
Dieses Ausscheiden ereignete sich beim Formel-3-Rennen im Vorprogramm des Großen Preises von Großbritannien. Niki hat zu dieser Zeit nicht gerade viel für Österreichs Ansehen als Motorsportnation getan, ganz anders als Jochen Rindt. Laudas charismatischer und extrem schneller Landsmann hatte diesen Grand Prix in einem Lotus 72 gewonnen und seine Chancen auf den Weltmeistertitel in der Formel 1 erhöht.
Einer von Laudas Konkurrenten in diesem Formel-3-Rennen war James Hunt, ebenfalls eine Nachwuchshoffnung, die über deutlich mehr Ehrgeiz als Geld verfügte. Damals konnte keiner der beiden ahnen, dass sie sich sechs Jahre später ein verbissenes und hochdramatisches Duell um den Weltmeisterschaftstitel liefern würden – und dass ihre Geschichte vier Jahrzehnte später den Stoff für einen erfolgreichen Kinofilm abgeben könnte.
Im Juli 1970 war ihre Bilanz noch mager: ein dritter Platz für Hunt und ein Bericht in der Autosport, in dem Laudas Ausscheiden in der vorletzten Runde so zusammengefasst wurde: „Ein Unfall, bei dem Lauda unverletzt blieb, sein McNamara hingegen einen traurigen Anblick bot.“
Immer wieder mal war Laudas Name in dem britischen Wochenmagazin zu lesen. Über ein Formel-3-Rennen im schwedischen Karlskoga stand in der Autosport: „Im ersten Lauf holte Lauda aus dem McNamara alles heraus, machte Runde um Runde Plätze gut und kämpfte sich von Position acht auf drei.“ Vom Rennen in Knutsrop eine Woche später, am 16. August, berichtete Autosport: „Für die Überraschung des Tages sorgte der junge Nicki [sic] Lauda: Schon im Training schnell unterwegs, holte er sich die Pole und lag in Runde 2 in Führung, fiel nach einem Dreher aber auf den letzten Platz zurück.“
Ganz gleich, wie viele Schrammen Laudas Auto im Laufe der Saison davongetragen haben mochte, sein Selbstvertrauen hatte definitiv keinen Schaden genommen. Er arbeitete verbissen daran, das Beste aus dem Wagen und sich herauszuholen und war fest davon überzeugt, für die Formel 1 schnell genug zu sein – er musste nur die richtige Gelegenheit bekommen, um das unter Beweis stellen zu können. In der Formel 3 war er nun lange genug, als Nächstes musste er den Sprung in die Formel 2 schaffen, auch wenn das angesichts seines Kontostands ein Ding der Unmöglichkeit zu sein schien.
Ohne Geld geht im Rennsport nichts. Dieser Logik folgend suchte sich Lauda einen Rennstall, dem es finanziell noch schlechter ging als ihm selbst. Das erst im September 1969 gegründete Konstrukteursteam March Engineering setzte auf drei Dinge: relativ schnelle Rennwagen, extreme Unverfrorenheit und große Überzeugungskraft. Dem Unternehmen wurde von Beginn an ein rasches Ende vorhergesagt, aber March hatte allen Unkenrufen zum Trotz Rennwagen für die Formel 1, die Formel 2 und die Formel 3 produziert – und 1970 hatten sie es irgendwie geschafft, ihre erste Formel-1-Saison zu überstehen, nicht zuletzt dank eines überraschenden Sieges beim Großen Preis von Spanien.
Die Unbekümmertheit der Anfangsphase hatte sich mittlerweile ein wenig verflüchtigt, man stand nun vor der Aufgabe, etwas von dem ursprünglichen Schwung und Enthusiasmus in die zweite Saison zu retten. Für die britische Firma war das aber kein ganz so großes Problem, da sie mit Ronnie Peterson einen wahren Trumpf in der Hand hielt. Der junge, hoch talentierte Schwede sollte seine erste komplette Saison bestreiten, nachdem er 1970 bereits eine Handvoll Rennen für einen privaten, von March belieferten Rennstall gefahren hatte.
Peterson war als Nummer eins des Formel-2-Teams von March 1971 gesetzt, seinen Platz finanzierten schwedische Sponsoren. In die anderen Formel-2-Wagen des Rennstalls konnte man sich gegen Höchstgebot einkaufen. Beziehungsweise, wie Lauda schnell herausfand, mit genügend Geld, um March am Leben zu erhalten.
Lauda wollte unbedingt einen Platz im nagelneuen Formel-2-March, dem 712M. Das Team bot ihm die Möglichkeit, sich mit den besten Fahrern der Welt zu messen – im Gegenzug musste er eine halbe Million Schilling (damals 80 000 DM) beisteuern. Lauda besaß allerdings kaum 1000 Schilling. Einen Teil der fehlenden Summe kratzte er aus verschiedenen Ecken zusammen, für den Rest nahm er einen Bankkredit auf, der mit einer Lebensversicherung abgesichert war. Für Lauda war das alles nur ein Mittel zum Zweck: Seine Resultate würden für sich sprechen, dachte er. Mit ihnen würde er sich für einen Platz als bezahlter Fahrer empfehlen, und als regulärer Grand-Prix-Pilot hätte er dann Einnahmen, mit denen er die Schulden peu à peu begleichen könnte. Eigentlich war alles ganz einfach.
Mit diesem Plan kam Lauda im März 1971 nach Mallory Park und zu seiner ersten Fahrt mit einem nagelneuen Formel-2-Boliden im Gelb des Sponsors, dessen Name im Programmheft so bizarr falsch geschrieben worden war. Solche Probleme waren John Watson fremd, denn er hatte keinen Sponsor. Der Nordire stand vor seiner zweiten Saison als Privatfahrer. Es war der Auftakt zu seiner späteren Karriere als Grand-Prix-Pilot und Laudas Teamkollege in der Formel 1 – was er sogar zweimal war. Watson erzählte:
Wie alle anderen [Fahrer] auch habe ich damals jede Woche die Rennsportzeitschriften gelesen und in den Ergebnislisten nachgesehen, wie die einzelnen Fahrer so abschnitten. Der Name Niki Lauda sagte mir nichts, und es drängte sich einem auch nicht unbedingt der Eindruck auf, dass er irgendwann dreifacher Weltmeister werden könnte. Von seinem Auftritt an diesem Wochenende in Mallory Park ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass er mit einem nagelneuen Porsche 911S ankam und in Begleitung von Mariella Reininghaus war, einer grazilen, klassischen Schönheit. Ich weiß noch, wie ich dachte: „Verdammt! Der Typ weiß, was wirklich wichtig ist.“
In der Qualifikation wurde Lauda Zehnter. Mit 1,8 Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten Peterson war er auf jeden Fall nicht der Langsamste von den sechs March, die teilnahmen. Das Rennen ging über zwei Läufe. Im ersten musste Lauda, an achter Stelle liegend, wegen einer nicht festgeklemmten Benzinleitung aufgeben –vermutlich waren die March-Mechaniker mit den vielen Wagen, um die sie sich kümmern mussten, schlichtweg überfordert. Der zweite Lauf verlief zunächst deutlich vielversprechender. Lauda hatte sich auf einen beeindruckenden vierten Rang vorgearbeitet, bevor dann in der 29. von 40 Runden der Ford-Cosworth-Motor seinen Geist aufgab.
Die Schlagzeile des Tages gehörte jedoch Peterson. Im ersten Lauf fuhr er mit komfortablem Vorsprung dem erwarteten Sieg entgegen, als beim Einlenken in eine schnelle Rechtskurve ein Kugelgelenk der linken Vorderradaufhängung brach. Der March wurde über die Böschung katapultiert, überschlug sich und landete kopfüber ein Stück vor dem Maschendrahtzaun, der den Zuschauerbereich von der Strecke trennte. Peterson kroch schlammbespritzt und leicht unter Schock stehend aus dem Wrack, während sich die Streckenposten vielleicht ausmalten, was alles hätte passieren können, wenn der March nur wenige Meter weiter geflogen wäre. So kam nur ein kleiner Junge zu Schaden, der durch herumfliegende Plastikteile leichte Schnittwunden im Gesicht davontrug. Zumindest den ersten Schrecken hatte dieser jedoch rasch vergessen, als er freudestrahlend von Peterson ein signiertes Stück der zerstörten Verkleidung überreicht bekam.
Nach Petersons Ausfall hatte das Rennen für die meisten Zuschauer den Reiz verloren, wie der Autor selbst bezeugen kann. Voll Vorfreude hatte ich damals dem Beginn der Saison entgegengefiebert und war mit anderen Rennsportenthusiasten über die M1 aus London angereist. Mir Zutritt zu der als Fahrerlager dienenden Wiese zu verschaffen, war leicht gewesen, auf Zäune und Absperrungen war aus Mangel an Bedarf und Kostengründen verzichtet worden.
Während ich am Morgen des Renntags die Atmosphäre dort genoss und zwischen Lastwagen und Ersatzteillagern herumspazierte, sah ich, wie Lauda ganz ruhig in das Cockpit seines 712M stieg. Nur ein Mechaniker war bei ihm, die meisten Zuschauer und March-Mitarbeiter drängten sich in einiger Entfernung um Petersons Wagen. Zu diesem Zeitpunkt spürte ich noch keinerlei Neigung, Motorsportjournalist zu werden, wenn überhaupt sah ich mich als Fotograf. Ich ging näher ran und machte eine Aufnahme dieses nicht gerade vielversprechenden Milchbubis. Warum, weiß ich bis heute nicht.
Vierzig Jahre, vier Monate und acht Tage später zeigte ich Niki Lauda diese Schwarzweißaufnahme zum ersten Mal.
KAPITEL 1
Der Wahnsinn der frühen Tage
„Ich schau ja aus wie ein Schulbub! Wo ist das?“
„Das war in Mallory Park, März 1971. Dein erstes Rennen in der Formel 2.“
„Könnte sein … Erinnern kann ich mich ned. Wo hast du das her?“
„Selbst geschossen! Damals war ich einfach nur Fan und zu der Zeit kam man noch problemlos in die Boxen. Ich hab allerdings keine Ahnung, warum ich dich fotografiert hatte, zu der Zeit warst du noch ein Nobody!“
„Stimmt! Interessant ist der Ring, den ich hier trage. Das war der Siegelring meiner Familie, schau, hier ist das Familienwappen. Mein Großvater und mein Vater hatten ihn vor mir getragen.“
„Ein echtes Erbstück also.“
„Kann man so sagen. Ich hab ihn bekommen und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch deppert genug, ihn zu tragen! Meine Familie ist wer in Österreich, Aristokraten, wenn man so will. Merkwürdige Leute. In England gibt’s davon einen Haufen, in Österreich weniger. Na ja, ich war halt sehr jung – siehst, wie ich hier ausschau – und ich hab gedacht, es wär richtig, den Ring zu tragen.“
„Du trägst ihn links, das wirkt so, als ob du verheiratet wärst.“
„Ich war ned verheiratet, überhaupt ned. Ich hatte keine Ahnung, wie man ihn richtig trägt, das zeigt nur, wie deppert ich war. Ein sehr interessantes Bild, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Dass ich den Ring zu Beginn meiner Rennkarriere noch hatte, war mir komplett entfallen. Ich weiß noch, dass ich ihn bald danach weggeschmissen hab. Ich hab alles hinter mir gelassen, das ganze Aufwachsen in der Familie und die guten Manieren, all dieses Zeug, und mich dazu entschieden, ein richtiger Rennfahrer zu werden!“
Laudas Versuche, 1971 in einem Formel-2-Wagen als „richtiger Rennfahrer“ aufzutreten, hinterließen – zumindest zu Beginn – zu wenig Eindruck bei den Eigentümern von March Engineering. Aber das mussten sie auch nicht. Für March – der Firmenname setzte sich aus den Initialen der Gründer zusammen – Max Mosley, Alan Rees, Graham Coaker und Robin Herd – ging es ums nackte Überleben. Zuallererst interessierte die Briten an den Möchtegernchampions das Geld, das man ihnen abknüpfen konnte. Die eigentlichen Erfolgschancen waren eher zweitrangig.
Coaker hatte Erfahrung in Verwaltung und Produktion, Rees – selbst als Formel-2-Fahrer hoch gehandelt – war Teammanager, der geniale Herd, der sein Oxford-Studium in Physik und Maschinenbau jeweils mit Bestnote abgeschlossen hatte – kümmerte sich um Technik und Design, Mosley – Rechtsanwalt und früherer Amateurfahrer – vertrat eloquent und mit Verve das Unternehmen nach außen. Mosley erzählte:
March war knapp bei Kasse. Niki kam und traf sich mit Alan Rees, nicht mit mir. Er verfügte über 8000 £, was damals eine Menge Geld war. Alle mochten ihn, als Mensch hat uns Niki sehr beeindruckt. Er war ausgesprochen intelligent. Ich erinnere mich an ein gemeinsames Abendessen mit ihm und meiner Frau Jean in einem indischen Restaurant in South Kensington. Man fühlte sich sehr wohl in seiner Gesellschaft. Jean und ich waren von London nach Oakley gezogen, in die Nähe des March-Werks in Bicester, und Niki mietete kurzzeitig unsere Wohnung in Victoria. Wir hielten ihn als Fahrer nie für besonders schnell, er war es einfach nicht. Er war nicht so schnell wie Ronnie – aber so schnell war damals keiner, glaube ich.
Es war typisch für Lauda, dass er sich permanent mit Peterson, der einen ähnlichen Formel-2-Boliden fuhr, verglich – an ihm konnte er seine Fortschritte messen. Damals teilte er sich eine Wohnung mit Mike Hailwood, dem vormaligen Motorradweltmeister, der zu der Zeit in der Formel 1 fuhr. Das Appartement war günstig gelegen (im Bezirk Heston, nahe dem Flughafen Heathrow), zudem lebten Peterson und seine Frau Barbro im selben Haus. Lauda erzählte:
Ronnie und Barbro hatten die Wohnung unter mir gemietet. Für mich war Ronnie„der Meister“. Ich fuhr häufig mit ihm im Mercedes nach Bicester [zum March-Werk] und ich kann mich gut daran erinnern, dass er immer mit links bremste. Ich wollte wissen, warum er das machte – der Wagen hatte schließlich eine Handschaltung, also hätte er eigentlich mit rechts Bremse und Gas betätigen müsse. Er meinte, er mache das als Training. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wofür er damit trainierte. Aber Ronnie war so anpassungsfähig, man merkte als Beifahrer überhaupt nicht, ob er nun mit rechts oder mit links bremste. Da war er unglaublich geschickt. Mich hat er in jeder Hinsicht beeindruckt. Wenn ich gegen ihn fuhr, dann habe ich gemerkt, worauf es beim Rennfahren eigentlich ankommt. Ronnie war zu der Zeit einfach der Schnellste.
Peterson probierte auf den Fahrten nach Bicester noch andere Dinge aus. Mosley berichtete davon:
Auf der Strecke nach Bicester gibt es eine Stelle – zwischen Long Crendon und Oakley –, an der die Straße erst bergauf verläuft, dann einen Knick nach rechts und schließlich einen nach links macht. Diese Kurve war ziemlich berüchtigt, und Ronnie war davon überzeugt, sie nehmen zu können, ohne vom Gas gehen zu müssen. Einmal nahm er einen Reporter aus Skandinavien mit, der mir hinterher erzählte, dass Ronnie wissen wollte, wie schnell er in der Kurve war. Er wusste bereits, dass er sie Vollgas fahren konnte, jetzt interessierte ihn die Geschwindigkeit. Also musste der Reporter den Tacho im Auge behalten, während sich Ronnie aufs Fahren konzentrierte. Wenn man durch diese Kurve fährt, dann ist die Vorstellung, da in einem Mercedes mit Vollgas … nun ja … anscheinend hat er’s gemacht. Der arme Reporter war kreideweiß, als er davon erzählte. Und Niki, da bin ich mir sicher, wird bei Ronnie im Auto ähnliche Aktionen miterlebt haben.
Abgesehen von einem bemerkenswerten sechsten Platz auf dem Nürburgring, gab es für Lauda in der ersten Saisonhälfte angesichts von zahlreichen Ausfällen nicht viel zu feiern. Und einmal verpasste er sogar die Qualifikation – ausgerechnet in Crystal Palace, einer in einem Park gelegenen Rennstrecke, auf der sein Landsmann Jochen Rindt mit einem spektakulären Sieg seinen internationalen Durchbruch gefeiert hatte. Dann ging es für Lauda zum ersten Mal aufwärts. Am 27. Juni wurde in Rouen-Les-Essarts gestartet, auf einer zum größten Teil über öffentliche Straßen führenden Rennstrecke, die vor allem für die rasanten Bergabpassagen mit einem entsprechenden Anstieg auf der Gegenseite und einer sehr schnellen Zielgeraden bekannt war. Lauda berichtete:
In der Formel 2 war ich einmal schneller als Ronnie. Das war in Rouen und lag nur daran, dass die March-Leute unterschiedliche Heckflügel ausprobierten. Bei Ronnie hatte man einen neuen, kleineren Flügel montiert, der auf der Geraden besser war. Ich hatte den normalen Flügel – und hängte ihn mühelos ab, weil ich wegen des Heckflügels auf den Bergabpassagen deutlich schneller war. Das fühlte sich total seltsam an, denn, wie gesagt, Ronnie war wirklich der Meister.
Bei diesem Rennen wurde Lauda Vierter, sein bestes Resultat in dieser Saison. Peterson gewann am Ende locker die Formel-2-Europameisterschaft 1971, Lauda lag in der Gesamtwertung auf Platz 10. John Watson erzählte:
Je länger die Saison dauerte, umso deutlicher traten Nikis Qualitäten zutage. Nicht nur als kompetenter Rennfahrer, sondern als intelligenter Mensch, der Robin Herd und dem Team gut erklären konnte, wie er sich die Abstimmung des Wagens wünschte und was man zusätzlich noch verbessern könne. Vor allem wegen dieser Rückmeldungen wurde er vom Team mehr und mehr geschätzt. Man bekam mit, dass sich die Techniker und Mechaniker immer häufiger an ihn wandten, um von ihm zu erfahren, wie man das Set-up des Wagens weiter verbessern konnte. Und er besaß noch ein anderes bemerkenswertes Talent: Er konnte Geld auftreiben. Dass er aus einem reichen Elternhaus kam, mag ihm geholfen haben, aber es war schon beeindruckend, mit welchem Selbstvertrauen er zu diesem Zeitpunkt zur Bank ging – und mit einem Sponsorenvertrag zurückkam. Es wurde immer klarer, dass Lauda keiner dieser reichen Schnösel war, die einfach nur Lust hatten, mal ein bisschen Rennen zu fahren.
Mit seinen Leistungen überzeugte Lauda auch die ihm gegenüber bisher sehr kritischen österreichischen Journalisten, zu denen auch Helmut Zwickl zählte, der damalige Motorsportjournalist der Wiener Tageszeitung Kurier. Zwickl berichtete:
Zu Beginn seiner Laufbahn sah ich Niki sehr kritisch. Er war kein geborener Siegfahrer ab der Formel 3 aufwärts. Wir hatten kein besonders gutes Verhältnis. Im Vorjahr hatten wir Jochen Rindt verloren [der Österreicher war bei der Qualifikation zum Großen Preis von Italien tödlich verunglückt und am Ende der Saison posthum Weltmeister geworden]. Lauda war ein ganz anderer Typ als Jochen. Vor allem hatte er dessen Charisma nicht. Ich war nicht der Meinung, dass er ein großer Fahrer werden könne – da lag ich völlig falsch! Aber im Laufe des Jahres 1971 wurde deutlich, dass er ein guter werden könnte. Unser Verhältnis verbesserte sich deutlich und wir wurden sehr gute Freunde.
In seinem Saisonrückblick schrieb Ian Phillips, Formel-2-Korrespondent der Autosport: „Aufgrund seines Alters hatte Niki Lauda noch relativ wenig Erfahrung, stellte sich aber rasch auf den March ein und zeigte einige sehr vielversprechende Rennen, was mit dazu beitrug, dass er für das kommende Jahr mit einem beneidenswerten Vertrag ausgestattet wurde.“ Phillips hatte den Rückblick im November 1971 geschrieben und zuvor dank seiner exzellenten Kontakte in Erfahrung gebracht, dass Lauda 1972 für March sowohl in der Formel 1 als auch der Formel 2 antreten sollte. Der 22 Paragrafen umfassende Vertrag, den Lauda am 23. September unterzeichnete, enthielt die Zusage, dass Lauda in beiden Formelserien der zweite Fahrer (hinter Peterson als Nummer eins) werden sollte.
Paragraf 11 des dreiseitigen Vertrages legte fest: „Bei Vertragsunterzeichnung entrichtet der Fahrer für seinen Platz in der Formel 1 und Formel 2 an das Team die Summe von 50 000 £. Der Fahrer erhält vom Team 45 Prozent aller Start- und Preisgelder, die er mit dem Fahrzeug des Werkteams verdient.“ Die Zahl „50 000 £“ hatte man durchgestrichen und mit Tinte handschriftlich korrigiert in „2 500 000 S (Österreichische Schilling)“, statt „Bei Vertragsunterzeichnung“ hieß es nun: „Wie in Paragraf 22 dieses Vertrags festgelegt“.
Der handschriftlich am Ende der letzten Seite eingefügte Paragraf 22 lautete: „Bedingung dieses Vertrages ist, dass die Bezahlung der gemäß Paragraf 11 fällig werdenden Summe entweder am 29. September 1971 durch den Fahrer erfolgt oder dieser eine von seinem Vater unterzeichnete Sicherheit vorlegt, dass diese vor dem 31. Oktober 1971 entrichtet wird. Bei Nichterfüllung dieser Bedingung kann das Team ohne Anerkennung einer Rechtspflicht seine Zusage zurückziehen.“ Die Änderungen und Zusätze waren von Lauda und Mosley unterzeichnet bzw. paraphiert worden.
Lauda ging fest davon aus, dass er das Geld würde auftreiben können. Die Erste Österreichische war mit dem 1971 erreichten Werbewert zufrieden gewesen und gab die Zusage für die Finanzierung eines weiteren Jahres. Dann, aus heiterem Himmel, wurde ihm von der Bank mitgeteilt, dass der Vertrag geplatzt sei. Lauda fand heraus, dass sein Großvater Hans Lauda, der von Anfang gegen Nikis Rennfahrerambitionen war, Freunde im Aufsichtsrat der Bank kontaktiert und diese dazu gebracht hatte, die Zusage zu kassieren – „um den Buben zur Vernunft zu bringen“. Wie man das von ihm erwarten konnte, reagierte Lauda prompt und ohne Umschweife:
Ich rief meinen Großvater an und bat ihn, sich verflucht noch mal nicht in meine Angelegenheiten einzumischen. Er weigerte sich und meinte, dass ein Lauda nie ein Rennfahrer werden könne, dass ich in die Wirtschaft gehen und mich aus diesem bescheuerten und gefährlichen Sport raushalten solle. Bis zu seinem Tod habe ich nie wieder mit ihm gesprochen, leider verstarb er, ehe ich Weltmeister wurde. – Aber jetzt steckte ich in der Klemme. Ich hatte einen Vertrag unterzeichnet und keine Möglichkeit, die vereinbarte Summe zu bezahlen – und so war ich nicht erzogen worden. Aus meiner Sicht wollte ich March einfach nicht enttäuschen.
Angesichts des bedrohlich näher rückenden Fälligkeitsdatums wandte sich Lauda an eine andere Bank, die Raiffeisenkasse. Lauda erzählte:
Ich traf dort einen ziemlich guten Mann, Karlheinz Oertel. Er verschaffte mir einen zinslosen Kredit über fünf Jahre, dafür würde mein Auto und mein Helm den Namen seiner Bank tragen. Dann fragte er mich, was im Falle meines Todes passieren würde. Ich dachte: „Mist, daran hab ich noch gar nicht gedacht.“ Zur Absicherung des Kredits haben wir dann eine Lebensversicherung abgeschlossen. Allerdings musste ich – wenn mir nichts zustieß – den Kredit natürlich immer noch zurückzahlen. Jetzt hatte ich keinen Schilling mehr, aber enorme Schulden.
Ian Phillips war über die neue Entwicklung schnell im Bilde und schrieb in der Autosport:
Die Raiffeisenkasse teilt mit, dass Niki Lauda bei seinen Formel-1- und Formel-2-Rennen für March in den Farben der Bank antreten wird. Die Bank gewährte Lauda einen Kredit in Höhe von bis zu 38 000 £, den Niki binnen drei Jahren durch Einnahmen aus Start- und Preisgeldern tilgen muss. Mit 6000 £ wird dabei das Fahrzeug gesponsert. Für seine Partner stellt Lauda, Sohn eines vermögenden Bankaufsichtsrats, aufgrund seines wohlhabenden Elternhauses kein finanzielles Risiko dar, da sich die Familie zur Absicherung des Kredits verpflichtet hat.
Es ist fraglich, ob die Familie von dieser Verpflichtung wusste. Auf jeden Fall würde man Lauda bei March Engineering Limited nicht vor die Tür setzen. Die Firma hatte einen Verlust von 73000 £ gemacht und Bankschulden in Höhe von 40000 £, was Ende 1971 beträchtliche Summen waren. Lauda hatte den Vertrag unterschrieben und zugesagt, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. In Anbetracht der enormen Summe, um die es ging, hatte Mosley Lauda um eine Bankgarantie von seinem Vater gebeten. Er erzählte:
Ich wusste damals nicht viel über seine Familienverhältnisse. Von der Geschichte mit dem Großvater und dem Geld habe ich erst später erfahren. Ich hatte keine Ahnung, dass seine Familie in Österreich so einflussreich war, Niki war keiner, der mit so etwas hausieren ging. Auf jeden Fall hatte er zugesagt, den gewünschten Garantiebrief vorzulegen. Ich erinnere mich daran, wie ich unserem Sachbearbeiter bei der Bank erklärte, dass alles okay wäre: Das Geld sei unterwegs. Aber das Geld kam nicht, und Niki sagte: „Kein Problem, kein Problem, ich bringe das in Ordnung.“
Schließlich kam er mit diesem Brief. Er schien auf derselben Schreibmaschine und demselben Papier getippt worden zu sein wie Nikis sonstige Korrespondenz, die Unterschrift war ziemlich unleserlich, schien aber gewisse Ähnlichkeiten mit Nikis Handschrift aufzuweisen. Was hätten wir machen sollen, wir bekamen ja von nirgendwoher sonst Geld. Dem Bankangestellten erzählte ich dann, dass alles okay wäre, sein Vater hätte ja die Garantie abgegeben. Natürlich hatten die bei der Bank kein Interesse daran, unserem Laden das Licht auszuknipsen. Als das Geld schließlich eintraf, meinte der Sachbearbeiter: „Ich fasse es nicht. Das ist ja, als ob man die Trustee Savings Bank [Kreissparkasse] dazu überredet, die Formel 1 zu kaufen.“
Lauda meinte:
Es war schon ein Wahnsinn, ein riesiges Lotteriespiel. Aber ich war jung und sicher, dass es klappen würde. Von meiner Familie würde ich fürs Rennfahren eh kein Geld bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass das der richtige Weg war, um schnell nach oben zu kommen – die Saison würde ich durchziehen, zeigen, dass ich schnell bin, und im folgenden Jahr würde man sich dann um mich reißen und ich würde genug verdienen, um mit den Rückzahlungen anzufangen. Ich ging fest davon aus, dass ich das schaffen würde. Aber natürlich musste das Auto mitspielen.
Der zweite Formel-1-Wagen von March hatte Lauda beeindruckt. Mit dem 711 hatte Peterson 1971 vier zweite Plätze erreicht, in Monaco, Silverstone, Monza und auf der Mosport-Rennstrecke in Kanada. Alles sprach dafür, dass es 1972 mit einem noch besseren Rennwagen weiter bergauf gehen würde. Tatsächlich erwies sich dieser aber als einer der schlechtesten, den March je gebaut hatte, eine kaum fahrbare Fehlkonstruktion. Der ehrgeizige Robin Herd hatte sich schlichtweg zu viel auf einmal vorgenommen. Dazu Lauda:
Robin und Max hatten mir vorgeschwärmt von dem neuen Wunderauto, dem 721X, den ich in der Formel-1 fahren würde. Es hatte ein zwischen Differential und Chassis liegendes Sportwagengetriebe von Alfa-Romeo. Das meiste Gewicht sollte in der Fahrzeugmitte liegen: Das Ziel war ein niedriges polares Trägheitsmoment zu erreichen, damit der Wagen auf Lenkbewegungen besser ansprach. Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln, schließlich war Ronnie 1971 Zweiter in der WM-Gesamtwertung geworden.
Zu Saisonbeginn 1972 fuhr ich noch das überholte 71er-Modell, das zwar noch brauchbar, aber eigentlich veraltet war. Beim ersten Rennen in Argentinien wurde ich Elfter. In Südafrika wurde ich Siebter, nur zwei Plätze hinter Ronnie, und der galt zu dem Zeitpunkt als das große Talent in der Formel 1. Für mich als Formel-1-Neuling war das also okay. Aber wir brauchten dringend ein neues Auto – diesen tollen 721X.
Der neue Wagen sollte auf der Rennstrecke in Jarama getestet werden, eine Woche vor dem dort stattfindenden Großen Preis von Spanien. Lauda hatte kein Problem damit, dass der 721X zunächst Peterson überlassen wurde – zumal dieser den Wagen danach lobte. Lauda erzählte:
Ronnie testete den Wagen, weil er die Nummer eins war, ich war der Lehrbub. Zwei Tage fuhr und fuhr und fuhr Ronnie damit. Es sah alles gut aus, vor allem, weil die Rundenzeiten nicht schlecht waren im Vergleich zu Jackie Stewart [dem damaligen Weltmeister], der zur gleichen Zeit seinen Tyrrell testete. In der letzten Stunde am zweiten Tag durfte ich dann auch mal ran.
Ich fuhr zwei Runden und sagte: „Das ist der größte Scheiß, mit dem ich je gefahren bin.“ Ein bisschen beeindruckt hat Herd meine Meinung schon – aber glücklich war er damit natürlich nicht. Der Wagen untersteuerte [schob in Kurven über die Vorderräder], übersteuerte [brach mit dem Heck aus], war auf der Geraden langsam und schaltete sich furchtbar. Wenn man vom fünften in den vierten Gang schalten wollte, landete man manchmal im zweiten oder ersten. Ob man den richtigen Gang erwischte, war reine Glückssache. Aber am schlimmsten war das Handling. Zwischen Fahren und Rutschen gab es einfach keinen Spielraum, um noch einzugreifen.
Ronnie verstand nicht, wovon ich redete, weil er mit seinem fahrerischen Talent alle Fehler des Autos ausgleichen konnte. Ihm fehlte das Gespür dafür, wie schlecht oder gut ein Auto war, er hatte da keine Ahnung. Er bewegte den Wagen einfach am Limit und kam mit dem zurecht, was das Auto dann machte. Das war für mich unvorstellbar – das konnte ich schlichtweg nicht! Als ich nach einigen weiteren Runden Robin erzählte, dass ich mit dem Auto nicht zurechtkam, sagte er zu mir: „Wenn du einmal soviel Erfahrung hast und so gut fahren kannst wie Ronnie Peterson, wirst du das auch schaffen.“ Ich habe mir jedes einzelne Wort gemerkt. Bei mir hat das einen großen Eindruck hinterlassen.
Herd zweifelte an Laudas Urteil, weil Peterson sich so positiv äußerte und seine Rundenzeiten fast so gut waren wie die von Stewart. Bei diesem Vergleich wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass Tyrrell verschiedene Neuentwicklungen ausprobierte, die nicht wie gewünscht funktionierten, und wie zum Beweis war der sonst so zuverlässige und präzise Weltmeister mehrfach von der Strecke abgekommen.
Mit Beginn des offiziellen Trainings zum Großen Preis von Spanien ging allmählich allen ein Licht auf. Peterson qualifizierte sich als Neunter (1,4 Sekunden langsamer als Jacky Ickx mit seinem Ferrari, der sich die Pole gesichert hatte, bzw. eine halbe Sekunde hinter dem Viertplatzierten Jackie Stewart auf Tyrrell) und ein extrem unglücklicher Niki Lauda fand sich auf Position 25 in der letzten Startreihe wieder, unglaubliche fünf Sekunden hinter Peterson, ganz zu schweigen von dem Rückstand auf die Bestplatzierten. Im Rennen fiel Laudas Wagen schon früh aus, und auch Peterson schied vorzeitig aus aufgrund von technischen Problemen mit seinem 721X.
March machte bis zum nächsten Rennen in Monaco unbeirrt weiter – was man dort wohl im Nachhinein bereut haben dürfte. 1971 war Peterson auf dieser Strecke noch über sich hinausgewachsen, nun reichte es für ihn – obwohl er wieder alles gab – in der Qualifikation nur zu Platz 15. Für Lauda, der auch in Monaco von ganz hinten starten musste, war das tröstlich. Im Rennen schaffte er es irgendwie, sich auf der extrem nassen Strecke von den Leitplanken fernzuhalten und kam als 16. ins Ziel, allerdings mit sechs Runden Rückstand. Peterson wurde am Ende Elfter – und war damit „nur“ vier Runden hinter dem siegreichen Jean-Pierre Beltoise im BRM ins Ziel gekommen. Herd wusste längst, dass Lauda mit seinem drastischen ersten Urteil über das neu entwickelte Auto offenbar ins Schwarze getroffen hatte:
Ronnie war einer der besten Freunde in meinem Leben, ein fantastischer Fahrer und liebenswerter Mensch. Aber er war in der Lage, sich etwas vorzumachen – genau wie ich. Der 721X war furchtbar. Es spielt keine Rolle, ob man – in der Hoffnung, dass sich das Auto dann besser fährt – das Getriebe vor die Hinterachse setzt, ein Rennwagen muss zunächst mal mit den Reifen harmonieren, und schon das war beim 721X überhaupt nicht der Fall. Beim Einfahren in eine Kurve untersteuerte das Ding irrsinnig, um dann plötzlich total zu übersteuern. Sowohl Ronnie als auch ich wollten unbedingt, dass der Wagen funktioniert. Ronnie legte sich mächtig ins Zeug – und dann war Niki an der Reihe. Niki war immer sehr offen, und so war auch seine Einschätzung des 721X brutal ehrlich. Und auch wenn ich das damals nicht gleich akzeptieren wollte, lag er damit vollkommen richtig.
Das bestätigte einen Eindruck, den ich schon früher von ihm gehabt hatte. Als ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass er ein richtig guter Fahrer werden könne, waren wir mit ihm und Ronnie zu Tests in Thruxton [in Hampshire]. Zu dem Zeitpunkt hatte Niki bereits ein paar Formel-2-Rennen absolviert, war dabei aber nicht besonders aufgefallen. Er übernahm die ersten zehn Runden, damit wir eine Vergleichszeit hatten, anschließend war Ronnie im selben Auto an der Reihe. Ich fuhr mit Niki zum schnellsten Abschnitt der Strecke, wo wir Ronnie zusehen wollten. In der Aufwärmrunde kam er schon driftend durch die Kurve. Der Wagen sprang über eine Bodenwelle, die Reifen qualmten – typisch Ronnie eben. Niki machte einen Schritt zurück und wurde buchstäblich kreideweiß. Er war total still und sagte dann: „Robin, nie im Leben könnte ich einen Rennwagen so fahren.“ Man konnte ihm ansehen, dass er den Glauben an sich komplett verloren hatte.
Ronnie drehte seine zehn Runden und auf dem Weg zurück zu den Boxen fragte ich Niki, welche Zeit Ronnie seiner Meinung nach wohl gefahren ist. Niki überlegte und sagte dann: „Ich hatte eine 1:14. Er dürfte zwei Sekunden schneller gewesen sein – sagen wir eine Minute 12.“ Tatsächlich hatte Ronnie aber eine Minute und 14,3 Sekunden benötigt. Damals dachte ich, dass Niki wirklich ein richtig Guter werden könne.
An der Rennstrecke von Thruxton mag Lauda für einen Moment niedergeschlagen gewesen sein, nun war er komplett entmutigt. Er kam mit dem 721X überhaupt nicht zurecht: „In der Woche zwischen diesem ersten Test und dem Beginn des Trainings zum Großen Preis von Spanien habe ich nur noch an mir gezweifelt“, erzählte er. „Ich hab geglaubt, ich hab keine Chance, je so schnell wie ‚der Meister‘ zu sein. Aber dann fuhren wir im offiziellen Training in Spanien und plötzlich sah der 721X nicht mehr ganz so großartig aus.“ Er fuhr fort:
Nach Monaco ersetzte man das Alfa-Romeo-Getriebe durch ein Hewland-Getriebe. Schalten konnte man so besser, aber der Rest des Autos war so heillos wie zuvor. Richtig heftig wurde es, als Ronnie sich darüber beklagte, dass ihn auf der Geraden beim Großen Preis von Belgien [in Nivelles] ein Privatfahrer in einem Formel-2-March mit einem Formel-1-Motor abgehängt hatte. Beim nächsten Rennen [dem Großen Preis von Frankreich in Clermont-Ferrand] war genau das unsere Lösung: ein Formel-2-Auto mit einem Formel-1-Motor. Freilich, das war nicht besonders toll, aber eine deutliche Verbesserung. Wenigstens konnte ich versuchen, damit zu fahren.
Herd erinnert sich so daran: „Den ungeliebten 721X ersetzten wir durch ein Auto auf Formel-2-Basis. Es trug die Bezeichnung 721G. Das G stand dabei für Guinness, weil wir in unserer Verzweiflung bis zur Fertigstellung nur neun Tage brauchten, was unserer Meinung nach für einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde gereicht haben dürfte.“ Mit diesem Wagen schaffte Lauda gerade noch einen weit abgeschlagenen neunten Platz beim Großen Preis von Großbritannien, ansonsten fiel er entweder mit technischen Defekten aus oder landete auf Platz 10 oder schlechter. Im Gesamtklassement wurde er mit null Punkten unter „ferner liefen“ geführt. Der als das überragende Fahrertalent in der Formel-1 gehandelte Peterson wurde in der Gesamtwertung Neunter – was sich für ihn kaum besser angefühlt haben dürfte als der 99. Platz.
Lauda erzählte:
Der 721X hätte meine Karriere beenden können, noch ehe sie richtig losging. Für mich war das damals eine Katastrophe. Ronnie galt schon etwas, für ihn war das nicht so schlimm. Er konnte sich vom Acker machen – und tat das auch, er ging 1973 zu Lotus. Aber für mich sah es so aus, als wäre ich damit endgültig gescheitert. Ronnie hat mich in dieser Zeit sehr unterstützt. Er half mir, sprach mir Mut zu, vor allem auf den gemeinsamen Fahrten in seinem Auto nach Bicester. Einer der Gründe, warum ich eben nicht verzweifelte, war, dass meine Zeiten bei Tests immer nah an Ronnies waren, manchmal auch schneller. Da er einer der Besten war, konnte ich also gar nicht so schlecht sein. Und wenn wir in der Formel 2 gegeneinander antraten, konnte ich mit ihm mithalten.
In der europäischen Formel-2-Meisterschaft schaffte es Lauda 1972 drei Mal aufs Podium. Gleichzeitig gab es auch ein britisches Formel-2-Championat, eine eher unbedeutende Serie mit fünf Rennen. In zwei davon konnte Lauda nachhaltig auf sich aufmerksam machen: Am Karfreitag 1972 hatte Lauda das Regenrennen in Oulton Park gewonnen, an dem Peterson nicht teilgenommen hatte, und im September – beim zweiten Rennen auf der in Cheshire gelegenen Strecke – wurde er dort Zweiter, hinter Peterson und vor Hunt (der in einem March als Privatfahrer teilnahm). „Niki hat an diesem Tag in Oulton Park mit seinem Sieg ein deutliches Zeichen gesetzt“, sagte Mosley. „Es sagt viel über einen Fahrer aus, wenn er bei Nässe schnell ist. Darauf schaue ich immer mit als Erstes. Nikis Talent wäre sicher viel früher erkannt worden, wenn sein Teamgefährte nicht Ronnie gewesen wäre.“
Aber als es um die Entscheidung ging, wer 1973 für March fahren sollte, reichte großes Talent – ob bemerkt oder nicht – allein nicht aus, so sehr beide Seiten auch guten Willens waren. Lauda hatte das Gefühl, alles Menschenmögliche getan zu haben. Und in Anbetracht des miserablen Wagens, den man ihm zu Beginn der Saison zur Verfügung gestellt hatte, war das Team bereit, Zugeständnisse zu machen.
Am 4. November 1972 fuhr Lauda gemeinsam mit Jody Scheckter (der bald darauf ins „Driver to Europe“-Förderprogramm aufgenommen und später Weltmeister wurde) im March-BMW ein Neunstundenrennen im südafrikanischen Kyalami. Lauda holte nicht nur einen vierten Platz, er schöpfte auch neue Hoffnung: Anlässlich des Rennens besprach Herd mit ihm detailliert die Formel-1-Pläne von March für das kommende Jahr. Herd reizte allein die technische Herausforderung, für die neue Saison einen komplett neuen Formel-1-Wagen zu entwickeln, von der schwierigen finanziellen Situation des Unternehmens hatte er keine Ahnung bzw. wollte davon einfach nichts wissen. Wie Lauda bald herausfinden sollte, sah das Geschäftsergebnis nicht anders aus als im Vorjahr. Er berichtete:
Im Dezember fuhr ich nach Bicester, wo mir Max [Mosley] mitteilte, dass kein Geld da sei, um mich in der Formel 1 starten zu lassen. Er meinte, ich könne Formel 2 fahren und das Testen des Formel-1-Wagens übernehmen – inzwischen hatte man kapiert, wie gut ich darin war, aber für mich kam das alles etwas zu spät. Mehr gab es nicht zu sagen. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte kein Geld, zwei Millionen Schilling Schulden, keinen Vertrag, und das hauptsächlich, weil ich dieses Scheißding von 721X hatte fahren müssen.
Auf der Strecke vom March-Werk gab es eine T-Kreuzung mit Stoppschild, dahinter eine solide Mauer. Für eine Sekunde durchzuckte mich der Gedanke, dass ich einfach in die Mauer fahren und mich umbringen könnte: Es gab keine Möglichkeit, das Geld zurückzuzahlen, und ich hatte komplett versagt bei dem Versuch, mich in der Formel 1 durchzusetzen. Gott sei Dank war dieses Gefühl schnell vorbei und ich hatte mich wieder unter Kontrolle. Aber an diesen Moment kann ich mich gut erinnern.
Später dachte ich darüber nach, was ich jetzt machen könnte. Mit einem Zivilberuf würde ich das Geld nie zurückzahlen können, das würde bis zum Ende meines Lebens dauern. Es gab also keine andere Wahl: Ich musste mich als Formel-1-Fahrer durchsetzen. Und das bargeldlos. Ein weiterer Kredit war nicht drin.
Mosley erzählte:
Niki hat mir davon [seinen spontanen Selbstmordgedanken] erst viel später erzählt. Wenn man von unserem Betriebsgelände in der Murdock Road Richtung Hauptstraße fuhr, hielt man an einer Stelle vor einer Mauer. Er dachte: „Warum bleib ich nicht voll am Gas?“ Zum Glück hat er sich dann eines Besseren besonnen, aber in dem Augenblick war er völlig verzweifelt.
Damals hatte nur Robin mit ihm zu tun – ich hab Niki nicht oft getroffen –, aber Robin hasste jede Form von Auseinandersetzung. Also war es an mir, Niki die Hiobsbotschaft zu überbringen. Mir war klar, dass das, was ich Niki mitteilen musste, eine Katastrophe für ihn war – aber ich hatte keine andere Wahl. Dann fuhr er weg und wollte Schluss machen. Wir haben uns später oft darüber unterhalten. Es war ein furchtbarer Moment. Und wenn jemand wie Niki solche Gedanken hat, dann zeigt das schon, wie sehr ihm das in dem Moment den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Als er den Flughafen erreicht hatte und in der Maschine nach Wien saß, fing Lauda an, einen neuen wagemutigen Plan zu schmieden. Eine wichtige Rolle kam darin dem Boss eines Formel-1-Rennstalls zu – der selbst hochfliegende Träume hatte.
KAPITEL 2
Hilfe von oben
Louis Stanley trat gern wie der Eigentümer von BRM auf, was er allerdings nicht war. British Racing Motors war 1945 gegründet worden, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Idee dahinter war klar: Bündelung der Kräfte, damit Großbritannien wieder stolz sein konnte auf das, was die eigenen Ingenieure und Fahrer im Motorsport leisteten. Die Finanzierung erfolgte über einen speziell aufgelegten Fonds, wobei sich jedoch schon bald herausstellte, dass sich die beteiligten Unternehmen der britischen Automobilindustrie nur schwer koordinieren ließen – ähnlich wie bei einem sehr ambitionierten, aber übermäßig kompliziert konstruierten Rennwagen blieben die Ergebnisse weit hinter den Erwartungen zurück. Und das hatte zur Folge, dass die Unterstützung für dieses Projekt zusehends schwand, bis schließlich Sir Alfred Owen, der zuvor schon am Fonds beteiligt war, das Unternehmen übernahm.
Auf diese Weise wurde BRM zu einem kleinen Anhängsel des riesigen Rubery Owen Konzerns. Nach Sir Alfreds Willen sollte der Rennstall die Leistungsfähigkeit des Unternehmens demonstrieren. Doch der Erfolg ließ lange auf sich warten. Erst 1959 feierte man den ersten Sieg in der Formel 1, 1962 folgte dann der Gewinn der Weltmeisterschaft. Jetzt war man endlich erfolgreich, und zwar richtig. Und das verdankte BRM zumindest zu einem gewissen Teil einem Mann, der ursprünglich kaum beziehungsweise gar keine Ahnung vom Motorsport hatte: Louis Stanley.
Stanley war Geschäftsführer des Hotels Dorchester in London und mit Jean Owen, der Schwester von Sir Alfred, verheiratet. 1959 war das Ehepaar zufällig in Monaco, als dort das Grand-Prix-Rennen stattfand. Sie schauten es sich an und schon war Stanleys Interesse am Motorsport geweckt. Als BRM dann beim nächsten Rennen den ersten Formel-1-Sieg errang, schien der Bann endgültig gebrochen zu sein, und Stanley wurde tätig. Als erfahrenem Manager war ihm die Unruhe im Team nicht entgangen. Um dem technischen Personal mehr Einfluss zu verschaffen, krempelte er den ganzen Rennstall um und besetzte zentrale Stellen mit Ingenieuren. Damit machte er BRM in den frühen 1960er-Jahren deutlich wettbewerbsfähiger. Der Rennwagenhersteller gehörte nun zu den profiliertesten Teams der Formel 1– wovon Stanley bestens zu profitieren verstand.
Da der strenggläubige Sir Alfred es ablehnte, zu den Sonntagsrennen zu reisen, übernahm es nun Stanley BRM zu repräsentieren – etwas, das ihm Dank seines ausgeprägten Selbstbewusstseins nicht sonderlich schwer fiel. Er war eine imposante Erscheinung, doch sein Auftreten wirkte oft ziemlich überheblich – zumal im Ausland. Sprach ihn jemand, der es nicht besser wusste, als „Lord Stanley“ an, was insbesondere bei Rennen in den USA durchaus vorkam, war ihm das alles andere unrecht: Statt diese Beförderung in den Adelsstand höflich zurückzuweisen, trat er gleich noch etwas großspuriger auf.
Er hatte auch seine zweifellos guten Seiten. Er unterstützte beispielsweise Jackie Stewarts Kampf für die dringend notwendige Verbesserung der medizinischen Notfallversorgung bei Rennen, aber am Ende musste vor allem sein eigenes Team wiederbelebt werden. Als Sir Alfred 1969 einen Herzinfarkt erlitt und sich zurückziehen musste, hatte Stanley freie Hand. Er tat mit Marlboro einen neuen Sponsor auf und schmiedete mit diesem hochfliegende Pläne – BRM expandierte, sodass man am Ende vier Werkswagen im Einsatz und zahlreiche Fahrer unter Vertrag hatte, neun allein im Jahr 1972.
Lauda hatte das natürlich mitbekommen. Er nahm an, dass es bei Stanley am erfolgversprechendsten sein würde, ihm einerseits zu schmeicheln und andererseits Geld in Aussicht zu stellen. Lauda vereinbarte ein Treffen mit ihm. Er erzählte:
Ich wusste, dass Stanley auf der Suche nach Sponsoren war. Ich rief ihn an und sagte: „Sir, ich möchte unbedingt einen ihrer Rennwagen fahren, bla, bla, bla.“ Ich gab vor, einen Sponsor an der Hand zu haben – was nicht der Fall war. Er meinte, er würde sofort nach Wien kommen, um mit mir den Vertrag auszuhandeln. Wir trafen uns am Flughafen und er verhandelte mit mir und dem Bankdirektor, den ich mitgebracht hatte. Das war der [Oertel], dem ich den letzten Kredit schon zu verdanken hatte, und nun wollte ich Stanley überzeugen, dass der mich erneut sponsoren würde. Der Bankmann sprach kaum Englisch, ich übersetzte so, dass ich – vorsichtig gesagt – gut dabei wegkam. Ich brachte Stanley dazu, für die Zahlung des „Sponsorengeldes“ einen späteren Termin als den ursprünglich vorgesehenen zu akzeptieren, und zwar im Mai, so um den Großen Preis von Monaco herum.
BRM hatte mit [Jean-Pierre] Beltoise und [Clay] Regazzoni schon zwei Fahrer unter Vertrag, als dritten hatte man [Vern] Schuppan im Visier. Ich überzeugte Stanley, mir das dritte Cockpit zu lassen. Wir vereinbarten damals, dass meine erste Sponsorenrate an BRM im Mai fällig wäre. Dann meinte Stanley, dass ich nur die ersten drei Rennen fahren dürfe [Argentinien im Januar, Brasilien im Februar, Südafrika im März, alle neben Regazzoni], dann würde Schuppan übernehmen. Ich sagte, dass mir das nicht reichen würde. Aber mir war natürlich klar, dass alles Weitere von den ersten Rennen abhing.
Im ersten Rennen der Saison 1973, in Buenos Aires, fiel Lauda mit Motorschaden aus, im zweiten, in São Paulo, wurde er Achter, wobei er jeweils der langsamste BRM-Pilot war. In Südafrika änderte sich die Lage allerdings schlagartig. Nach einer Kollision zog Mike Hailwood Regazzoni aus dessen brennendem Wagen, und Beltoise musste nach wenigen Runden aufgeben. Lauda blieb als einziger BRM im Rennen und hielt sich auf einem beeindruckenden sechsten Platz, bis auch bei seinem Auto der Motor streikte. Ob das wohl reichte, um sich für weitere Rennen bei BRM zu empfehlen? Lauda erinnerte sich:
Schuppan fuhr bei einem Rennen in Brands Hatch, das nicht in die Weltmeisterschaftswertung einging. Sonderlich toll war er nicht, glaube ich [in der Qualifikation wurde Schuppan Dritter, fiel dann aber im Rennen infolge eines Unfalls aus]. Ist ja auch egal, wie das genau war, auf jeden Fall hatte man mitbekommen, wie schnell ich von Anfang an gefahren bin – besonders in Südafrika –, also durfte ich weiter ran. Dann wurde ich in Belgien Fünfter und holte die ersten WM-Punkte meines Lebens. Das Problem war, dass Mr. Stanley in Monaco natürlich auf sein Geld warten würde – und ich hatte keins. Nicht einen Groschen.
Lauda blendete die Geldsorgen aus und konzentrierte sich mit dem ihm eigenen Pragmatismus voll und ganz auf den berühmten Stadtkurs. Nach umfangreichen Bauarbeiten präsentierte sich die Rennstrecke in diesem Jahr entlang des Hafens völlig neu – die erste große Veränderung seit dem ersten hier ausgetragenen Grand Prix im Jahr 1929. Lauda stellte sich rasch auf den engen Kurs ein und war bei zwei der drei Trainings der schnellste BRM-Fahrer. Sein rot-weiß lackierter Wagen startete damit von Position sechs, direkt vor Regazzoni.
Beim Start kam Lauda gut weg und arbeitete sich bald auf den dritten Platz vor – hinter dem Tyrrell von Jackie Stewart und dem Lotus von Emerson Fittipaldi. Jetzt war er nicht nur bester BRM, er hatte auch die Ferraris hinter sich gelassen – und das registrierte man auch in Maranello, wo Enzo Ferrari verfolgte, wie sich seine Autos schlugen. 25 Runden lang konnte Lauda diesen wunderbaren Moment genießen, dann fiel der BRM mit Differenzialschaden aus. Lauda war, wie er selber sagte, „in großem Stil aufgefallen“, nur konnte er Stanley immer noch nicht die vertraglich vereinbarte Summe zahlen. Als er am Abend eine Einladung zum Essen im Hôtel de Paris erhielt, war ihm völlig klar, dass sein Gastgeber dort mehr von ihm erwartete als nur Komplimente für die Wahl des edlen Weins: