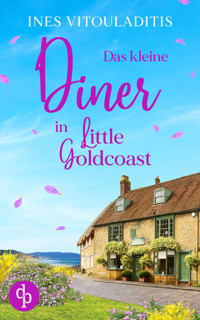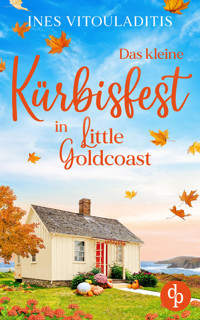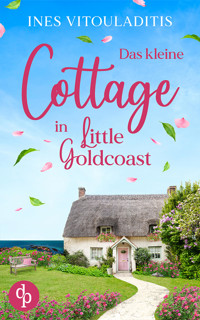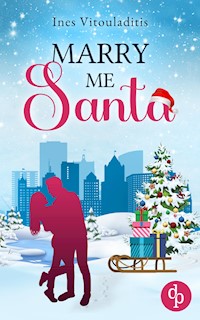8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wortschatten Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Und ihr fliegt, fliegt über den Schattenwald, fliegt über den Ozean, fliegt unter einem Himmel aus tausend Sternen.« Verborgen vor den Augen der Menschen leben die Antari, die über magische Begabungen verfügen. Nilah, die sich nie für etwas Besonderes gehalten hat, soll eine von ihnen werden. Als sie mit acht anderen jungen Erwachsenen zur Akademie »Der Schwarze Flügel« verschleppt wird, muss sie sich entscheiden: Will sie ihr unbedeutendes, kaputtes Leben zurückhaben oder will sie endlich einen Unterschied machen können? Gerade ihr Mentor Flynn lässt sie immer wieder zweifeln. Doch nicht nur ihre eigenen Gefühle scheinen unklar zu sein. Als ein dunkler Schatten die Akademie bedroht, steht für Nilah plötzlich alles auf dem Spiel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ines Vitouladitis
Nilah Taro und der Schwarze Flügel
Ines Vitouladitis
Nilah
Taro
und der
Schwarze Flügel
IMPRESSUM1. Auflage 2020© Wortschatten VerlagIn der Verlagsgruppe MainzAlle Rechte vorbehaltenPrinted in GermanyWortschatten VerlagVerlagsgruppe MainzSüsterfeldstraße 8352072 [email protected] (0)241 87343413www.wortschatten.deGestaltung, Druck und Vertrieb: Druckerei und Verlagshaus MainzSüsterfeldstraße 8352072 Aachenwww.verlag-mainz.deLektorat:Julia HuntschaUmschlaggestaltung:Nicole GanserAbbildungsnachweise:https://cdn.pixabay.com/photo/2020/06/08/03/37/landscape-5272819__340.jpghttps://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/09/09/58/wings-4832546_960_720.pngPrint:ISBN-10: 3-96964-002-4ISBN-13: 978-3-96964-002-9E-Book:ISBN-10: 3-96964-003-2ISBN-13: 978-3-96964-003-6
PrologDie Abenteuer des Flynn Gideon
Alles begann mit einem kleinen Jungen, der vor vielen Jahren an einem weit entfernten Ort lebte. Er war ein besonderer kleiner Junge, mutig und tapfer, und weiser als viele andere, die ihr Leben schon viel länger lebten. Sein Haar war rot, sein Herz groß, und sein Name war Flynn Gideon.
Flynn lebte am Ende des Schattenwaldes, weit hinter den sieben Inseln und nahe den Klippen von Tenebris, wo nie zuvor ein Mensch gewesen war. Sein Zuhause war eine Höhle, die Wände aus Stein, der Boden hart und kalt und ohne eine Menschenseele weit und breit. Es gab nur ihn, seine Mutter und all die wunderbaren Geschichten, die sie ihm erzählte. Geschichten von einer fernen Welt, von Helden und Bösewichten, Städten und Wäldern, Liebe, Kriegen und Menschen. Flynn konnte gar nicht genug bekommen von ihnen. Und während er lauschte, versuchte er, sich jedes Wort, das sie sagte, und jedes Detail im Gesicht seiner Mutter einzuprägen, um es in der Nacht noch vor sich sehen zu können. Vielleicht würde es gegen die Albträume helfen, die ihn dann und wann heimsuchten.
Er dachte dann gerne an ihr braunes Haar, das in samtigen Wellen über ihre Schulter fiel. Ihre Lachfalten und ihre vielen Sommersprossen, die jeden Winter verschwanden und treu im Sommer zurückkehrten wie Zugvögel nach einer langen Reise durch die Welt. Ihre zarten, schmalen Hände, mit denen sie ihm so liebevoll über das Haar strich. Die sattgrünen Augen und ihre Flügel, so markant und mächtig wie die Schwingen eines Adlers.
»Und wenn die beiden nicht gestorben sind, dann fliegen sie noch heute mit den Sternschnuppen um die Wette.« Runa beugte sich über ihren Sohn und drückte ihm einen Kuss auf den Kopf. »Schlaf jetzt, mein Füchslein. Der Mond ist schon aufgegangen, um dir Gesellschaft zu leisten.«
Flynn seufzte.
»Das ist meine Lieblingsgeschichte!«
»Eines Tages wird es deine Geschichte sein.« Seine Mutter stupste ihm mit dem Finger auf die Nasenspitze, deckte ihn zu und legte sich neben ihn, ganz dicht, nah und warm. »Du wirst ein Mädchen finden, das so ist wie du, Flynn. Und wenn deine Flügel stark genug sind, dann fliegst du mit ihr durch die Nacht. Und ihr fliegt, fliegt über den Schattenwald, fliegt über den Ozean, fliegt unter einem Himmel aus tausend Sternen.«
Sie nahm seine Arme und breitete sie aus wie Flügel, denn echte Flügel hatte er natürlich noch nicht. Erst wenn er zum Mann werden würde, würden sie wachsen. Flynn lachte.
»Und woher weiß ich, dass sie es ist?« Er schob die Decke beiseite und richtete sich auf. »Das Mädchen aus der Geschichte. Aus meiner Geschichte. Wo werde ich sie finden? Woran werde ich sie erkennen?«
Runa schwieg eine Weile – und dann, als er schon nicht mehr daran geglaubt hatte, dass sie ihm antworten würde, sagte sie leise und voller Bedacht: »Wenn du in ihre Augen blickst, dann wirst du es wissen.«
»Und wir werden über den Schattenwald fliegen?«
»Das werdet ihr.«
»Und über den ganzen Ozean?«
»Oh, und wie ihr das werdet!«
»Und unter einem Himmel aus tausend Sternen?«
»Und unter einem Himmel aus tausend Sternen.« Sanft zog sie den Jungen zurück in ihre Arme. »Und die Menschen werden sich deine Abenteuer erzählen. Die Abenteuer des Flynn Gideon. Und wann werden sie das tun, mein Füchslein?«
»Wenn sie dazu bereit sind, Mutter.« Flynn gähnte. Gerade wollte er sich auf die Seite drehen und die Augen schließen, als ihn ein Geräusch aufhorchen ließ. Flynns Ohren, hochsensibel durch das Aufwachsen und Leben in der Stille jener Höhle, vernahmen einen leisen, scharrenden Atemzug.
»Mutter, was –«, setzte er an, doch sie unterbrach ihn, indem sie ihm fahrig den Mund zuhielt. Flynn erschrak beinahe zu Tode. So grob hatte sie ihn nie zuvor berührt. Mit vor Schreck geweiteten Augen wandte er sich ihr zu. Kerzengerade saß sie da, wie eingefroren in ihrer Bewegung. Er folgte ihrem Blick, der starr auf den Höhleneingang gerichtet war, und für den Bruchteil einer Sekunde schien sein Herz auszusetzen.
Wenige Meter von ihnen entfernt, dort, wo das Mondlicht in ihr Zuhause flutete, stand eine Gestalt von kräftiger Statur, mit breiten Schultern und schnaubender Atmung. Sie war sicher einen ganzen Kopf größer als seine Mutter und wahrscheinlich auch mindestens doppelt so schwer. Flynn hatte nie zuvor einen gesehen, doch aus den Geschichten seiner Mutter konnte er erahnen, dass es sich bei der Gestalt um einen Mann handelte. Vermutlich um einen menschlichen, denn Flügel hatte er keine.
»Was willst du hier?« Seine Mutter hatte endlich ihre Stimme wiedergefunden, aber sie klang fremd. Heiser und zittrig. Flynn wusste nicht, was ihm mehr Angst bereitete – der unheimliche Fremde, der sich bisher weder geregt noch gesprochen hatte, oder die Reaktion seiner Mutter, die er immer für furchtlos und unerschrocken gehalten hatte.
Langsam, ganz langsam erhob sie sich und stellte sich schützend vor ihren Sohn. Als sie wieder zu sprechen begann, hatte sie die Stimme einer Kriegerin. Ebenfalls fremd für Flynn, aber mutiger und lauter als vorhin, und irgendwie beruhigte ihn das ein wenig.
»Vico Ambrosius, ich habe dich gefragt, was du hier willst!«, wiederholte sie voller Wut. »Verschwinde von hier, wenn dir dein jämmerliches Leben lieb ist!«
Flynn zog sich die Decke bis über die Nase. Vico Ambrosius? Nie zuvor hatte seine Mutter diesen Namen erwähnt, nicht ein einziges Mal war er in einer ihrer Geschichten aus der anderen Welt gefallen. Und wie konnte sie ihn überhaupt erkennen, wo doch das Mondlicht gar nicht viel von ihm offenbarte?
Endlich regte der Mann sich. Er ging einen Schritt auf Flynns Mutter zu und lachte höhnisch, als sie alarmbereit die Flügel spreizte. Sein Lachen, kalt und boshaft, durchflatterte die Höhle. Flynns Herz schlug so heftig in seiner Brust, dass er beinahe glaubte, es hören zu können. Wie das Hufgeklapper der galoppierenden Pferde, das seine Mutter ihm schon so oft vorgemacht hatte.
»Runa, Runa, Runa«, der Fremde sprach den Namen so abfällig aus, dass Flynn erschauderte, »wenn du wüsstest, wie viele Berge, Seen, Tage und Nächte ich hinter mir gelassen habe, nur um dich zu finden. Wie lange ist es her, fünf Jahre? Sechs Jahre? Nur mein Begehr nach Rache hat mich am Leben gehalten und hierhergeführt.« Drohend trat er einen weiteren Schritt nach vorn. »Glaubst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Glaubst du wirklich, ich würde es jemals vergessen?«
»Und was ist mit dem, was du getan hast?« In Runas Stimme lag ein Zittern, das nicht zu überhören war.
Vico Ambrosius schnaubte verächtlich.
»Bestohlen hast du mich! Verraten, belogen, ausgenutzt und dem Gespött der Leute ausgesetzt«, zählte er auf.
Flynns Mutter schüttelte heftig den Kopf.
»Geflohen bin ich! Geflohen vor deiner Gewalt und deiner –«
»Was versteckst du denn da?«, unterbrach er sie spöttisch. »Los, geh beiseite und lass es mich sehen!«
»Niemals«, knurrte sie, doch der Fremde versetzte ihr einen Stoß, sodass sie auf den Boden stürzte, als wäre sie kaum schwerer als eine Feder.
»War mal spektakulärer, gegen dich zu kämpfen. Dürr bist du geworden. Und schwach«, lachte er und hielt etwas vor Flynns Gesicht, woraus eine kleine Flamme sprang, die alles um sie herum ein wenig erhellte. »Was zum Teufel …« Er und Flynn starrten sich mit weit aufgerissenen Augen an. Beide hatten die gleiche Haarfarbe und auffällige, hellbraune Augen. Und plötzlich ahnte Flynn, weshalb seine Mutter ihm nie etwas über seinen Vater erzählt hatte.
»Du … du Hexe«, stieß der Fremde voller Verachtung hervor, ließ den kleinen Gegenstand neben Flynn auf den Boden fallen und versetzte Runa, die sich gerade erst aufgerappelt hatte, einen erneuten Stoß, sodass sie wieder stürzte. »Du warst schwanger? Sowas wie du kann sich fortpflanzen? Wieso hast du mir das nicht vorher gesagt?«
»Hättest du mir dann etwa eine Wahl gelassen?«, fragte Runa bitter. Keuchend stemmte sie sich in die Höhe.
Auf einmal fiel Flynn auf, wie dünn und zerbrechlich sie war. Er wollte sie beschützen, wollte ihr zur Hilfe eilen, ihr sagen, dass sie ihre Flügel ausbreiten und mit ihm fortfliegen sollte. Weit, weit fort, durch Tage, Nächte, Sonnenstrahlen und Mondlicht, bis alles Böse sie niemals wieder erreichen würde. Aber er konnte nicht. Er war wie gelähmt.
Vico Ambrosius’ höhnisches Lachen flatterte ein weiteres Mal durch die gesamte Höhle wie ein schattenhafter Vogel.
»Umso besser«, sagte er leise und boshaft. »Dann haben wir beide wohl einen Zuschauer.«
Runa atmete lautstark aus. Die Höhle erfüllte sich mit einer unangenehmen, surrenden Stille, die nichts Gutes verhieß. Flynn hielt den Atem an, während Vico Ambrosius gehässig und scheinbar zufrieden lachte.
»Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich mit dem Leben davonkommen lasse?! Nach allem, was du getan hast? Nach all den Jahren der Suche? Nein, Runa Gideon, niemals – ich werde erst ruhen, wenn dein dreckiges Herz nicht mehr schlägt.«
Runa atmete erneut beunruhigt aus. Flynn verstand sie nicht, und je mehr er darüber nachdachte, umso weniger konnte er ihr Verhalten nachvollziehen. Wieso resignierte sie? Wieso tat sie nichts? Wieso lehnte sie sich nicht auf gegen diesen rabiaten Fremden und kämpfte, wie man es von der Heldin Runa Gideon erwarten würde? Flynn schluckte. Waren all ihre Geschichten, in denen sie so stark gewesen war, bloß Lügen?
Vico Ambrosius’ Schatten tanzte gespenstig im Licht des Mondes, als er sich Runa mit gemächlichen Schritten näherte. Er schien seine Überlegenheit zu genießen.
»Ich werde nicht kämpfen.« Kapitulierend hob Flynns Mutter die Arme. »Ich mache es dir leicht! Aber verschone meinen Jungen. Ich bitte dich. Er ist ein unschuldiges Kind.«
»Oh, das werde ich.« Vico Ambrosius lachte erneut sein kaltes Lachen. »Er soll elendig verhungern und verdursten in dieser gottverlassenen Höhle und dabei während jedem einzelnen Atemzug daran denken, was für eine Hexe seine Mutter war.«
Runa sackte neben Flynn auf die Knie. Sie tastete nach dem Gegenstand, den ihr Feind hatte fallen lassen, und entzündete atemlos eine winzige Flamme zwischen ihren Gesichtern. Die Wärme wirkte paradoxerweise tröstlich auf Flynn. Schweigend sah er seine Mutter an. Runas Augen, ihre sanften, grünen Augen, waren tiefschwarz geworden. Er hatte schon öfter gesehen, dass sie die Farbe wechselten, aber schwarz waren sie noch nie gewesen.
»Ganz gleich, was geschieht – du wirst über den Schattenwald fliegen, über den Ozean und unter einem Himmel aus tausend Sternen. Das verspreche ich dir, Flynn Gideon«, wisperte sie und drückte ihm einen Kuss auf den Kopf. »Und nun schließ die Augen.«
»Mutter, ich…«
»SCHLIEß DEINE AUGEN!«, fuhr sie ihn an, so laut und bestimmend, wie sie nie zuvor mit ihm gesprochen hatte. Sie ließ die kleine Flamme ersticken und wandte sich ruckartig von ihm ab.
Flynn zog die Beine an den Körper, schloss die Augen wie befohlen und presste sich seine Hände so fest auf die Ohren, dass es schmerzte. Vielleicht war es nur ein Albtraum. Vielleicht würde er aufwachen und das Sonnenlicht würde die Höhle erhellen und all die finsteren Träume fortwischen.
Alles begann mit einem kleinen Jungen, der vor vielen Jahren an einem weit entfernten Ort lebte. Sein Haar war rot, sein Herz gebrochen, und sein Name war Flynn Gideon.
Kapitel 1Nilah
Ein Windzug blies mir all meine Haare ins Gesicht. Ich versuchte, einen tiefen Atemzug zu nehmen, doch eine bleierne Schwere lag auf meinem Brustkorb und schnürte mir die Luft ab. Keuchend strich ich mir die von Nässe schweren, dunklen Locken aus dem Gesicht.
Ein Meer aus schwarzem Wasser umgab mich, und bis zum Horizont war da nichts anderes als das. Meine Kleidung und meine Haut waren feucht.
Ich spürte den kalten Wind mit jeder Faser meines Körpers. Ich wusste weder, wie ich hierher gelangt war, noch wie lange dieses modrige Wrack, in dem ich saß und welches man kaum ein Boot nennen konnte, mich noch tragen würde. Und erst recht wusste ich nicht, wer die Gestalt war, die mir gegenübersaß. Ich hatte sie schon so oft gesehen, aber immerzu wurde sie beinahe gänzlich von einer schwarzen Kutte mit einer übergroßen Kapuze bedeckt. Es war beinahe so, als säße der leibhaftige Tod mit mir im Boot.
Es fühlte sich alles echt an, furchtbar echt sogar – aber das war es nicht. Es war nur ein Traum. Wie jedes Mal. Es war nicht mehr und nicht weniger als das. All dies war nicht wahr, war nicht real und konnte mir nichts anhaben.
Meine Träume waren schon mein ganzes Leben lang realistisch gewesen, lebendig und voller Farbe. Einige waren finster, andere wunderschön. Einige träumte ich nur ein Mal oder wenige Male, andere verfolgten mich schon, solange ich zurückdenken konnte. Und wenn ich träumte, so war es nie wirklich, als würde ich träumen, sondern vielmehr hatte ich das Gefühl, von der einen Realität in die andere einzutauchen. Und egal, was ich tat – ich konnte nicht aufwachen, bevor ich sie bis zum bitteren Ende geträumt hatte. Niemals.
Meine Lippen waren rissig und schmeckten nach Salz. Ich hatte Durst. Alles hier war so intensiv – der Wind, die Kälte, das trockene Gefühl im Hals. Hunderte Male intensiver als das Leben, das ich im Wachzustand lebte. Alles, selbst die Stille. Vor allem die Stille. Das Meer schien stumm, selbst die Wellen, die sich schäumend über den Rand des Bootes ergossen, taten keinen Laut.
Es war wie immer; obwohl ich wusste, dass ich träumte, und bei klarem Verstand war, konnte ich nichts tun, um den Verlauf des Traums zu beeinflussen oder gar aufzuwachen.
Den Versuch, zu schreien, unternahm ich gar nicht erst, denn mein Schrei würde von der Stille in tausend Teile gerissen werden. Und so ergab ich mich meinem stillen Schicksal und wartete. Wartete, bis die See rauer wurde, der Wind stärker und der Himmel dunkler.
Allmählich nahm das Wrack, wie von einem unsichtbaren Motor betrieben, an Geschwindigkeit zu. Ich wusste, was das zu bedeuten hatte; wir näherten uns unwiderruflich dem Höhepunkt des Traumes, jenem riesenhaften Strudel, Mittelpunkt dieses schwarzen, stillen Meeres. Er sog alles auf, was ihm in die Nähe kam, und auch wir waren im Begriff, aufgesogen zu werden. Je näher wir dem Strudel kamen und je schneller das Wrack wurde, umso unruhiger wurde mein Gegenüber. Das Wesen, von dem ich nicht zu sagen vermochte, ob es ein Mann oder eine Frau, oder überhaupt der menschlichen Spezies angehörig war, begann am ganzen Leib zu zittern und griff mit seinen kalten Fingern nach mir.
»Sieh. Nicht. Hinein«, brachte es mühsam hervor, und es klang, als würde jedes Wort unendlich viel Kraft kosten.
Angewidert schüttelte ich seine leichenblassen, kalten Hände ab, mit denen es Halt an mir suchte.
»Sieh. Nicht. Hinein.« Seine dumpfe Stimme klang wenig menschlich und erinnerte an ein altes Radio, das eine verzerrte Melodie spielte. »Sieh. Nicht. Hinein.« Zwischen den Worten schnappte es ächzend nach Luft. Es wiederholte sie wie ein Mantra, immer und immer wieder.
Der Wind wurde mit jeder Sekunde heftiger, das Meer stürmischer und das Wrack war dem Strudel so nah, dass ich in dessen schwarzes, bodenlos scheinendes Auge blicken konnte. Ich wusste, dass es wahnsinnig war, und lebensmüde, und über alle Maßen unklug, und doch wollte ich sehen, musste ich sehen, was da unten war. Also beugte ich mich, wie jedes Mal, dem Strudel entgegen, blendete meinen Gegenüber aus, lehnte mich noch weiter aus dem Wrack, immer weiter … und fiel.
Schweißgebadet wachte ich auf. Noch immer konnte ich das Salz auf meinen Lippen schmecken. Mein Hals war so trocken, dass es wehtat. Ächzend rappelte ich mich auf, doch kaum saß ich im Bett, befielen mich auch noch rasende Kopfschmerzen. Außerdem sah das Bett weder wie mein Bett aus noch das Schlafzimmer wie mein Schlafzimmer. Verunsichert blickte ich mich um.
Ich seufzte. Es handelte sich hierbei eindeutig nicht um mein Bett. Das war auch nicht mein Schlafzimmer, nicht mein Zuhause und der spärlich bekleidete Kerl, der schnarchend neben mir lag, war definitiv nicht meiner. Mit einem unterdrückten Seufzer und beiden Händen an meinem schmerzenden Kopf schlich ich unbeholfen aus dem Raum.
Grelles Tageslicht durchflutete die ungewöhnlich chaotische Wohnung, die ich nie zuvor gesehen hatte. Zumindest nicht im so nüchternen Zustand, dass ich mich daran würde erinnern können. Eine bunte Mischung aus den verschiedensten Möbeln erstreckte sich vor mir, außerdem leere Pizzaschachteln auf dem Boden, ein verstaubtes, uralt aussehendes Regal voller Bücher und, oh, mein Kleid! Eilig nahm ich es hoch und schlüpfte hinein. Es roch nach Parfüm und Zigaretten.
Unter einem mit halbvollen Gläsern und Anatomiebüchern beladenem Tisch entdeckte ich meine Handtasche und meine Schuhe. Schwarze High Heels, die ich mir von meiner besten Freundin geliehen hatte, auf denen ich kaum schmerzfrei laufen konnte, die aber unglaublich gut zum Kleid passten. Ich erinnerte mich dumpf daran, sie am Abend zuvor an- und irgendwann ausgezogen zu haben. Wo und weshalb war mir allerdings ein Rätsel.
»Guten Morgen.« Plötzlich stand der wenig bekleidete Kerl von vorhin im Türrahmen, und ich stieß mir vor Schreck den Kopf an der Tischplatte an.
»Morgen«, murmelte ich.
»Normalerweise ist es hier aufgeräumt.« Er grinste verlegen.
»Klar.«
»Willst du ’n Kaffee?« Er fuhr sich mit beiden Händen durch die dunklen Locken. »Oder vielleicht lieber ’ne Aspirin?«
Ich musterte ihn argwöhnisch von Kopf bis Fuß. Eigentlich sah er recht gut aus mit seinen dunklen Augen und der sonnengebräunten Haut. Ein südländischer Typ, groß und schlank mit weißen Zähnen und hübschem Gesicht. Der Haken an der Sache war, dass ich mich tatsächlich beim besten Willen nicht daran erinnern konnte, ihm je zuvor begegnet zu sein.
»Du bist eingeschlafen.« Er zuckte mit den Schultern. »Kurz bevor irgendwas passieren konnte.«
»Gott sei Dank«, seufzte ich.
»Ähm … ja.« Er wirkte verunsichert. »Du hast im Schlaf nonstop gesprochen. Ziemlich wirres Zeug. Ich wollte dich wecken, aber hatte vergessen, wie du heißt und … ähm … ich bin Mike. Für den Fall, dass du meinen Namen auch vergessen hast.«
Ich betrachtete ihn fassungslos. Wieso redete er wie ein Wasserfall? Als wäre die Situation so nicht schon unangenehm genug.
»Eigentlich Michael«, fuhr er fort. »Aber meine Freunde nennen mich Mike. Du kannst mich also gern auch Mike nennen, wenn …« Er verstummte, als er meinen argwöhnischen Blick bemerkte, und räusperte sich. »Ist ja auch egal. Kaffee, namenloses Mädchen?«
»Keine Zeit, ich muss zur Arbeit«, wiegelte ich ab.
»Es ist Sonntag!«
»Ich bin Krankenschwester«, log ich.
»Coole Sache.« Mike grinste. »Ich studiere Medizin. Fünftes Semester.« Lässig deutete er auf die Anatomiebücher auf dem Tisch. »Ein tolles Gefühl, wenn man Menschen helfen kann, oder?«
Ich seufzte.
»Luke«, setzte ich an.
»Mike«, verbesserte er mit einem Gesichtsausdruck, der nun vollends sein Unwohlsein verriet.
»Mike. Logisch.« Mein Kopf hinderte mich daran, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. »Bitte – wo ist die Haustür?«
Schweigend nickte er in Richtung einer Tür, an der ein paar Postkarten und Fotos klebten. Ich stolperte ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei, wobei ich unbeholfen die High Heels überzog. Wie auf Kommando begannen meine Fersen zu schmerzen. Auch das noch.
Erst als ich draußen auf dem Gehweg stand und ein lauer Wind mir um die nackten Schultern wehte, wurde mir bewusst, wie unhöflich ich mich ihm gegenüber verhalten hatte. Und zu dem unwohlen Gefühl im Kopf und dem in den Füßen gesellte sich ein unwohles Gefühl im Bauch, das auch so schnell nicht mehr verschwinden sollte.
Ich entdeckte ein Taxi einige Meter entfernt und hatte das Glück, dass es frei war. Erschöpft sank ich auf die Rückbank und lehnte, nachdem ich dem Fahrer meine Adresse genannt hatte, meine Stirn an die Fensterscheibe. Die Kälte tat gut. Sie weckte mich förmlich auf. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Umso mehr erstaunte es mich, dass das Taxi bereits wenige Minuten später am Ziel anhielt und ich bloß knappe zwanzig Euro zahlen musste.
Für einen Dezembertag war es ungewöhnlich warm, dennoch zitterte ich in meinem dünnen Kleid vor Kälte. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Bei allem. Ich schüttelte den Kopf über mich selbst.
So schnell wie es in diesen unbequemen Schuhen nur möglich war, stieg ich die Treppen zu dem Haus empor, das ich seit zwei Jahren mein Zuhause nannte. Damals war es eigentlich nur als Übergangslösung angedacht gewesen, als die Mutter meiner besten Freundin Emma mir nach einer scheußlichen Trennung deren altes Zimmer vermietet hatte. Meine Eltern waren nach der Scheidung beide zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sodass ich bei keinem der beiden hätte wohnen wollen. In einer Nacht- und Nebelaktion war ich aus der gemeinsamen Wohnung meines Exfreundes und mir ausgezogen und war Emmas Mutter bis heute unendlich dankbar dafür, dass sie mich mit offenen Armen aufgenommen hatte.
Ich konnte es kaum erwarten, ins Bett zu fallen und die Kopfschmerzen und das Schamgefühl zu vergessen. Geradezu kopflos zog ich meine Schlüssel aus der Tasche, schloss die Tür auf und stolperte ins Badezimmer.
Mit beiden Händen schöpfte ich mir Wasser ins Gesicht. Die Erfrischung tat gut. Entspannt schloss ich die Augen und tat ein paar ruhige Atemzüge. Als ich aufschaute, fiel mein Blick auf mein Spiegelbild, das mir unsicher entgegensah.
Ich war blass wie eh und je, und mein hellbraunes Haar, das ich gestern Abend noch mit dem Lockenstab zu großen, weichen Wellen geformt hatte, fiel mir platt über die Schultern. Meine grünen Augen sahen ungewöhnlich trüb aus. Seit der Trennung hatte ich das Gefühl, als hätte sich ein grauer Schleier über sie gelegt, was merkwürdig war, denn wissenschaftlich gesehen konnten Augen ihre Farbe bloß im ersten Lebensjahr und keinesfalls noch im Erwachsenenalter ändern. Und es war nicht das erste Mal, dass dies mit mir geschah. Meine Eltern hatten mir erzählt, dass ich als Kind an manchen Tagen blaue und an anderen Tagen grüne Augen hatte, und dass sie, wenn ich krank war, einen lilafarbenen Schimmer trugen. Ich hatte das früher immer für aufregend gehalten, aber irgendwann hatten sie aufgehört, die Farbe zu wechseln und blieben konstant grün, jahrelang, bis schließlich meine Beziehung zerbrach. Ich schluckte.
Zwei Jahre war es her. Zwei Jahre. Und immer noch lag mir diese Trennung schwer im Magen. Ich hatte nie verkraftet, dass er mich für eine andere verlassen hatte, mit der er inzwischen sogar verheiratet war und ein Kind erwartete. Mir hatte er immer gesagt, dass er weder das eine noch das andere wollte. Ich blinzelte die aufsteigenden Tränen fort und versuchte den Kloß hinunterzuschlucken, der in meinem Hals aufstieg, wann immer ich an ihn dachte. Und ich dachte oft an ihn.
Ein abruptes Klopfen riss mich aus meinem Trübsal. Schnell trocknete ich mein Gesicht ab und öffnete die Tür. Ich hatte gedacht, ich wäre alleine zuhause, doch dem war nicht so.
»Nilah!« Emma fiel mir um den Hals und drückte mich, als hätte sie mich seit Jahren nicht gesehen. Wie immer eigentlich. Emma war der herzlichste, quirligste und liebevollste Mensch, den ich kannte, was meistens toll, aber manchmal auch anstrengend war.
»Was machst du hier?«, fragte ich, als sie mich nach einer gefühlten Ewigkeit losließ.
»Ich wohne hier«, antwortete sie.
»Du wohntest hier«, korrigierte ich. »Jetzt wohne ich hier.«
Wir lachten. Emmas Mutter pflegte oft scherzhaft zu sagen, dass Emma nun öfter zuhause war als damals, als sie selbst noch hier wohnte.
»Erzähl schon – wie war es?«, Emma sah mich mit erwartungsvollen Augen an.
»Was meinst du?«
»Mike?«, half sie mir auf die Sprünge.
Ach, sie wusste, wie er hieß. Ich schüttelte den Kopf.
»Da war nichts, ich bin eingeschlafen«, entgegnete ich ausweichend.
Emma prustete los.
»Dein Ernst?« Sie versuchte, aufzuhören, fing aber direkt wieder an zu kichern. »Du bist echt eingeschlafen? Oh man, Nilah.« Lachend schüttelte sie den Kopf. »Na ja, vielleicht kannst du es später wieder gut machen.«
»Was meinst du?« Alarmiert runzelte ich die Stirn.
»Na, die Silvesterparty. Da kommt er sicher auch. Alle kommen!«
»Oh, es gibt eine Silvesterparty?«, seufzte ich wenig begeistert.
»Nilah! Es ist der einunddreißigste Dezember.« Emma schnalzte mit der Zunge und sah mich an, als wäre ich ein hoffnungsloser Fall. »Natürlich gibt es eine Silvesterparty.«
»Von mir aus. Aber ich werde nicht hingehen. Du überredest mich nicht nochmal.« Ich schob sie beiseite, ging in mein Zimmer und ließ mich auf mein Bett fallen. Endlich. Auf dieses Gefühl freute ich mich schon, seit ich wach war. Zufrieden schloss ich die Augen.
»Nilah?« Emma hatte sich auf meine Bettkante gesetzt. In ihrer Stimme lag ein süßlicher, flehender Tonfall.
»Hör mir gut zu, Emma.« Ich setzte mich auf, senkte meine Stimme und betonte jedes einzelne Wort, als wäre es von größter Bedeutung für den Satz. »Ich. Werde. Da. Nicht. Hingehen.«
Wenige Stunden später fand ich mich auf eben jener Silvesterparty wieder, auf die ich nicht hatte gehen wollen. Natürlich. Emma besaß ein unglaublich großes, geradezu kriminelles Potenzial, Leute zu Dingen zu überreden, die sie eigentlich nicht tun wollten. Ich seufzte. Es gab so viele Orte, an denen ich lieber gewesen wäre. Mein Bett zum Beispiel. Mit einem Glas selbstgemachter Früchtebowle in der Hand und einer derart schlechten Laune, dass sie eigentlich eine mit dem bloßen Auge zu erkennende schwarze Aura um mich bilden müsste, blickte ich mich um.
Da stand ich also und verbrachte mein Jahresende auf irgendeiner Studentenparty im Haus der Eltern eines Kerls, den Emma kannte, woher auch immer. Emma kannte prinzipiell jeden.
Nachdenklich betrachtete ich meine Freundin. Sie wirkte so frei, so glücklich und selbstbewusst. So losgelöst von allem. Mit großem Unbehagen spürte ich Neid in mir aufkeimen. Wieso konnte ich nicht sein wie sie? Wieso fiel es ihr so leicht und mir so unfassbar schwer, loszulassen? Es gab hier weit und breit niemanden, den ich kannte, und dennoch verurteilte ich mich selbst dazu, stumm in der Ecke zu stehen und mürrisch dreinzuschauen. Seit der Trennung fühlte ich mich ständig klein und unbedeutend. Es fühlte sich an, als wären mein Herz und mein Selbstbewusstsein bei meinem Auszug in der alten Wohnung geblieben. Und das, was blieb, war ein Schatten meiner selbst.
Meine Hände umklammerten das Glas, als könnte es mir auf irgendeine Art und Weise Halt geben. Unsicher nippte ich an meiner Bowle. Sie schmeckte furchtbar.
»Amüsierst du dich?«, rief Emma mir zu. Sie tanzte mit einem schlaksigen Kerl, der sie völlig verzückt ansah.
»Aber klar doch«, murmelte ich bitter vor mich hin. »In der Luft liegt der Geruch von guten Vorsätzen, leeren Hoffnungen und Träumen, die sich nie erfüllen werden. Oh, und Kotze, nach Kotze riecht es irgendwie auch. Wer würde sich da nicht amüsieren?« Mit einem gequälten Lächeln nickte ich ihr zu, was ihr offensichtlich genügte.
Lachend wandte sie sich wieder ihrem Fan zu. Irgendwie machte mich ihre Reaktion wütend. Sah sie nicht, wie unwohl ich mich in meiner Haut fühlte? Dabei war es allein ihre Schuld, dass ich hier war.
»Ich muss nur mal kurz raus«, rief ich ihr zu.
»Was?« Emma legte sich eine Hand ans Ohr.
»Nur frische Luft schnappen.« Ich zeigte auf das Fenster.
Ich wollte wirklich nur frische Luft schnappen, als ich mir meinen Mantel anzog und leise die Haustür hinter mir schloss. Aber kaum hatte ich das Haus verlassen, als meine Beine wie automatisch zu laufen begannen. Ich wusste nicht einmal, wohin ich lief, aber ich lief und lief, lief über Straßen und um Ecken, bis ich irgendwann völlig außer Atem und zitternd vor Kälte an einer Hauswand im Licht einer Straßenlaterne zum Stehen kam.
Plötzlich machte sich die Wirkung der Früchtebowle bemerkbar. Mir wurde schummrig und in meiner Magengegend rumorte es gewaltig. Ich unterdrückte den langsam in mir aufsteigenden Würgereiz, dann bemerkte ich, dass mir Tränen über das Gesicht liefen. Fahrig wischte ich sie mit dem Ärmel meines Mantels fort, als ich im Augenwinkel plötzlich eine Bewegung registrierte.
Erschrocken wirbelte ich herum und fand mich Auge in Auge mit einem Mann wieder, der mir offenbar lautlos gefolgt war. Er stand nur wenige Zentimeter von mir entfernt, viel zu nah für meinen Geschmack. Doch als ich zurückwich, prallte ich gegen einen zweiten Fremden, der nur einen knappen Meter hinter mir gestanden hatte. Mein ohnehin schon schnell schlagendes Herz begann zu rasen. Ich hatte keine Ahnung, wie die beiden es geschafft hatten, schier aus dem Nichts aufzutauchen.
»Du musst mit uns kommen«, sagte der eine von ihnen, ein hochgewachsener, blasser Kerl mit ungewöhnlich langem Hals und wasserstoffblondem Haar.
»Was?«, brachte ich mit brüchiger Stimme hervor. »Wieso?!«
»Anordnung von ganz oben«, antwortete der andere Mann wichtigtuerisch. Er war ebenso groß und dünn wie der erste und trug sein schwarzes Haar zu einem strengen Zopf zurückgebunden. Sie sahen beide auf irgendeine Art und Weise, die ich mir selbst nicht erklären konnte, komisch aus. Außerdem fiel mir auf, dass sie beide den gleichen merkwürdigen, weißen Anzug trugen, der entfernt an Sportkleidung erinnerte. Ob das eine Art Uniform war?
»Bin ich … verhaftet?« Plötzlich war ich vollkommen nüchtern.
Die beiden lachten.
»Wir sind keine Polizisten«, erklärte der Wasserstoffblonde.
»Bist du das hier?« Der Dunkelhaarige hielt plötzlich wie aus dem Nichts ein paar Bilder in der Hand und hielt sie mir vor die Nase. Was ich im Schein der Straßenlaterne sah, ließ mich nach Luft schnappen. Fotos von mir. Ich an der Bushaltestelle, ich mit Emma im Restaurant, ich, wie ich verschlafen aus dem Fenster blickte. Ich spürte, wie mir sämtliche Farbe aus dem Gesicht wich.
»Woher habt ihr die?«, brachte ich heiser hervor. Angstgelähmt blickte ich mich um. Doch weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Niemand, der mir hätte helfen können.
»Ob du das bist, habe ich gefragt!« Der Dunkelhaarige wedelte mit den Fotos vor meinem Gesicht.
»Ich … das … ja«, stammelte ich. »Ja, das bin alles ich. Sagt mir jetzt mal jemand, was hier vor sich geht?«
Der Wasserstoffblonde nickte dem Dunkelhaarigen fast unmerklich zu, dann hakte sich einer von ihnen links, der andere rechts bei mir unter. Ich hatte keine Chance, zu reagieren. Ihre Bewegungen waren unglaublich schnell und fließend, fast schon unmenschlich.
Und bevor ich auch nur ansatzweise realisierte, wie mir geschah, bog ein gelber Kleinbus um die Ecke und hielt direkt neben uns auf dem Bordstein. Ein kurzer Aufschrei meinerseits, viel zu leise und heiser, als das ihn jemand hätte hören können, und schon hatten sie mich hochgehoben und hineingetragen. Mein Herz raste so schnell, dass es wehtat. Der Fahrer, ein glatzköpfiger, hochgewachsener Mann, trug den gleichen Anzug wie die anderen beiden.
»Das war die Letzte«, sagte er und musterte mich kurz, bevor er losfuhr.
Auf den Sitzen des Kleinbusses saßen mehrere andere junge Menschen, die genauso verängstigt dreinblickten, wie ich mich fühlte.
»Hinsetzen.« Der Wasserstoffblonde schubste mich neben ein dunkelhäutiges Mädchen, das nervös an den Fingernägeln knabberte.
»Melvin«, tadelte der Fahrer. »Merlias hat gesagt, wir sollen nett zu ihnen sein!«
»Ich bin nett!« Der Blonde, der also Melvin hieß, blieb im Gang stehen und ließ uns nicht aus den Augen, während der Dunkelhaarige mit dem Zopf sich auf einem der freien Sitze niederließ und die Hände hinter dem Kopf verschränkte.
Vorsichtig blickte ich mich um. Ich konnte kaum fassen, dass mir das gerade wirklich passierte. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem verrückten Actionfilm gelandet.
»Hey, du.« Ich berührte das Nägel kauende Mädchen behutsam am Arm, woraufhin sie erschrocken zusammenfuhr. »Weißt du, was die mit uns vorhaben?«
»Ich habe absolut keine Ahnung«, flüsterte sie zurück. Mit ihren weit aufgerissenen Augen sah sie mich an, als würde sie hoffen, dass ich sie retten konnte.
Ängstlich blickte ich mich um und zählte die anderen. Wir waren neun. Männer und Frauen. Wir hatten keine offensichtliche Gemeinsamkeit, außer vielleicht das Alter. Wie ich schienen sie alle etwa Anfang zwanzig zu sein.
»Ich bin Sadie«, wisperte das Mädchen mir zu.
»Nilah.« Ich versuchte, ihr aufmunternd zuzulächeln, aber mein Gesicht tat nicht, was es sollte. Wie könnte ich jemandem Mut machen, wenn ich selbst vor Angst wie gelähmt war? Es war unmöglich.
»Tom«, sagte der Busfahrer und hob seine rechte Hand. Dann deutete er auf den Dunkelhaarigen und den Wasserstoffblonden. »Das sind Alois und Melvin. Ihr kennt uns nicht, aber wir kennen euch. Euch wird nichts geschehen.«
»Und das sollen wir glauben?« Ein junger Kerl aus der hintersten Reihe lachte unfroh. »Wieso habt ihr uns dann unsere Handys geklaut?«
Ich tastete meine Manteltasche ab. Meins war auch weg. Sadie ging es genauso.
»Eine reine Sicherheitsmaßnahme.« Der Fahrer schien völlig gelassen.
Ich hätte nicht sagen können, wie lange die Fahrt dauerte, denn ich hatte sämtliches Zeitgefühl verloren und ein Stück weit resigniert. Womöglich war es bereits nach Mitternacht und Emma suchte überall nach mir, andererseits war mir unterwegs kein Feuerwerk aufgefallen.
Irgendwann bog der Bus in einen Waldweg ein. Wir wurden alle ein wenig unruhig, aber keiner stand von seinem Sitz auf. Sadie griff nach meiner Hand. Ich drückte ihre leicht. Viele Minuten vergingen, in denen der Bus kreuz und quer durch den Wald fuhr. Als wir endlich zum Stehen kamen, konnten wir alle im Licht der Scheinwerfer ein riesenhaftes Gebäude erkennen. Ein Gebäude, schwarz, groß und rustikal, mit unzähligen Fenstern.
Ich konnte kaum fassen, was ich da mit eigenen Augen sah. Etwas an diesem Gebäude ließ eine Empfindung in mir schwingen. Ich kannte dieses Gebäude. Irgendwo hatte ich es schonmal gesehen. Doch die Erinnerung war so schwach, so verwaschen, dass ich sie nicht weiter greifen konnte. Sie hinterließ bloß eine unterschwellige Ruhe in mir.
Tom, der Fahrer, blickte geradezu feierlich zu uns nach hinten.
»Herzlich willkommen beim Schwarzen Flügel«, sagte er, und wir alle spürten, dass hier, gerade in diesem Moment, etwas unfassbar Großes geschah.
Kapitel 2Der Schwarze Flügel
In jener Nacht, die mein ganzes Leben verändern sollte, regnete es. Feiner, winterlicher Nieselregen, der an die Fenster prasselte wie kleine Hände, die nach Einlass verlangten. Keiner von uns sprach ein Wort. Tom, der Fahrer, Melvin, der Wasserstoffblonde, und der tiefenentspannte Alois betraten als erste das Gebäude, das aussah wie ein verwittertes altes Märchenschloss. Offensichtlich machten sie sich keine Sorgen, dass wir fortlaufen könnten. Sadie und ich tauschten einen Blick miteinander. Sie wirkte immer noch unsicher, aber nicht mehr derart verängstigt, wie sie es vorhin im Bus gewesen war. Vielmehr lag ein Ausdruck der Ehrfurcht in ihren dunklen Augen. Irgendwie schienen wir schon zu diesem Zeitpunkt zu spüren, dass das, was uns hier widerfuhr, gut und richtig war. Eine Ruhe hatte sich über uns gelegt, eine Ruhe, die tief aus dem Inneren heraus mit sanfter Stimme flüsterte, dass alles gut werden würde. Dass alles in Ordnung war. Dass wir bleiben konnten, denn an diesem Ort würden wir sicher sein. Es war fast so, als wären wir alle schon einmal dort gewesen. Wie ein Zurückkehren in ein Zuhause, das viele Jahre lang verstaubt tief in der Erinnerung geschlummert hatte. Und kaum betrat man es, sah es, roch es, da fühlte man sich wieder daheim. Ruhig. Angekommen. Stumm nickten wir einander zu, und es war wie ein stillschweigendes Einverständnis zwischen uns, als wir zugleich die marmornen Stufen emporstiegen.
Meine beste Freundin Emma, die letzte Nacht und die Silvesterparty schienen Lichtjahre entfernt. Nach und nach folgten uns auch die anderen, zwar zögerlich und bedachtsam, aber dennoch stetig. Nicht einer blieb zurück. Wir waren wie Motten, die ins Licht flogen, förmlich hypnotisiert von dem Ungewissen, das uns bevorstand. Schritt für Schritt stiegen wir die Treppe empor, bis wir in eine riesige Eingangshalle gelangten. Erst als sich nach dem letzten von uns die Tür wie von Geisterhand wieder schloss, fiel der tranceartige Zustand von uns ab.
Verunsichert blickten wir einander an. Keiner von uns schien auch nur ansatzweise zu erahnen, was gerade mit uns geschah. Wir fanden uns in einem großen, hell erleuchteten Saal wieder, viel größer als ein ganz gewöhnlicher Raum in einem ganz gewöhnlichen Haus. An der Decke prangte ein Kronleuchter. Kerzen brannten auf den altmodischen Kommoden an den Wänden, und der weiße Marmorboden war vor unserer Ankunft sichtlich auf Hochglanz poliert worden. Eine schwarze Wendeltreppe, die ihren Ursprung mittig im Raum hatte, führte hinauf in eine geradezu schwindelerregende Höhe.
Ich blickte mich um. Wo bloß waren die Männer, die uns hergebracht hatten? Ich hätte schwören können, dass sie nur wenige Meter von mir entfernt gewesen waren, dennoch waren die anderen acht Unwissenden und ich nun die einzigen im Raum. Meine Kopfschmerzen vom vergangenen Morgen kehrten zurück. Ich fühlte mich wie in einem Traum gefangen, der noch viel verrückter und surrealer war als alles, was ich je geträumt hatte. Aber irgendetwas sagte mir, dass ich nicht aufwachen würde. Dieses Mal nicht.
Ein unerwartetes »Herzlich willkommen« ließ uns alle erschrocken zusammenzucken. Ein kleiner, ältlicher Mann war wie aus dem Nichts vor uns aufgetaucht. Sein Haar war ganz grau und zu einem unordentlichen Dutt gebunden. Seine stahlblauen Augen hatten uns gespannt ins Visier genommen.
»Herzlich willkommen«, wiederholte er mit einer weit ausholenden Geste, die den ganzen Saal umfasste, »im Schwarzen Flügel! Nun«, er lächelte uns gutmütig zu, einem nach dem anderem, »lasst mich euch kurz erklären, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr braucht keine Angst zu haben, Nilah, Damien, Sadie, Dina, Makaio, Joaquin, Morten, Piet und Liron, tretet beruhigt näher!«
Unruhige Blicke wurden ausgetauscht. Es war beängstigend, dass er uns alle zu kennen schien, während wir nicht einmal seinen Namen wussten. Obwohl niemand seiner Aufforderung, näher zu treten, Folge leistetet, lächelte er weiterhin und fuhr fort:
»Wir sind eine kleine Einheit, die sich zusammengetan hat, um nach bestem Wissen und Gewissen unsere Nachfolger zu unterrichten. Wenn ihr so wollt, führen wir also eine Ausbildungsstätte. Wir lehren das, was wir am besten können. Mein Name ist Merlias«, er faltete seine Hände vor der Brust, »und ich bin der Leiter des Schwarzen Flügels, benannt nach einem großen, Flügel tragenden Mann, gutem Freund und Mitbegründer der Akademie.« Er schwieg für einen kurzen Moment. »Nun, man habe ihn selig.«
Ein Flügel tragender Mann? Das wurde ja immer skurriler …
»Ihr fragt euch sicher, was das mit euch zu tun hat und weshalb ihr hier seid.« Merlias nickte, als würde er sich die Frage selbst beantworten. »Nun – jedes Jahr wählen wir nach einträchtiger Beobachtung und Abstimmung neun junge, vielversprechende Individuen aus und laden sie dazu ein, sich uns anzuschließen.«
»Laden sie dazu ein!« Der junge Mann, der uns vorhin im Bus darauf aufmerksam gemacht hatte, dass unsere Handys fehlten, lachte zynisch. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt. »Das nennen Sie also eine Einladung? Ich nenne das eine Entführung!«
»Nun, Damien, es steht dir frei zu gehen«, sagte Merlias freundlich.
Aufmunternd lächelte er ihm zu, doch Damien rührte sich nicht von der Stelle. Niemand von uns tat das. Zu sehr hatte dieser geheimnisvolle Ort uns schon in seinen Bann gezogen.
»Nun …« Merlias räusperte sich und strich sich mit der Hand über den silbrig grauen Bart. »Ab sofort ist der Schwarze Flügel euer Zuhause. Ihr werdet hier leben, schlafen, speisen … vor allem aber werdet ihr euren Körper und euren Geist trainieren. Ihr werdet beides auf eine gänzlich neue Ebene bringen. Ihr werdet Ehrfurcht erlernen. Ihr werdet Demut, Disziplin und Selbstachtung erlernen. Bald schon werdet ihr die stärkste und bestmöglichste Ausgabe eurer Selbst sein.« Er sah uns alle der Reihe nach an, mit einem warmen, väterlichen Blick in den Augen. »Nun – habt ihr Fragen?«
»Was für eine Ausbildung soll das sein?« Damien klang immer noch ein wenig angriffslustig und betonte das Wort »Ausbildung«, als wäre es etwas Schmutziges, das er kaum auszusprechen wagte.
Das Lächeln verschwand auch jetzt noch nicht aus Merlias’ Gesicht. Voller Duldsamkeit hörte er Damien zu und sagte dann: »Das fragst du am besten unsere Mentoren selbst.«
Als hätten sie nur auf ihr Stichwort gewartet, schritten in jenem Augenblick drei Männer und eine Frau feierlich die schwarze marmorne Wendeltreppe hinab. Ich hielt den Atem an. Sie sahen unglaublich sportlich und unglaublich wichtig aus.
Alle trugen sie jene merkwürdigen Anzüge, die mir schon bei Alois, Melvin und dem Fahrer Tom aufgefallen waren. Allerdings hatte jeder Anzug seine eigene Farbe. Ihre Mienen waren ernst. Etwas zu ernst für meinen Geschmack. Sie wirkten Respekt einflößend und streng. Auch Sadie sah eingeschüchtert aus.