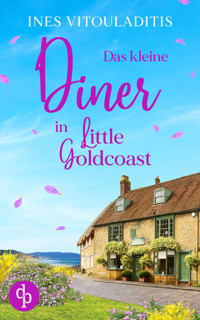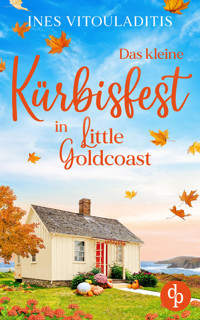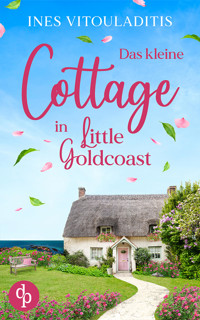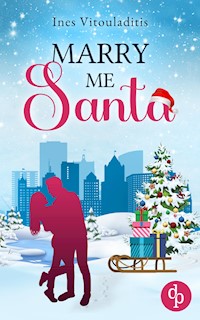8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wortschatten Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Obwohl ich mit dem Rücken zum Fenster saß, konnte ich die Dunkelheit spüren, die sich langsam über den Wald legte. Es war eine Finsternis ohnegleichen. Eine rabenschwarze, stumme, seelenlose Finsternis. Schwärzer als schwarz. Dunkelschwarz. Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Nilahs Leben auseinandergerissen und wieder zusammengesetzt wurde. Das prophezeite Unheil kann sie einfach nicht vergessen. Jeder Versuch, die Visionen zu entschlüsseln, lässt sie mehr und mehr an ihrem eigenen Verstand zweifeln. Bevor Nilah nach dem rettenden Licht greifen kann, hat sich die Dunkelheit bereits in die Akademie geschlichen. Allein wird Nilah diese Bedrohung nicht besiegen können. Doch niemand sonst scheint die Gefahr zu sehen. Das fulminante Finale der Nilah-Taro-Trilogie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
IMPRESSUM
1. Auflage 2023
© Wortschatten Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Wortschatten Verlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
0049 (0)241 87343400
www.wortschatten.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druckerei und Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Lektorat:
Julia Huntscha
Umschlaggestaltung:
Dietrich Betcher
Druckbuch:
ISBN-10: 3-96964-036-9
ISBN-13: 978-3-96964-036-4
E-Book:
ISBN-10: 3-96964-037-7
ISBN-13: 978-3-96964-037-1
Ines Vitouladitis
Nilah
Taro
und die Boten
des Unheils
Prolog
Elvira
Der Geruch von Moos und aufgewühlter Erde lag in der Luft. Der Waldboden war taugetränkt, und das Licht der aufgehenden Sonne brach sich in tausenden und abertausenden feinen Tropfen, die alles ringsum benetzten.
Elviras Flügel trugen sie lautlos durch den anbrechenden Morgen, während ihre scharfen Augen jede Bewegung im Umkreis unzähliger Meilen wahrnahmen. So lange schon hatte sie auf diesen Moment gewartet, und nun, endlich, schien er zum Greifen nah.
Elvira überquerte den Schattenwald, schwebte über die sieben Inseln und erreichte schließlich nach Stunden, derer sie müde geworden war, zu zählen, nahe den Klippen von Tenebris, jene steinerne Höhle, die ihr endlich das offenbaren würde, wonach ihr erkaltetes Herz sich einzig sehnte.
Mit einem katzenähnlichen Sprung landete sie lautlos neben der Höhle, richtete sich auf und strich mit beiden Händen ihr schwarzes Gewand glatt. Auch ihre Haare, beinahe knielang und von betörendem Glanz, waren schwarz, ebenso wie ihre Flügel, ihre Augen und – wie einige scharfe Zungen zu sagen beliebten – ihre Seele.
Erwartungsvoll ließ sie ihre Zunge über die von Durst rauen Lippen gleiten. Jede Faser ihres Körpers war zum Zerbersten gespannt, als sie endlich mit einer einzigen, lautlosen Bewegung geduckt in das Innere der Höhle glitt, um Runa Gideon das zu stehlen, womit sie selbst nicht gesegnet worden war.
Runa Gideon … beim Gedanken an sie und daran, dass diese Aussätzige den größten Schatz besaß, den Elvira sich je zu wünschen gewagt hatte, musste sie einen wütenden Aufschrei unterdrücken. Sie ballte die Hände zu Fäusten, so fest, dass sich ihre spitzen Fingernägel in die weiche Haut des Handballens bohrten, und einen Schmerz in ihr aufkeimen ließen, der jedoch nicht annähernd jenen Schmerz erreichte, den ihr Innerstes verspürte.
Runa hatte einst wahre Größe besessen. Besonders war sie gewesen, mächtig, klug und wunderschön. Eine der Stärksten unter den Starken. Doch seither waren viele Jahre ins Land gegangen. Runa hatte dem Rudel Untreue angetan und war verbannt worden, lange bevor sie sich auf diese jämmerliche, fünfsinnige Kreatur eingelassen und einen Mischling geboren hatte. Einen Bastard. Aber, und das war es, was Elvira an jenem Morgen durch Nebel und Kälte, über Wälder und Seen, hin zu diesem kargen Ort getrieben hatte, einen Sohn. Sie hatte einen Sohn geboren.
Runa, bleich, noch sichtlich entkräftet von der Geburt und durchweg recht hager, aber dennoch schön wie eh und je, richtete sich auf, als der Schatten Elviras sich jäh über sie legte. Ihr braunes Haar fiel ihr in samtigen Wellen über ihre Schulter und über das kleine Bündel in ihrem Arm, das sie nun instinktiv fester an sich drückte. Ihr müdes, von Sommersprossen übersätes Gesicht und ihre klaren, grünen Augen waren gezeichnet von Misstrauen, als Elvira ohne ein Wort des Grußes nähertrat, sich über sie beugte und mit langen Fingern Runas Haare beiseiteschob, um das Bündel ansehen zu können.
»Was willst du nach all den Jahren?«, fragte Runa mit fester Stimme und wandte sich leicht von Elvira ab, um sich zwischen sie und das Kind zu schieben.
»Oh, Runa! Dumme, kleine, ängstliche Runa.« Elvira lachte glockenhell auf und tätschelte ihr mit einer herablassenden Geste den Kopf. Ihre Stimme war süßlich und zischend, und hin und wieder betonte sie ein Wort auf so merkwürdige Art und Weise, als trüge es eine ganz besondere Bedeutung für die gesamte Aussage. »Sei nicht immer so argwöhnisch, du dummes Mädchen. Ich komme bloß, um dir beizustehen in dieser schweren Zeit. So etwas tun Freunde!«
»Wir sind keine Freunde, Elvira.«
Runa erhob sich und begann, mit dem inzwischen leise wimmernden Neugeborenen durch die Höhle zu wandern, auf und ab, und ab und auf, während sie ihm, in einem behutsam sanften Rhythmus, fortwährend den Rücken tätschelte. Dabei gab sie sich sichtlich Mühe, nicht allzu nahe an Elvira heranzutreten, die sich inzwischen mit vor der Brust verschränkten Armen und einem aufgesetzten Lächeln im Gesicht in der Höhle umsah.
»Geräumig ist es hier nun nicht gerade«, schnurrte Elvira. »Er wird sich nie richtig entfalten können. Nie lernen. Nie stark werden. Armer Junge.«
Runa, die den Worten Elviras nicht zu lauschen schien, sondern eher abwesend wirkte, kam am Eingang der Höhle zum Stehen, blickte in die Ferne, und für den Bruchteil eines Augenblicks schien es, als wolle sie die Flügel ausbreiten und fliehen. Doch dann seufzte sie und ließ sich im Schneidersitz nieder, um ihr Kind an die Brust zu legen. War es Resignation, die sie dazu bewegt hatte? Wusste sie, dass sie es in ihrem Zustand niemals schaffen würde, Elvira zu entkommen? Elvira war es gleich; das einzig Wichtige war, dass das Kind, der Junge, ihr Junge, endlich zum Greifen nahe war.
Als sie sich hinzuschlich und sich mit gebleckten Zähnen und begierigen Blicken nur wenige Zentimeter neben die stillende Mutter kauerte, spannte Runa ihren Kiefernknochen sichtlich an.
»Wie hast du mich gefunden?«, fragte sie tonlos.
»Oh, das war leicht. Viele der Neuen haben nützliche Gaben.« Elvira zog erneut am Tuch, in das das Neugeborene eingewickelt war, und entblößte dessen mit rotem Flaum besetzten Kopf. »Ein Rothaariger. Wie ungewöhnlich. Wie ist sein Name?«
»Er soll Flynn heißen.« Zärtlich strich Runa über den kleinen Kopf, bevor sie ihn wieder mit dem Tuch bedeckte.
Elvira rümpfte die Nase.
»Flynn? Was ist das denn für ein Name?«
»Es ist sein Name.« Runa lächelte milde, ohne den Blick von ihrem trinkenden Sohn abzuwenden oder sich gar von der harschen Kritik der ungebetenen Besucherin verunsichern zu lassen.
Elvira schnalzte mit der Zunge.
»Du könntest zurückkehren«, sagte sie sanft. »Er könnte eine glänzende Zukunft haben im Rudel. Niemand müsste erfahren, dass er ein Bastard ist. Ihm werden Flügel wachsen, das weißt du! Unser Blut ist um so vieles stärker als das der gewöhnlichen Menschen.« Das letzte Wort spuckte sie voll Abscheu aus. »Du kannst ihm das, was er braucht, nicht alleine bieten. Nicht hier. Nicht in deinem jämmerlichen, untrainierten Zustand. Sieh ihn dir doch an, Runa! Eingewickelt in ein dreckiges, stinkendes Stück Stoff, frierend, hungrig, ohne eine Familie, ohne ein Rudel, das ihn beschützen könnte, wie er beschützt werden sollte! Und sieh dir dich an; ein bloßer Schatten jener Person, die du einst warst. Ausgezehrt und kränklich und isoliert vom Rest der Welt! Niemand sollte so leben.«
Runa schwieg eine ganze Weile, dann nahm sie ihren inzwischen schlafenden Sohn von der Brust, wickelte ihn fester in das Tuch und wog ihn sachte im Arm, bevor sie Elvira in die Augen blickte. Pure Entschlossenheit lag in ihrem Blick. Obwohl sie zarter, wesentlich schmaler und auch einen guten Kopf kleiner war als Elvira, wirkte sie stärker.
»Wir haben einander, und das genügt. Ich werde niemals zum Rudel zurückkehren«, sagte sie fest.
Elvira fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, lächelte und entblößte dabei zwei Reihen perfekter, perlweißer Zähne. Runas Entgegnung schien sie nicht im Mindesten getroffen zu haben, oder aber sie ließ es sich nicht anmerken.
»Und was ist mit ihm?«, säuselte sie. »Willst du ihm diese Chance verwehren? Tu ihm das nicht an. Bleib hier und lebe dein von dir selbst gewähltes, sinnfreies, kaltes und einsames Leben. Ein Leben, das unserer Art nicht würdig ist. Vergammle in dieser schmutzigen Höhle, während deine ganze Kraft und deine ganzen Gaben qualvoll schreiend dahinscheiden. Aber richte nicht über sein Schicksal! Wähle nicht für ihn … Gib ihn mir!«
Elviras Lippen bebten, und nun fiel es ihr offenkundig schwerer, die Contenance zu bewahren. Sie hatte sich immer einen Sohn gewünscht, schon von Kindesbeinen an. Einen stattlichen, mutigen Sohn, einen Krieger, einen Jäger, einen mutigen und dominanten Rudelführer.
Doch sie war älter geworden und immer älter, bis es fast schon nicht mehr möglich schien, dass die Dunkelheit sie zur Mutter machen würde. Und schließlich, in der dunkelsten Nacht zur dunkelsten Stunde hatte sie fast ihr Leben gelassen, um ihr erstes und letztes Kind zu gebären, eine Tochter mit dunklem Haar, Ria. Ein stetig schreiendes, unersättliches und winziges Kind, das schlecht wuchs und schlecht schlief und dem kein Platz in Elviras kaltem Herz zustand.
»Gib ihn mir«, wiederholte sie mit einem Zischen und gab sich nunmehr keine Mühe, die Begierde und Erregung, die ihre Stimme zittern ließen, zu unterdrücken. Ein keckerndes, vorfreudiges Lachen kroch ihre Kehle empor, als sie die Hände nach dem schlafenden Bündel ausstreckte.
»Niemals.« Runa festigte den Griff um ihren Sohn und funkelte Elvira an.
»Er hat einen Platz in diesem Rudel, und daran hast du nichts zu rütteln! Er ist nicht dein verdammter Besitz!«, begehrte Elvira nun unwirscher denn je zuvor auf, und feine Spuckefäden flogen aus ihrem Mund.
»Er hat einen Platz an meiner Seite«, fuhr Runa Elvira mit unterdrückter Wut in der Stimme an. »Einen Platz hier, einen Platz in dieser Welt! Das Rudel hat keinen Anspruch auf Flynn. Er ist mein Kind!«
Und in ihren Augen blitzte ein Funke von Kampfeslust auf, nur ganz kurz, als wolle sie sich jeden Moment auf ihre ehemalige Gefährtin stürzen. Doch stattdessen atmete sie tief ein und wieder aus und strich ihrem Sohn mit gekrümmtem Zeigefinger über die Wange. Elvira verfolgte die zärtliche Geste mit einem sehnsüchtigen Wahnsinn im Blick.
»Wenn Veit tot ist«, setzte sie an, und der Gedanke schien sie tief im Innersten zu erheitern, »bist du, so will es unser Gesetz, als seine Schwester die nächste Alpha. Und da du nicht mehr zum Rudel gehören willst … und obwohl er«, sie deutete mit einem langen, spitzen Finger auf den Säugling, »nur zur Hälfte ist wie wir, macht ihn dies zu deinem Nachfolger. Er ist zum Alpha geboren, Runa. Und es wird durchkommen. Es wird aus ihm herausbrechen. Eines Tages. Irgendwann. Ganz gleich, was auch immer du tust.«
Runa schwieg einen Moment, und es war unklar, ob sie über das Gesagte nachdachte oder ihm schlichtweg keine Bedeutung beipflichten wollte.
»Also gib ihn mir«, hauchte Elvira beschwörend und sah Runa in die Augen, als wolle sie sie hypnotisieren. »Und ich mache ihn zu dem Alpha, der er sein muss.«
Tausende Male war sie das Szenario in ihrem Kopf durchgegangen: Ihr Sohn, nach Veits Tod an der Spitze des Rudels. Dass Ria als Veits Tochter der Platz rechtmäßig zustand, schob sie in ihrem Kopf unwirsch beiseite. Sie würde persönlich dafür sorgen, dass Ria sich unterordnete. Dass sie freiwillig verzichtete. Dass der Junge die Rolle des Alpha einnahm und sie als seine Mutter, stolz und aufrecht, an seiner Seite stehen würde.
»Nein«, sagte Runa schlicht.
»Und wenn ich ihn mir einfach nehme?«, säuselte Elvira.
»Wage es nicht einmal, daran zu denken.« Runas Stimme war leise, doch bedrohlicher denn je. »Selbst entkräftet von der Geburt und mit nur einem Arm, weil ich meinen Sohn im anderen halte, bin ich noch stärker als du.«
Elvira öffnete ihre vollen Lippen, als wolle sie etwas entgegnen, hielt jedoch inne und presste sie dann zu einem schmalen Schlitz zusammen.
»Und vergiss nicht«, fügte Runa in fast schon beschwörender Stimmlage hinzu, »dass Merlias, mitsamt der Kraft des ganzen Schwarzen Flügels, hinter mir steht. Glaube mir, du willst nicht, dass er deinetwegen das Rudel findet. Dass er tut, was er schon vor Jahrzehnten hätte tun sollen, doch aus Güte nicht zu Ende gebracht hat. Wissen sie, dass du hier bist? Weiß Veit es? Willst du als Verräterin zum Alpha zurückkehren, Elvira? Wir wissen beide nur zu gut, was mit verräterischen Rudelmitgliedern geschieht. Du wirst für deine Fehler bluten, Elvira.«
Elvira lächelte weiterhin, doch ihre Gesichtszüge hatten sich sichtlich verhärtet, und durch ihre Entschlossenheit und Gier schimmerte jäh die nackte Angst hindurch. Runas Drohung hatte ihr Ziel nicht verfehlt.
»Das wirst du bereuen, Runa Gideon«, zischte sie, bevor sie kreischend von dannen flog. »Wir werden ihn finden. Eines Tages werden wir ihn finden. Spätestens, wenn du nicht mehr bist und Merlias nicht mehr ist … Und ich werde nicht eher ruhen, bis er mein ist!«
Kapitel 1
Nilah
Mit unterdrücktem Atem huschte ich von meinem sicheren Versteck hinter einem der dicht aneinander stehenden Bäume des Waldes hinter den nächsten.
Er durfte mich nicht entdecken.
Der trockene Waldboden knirschte kaum hörbar unter den Spitzen meiner grauen Turnschuhe. Wo war er? Vorsichtig duckte ich mich und lugte zwischen zwei dicken Ästen hindurch, die so ineinander verschlungen waren, dass nur ein minimaler Schlitz entstand.
Mein Herz pulsierte so laut, dass es den gesamten Wald zu erfüllen schien. Mit angestrengt zusammengekniffenen Augen und voller Konzentration hielt ich Ausschau nach meinem Gegner, jederzeit bereit für jenen Angriff, auf den jede Faser meines Körpers zu warten schien. Doch weit und breit fehlte jede Spur von ihm. War er verschwunden? Unmöglich. Er jagte mich ebenso wie ich ihn. Und er würde nicht aufgeben, genau wie ich.
Mit dem Rücken eng an den Baum gepresst, ließ ich meinen Blick durch den Wald gleiten, der mich umgab. Jenen Wald, den ich einerseits so gut kannte, und der dennoch plötzlich mysteriös und auf eine paradoxe Art und Weise befremdlich schien. Beängstigend. Lauernd. Zentimeter um Zentimeter bewegte ich mich um den Baum herum, stets bemüht, keinen Laut von mir zu geben und mit dem Rücken eng am Stamm zu bleiben. Ich konnte ihn nirgendwo entdecken, aber ich spürte, wie nah er mir war. Ich konnte seine Entschlossenheit geradezu riechen.
Obwohl die dichten Baumkronen die pralle Sonne von mir abhielten, war es unerträglich heiß. Von meinem langen, braunen Haar, das ich mir vor dem Kampf hastig zu einem hohen Zopf zurückgebunden hatte, hatten sich mehrere Strähnen gelöst, die mir nun im schweißnassen Gesicht hingen. Meine Wangen glühten. Ob ich es riskieren konnte, Blickkontakt zu den anderen aufzunehmen? Vielleicht wussten sie, wo er sich verbarg und würden mir ein Zeichen geben. Sie waren auf meiner Seite, allesamt, auch wenn sie mir in jenem unvermeidbaren Kampf, der mir bevorstand, nicht von Nutzen sein würden.
Auf Zehenspitzen schlich ich eine weitere Halbrunde um den Baum herum, bis ich durch die dichten Verästlungen die Gruppe ausmachen konnte, die vor dem Waldeingang zurückgeblieben war. Weiß, grau, schwarz und rot gekleidet standen sie da und schienen sich vor Anspannung kaum halten zu können. Ich hatte sie selten so still erlebt, so fokussiert und gleichermaßen erregt in Anbetracht dessen, was nun jede Sekunde geschehen könnte.
Doch kaum war es mir gelungen, Blickkontakt zum ersten von ihnen aufzunehmen, da bereute ich meine kurze Unachtsamkeit bereits. Mit einer solchen Wucht, dass mir der Atem stockte, hatte er mich mit einem Sprung aus dem Nirgendwo erreicht, seine Arme schraubstockartig um meine Körpermitte geklemmt und mich mit sich zu Boden gerissen. Ein kurzer, stechender Schmerz schoss durch meinen Körper.
Er hatte an Stärke gewonnen seit unserem letzten Kampf. Nie hätte ich geglaubt, dass er noch stärker werden könnte, als er ohnehin schon war. Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich ihm ins Gesicht. Aufgeben war keine Option.
Doch während ich versuchte, ihn von mir zu stoßen, drückte er bereits seine Knie auf meine Beine, während seine Hände meine Arme festhielten. Er agierte unsanft, eilig und siegessicher. Sein Gesicht kam ganz nah, so nah, bis es fast das meine berührte. Und da alles Winden und Wehren nichts half, drehte ich meinen Kopf zur Seite, um zumindest den Triumph in seinem Gesicht nicht sehen zu müssen. Ich musste konzentriert bleiben, wenn ich diesen Kampf doch noch gewinnen wollte, fokussiert und stark, auch wenn es beinahe aussichtslos schien.
»Angst?«, flüsterte er mir mit heiserer Stimme und ebenso atemlos wie ich ins Ohr.
»Vor dir? Keineswegs«, knurrte ich.
Er lachte spöttisch auf.
»Also gibst du nicht auf?«
»Niemals«, keuchte ich, während er seinen Griff um meine Handgelenke quälend langsam weiter und weiter festigte, bis ein blitzartiger Schmerz durch meine gesamten Arme schoss und sich in meinen Händen allmählich ein Gefühl von Taubheit ausbreitete.
»Okay, okay«, wimmerte ich, als es so unerträglich wurde, dass mein Schmerzempfinden stärker wurde, als mein Kampfgeist es war. »Du hast gewonnen!«
Endlich ließ er mich los. Zäh und gemächlich schien das Blut zurück in meine Hände und bis in die Fingerspitzen hinein zu fließen, was mit einem Kribbeln und Stechen einherging. Ich schüttelte meine Arme leicht aus, um das unangenehme Gefühl loszuwerden, und versuchte, mich aufzurichten. Doch mein Gegner ließ es nicht zu.
»Na, Nilah Taro, kalte Füße bekommen?« Sein Atem war heiß, seine Stimme unüberhörbar triumphierend. Er lachte.
»Träum weiter«, brummte ich und musste nun ebenfalls lachen, obwohl ich es gar nicht wollte.
»SIE HAT AUFGEGEBEN!«, rief er, und die Schüler, die vor dem Waldpfad zurückgeblieben waren und allesamt auf meinen Sieg gehofft hatten, stöhnten enttäuscht.
Flynn stemmte sich auf, zog mich in einer einzigen, geschmeidigen Bewegung an sich und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Außer Atem lehnte ich mich an ihn.
»Du warst gut«, sagte er sanft.
»Und du warst besser. Du bist verdammt stark geworden«, murmelte ich, einerseits stolz auf meinen so unfassbar athletischen, starken und geschickten Geliebten, andererseits aber auch etwas neidisch, da ich nicht mehr mit ihm mithalten konnte.
Flynn blieb der Unterton in meiner Stimme nicht verborgen.
»Ich habe viel trainiert«, antwortete er mit einem Achselzucken, und es klang, als würde er sich für seine Stärke entschuldigen. »Sobald Ava älter ist und du wieder mehr trainieren kannst, wirst du auch wieder stärker. Oder …« Er zog das »O« so lang wie Kaugummi, und seine Lippen kräuselten sich zu einem Grinsen. »Oder du könntest sie einfach öfter Clara überlassen und bereits jetzt mehr trainieren. Ich habe schließlich nicht umsonst ein Kindermädchen angeheuert.«
»Ja. Wenn Ava älter ist, komme ich wieder in Form«, stimmte ich ihm zu, ohne auf seine letzten Sätze einzugehen. »Und dann, Flynn Gideon, dann schlage ich dich!«
Er lachte.
»Wir werden sehen, Nilah, wir werden sehen.«
Es war Sommer. Unsere Haut war sonnengebräunt und das Leben war gut zu uns gewesen. Wir hatten ein Zuhause, das zugleich unseren Beruf, unsere Berufung und unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich vereinte. Es war der Ort, an dem unsere Liebe begonnen hatte, an dem unser achtjähriger Sohn Nataniel und unsere zweijährige Tochter Ava das Licht der Welt erblickt hatten und an dem unsere lang ersehnte Hochzeit stattfinden würde.
»Morgen ist es soweit«, sagte Flynn, als hätte er meine Gedanken gelesen.
»Endlich.« Ich nickte, während wir den Waldpfad verließen und zurück zu unseren Schülern gingen, die sich vor dem Waldeingang versammelt hatten und immer noch ziemlich enttäuscht dreinblickten, weil ich gegen Flynn verloren hatte.
»Bist du nervös?«, fragte er sanft.
»Bist du nervös?«, antwortete ich mit einer Gegenfrage, denn tatsächlich war ich nervös.
Ich hatte weder Zweifel, noch glaubte ich daran, je einen anderen Mann auch nur ansatzweise so lieben zu können, wie ich Flynn liebte. Zweifelsfrei würde ich bis an unser Lebensende an seiner Seite sein. Und dennoch stimmte dieser Tag, und das Unvorhersehbare daran, mich zugleich freudig erregt, melancholisch und nervös.
Ich hatte schon viel zu lange auf dieses Ereignis gewartet. Andererseits schien erst ein Wimpernschlag vergangen zu sein, seit Flynn um meine Hand angehalten hatte. Anstrengende und Kräfte zehrende Monate waren seinem Antrag gefolgt, in denen Ava sich als besonders anspruchsvolles Baby und Kleinkind entpuppt hatte. Flynn und ich hatten beide alle Hände voll zu tun gehabt und nicht einmal im Ansatz an das Organisieren einer Hochzeit denken können.
»Ich bin nicht nervös.« Flynn nahm meine Hand in seine, führte sie an seine Lippen und drückte einen Kuss darauf. »Du warst immer dazu bestimmt, mein Mädchen zu sein. Und jetzt wirst du endlich meine Frau. Ich habe mehr, als ich mir je zu träumen erhofft habe. Nenn mir einen Grund, weshalb ich nervös sein sollte?«
Und in seinen karamellbraunen Augen lagen so viel Liebe, Ruhe und Freude, dass ich mich sofort geerdet fühlte.
Obwohl es bereits sehr spät am Abend war, stand die Sonne noch gleißend hell und heiß am Himmel und schien noch lange nicht untergehen zu wollen. Ava, die – wie so oft – auf den Schultern meines Schülers Tree saß, streckte sofort ihre kleinen Ärmchen nach mir aus und schmiegte sich an mich, als er sie mir behutsam herabreichte. Als hätte sie mich ganze Wochen nicht gesehen, klammerte sie sich an meinem Hals fest und verbarg ihr Gesicht an meiner Brust. Sie war warm und roch nach Honig, Wald und Seife. Flynn witzelte manchmal, dass sie einen kleinen Magneten im Körper trug, der wiederum von einem Magneten in meinem Körper angezogen wurde.
»Kleine Klette«, sagte Tree liebevoll.
Die Schüler vergötterten Ava, und vor allem zu Tree pflegte sie eine besondere Beziehung. Vom ersten Tag an hatte sich ihr kleines Gesicht erhellt, sobald er den Raum betrat, obwohl sie grundsätzlich stark fremdelte und keine Nähe zu anderen Personen als zu ihren engsten Vertrauten zuließ.
Tree, der eigentlich Tristan hieß, sich aber zu Beginn der Ausbildung umbenannt hatte, war einer der ehrgeizigsten Schüler, die ich je unterrichtet hatte, wenn nicht sogar der ehrgeizigste. Groß, schlank und sportlich mit einem jungenhaften Lächeln und weisen, kristallblauen Augen machte er es einem leicht, ihn zu mögen. Er hatte kurz rasierte, dunkelbraune Haare, ein großes Herz und auf fast jede Frage eine Antwort. Wenn die anderen Schüler aufgaben, trainierte Tree noch härter. Er war der erste am Morgen, der aufstand, um zu trainieren und der letzte, der abends zu Bett ging, und man sah ihn selten ohne sein kleines, rotes Notizbuch in der Hand, in das er immer wieder etwas hineinkritzelte. Niemand von uns wusste, was er dort hineinschrieb oder -zeichnete. Er hütetet es wie seinen Augapfel und ließ nie zu, dass jemand einen Blick hinein erhaschte. Er war, wie seine Gabe, wirklich etwas Besonderes, und ich konnte gut verstehen, dass Ava ihn mochte.
Neben ihm unterrichtete ich derzeit die agile Nikky, die fast am ganzen Körper tätowiert war und sich ihre einst hüftlangen, rosa gefärbten Haare kurzerhand raspelkurz abgeschnitten hatte, nachdem ihr klar geworden war, dass es im Schwarzen Flügel keine Friseure gab. Sie hatte die Gabe der Anhaftung, und konnte sich wie eine Fliege an Oberflächen aller Strukturen halten, wobei sie besonders gerne die Wände hinauf und an der Decke lief und einen jedes Mal fast zu Tode erschreckte, wenn man den Raum betrat.
Mein dritter Schüler, Jendrik, ein stiller, blonder Zwanzigjähriger mit schwedischem Akzent, war der dritte und letzte im Bunde meiner aktuellen Kämpferklasse. Er konnte Gegenstände mithilfe seiner Gedankenkraft bewegen, bisher jedoch nur am Boden und nicht in der Luft.
Ihre müden und abgekämpften Gesichter erinnerten mich an meine eigene Ausbildung. Die ersten Monate waren besonders hart gewesen, und die physische und psychische Belastung konnte man sich kaum vorstellen, wenn man sie nicht selbst durchlebt hatte. In Erinnerungen schwelgend ließ ich meinen Blick über die Heilerschüler – den unscheinbaren, schwarzhaarigen Bela und die zierliche Fee, deren Name wie die Faust aufs Auge passte –, die Aufspürerschüler – den drahtigen Joah und Andres, der rein äußerlich betrachtet glatt Cato Akumas Sohn sein könnte – und die beiden angehenden Beschützer – die puppenhaft aussehende Suri und den entspannten, Dutt tragenden Kjell – gleiten, während Ava sich immer noch an mich klammerte, als wolle sie mich nie wieder loslassen.
»Denk an meine Worte von vorhin, Nilah. Ich habe nicht umsonst ein Kindermädchen angeheuert.« Flynn streichelte seiner Tochter sanft den Rücken und zwinkerte mir zu, bevor er sich der müden, schwitzenden Schülergruppe zuwandte. »Auf, auf, wir drehen eine Extrarunde durch den Wald!«
Ein mehrstimmiges Aufstöhnen erklang. Flynn verschränkte die Arme vor der Brust.
»Möchte jemand sich beschweren?«, fragte er gebieterisch.
Betretene Stille machte sich breit. Alle neun Schüler starrten auf ihre Schuhe und schüttelten den Kopf.
»Das dachte ich mir.« Er lief voraus, und mit resignierender Miene folgte ihm die Gruppe in den Wald hinein.
Später am Abend, nachdem Flynn vom Waldlauf zurückgekehrt war und ich Ava und Nataniel zu Bett gebracht hatte, kam er erneut auf das bei mir unbeliebte Thema zu sprechen.
»Du könntest sie wirklich öfter Clara überlassen«, begann er sanft und fuhr sich durch die vom Duschen noch nassen Haare, die ihm inzwischen bis in den Nacken reichten. »Die beiden schaffen das schon.«
»Clara ist hier, damit ich arbeiten kann.« Ich richtete die Kopfkissen, unterdrückte ein Gähnen und setzte mich auf die Bettkante. »Sie betreut Ava, während ich unterrichte.«
»Und sie hat schon des Öfteren angeboten, diese Betreuung auszuweiten«, erinnerte Flynn mich ruhig.
Ich seufzte. »Für Nataniel habe ich nie ein Kindermädchen gebraucht.«
»Du kannst doch Ava nicht mit Nataniel vergleichen«, widersprach Flynn mir ruhig.
Er hatte Recht. Nate war schon immer unabhängig und freiheitsliebend gewesen und hatte sich im Schwarzen Flügel meist selbst beschäftigt, während Ava wahnsinnig Nähe bedürftig war und am liebsten von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang mit mir gespielt hätte. Sie war ein forderndes Kind. Sensibel, aufgeweckt und wissbegierig verlangte sie fast rund um die Uhr nach Körperkontakt und Bewegung an der frischen Luft, ganz gleich bei welchem Wetter. Ich verbrachte gerne Zeit mit ihr und genoss es, ihr beim Spielen, Lernen und Wachsen zuzusehen. Doch Flynn hatte nicht ganz Unrecht; Ava schränkte mich enorm ein. Sie zehrte an meinen Kräften, und obwohl ich wusste, dass ich nach wie vor eine gute Lehrerin und eine starke Kämpferin war, hatte ich das Gefühl, einen Großteil meiner Kraft, meines Bisses und meiner Disziplin durch die mütterliche Fürsorge verloren zu haben.
Ich wusste, dass Flynn sich Sorgen machte. Er wollte mir das bestmögliche Leben bieten und mir zu mehr Freiheit verhelfen. Aber es fühlte sich nicht richtig an, Ava dem Kindermädchen zu übergeben, um in Ruhe trainieren zu können. Es fühlte sich selbstsüchtig an, unnatürlich und falsch. Ava war zart, sie wirkte zerbrechlich, und das Gefühl, sie vor allem und jedem beschützen zu müssen, war seit ihrer Geburt der übermächtigste Gedanke in meinem Kopf.
»Sie ist noch so klein«, sagte ich lahm.
Das Argument, das ich jedes Mal einsetzte. Flynn stöhnte auf und schüttelte lachend den Kopf.
»Sie ist zweieinhalb. Sie ist kein Baby mehr.« Er ließ sich neben mich auf das Bett fallen und zog mich mit einem Ruck auf seine Brust. »Ich will nur, dass du glücklich bist.«
»Das bin ich«, flüsterte ich.
Ich war glücklich. Überglücklich. Ich hatte zwei gesunde, wunderbare Kinder, die in Freiheit und Selbstbestimmung aufwachsen durften sowie einen Beruf, den ich über alles liebte. Ich hatte eine Gabe, die mir Macht, Stärke und Stolz verlieh und die ich gelernt hatte, gänzlich zu kontrollieren. Und der Mann, den ich liebte, liebte mich ebenfalls und würde mich am Folgetag zur Frau nehmen. Alle Wünsche, die ich gehabt hatte, hatte der Schwarze Flügel mir erfüllt.
Ich drückte Flynn einen Kuss auf die mit Bartstoppeln übersäte Wange und stand auf, um das Fenster zu öffnen, damit die kühle Nachtluft uns besser schlafen ließ. Obwohl es inzwischen bereits dunkel war und beinahe Mitternacht sein musste, war die Luft, die in unser Zimmer eindrang, noch schwer und feuchtwarm. Ich ächzte. Die Hitzeperiode hielt nun schon seit Wochen an. Es war Ende August und es hatte den ganzen Monat noch nicht ein einziges Mal geregnet. Doch in der Ferne begann es zu brummeln. Anscheinend braute sich ein Gewitter zusammen.
Ich lehnte mich ein Stückweit aus dem Fenster und blickte in die Dunkelheit hinein. Im Licht des fast vollen Mondes konnte man die Umrisse der Bäume ausmachen, die den gesamten Schwarzen Flügel umgaben. Irgendetwas, ob es Intuition oder einfach ein absoluter Zufall war, hätte ich nicht sagen können, hielt mich davon ab, den Blick vom Wald abzuwenden. Jäh glaubte ich, eine Bewegung ausmachen zu können.
Mit zusammengekniffenen Augen lehnte ich mich noch einige Zentimeter weiter vor, um genauer hinsehen zu können. Es vergingen einige Sekunden, bis ich es erneut sah. Da war jemand. Eindeutig. Eine Gestalt im blassen Mondlicht, die menschlich, aber irgendwie dennoch schattenhaft schien. Oder war es vielleicht einfach bloß ein Vogel? Ein im Wind wackelnder Ast? Unsinn. Ich schüttelte den Kopf. So große Vögel hatte ich noch nie gesehen, und es wehte nicht einmal der Hauch eines Windes.
Mit unterdrücktem Atem versuchte ich, genauer hinzusehen, doch die Dunkelheit machte es schier unmöglich, mehr als einen schemenhaften Schattenumriss vor all den Bäumen auszumachen. Jäh bewegte sich das Etwas erneut. Ich war wie erstarrt. Hatte es gerade seine Flügel gespreizt?
»Was gibt es denn da zu sehen?« Flynn war von hinten an mich herangetreten, hatte seine Hände auf meine Schultern gelegt und mir dabei einen leisen Aufschrei entlockt.
Mit rasendem Herzen blickte ich zu ihm auf, bevor ich wieder aus dem Fenster sah. Doch das, was ich gesehen hatte, war verschwunden. Hatte ich überhaupt etwas gesehen? Oder war ich einfach nur müde?
»Was ist denn los?« Flynn musterte mich besorgt.
»Nichts, ich … ich dachte nur, ich hätte etwas gesehen.«
Mit immer noch viel zu schnell pochendem Herzen eilte ich zurück ins Bett. Plötzlich war mir trotz der Hitze kalt. Ich flocht mein vom Duschen noch feuchtes Haar zu einem langen Zopf und zog mir die Sommerbettdecke, die angenehm leicht war, bis zum Kinn. Flynn legte sich neben mich und lächelte milde.
»Du bist bloß aufgeregt wegen morgen«, sagte er ruhig.
»Wahrscheinlich.« Ich nickte bedachtsam, wie um mich selbst zu beruhigen. »Sadie kommt in den frühen Morgenstunden an.«
Flynn lächelte.
»Dann sind an unserem großen Tag alle wichtigen Menschen bei uns, um ihn mit uns zu feiern«, sagte er mit einem zärtlichen Unterton in der Stimme.
»Fast alle.« Ich lächelte wehmütig. »Ich wünschte, unsere Eltern könnten uns sehen.«
Ohne ein Wort zu sagen, strich Flynn mir mit dem Handrücken über die Wange. Seine Mutter Runa und sein Ziehvater Merlias lebten beide nicht mehr, und meine Eltern hatten keine übersinnlichen Fähigkeiten und durften nicht von der Existent des Schwarzen Flügels erfahren. Obwohl ich sie aufgrund unseres distanzierten Verhältnisses zueinander, sowie auch die Welt, in der sie lebten, kaum vermisst hatte in meinen Jahren als Kämpferin, hatte ich mir immer eine Hochzeit ausgemalt, bei der sie beide eine Rolle spielten.
Ich sah förmlich vor mir, wie mein Vater mich innerlich angespannt zum Altar führte, und meine Mutter, in ein schrecklich buntes, selbstgenähtes Kleid gehüllt, sich mit einem farblich darauf abgestimmten Taschentuch die Augen trockentupfte. Es war schwierig, sich vorzustellen, dass dies nie eintreffen würde. Sie würden nicht einmal wissen, dass ich geheiratet hatte und zweifache Mutter geworden war.
Doch die Vorfreude überwog. Meine beste Freundin Sadie würde kommen, mein bester Freund Damien würde dabei sein und neben unseren Kindern auch alle anderen, die unser Leben im Schwarzen Flügel lebenswert und liebenswert machten.
»Hab keine Angst.« Flynn fuhr mit seinem Finger die Form meiner Ober- und dann meiner Unterlippe nach. »Das wird unser Tag. Ich kann es kaum erwarten, dich zur Frau zu nehmen.«
»Ich kann es auch kaum erwarten«, wisperte ich, bevor er seine Lippen auf meine presste und mich innig küsste.
Seine Bartstoppeln kratzten auf meiner Haut und ich erschauderte unwillkürlich, als er sanft meinen Hals zu küssen begann. Meine Kopfhaut prickelte. Eine Gänsehaut breitete sich auf meinem gesamten Körper aus. Mit einer einzigen, schnellen Bewegung zog er sich sein T-Shirt über den Kopf und umfasste schließlich mit beiden Händen das meine, um es voller Hast hochzuschieben.
Im selben Moment durchzuckte ein greller Blitz, gepaart mit einem Donnerknall die Luft. Wir zuckten beide zusammen und hielten wie erstarrt inne, bevor Avas Weinen aus dem Nebenraum zu uns hervordrang. Flynn sog lautstark Luft durch die Nase, dann lächelte er gequält.
»Ich hole sie.« Eilig schwang ich meine Beine aus dem Bett und lief mit nackten Füßen in Avas Zimmer, welches durch eine Tür mit unserem verbunden war. Bis vor Kurzem hatte sie noch jede Nacht bei uns im Bett geschlafen, und obwohl ich die Zweisamkeit mit Flynn genoss, war es zu Anfang ein merkwürdiges Gefühl gewesen, sie auszuquartieren. Hin und wieder wachte sie nachts auf, und durfte dann bei uns im Elternbett weiterschlafen, in dem sie und ich dann eng aneinandergeschmiegt besser schlafen konnten als ohneeinander.
Flynn hatte sein T-Shirt wieder angezogen und das Fenster geschlossen, als ich mit der völlig nassgeschwitzten, immer noch leise wimmernden Ava im Arm zurückkehrte. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie sich zwischen uns ausgebreitet, die Beine auf Flynns Bauch und den Kopf auf meiner Brust liegend, und war wieder eingeschlafen.
Als Flynn schon längst schlief und seine und Avas ruhige, gleichmäßige Atemzüge den Raum erfüllten, dachte ich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch an die Gestalt zurück, die ich vor dem Wald hatte stehen sehen. Hatte Flynn Recht gehabt und mein Kopf hatte mir bloß einen Streich gespielt, weil ich so aufgeregt war wegen der bevorstehenden Trauung? Und wenn dem nicht so war … wen oder was hatte ich dann gesehen? Niemand, den ich kannte – abgesehen von Flynn und Nataniel –, hatte Flügel. Selbst bei den Antari gab es keine Flügel tragenden Dorfbewohner, da das Fliegen eine absolut seltene Gabe war. Was hatte das bloß zu bedeuten?
Unwillkürlich musste ich an einen längst verdrängten Traum denken. Ich hatte jenen Traum mit der Finsternis und der weißen Gestalt seit Monaten nicht mehr gehabt, und obwohl ich wusste, dass es nicht richtig war, verdrängte ich jegliche Gedanken daran. Ich wollte glücklich sein. Glücklich bleiben. So glücklich, wie ich war. Und nichts und niemand sollte dieses Glück gefährden.
Es war Sommer, unsere Haut war sonnengebräunt und das Leben war gut zu uns gewesen. Doch das sollte nicht von Dauer sein.
Kapitel 2
Bis dass der Tod uns scheidet
Der nächste Morgen, der Morgen unserer Hochzeit, brach mit einem feinen Sommerregen an, und wie immer, wenn es regnete, schwang Flynn mit großem Elan die Beine aus dem Bett, riss das Fenster auf und atmete mit geschlossenen Augen tief ein und wieder aus. Und als er sie wieder öffnete und seine Flügel mit einem lauten, peitschenknallähnlichen Geräusch spreizte, glitt sein Blick schier sehnsüchtig in die Ferne.
Sein Körper war meinem so nah, doch sein Geist schien in weiter, weiter Ferne. Manchmal hatte ich in Augenblicken wie diesen das Gefühl, dass er seine Freiheit vermisste. Seine Unabhängigkeit. Seine Ungebundenheit. Sein Ich. All das, was ich ihm einst geschenkt hatte.
Kalt und klamm zog sich das Gefühl dann um mein Herz und schnürte mir die Kehle zu, bis er sich endlich mit einem warmen Lächeln im Gesicht zu mir umdrehte und das Gefühl verschwand. Nein, dieser Mann würde mich nicht verlassen. Nie wieder.
Mit leichten Schritten trat ich an ihn heran, schlang die Arme um seine Körpermitte und lehnte mich an seine Brust, um seinem starken, ruhigen Herzen zu lauschen. Er bette sein Kinn auf meinen Kopf und atmete tief ein. Sein Geruch umhüllte mich, eine sinnliche Wolke aus Zedernholz, Honig und Abenteuer, und für den Bruchteil einer Ewigkeit gab es nur uns beide. Nilah Taro und Flynn Gideon. Den Mentor und seine Schülerin. Wie sehr hatten wir um diese Liebe kämpfen müssen. Wie oft waren uns Steine in den Weg gelegt worden. Der Tod hatte uns bedroht, Flynns Vergangenheit hatte es ihm schwergemacht, mich zu lieben, und ich hatte ihn fortgeschickt – im Wissen, ihn niemals wiedersehen zu werden … und dennoch hatten wir es geschafft. Die Zeit der Trennung hatte Narben entstehen lassen und zu vielen Tränen und vielen Streitereien geführt, und ein ganz und gar ungeplanter, völlig wirr verlaufender Zeitsprung hätte beinahe alles zerstört – dennoch waren wir beide hier. Miteinander vereint. Wir hatten all dem getrotzt und jede Hürde, die uns gestellt worden war, hatte unsere Liebe nur noch stärker und inniger werden lassen.
Sanft schob Flynn mich von sich, um mich anzusehen, und strich mir eine Strähne hinter das Ohr, die sich in der Nacht aus meinem geflochtenen Zopf gelöst hatte. Es schien fast so, als würde er meine melancholischen Gedanken mit mir teilen. Seine karamellbraunen Augen leuchteten, als wäre ich alles, was er sich je erträumt hatte. Er hob mein Kinn an und zog mich zu einem zärtlichen Kuss an sich heran, doch kaum hatten unsere Lippen sich berührt …
»Igitt.« Ava, mit vom Schlaf feuchten und völlig wirren Haaren, saß im kerzengeraden Schneidersitz im Bett, rieb sich die Augen und verzog die Mundwinkel, als hätte sie gerade etwas unerträglich Widerliches gesehen.
Im selben Moment flog die Tür auf und Nate stürzte herein, gefolgt von Damien, der tigerähnliche Laute von sich gab und mit wild rudernden Armen versuchte, ihn zu fangen. Jauchzend sprang Nate ins Bett neben seine Schwester, die ungerührt ob der Lautstärke weiterhin das Gesicht verzog.
»Schon mal was von Anklopfen gehört?«, fragte Flynn halb belustigt, halb verärgert, doch niemand achtete auf ihn.
»Mama und Papa haben sich geküsst«, teilte Ava ihrem Bruder angewidert mit.
»Bäh«, machte Nataniel.
»Bäh«, machte Damien.
Flynn verdrehte die Augen.
»Wie viele Kinder haben wir noch gleich?«, raunte er mir zu, während Nate über Ava kletterte, eine Runde um uns herumsprang und sich dann flatternd an Damien vorbei aus dem Raum drängte.
»Sorry.« Damien grinste, und ich wusste, dass es ihm kein Stückweit leidtat. Während er Nate, der über ihm schwebte, am Fuß festhielt, trat er rückwärts aus dem Raum und zog die Tür hinter sich zu.
»Nataniel Flynn Gideon!«, rief ich hinter ihnen her. »Wie oft muss ich es dir noch sagen?! Kein Fliegen in den Fluren!«
Appetitlos rührte ich wenig später einen Löffel Honig in meinen Früchtetee, hob die Tasse an den Mund und nippte vorsichtig daran. Er war noch viel zu heiß zum Trinken. Beim Abstellen stieß ich die Tasse beinahe um und konnte gerade noch verhindern, dass die heiße Flüssigkeit sich über Ava ergoss, die mit angewinkelten Beinen auf dem Stuhl neben mir saß und Rosinen aß. Ich seufzte.
»