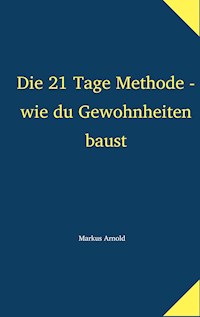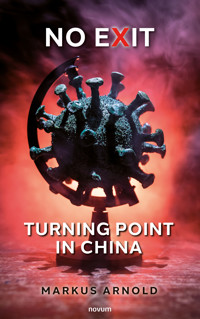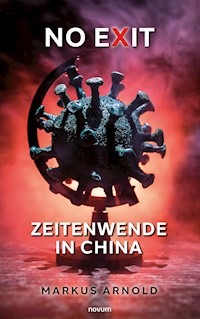
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitenwende in China: "Zero Covid" führt zu einem Rückfall in selbst gewählte Isolation und verschärft geopolitische Spannungen. Die chinesische Führung wähnt sich bald als Sieger im Kampf gegen die Pandemie und das westliche Gesellschaftssystem. Möglicherweise voreilig, denn gleichzeitig riskiert sie ihr seit Deng Xiaoping erfolgreiches Geschäftsmodell. Zwischen Fakten und Propaganda erleben die in China verbliebenen Ausländer, wie sich die Menschen in einem Land der Widersprüche einrichten. Sie beobachten, wie es in vielerlei Hinsicht im Land weiter vorangeht, während Repression und Nationalismus in die Zeiten Maos zurückweisen. Gleichzeitig erinnert China den Westen gnadenlos an dessen eigene Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Eine Momentaufnahme mit offenem Ausgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Impressum 2
Geschichte 3
Epilog 191
Dank 192
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-766-1
ISBN e-book: 978-3-99131-767-8
Lektorat: Bernadette Breitenfurther
Umschlagfotos: Aleksandar Mijatovic, Vasile Bobirnac, Choneschones, Peter Hermes Furian, Ilkin Guliyev | Dreamstime
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Geschichte
Ende Dezember 2018 nahe Stuttgart: Bei trübem mitteleuropäischen Winterwetter verbringen wir den Jahreswechsel gemütlich zu Hause und schmieden Pläne für das neue Jahr. Unsere Töchter Alma (15) und Marina (knapp 13) sind Neuem gegenüber sowieso aufgeschlossen. Meine Frau Verena und ich finden ebenfalls, eine Luftveränderung würde uns guttun. Wir nehmen uns vor, im Urlaub eine ganz andere Ecke der Welt kennenzulernen und zum ersten Mal als Familie nach Asien zu verreisen.
Nach ausgiebiger Recherche im Internet peilen wir Japan zur Zeit der Kirschblüte an. Schnell verfliegt unsere Euphorie, als das Reiseportal Flugpreise von 10.000 Euro und mehr avisiert. Während wir uns schon mit den Klassikern Südtirol oder Frankreich anfreunden, lässt Alma nicht locker und verkündet kurz nach Mitternacht, sie hätte erschwingliche Flüge aufgetrieben, praktischerweise während der Pfingstferien. Die Klimatabelle verheißt leider nur Regenzeit und die Kirschen sind zu dieser Jahreszeit längst verblüht. Aber für die Ersparnis im Gegenwert einiger Hundert Regenschirme nehmen wir gerne ein paar Tropfen in Kauf. Während unserer Vorfreude auf zwei Wochen „Asien light“ ahnen wir nicht, dass wir am Anfang eines Abenteuers stehen, das die Grenzen unserer Fantasie sprengen würde.
Bald danach erreicht mich ein Anruf meines Chefs, ob ich Lust hätte, eine neue Aufgabe bei unserer Einheit in Singapur zu übernehmen. Das klingt attraktiv – nach ausführlicher Erörterung im Familienrat und vorsorglicher Kontaktaufnahme mit der dortigen deutschen Auslandsschule signalisiere ich Interesse. In den nachfolgenden Gesprächen entpuppt sich die ursprünglich avisierte Stelle in Singapur rasch als Stelle in Shanghai. Der Familienrat ist nun intensiv gefordert und wir stellen Recherchen in unterschiedlichste Richtungen an – die Dimensionen chinesischer Megastädte, Luftverschmutzung und Zensur sind legendär. Auf der anderen Seite gibt es unheimlich viel zu entdecken, mehr als im von tropischem Dschungel und Palmölplantagen umgebenen Singapur. Eine deutsche Schule gibt es auch. So entschließen wir uns, unsere Zelte in Deutschland abzubrechen und für drei Jahre ins Reich der Mitte zu ziehen. Im schlimmsten Fall, so denken wir, können wir während der Ferien immer noch nach Europa fliegen und heimische Luft schnuppern. Wie sehr sollten wir uns irren.
Für Verena, die neben ihrer Berufstätigkeit sowieso schon unsere Familie organisiert, bricht ein Großprojekt an. Zunächst beginnt alles noch harmlos. Meine Firma hat einen Dienstleister engagiert, der weltweit bei Umzügen unterstützt. Dieser schickt uns lange Fragebögen, in denen wir unsere ganzen Bedürfnisse und Hobbys angeben sollen. Alma und Marina malen sich schon aus, wie sie in Shanghai ihrem Lieblingssport Hockey weiter nachgehen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, dass meine Firma den Vertrag mit dem Dienstleister längst gekündigt hat und ihm unser Umzug und erst recht die Hobbys unserer Töchter herzlich egal sind.
Erste Zweifel kommen auf, als sich unser Ansprechpartner für die Beschaffung unserer Visa für unzuständig erklärt. Meine Firma hat bisher nur wenige Ausländer nach China entsandt und gibt mir zu verstehen, die Sache am besten selbst in die Hand zu nehmen, die Kosten würden dann später übernommen.
Nachdem ich aus den Anweisungen auf der Website der chinesischen Botschaft und der Konsulate in Deutschland nicht schlau werde, engagiere ich eine spezialisierte Agentur. Deren freundlicher Mitarbeiter lotst mich in den kommenden Wochen über viele Stunden geduldig durch den Marathon der Visa-Anträge. Schon wieder geht es mit mehrseitigen Fragebögen los. Da ich außer dem Visum eine Arbeitsgenehmigung benötige, krame ich nach Jahrzehnten wieder mein Abiturzeugnis und meine Abschlussurkunden der Universität heraus. Mit einer einfachen Kopie ist es nicht getan. Es bedarf einer Übersetzung und notariellen Beglaubigung. Mein Arbeitgeber assistiert in Form eines offiziellen Einladungsschreibens, in dem dargelegt wird, aus welchen Gründen meine Mitarbeit als „foreign talent“ benötigt wird.
Außerdem erfahren wir, dass Verena zwar gemeinsam mit mir einreisen kann, das heißt aber noch lange nicht, dass sie deshalb automatisch in China arbeiten dürfte. Erst vor Ort kann sie sich theoretisch nach einem Arbeitgeber umsehen, der sich dann um eine eigenständige Arbeitsgenehmigung bemühen muss. In der Realität bleiben die meisten Partner und Partnerinnen zur beruflichen Untätigkeit verdammt, weil die praktischen und bürokratischen Hürden sehr hoch liegen. Schon früh lernen wir unsere erste Lektion, nämlich dass das Leben in China noch mehr als anderswo einem Hindernislauf gleichkommt.
Wegen der besagten Regelung eignet sich China vor allem für Singles oder für Paare, bei denen ein Partner entweder keine beruflichen Ambitionen hegt oder eine Auszeit beabsichtigt. Weil sich selbst in der aufregendsten Großstadt irgendwann eine neue Routine einstellt, birgt das enormes Frustrationspotential. Viele ausländische Firmen bieten für die nicht berufstätigen Partner ein paar Stunden Coaching an, damit sie sich in der neuen Umgebung zurechtfinden und eine sinnstiftende Rolle finden, während der berufstätige Teil lange Stunden in der Firma verbringt. Paare mit kleinen Kindern sind da im Vorteil, weil praktisch nie Langeweile aufkommt. Ist der Nachwuchs aber schon größer oder aus dem Haus, kann es schwierig werden.
Aus chinesischer Sicht hat die Regelung den Vorteil, dass die meisten Ausländer das Land in absehbarer Zeit aus freien Stücken wieder verlassen. Qualifizierte Partner mit beruflichen Ambitionen finden sich nämlich auf Dauer nicht mit der Rolle des geduldeten Anhängsels ab. Für ausländische Firmen macht das die Entsendung von Expats schwierig und teuer, weil das wegfallende Einkommen eines zuvor berufstätigen Partners irgendwie kompensiert werden muss und weil die Mitarbeiter oft häufiger wechseln als es dem Geschäft guttut.
Glücklicherweise kann sich Verena nach vielen Jahren in der Tretmühle mit einer Auszeit vom Beruf arrangieren, und die Betreuung von zwei Teenagern plus Hund lässt fürs Erste keine Langeweile befürchten.
Für Paare ohne Trauschein ist es fast unmöglich, gemeinsam eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Eine Bekannte aus der Schweiz kehrt deshalb China gerne den Rücken – erst durfte ihr Verlobter nicht einreisen, und später, als ihr Ehemann, war er wegen der Pandemie nicht willkommen.
China hat sich genauso wie die Nachbarländer noch nie als Einwanderungsland verstanden. Ausländische Arbeitnehmer bleiben im Wortsinn „Gastarbeiter“, selbst nach vielen Jahren Aufenthalt. Aus westlicher Sicht mag die Vorstellung, nach China auszuwandern, befremdlich erscheinen. Für Menschen aus ärmeren afrikanischen oder asiatischen Ländern sieht das wegen der lange Zeit boomenden Wirtschaft schon ganz anders aus. Mehrfach begegnen wir später in Shanghai Service-Mitarbeitern aus den Philippinen. In Guangzhou hat sich eine afrikanische Community etabliert. Dort gehen die Behörden konsequent gegen illegale Migration und illegale Beschäftigung vor.
Zu unserer Überraschung lernen wir, dass China nach US-Vorbild eine Greencard eingeführt hat, die besonders willkommenen ausländischen Fachkräften nach mehrjähriger Wartezeit einen dauerhaften Aufenthalt gestattet und sie in bestimmten Fragen mit chinesischen Bürgern gleichstellt, etwa beim Erwerb von Immobilien. Und tatsächlich lernen wir im Lauf unseres Aufenthalts zwei Landsleute kennen, die sich das Dokument im Scheckkartenformat gesichert haben. Im Einzelfall zeigen sich die Behörden also flexibel. Ein derartiger Gunsterweis gegenüber einzelnen Personen oder Unternehmen ändert indes nichts am Grundsätzlichen.
Leicht genervt von den Mühlen der Visum-Bürokratie unterbrechen wir unsere Vorbereitungen und nehmen unser ursprüngliches Ziel Japan in Angriff. Vielleicht können wir ja einiges für unseren Aufenthalt in China lernen, und wenn es nur die puren Gegensätze zu Europa einerseits und zu China andererseits sind. Wir werden nicht enttäuscht: Unser Zubringerflug nach Düsseldorf hat eineinhalb Stunden Verspätung, wir beginnen unsere Reise fast schon abzuschreiben. Doch da haben wir die Rechnung ohne die Japaner gemacht. Die Crew der ANA erwartet uns schon am Bus und lotst uns mit ausgesuchter Freundlichkeit, unaufdringlich, aber im Eiltempo durch alle Flure und Kontrollen bis ins Flugzeug. Erleichtert lassen wir uns in die Sitze sinken, die Mitreisenden unterhalten sich im Flüsterton und ziehen artig ihre extra mitgebrachten Reisesocken an. Mit gerade drei Minuten Verspätung starten wir gen Osten und erreichen Tokyo vorzeitig. Die Passagiere verlassen das Flugzeug, ohne zu drängeln und in nahezu andächtiger Stille. Mit Visumanträgen müssen wir uns nicht herumschlagen.
In Tokyo erwartet uns ein chaotischer Siedlungsbrei aus Millionen zumeist winziger Häuschen, nach zwei Jahren inmitten chinesischer Hochhäuser werden sie uns noch winziger vorkommen als im Original. In der Tokyoter U-Bahn finden wir dank englischsprachiger Beschriftung die Orientierung, meistens jedenfalls. Als wir einmal verloren vor Dutzenden Wegweisern stehen, fragt uns ein hilfsbereiter Einheimischer, wo wir denn hinwollten. Danach geleitet er uns durch das Labyrinth zum richtigen Ausgang. Die Episode sollte uns auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil sich derlei spontane Hilfsbereitschaft auf offener Straße in China kein einziges Mal wiederholt hat.
Eine bittere Erfahrung müssen wir bereits in Japan machen. Trotz jahrzehntelanger Bindung an den Westen ist es um englische Sprachkenntnisse traurig bestellt, quer durch alle Regionen und Generationen. Aus Furcht, das Gesicht zu verlieren, gehen viele Menschen dem Gespräch mit Ausländern aus dem Wege. Selbst in Hotels westlicher Prägung muss erst einmal der oder die Richtige ausfindig gemacht werden, um mit dem Westler zu kommunizieren. Als wir in einer Provinzstadt den vorreservierten Leihwagen abholen, verfügt dort nur das Navigationssystem über Englischkenntnisse. Mit meinen hundert Worten Japanisch kapituliere ich umgehend. Uns beschleicht der Verdacht, dass es in China nicht einfacher werden sollte.
Mit China kommen wir erst einmal indirekt in Berührung. Da die Zahl chinesischer Touristen stark zugenommen hat, erfolgen die Durchsagen im Shinkansen neben der Landessprache auch noch auf Englisch und in Mandarin. In Kyoto begegnen uns bei den zahlreichen Tempelanlagen junge Damen in traditioneller Geisha-Tracht, die sich gegenseitig in den unterschiedlichsten Posen fotografieren. Rasch stellen wir fest, dass es sich um chinesische Touristinnen handelt, die dem Volkssport Fotografieren nachgehen. Wir werden Zeuge der Hassliebe zwischen den beiden Völkern. Trotz konfliktreicher Vergangenheit und der bis heute anhaltenden Spannungen erfreut sich Japan gerade bei jüngeren Chinesen großer Beliebtheit als Reiseland. Dort finden sie Zeugnisse vergangener Epochen, die zu Hause Krieg und Kulturrevolution nicht überlebt haben. Und spätestens bei Sushi und Sashimi hört für die allermeisten die Politik auf. Das gilt erst recht beim Shopping – der Duty-free-Laden am Flughafen scheint vor allem von Besuchern aus dem Reich der Mitte zu leben.
Beim Besuch des Dokumentationszentrums des ersten Einsatzes einer Atombombe in Hiroshima fällt uns auf, dass dieses ausschließlich dem Leiden der Opfer gewidmet ist. Kaum ein Wort zur Vorgeschichte, insbesondere der japanischen Okkupation in China, Korea und anderen Teilen Asiens. Kritische Selbstreflexion scheint in der Region nicht en vogue zu sein, ganz zu schweigen von permanenter Selbstkasteiung wie in Deutschland.
Nach der Rückkehr aus Japan wird es allmählich ernst, weitere Überraschungen bleiben uns nicht erspart. So rät die Deutsche Schule in Shanghai Alma, die dort die zwei Jahre Kursstufe bis zum Abitur ablegen soll, trotz guter schulischer Leistungen sicherheitshalber die Klasse 10 zu wiederholen. Nach einer Schrecksekunde widersetzen wir uns vehement und schaffen es letztlich, dass sie nahtlos in Klasse 11 weitermachen darf.
Da wir uns in eine Weltgegend mit vielen Stempeln begeben, schlägt Verena in weiser Voraussicht vor, wir sollten uns neue Reisepässe beschaffen. Die aktuellen würden in einem guten Jahr ablaufen und man wisse ja schließlich nie. Wir machen uns auf zum Fotografen sowie zum örtlichen Bürgerbüro, nach kaum zwei Wochen halten wir druckfrische Reisepässe in Händen. Eine weitere, ungleich nervenaufreibendere Investition tätigen wir in neue Mobiltelefone. China gilt schließlich als Speerspitze der Digitalisierung, da wollen wir uns mit unseren alten Prügeln nicht blamieren. Selten hat sich eine Anschaffung so bewährt wie diese.
Da wir unser Eigenheim nicht drei Jahre leer stehen lassen wollen, ringen wir uns durch, dieses zu vermieten. Einfacher gesagt als getan, weil da noch die eine oder andere Reparatur ansteht. Außerdem muss unser ganzer Hausrat sortiert und für den Versand nach China vorbereitet werden. Immerhin bietet sich die Gelegenheit, sich von manchem Überflüssigen zu trennen, was sich über die Jahre angesammelt hat. Verena leistet Schwerstarbeit, die Handwerker gehen ein und aus.
Nicht überflüssig, aber dennoch Ballast wären unsere fahrbaren Untersätze. Und so verkaufen wir auch noch das gerade angeschaffte E-Fahrzeug sowie den vor allem von unseren Kindern heißgeliebten Wohnwagen. Jedes Vorhaben für sich kostet uns etliche Tage Aufwand und manche Nerven.
Nicht hingegen trennen wir uns von unserem Familienhund Willy, einem kräftigen 20-Kilo-Rüden mit ausgeprägtem Bewegungsdrang in freier Natur und mit einem Pelz, der ihn eher für die Arktis als das subtropische Shanghai prädestiniert. Erfreut lesen wir in den Entsendungsrichtlinien meiner Firma, dass Hunde im Unterschied zu Pferden im Rahmen des Servicepakets nach China expediert werden. Doch auch für Willys Umzug gilt es manch medizinische wie bürokratische Hürde zu überwinden. Welch ein Glück, dass er von Anfang an vorschriftsgemäß registriert, geimpft und entwurmt worden ist. Obendrein benötigt er als ein einziges Familienmitglied kein Visum und muss keine Sprachbarriere überwinden. Doch auch hier liegen die Tücken im Detail: Meine Eltern haben mir gleich drei Vornamen beschert, die sich leider nur schwer auf das entsprechende Zollformular für den Hundehalter pressen lassen – und ohne das korrekt ausgefüllte Formular keine Einreise für den Hund. Die Lösung dieses Problems in einer hektischen Nacht-und-Nebel-Aktion kostet Verena den vorletzten Nerv.
Eine echte Hiobsbotschaft hält die Spedition für uns bereit: In China gebe es leider die Spezialität, dass das Umzugsgut aus dem Ursprungsland, in unserem Fall also aus Deutschland, erst dann auf den Weg gebracht werden dürfe, sobald wir vor Ort die eigentliche Aufenthaltsgenehmigung erhalten hätten. Das dauere mindestens drei bis vier Wochen ab der Einreise. Unser Visum reiche dafür nicht aus. Wir verfluchen die Bürokratie und setzen die Aufenthaltsgenehmigung ganz oben auf die Prioritätenliste für die Zeit nach unserer Ankunft. Wir stellen uns darauf ein, mehrere Wochen aus dem Koffer zu leben, am Ende werden es fast fünf Monate.
Unsere Packaktion bleibt ebenfalls nicht ohne Zwischenfälle. Fein säuberlich trennen wir unser Umzugsgut zwischen der Luftfracht, die „schon“ nach wenigen Wochen eintreffen soll, sowie in die große Masse, die auf dem Seeweg verschifft wird. Trotz Erinnerung durch Verena versäume ich es, ein oder zwei Anzüge rechtzeitig in den Koffer zu legen. Nachdem die Packer verschwunden sind, konstatieren wir entsetzt, dass meine Anzüge im Seegepäck gelandet sind.
Die Spedition versichert uns mit dem größten Ausdruck des Bedauerns, dass es unmöglich sei, aus Dutzenden von Kartons ein paar Kleidungsstücke herauszuholen. Um mein neues Amt halbwegs ansehnlich anzutreten, muss dringend Ersatz beschafft werden. Anstatt den Abend vor meinem Abflug entspannt zu verbringen, erreichen wir um 19.40 Uhr abgekämpft das nächstgelegene Kaufhaus, nahezu blind erstehe ich zwei Anzüge. Glücklicherweise ist gerade Sommerschlussverkauf …
Um in den ersten Wochen passabel unterzukommen und in Ruhe eine dauerhafte Bleibe suchen zu können, mieten wir mit Unterstützung des Umzugsdienstleisters für die Anfangszeit ein möbliertes Apartment, eines der wenigen, das auch Hunde akzeptiert. Es handelt sich um dasselbe Apartment, das Verena selbst bereits im Internet ausfindig gemacht hatte – nur eben mit Vermittlungsprovision für unsere Helfer, wie sich später herausstellt.
Am Abend des 7. August 2019 fliege ich als Vorauskommando gen Shanghai, während meine Familie noch eine weitere Woche Kärrnerarbeit bei der Auflösung unseres Haushalts verrichtet. Am Vormittag des 8. August schwebe ich über einem Meer aus Hochhäusern in Shanghai ein. Peinlich genau befolge ich bei der Einreise die Instruktion der Spedition, bitte jeweils zwei Zollformulare für Flugfracht, Seefracht sowie für den Hund auszufüllen und abstempeln zu lassen. Ohne dieses Formular wäre die spätere Einfuhr leider nicht möglich. Nachdem ich den richtigen Schalter gefunden und die Stempel erhalten habe, hüte ich fortan die Formulare wie meinen Augapfel.
Am Ausgang empfängt mich mein sympathischer Fahrer Tian, der an diesem Morgen wohl genauso neugierig ist wie ich, was ihn in den kommenden drei Jahren wohl erwartet. Nach etlichen Jahren in Diensten amerikanischer Expats bin ich sein erster Europäer. Tian spricht passabel Englisch, fährt souverän und flößt mir spontan Vertrauen ein.
Über vorzüglich ausgebaute Schnellstraßen erreichen wir nach einer guten halben Stunde meine Unterkunft. An der Rezeption dauert es ein paar Minuten, den einzigen englischsprachigen Mitarbeiter aufzutreiben. Der erklärt mir, dass die Wohnung leider erst am Nachmittag bezugsfertig sei. Deshalb lasse ich mein Gepäck zurück und fahre, ungeduscht und zerknittert, in die Firma, um meine künftigen Kollegen kennenzulernen. Dort begrüßen mich in bestem Englisch unsere Personalchefin und meine Assistentin. Sie finden, dass ich nach dem langen Flug ein Mittagessen verdient hätte. Wir gehen in das nächstgelegene japanische Restaurant, was meine Beobachtungen aus Kyoto bestätigt.
Beim Verlassen des Büroturms verschlägt es mir beinahe den Atem. In Shanghai herrscht Hochsommer bei weit über 30 Grad und 90 % Luftfeuchtigkeit. Die subtropische Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. 200 Meter Fußweg zur gegenüberliegenden Mall reichen aus, um jedem Mitteleuropäer den Schweiß aus den Poren zu treiben. Insgeheim beneide ich meine Assistentin, die sich wie viele andere weibliche Büroangestellte mit einem Schirm bewaffnet hat, der gegen Sonnenbrand und Hitzschlag gleichermaßen schützt.
Der Bestellvorgang im Restaurant katapultiert mich unversehens in die nächste Stufe des Internet-Zeitalters. Damit es zügig geht und mittags jeder Tisch mehrfach besetzt werden kann, bedienen sich die Gäste eines am Tisch befestigten QR-Codes anstelle einer herkömmlichen Speisekarte, lange bevor Corona derlei Methoden auch in Europa den Weg bereitet. Binnen einer Minute wird online bestellt sowie vorab bezahlt. Die erforderlichen Apps fehlen noch auf meinem Handy. Deshalb oute ich mich als Neuankömmling und bitte um eine schöne klassische Speisekarte. Diese wird flugs gebracht. Zu meiner freudigen Überraschung strotzt sie vor bunten Bildern, in diesem Fall sogar mit zweisprachigen Erklärungen. Verhungern werde ich also definitiv nicht. Wie ich später feststelle, sind die Bilder landesweit Standard, nur die englische Übersetzung endet außerhalb der von Ausländern frequentierten Geschäften und Restaurants.
Nach einer ersten Vorstellungsrunde, Einweisung in Büro und Technik gilt es in den ersten Tagen vor allem meine Überlebensfähigkeit für den chinesischen Alltag herzustellen, und zwar in der Reihenfolge Bankkonto, Handyvertrag und Ausstattung mit den wichtigsten Apps. Dazu zählen vor allem WeChat, das chinesische Pendant zu WhatsApp, sowie Alipay. Die Registrierung erfolgt mit Reisepass und diversen weiteren persönlichen Informationen. Die Big-Data-Algorithmen der Behörden lesen garantiert mit, aber seit dem Visaantrag gibt es ohnehin kaum mehr Geheimnisse.
Bezahlen über WeChat oder Alipay ist absoluter Standard, die Verwendung von Bargeld erregt beinahe schon Argwohn. Für die Übergangszeit besorge ich mir an einem Geldautomaten mittels Kreditkarte notgedrungen einen Mindestbetrag an Bargeld. Die Einfuhr von Bargeld ist, abgesehen von Bagatellbeträgen, wegen der Devisenbewirtschaftung verboten, westliche Kreditkarten werden selten akzeptiert und ohne Bankkonto funktioniert keine der wichtigsten Apps.
Derart gerüstet, rücke ich am frühen Abend erneut in unserer Unterkunft an, doch vor der ersehnten Dusche, gilt es auch hier die Hürden der Bezahlung zu überwinden. Der Rezeptionist besteht auf Vorauskasse für vier Wochen, wovon unser angeblicher Umzugsexperte nicht berichtet hat. Leider überschreitet die Miete das Limit meiner Kreditkarte, kein Wunder bei den Mieten in Shanghai. Nach einigem Hin und Her begnügt sich der Rezeptionist mit einer Anzahlung. Telefonisch bitte ich V., sich bei unserer Bank zu Hause um ein großzügigeres Limit zu bemühen.
Die mir zugewiesene Wohnung ist modern, der leicht muffige Geruch ficht mich nach einem langen Tag nicht weiter an. Um eine Vorstellung von der neuen Umgebung zu entwickeln, entschließe ich mich zu einem abendlichen Spaziergang. Schon seit ungefähr 18.30 Uhr herrscht pechschwarze Nacht. Wegen der Lage auf dem 31. Breitengrad wird es nahezu schlagartig dunkel, eine längere Dämmerung nordischer Prägung ist unbekannt.
Bei unseren Recherchen vor der Abreise hatten wir den Aspekt der Zeitzone vernachlässigt, was sich nun als grobe Fahrlässigkeit herausstellt. Aufgrund einer West-Ost-Ausdehnung von über 5 000 Kilometer liegt China innerhalb von fünf der weltweit 24 Zeitzonen. Seit 1949 gilt trotzdem landesweit einheitlich die Pekinger Zeit, Symbol eines tief verwurzelten Zentralismus. Nachdem regionale Sonderwege leicht als Vorstufe zum Separatismus gelten, wagt niemand den Status quo in Frage zu stellen. Nicht einmal eine Sommerzeit gibt es, nachdem ein fünfjähriger Versuch 1986–1991 wohl auf wenig Resonanz gestoßen ist.1
So fühlen wir uns erst einmal im Land der Dunkelheit, schließlich können wir uns beim besten Willen nicht aufraffen, im Sommer um vier oder fünf Uhr aufzustehen, um die Morgensonne zu genießen. Umso mehr sollten wir uns in den kommenden beiden Jahren über Aufenthalte weiter im Westen von China freuen, wo es ähnlich wie in Europa helle Sommerabende gibt.
Die Straßenlampen spenden ein Funzellicht, bei dem selbst für Fußgänger Vorsicht geboten ist. An den Glitzermeilen des Geschäftsviertels und am Huangpu, der Shanghai durchzieht, sieht es natürlich anders aus. Ungleich gefährlicher als die Fußgänger leben die zahlreichen Fahrer von E-Scootern. Um die Reichweite ihrer Batterien auszuschöpfen, hält es kaum einer für nötig, das durchaus vorhandene Licht einzuschalten. Am Gewicht wird ebenso gespart – fast niemand trägt Helm, von den wenigen Fahrradfahrern ganz zu schweigen. Autofahrer respektieren wegen der allgegenwärtigen Kameras die roten Ampeln, Mopedfahrer scheinen die Ampeln eher als unverbindliche Empfehlung zu betrachten. Rasch wird mir klar, warum die meisten ausländischen Firmen ihren Expats das Autofahren angesichts der hohen Unfallgefahr entweder verbieten oder jedenfalls dringend davon abraten.
Ein deutscher oder europäischer Führerschein wird in China nicht anerkannt. Schon die ersten Eindrücke bestätigen mich darin, auf den Erwerb eines chinesischen Führerscheins zu verzichten. Eigentlich schade – der Verkehr ist keineswegs chaotisch, sobald die Autos unter sich sind, die Straßen sind meistens gut.
Die Dunkelheit wird untermalt durch eine einzigartige Geräuschkulisse. Doch nicht Straßen- oder Industrielärm dringen an mein Ohr, sondern ein schrilles Konzert Zehntausender Riesengrillen, die sich in den Alleebäumen breitgemacht haben. Ansonsten ist es trotz der dichten Besiedlung extrem ruhig, die meisten Menschen sind inzwischen längst zu Hause, die Geschäfte und Restaurants um diese Zeit spärlich besucht. Keine Spur von überbordenden Menschenmassen.
Weitere Erkundungen nehme ich mir für das erste Wochenende vor, habe meine Rechnung aber ohne den Wettergott gemacht. Die Kollegen warnen mich vor dem herannahenden Ausläufer eines Taifuns. Am Freitagnachmittag wird mir aus meinem Büro im 37. Stock ein Logenblick auf die herannahende schwarze Wolkenwand zuteil. Kurz darauf gießt es wie aus Kübeln. Auf dem Heimweg reichen die wenigen Meter Sprint zum und vom Auto, um völlig durchnässt zu werden.
Am nächsten Morgen sind die Straßen übersät von Ästen und losen Gegenständen, die der Sturm mitgerissen hat. Die tags zuvor noch adrett in Reih und Glied aufgestellten Leihräder liegen auf der Seite wie Dominosteine. Die Temperatur ist auf erträgliche 25 Grad gefallen, die App mit den aktuellen Daten zur Luftqualität meldet Bestwerte. So mache ich mich trotz des immer noch strömenden Regens auf, ein paar Lebensmittel zu besorgen und um unser Quartier abzulaufen. Dieses erfreut sich bei Ausländern großer Beliebtheit, vielleicht findet sich ja in der Nähe eine passende Bleibe.
Meine Exkursion endet nach wenigen Minuten, als die erste stärkere Bö meinen Regenschirm zerfetzt. Ausgestattet mit einem robusten Prachtexemplar aus heimischer Produktion, entliehen bei der Rezeption, unternehme ich einen zweiten Anlauf. Zielstrebig steuere ich das Carrefour-Einkaufszentrum um die Ecke an, dem praktischerweise ein Food-Court mit Dutzenden Imbissständen, Restaurants und Cafés angegliedert ist. Der Supermarkt erweist sich als unvorstellbar leer, was ich zunächst auf das schlechte Wetter schiebe. Später erfahre ich, dass die meisten Kunden inzwischen nach Hause liefern lassen. Das Personal steht sich die Beine in den Bauch, der riesige Supermarkt wirkt plötzlich wie aus der Zeit gefallen, schon vor Corona.
Das Sortiment zeugt von der kurz zuvor erfolgten Übernahme von Carrefour China durch einen einheimischen Investor. Abgesehen von einigen französisch geprägten Weinregalen hat man sich dem lokalen Geschmack angepasst. Viele Produkte vermag ich ohne Sprachkenntnisse nicht zu identifizieren. Das Bedürfnis nach wirklich frischen Lebensmitteln scheint Chinesen und Franzosen zu einen. Anstelle frisch gefangener Fische aus dem Mittelmeer grüßt hier ein – noch lebender – Ochsenfrosch. Obst und Gemüse gibt es in Hülle und Fülle.
In anderer Hinsicht folgt man leider dem schlechten Beispiel aus Amerika. Gebäck, Schokolade und selbst Joghurt enthalten Unmengen an Zucker. Käse wird großteils in Form gummiartiger Scheiben dargeboten, die während meiner Kindheit en vogue waren, sich aber glücklicherweise in Europa nicht durchgesetzt haben. Brot gibt es entweder abgepackt in Form labbriger Toastscheiben oder frisch nach französischer Machart. Da das Personal kein Wort Englisch spricht und die Übersetzungsapp an Spezialitäten wie „glutenfrei“ scheitert, fällt mein erster Einkauf mickrig aus. Als ich an der Kasse als Einziger in bar bezahle, fühle ich mich wie ein Relikt aus der Steinzeit.
Wenige Tage später werde ich stolzer Inhaber eines chinesischen Bankkontos. Dazu bedarf es der Hilfe zweier Kollegen, die alle möglichen Dokumente vom Arbeitsvertrag bis zur Meldebescheinigung in die Bankfiliale mitgebracht haben und übersetzen. Die Vorschriften für Ausländer scheinen kompliziert zu sein. Zwei, zeitweise drei Mitarbeiter der Bank sind damit beschäftigt, die Eröffnung meines schlichten Girokontos abzuwickeln. Nach rund eineinhalb Stunden ist es dann geschafft, gleichzeitig habe ich die Eintrittskarte in die Welt des chinesischen e-business gelöst. Danach kümmern wir uns um eine Mobilnummer. Das funktioniert ähnlich wie in Europa in einer Filiale des Telekomanbieters, nur mit etwas mehr Daten und Unterschriften. Der Reisepass mit Visum zählt bei all diesen Vorgängen zur Standardausstattung und als Nachweis dafür, dass man sich völlig legal im Land aufhält.
Mitte August trifft mit hängender Zunge meine Familie in Shanghai ein. Verena und die Kinder waren bis zum Abflug damit beschäftigt, unser Haus für die Vermietung vorzubereiten. Ohne die tatkräftige Hilfe unserer Verwandtschaft wäre es ganz eng geworden. Für Alma und Marina fallen die Sommerferien ins Wasser, weil das alte Schuljahr in Baden-Württemberg erst Ende Juli endet und das neue in Shanghai bereits um den 20. August beginnt. Obendrein gleichen die verkürzten Sommerferien 2019 umzugsbedingt einem Arbeitslager.
Die Koffer sind noch nicht verstaut, da ziehen Verena und die Kinder schnüffelnd durch die Wohnung, während ich mich mit dem modrigen Geruch abgefunden hatte. Nach kaum zehn Minuten haben sie mehrere Schimmelnester ausfindig gemacht. Trotz der Müdigkeit bestehen wir an der Rezeption auf eine andere Wohnung, die nicht im Erdgeschoss liegt. Welch ein Glück, dass wir noch nicht voll bezahlt haben, die Drohung mit Mietminderung wirkt auch in China Wunder. Flugs beziehen wir ein Apartment im Obergeschoss und verstauen den Inhalt unserer Koffer.
Noch am selben Tag wird mit großem Hallo unser Hund begrüßt. Willy hat es von uns allen am besten getroffen, muss er doch zur gemeinsamen Unternehmung nichts beitragen und darf, nach tierischen Standards, first class reisen. Eine derart überdimensionierte Hundekiste haben wir über all die Jahre nicht gesehen. Jetzt verstehen wir, warum die Firma alle Transportkosten übernommen hat, nicht jedoch die 250 Euro für die Transportbox. Auf Nachfrage erfahren wir, dass im internationalen Flugverkehr Tierschutz großgeschrieben wird. Die Kiste muss angeblich ausreichend Platz bieten, damit sich der Vierbeiner bequem der Länge nach ausstrecken kann, zuzüglich Schwanz versteht sich. Im Vergleich dazu waren unsere Economy-Sitze die reinste Käfighaltung. Willy darf zur Belohnung noch kurz auf die Straße. Angesichts der anhaltenden Hitze scheint er um Jahre gealtert. Erschlafft trottet er neben mir her, bis herumstreunende Katzen kurzzeitig seinen Jagdinstinkt wecken.
Die folgenden Tage stehen im Zeichen der Schulvorbereitung und der Beschaffung des Nötigsten für den Haushalt. Trotz praller Koffer und Übergepäck haben wir uns einschränken müssen. Die Ausstattung unseres Apartments zielt mehr auf den schönen Schein als auf das Praktische ab. Die Messer schneiden nicht, auf der Butter hinterlassen sie selbst nach mehrfachem gründlichem Spülen bläuliche Schlieren. Die übrigen Kochutensilien reichen allenfalls für Rühreier.
Anlass genug, nach Carrefour einem der rund halben Dutzend IKEA-Märkte in Shanghai einen Besuch abzustatten. Wir treffen auf ein Musterbeispiel weltweiter Standardisierung: dieselben endlosen verwinkelten Gänge, dieselbe Reihenfolge der Möbel und dieselbe Tischdeko wie überall. Im Gegensatz zum Supermarkt scheinen Möbelhäuser für chinesische Konsumenten noch ein echtes Einkaufserlebnis zu bieten. Komplette Familien mit allen Generationen rücken an, manche nutzen ausgiebig die Gelegenheit zum Probeliegen oder gleich für einen Mittagsschlaf. Rabattaktionen erfreuen sich großer Beliebtheit: Zunächst sind wir irritiert über den Wortschwall der Kassiererin, bis wir verstehen, dass sie es nur gut mit uns meint. Mit Nachdruck legt sie uns die Kundenkarte ans Herz, damit wir das neue Besteck und die Töpfe zum möglichst günstigsten Preis erwerben. Wir wollen sie nicht enttäuschen und nehmen dankend an.
Im Vertrauen darauf, dass IKEA einen Ruf zu verlieren hat und seine Kunden nicht vergiftet, wagen wir uns in den nächsten Tagen dank der neuen Gerätschaften an die Zubereitung von Speisen in unserer Küche. Einige Einkaufsquellen haben wir ja bereits ausfindig gemacht, gewöhnungsbedürftig finden wir das Trinkwasser aus Wasserkanistern mit 4–5 Litern Inhalt. Kollegen und die Mitarbeiter der Umzugsfirma raten inständig davon ab, das Leitungswasser zum Kochen zu verwenden oder gar zu trinken, denn Schwermetalle verschwinden leider nicht durch Erhitzen. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, welchen Beitrag allein die Trinkwasserversorgung von 1,4 Milliarden Menschen aus Kunststoffkanistern zum Anschwellen des Plastikmülls leistet.
Nebenher organisieren wir die Versorgung unseres Vierbeiners. An Geschäften für Haustierbedarf herrscht kein Mangel. Die Zahl der Hunde- und Katzenbesitzer steigt exponentiell, untrügliches Signal für steigenden Wohlstand und vielleicht auch für die hohe Zahl kontaktarmer Singles. Manches Hunde-Accessoire kann nicht schrill genug sein, damit die Umgebung das lebende Statussymbol auch gebührend wahrnimmt. Unserem Willy wird es also an Futter nicht fehlen.
Sein Bewegungsspielraum stellt sich bald als beschränkt heraus – in öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Mitnahme von Haustieren strikt untersagt, verständlich angesichts des Gedränges zu den Stoßzeiten. Leider besteht auch in den meisten Parks Hundeverbot. In unmittelbarer Nachbarschaft unserer provisorischen Unterkunft liegt ein Gewerbepark, der dank eines hübschen kleinen Sees und üppigem Grün seinem Namen alle Ehre macht. Die Zufahrten werden, wie in China üblich, von einem privaten Sicherheitsdienst überwacht, zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten. Somit scheitert unser erster Versuch zur Erkundung des Terrains an einer resoluten Dame, die wahrscheinlich über die geballte Gefahr durch Ausländer und Hund ebenso erschrocken ist wie ich über ihr Gezeter.
Fortan halte ich es mit den einheimischen Hundebesitzern. Die nutzen nämlich ein paar Trampelpfade abseits der offiziellen Zugänge und kommen bevorzugt frühmorgens oder abends, während die Security-Leute ihren Feierabend genießen. Hat man es einmal in den Park geschafft, droht nur selten Ungemach. Angesichts der Hitze bewegen sich die wenigen Wachleute innerhalb eines Radius von 20 Metern und lassen friedliche Hundebesitzer gewähren, solange nur der Abstand ausreichend groß ist. Dabei gilt es stets das Gesicht zu wahren: Hat man sich zufällig gegenseitig aus den Augenwinkeln erspäht, sehen beide Parteien voneinander weg und gehen jeglicher Eskalation aus dem Weg. Unangenehm nur, wenn der Chef mit auf Patrouille unterwegs ist oder wenn man in den militärisch zelebrierten Morgenappell des Security-Trupps gerät – in einem solchen Fall gibt sich niemand eine Blöße. Mit Hilfe von Trillerpfeifen und unter wildem Gestikulieren werden Eindringline kompromisslos vertrieben – bis das Katz-und-Maus-Spiel am nächsten Tag von Neuem beginnt.
So verschafft uns Willy ungewollt eine weitere kulturelle Erfahrung: Entgegen vielen westlichen Vorurteilen erleben wir einen ausgeprägten Hang zum laissez-faire, ja geradezu zur Anarchie. Regeln laden dazu ein, frei interpretiert, gebogen und kreativ umgangen zu werden. Im Erfolgsfall erntet man dafür Respekt und Bewunderung. Nach teutonischer Manier dagegen den direkten Weg zu suchen, und sei es stur mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, gilt als Ausweis mangelnder Reife.
Am 20. August beginnt das Schuljahr an der Deutschen Schule in Shanghai. Davon gibt es sogar zwei, an entgegengesetzten Enden der Stadt. Alma und Marina besuchen diejenige in Yangpu, mit 300 Schülern vom Kindergarten bis zum Abiturjahrgang fast eine Zwergschule. Die Schüler sind ähnlich bunt zusammengewürfelt wie die Lehrerschaft. Kinder von Expats wie unsere Töchter, die ein paar Jahre bleiben und dann wieder zurückkehren, stellen vielleicht noch die Hälfte, weil die Zahl der Entsandten seit einigen Jahren sinkt. Die anderen Kinder entstammen Familien, die dauerhaft in Shanghai leben, davon viele Mischehen zwischen einem deutschen und einem chinesischen Partner, oder auch chinesischen Familien mit Pässen eines deutschsprachigen Landes.
Chinesische Bürger dürfen ihre Kinder nicht an der Deutschen Schule anmelden. Kein Wunder, ist doch diese einer der wenigen Orte freier Meinungsäußerung außerhalb der eigenen vier Wände. In der Schule treffen die Kulturen und Meinungen aufeinander, und so kommt es durchaus vor, dass Werte oder Positionen, die in Europa als selbstverständlich gelten, von Schülern, die der Kommunistischen Partei nahestehen, angegriffen werden.
Eine chinesische Schülerin rechtfertigt das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit der Bemerkung, die Demonstranten seien zuvor gewarnt worden. Wer dies missachte, sei selbst schuld. Ihre Eltern haben Jahre in Deutschland verbracht, von demokratischen Werten aber wohl nichts mitgenommen, jedenfalls nichts weitergegeben. Zu allem Überfluss soll sich der Schüler, der das Massaker angeprangert hat, auch noch entschuldigen, weil er die Gefühle seiner Mitschülerin verletzt habe. Wie in Europa, wo Ideologie und Aggression vorwiegend aus der islamistischen, links- oder rechtsradikalen Szene kommen, bietet die Deutsche Schule auch in Shanghai den Feinden der Freiheit Raum. Wir fragen uns, wie die Freiheit verteidigt werden soll, wenn deutsche Institutionen Radikale ungestraft gewähren lassen. Neben solchen Unterschieden in der Weltanschauung nehmen Alma und Marina im Vergleich zu Deutschland ein stark ausgeprägtes Konkurrenzdenken unter den Schülern wahr.
Bald machen wir uns an die Wohnungssuche. Unsere Töchter freuen sich schon auf ein hübsches Haus, mit Garten und Terrasse. Damit wir uns in der Metropole zurechtfinden, beinhaltet das Umzugspaket meines Arbeitgebers Unterstützung durch einen freundlichen, englischsprachigen Helfer. Dieser holt uns an einem Samstag früh morgens ab. Wir brechen zu einer Rundtour zu bestimmt zwanzig Häusern in den typischen Siedlungen für wohlhabende Einheimische und die ausländischen Expats auf. Da Baugrund astronomisch teuer ist, liegen diese weitab vom Stadtzentrum, mindestens eine halbe Stunde Fahrt ins Büro, egal ob mit dem Auto oder mit der U-Bahn.
Von außen vermitteln diese Compounds einen adretten Eindruck. Umgeben von üppigem Grün und geschützt durch hohe, teils stacheldrahtbewehrte Mauern, unzählige Kameras und die allgegenwärtigen Security-Leute an den Zugängen, versprechen die Häuser im einheitlich gehaltenen Stil Sicherheit und großzügigen Wohnkomfort. Schon als wir das erste Haus betreten, verschlägt es uns den Atem. Das feuchtwarme Klima hat seine Spuren hinterlassen. Der Schimmel blüht, sofern er nicht gerade frisch übertüncht worden ist.