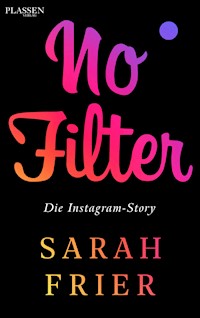
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die preisgekrönte Reporterin Sarah Frier enthüllt in ihrem Blick hinter die Kulissen, wie Instagram zu einer der kulturell prägendsten Apps des Jahrzehnts wurde. Gegründet im Jahr 2010, zog Instagram zunächst vor allem Kunsthandwerker an, bevor die Plattform den Durchbruch in den Massenmarkt schaffte und eine heute milliardenschwere Industrie schuf – die Influencer. 18 Monate nach dem Start trafen die Gründer die Entscheidung, das Unternehmen an Facebook zu verkaufen. Für die meisten Unternehmen wäre das das Ende der Geschichte, aber für Instagram war es erst der Anfang. Sarah Frier erzählt die fesselnde Geschichte, wie Instagram nicht nur eine neue Branche geschaffen, sondern auch unser Leben verändert hat – und sie tut dies virtuos auf Basis eines in diesem Maße noch nie gewährten Zugangs zu den verschiedenen Protagonisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
NO FILTER: The Inside Story of Instagram
ISBN 978-1-98212-680-3
Copyright der Originalausgabe 2020:
Copyright © 2020 by Sarah Frier.
All Rights Reserved.
Published by arrangement with the original publisher, Simon & Schuster, Inc.
Copyright der deutschen Ausgabe 2020:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Übersetzung: Egbert Neumüller
Umschlaggestaltung: Pete Garceau
Gestaltung, Satz und Herstellung: Johanna Wack
Lektorat: Karla Seedorf
ISBN 978-3-86470-696-7eISBN 978-3-86470-697-4
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
Für Matt
Das kleine Instagram-Team in der Facebook-Zentrale, 2015,
Foto: John Barnett
Inhalt
Vorbemerkung der Autorin
Einführung: Der ultimative Influencer
Projekt Codename
Das Chaos des Erfolgs
Die Überraschung
Ein Sommer in der Vorhölle
Schnell sein ohne Rücksicht auf Verluste
Vorherrschaft
Der neue Star
Insta-würdig werden
Das Problem Snapchat
Kannibalisierung
Andere Fake News
Der CEO
Epilog: Der Preis der Übernahme
Danksagungen
Anmerkungen
Vorbemerkung der Autorin
Dieses Buch ist der Versuch, Ihnen die definitive Geschichte von Instagram nahezubringen und hinter die Kulissen zu blicken. Ohne die Hunderte von Menschen – derzeitige und ehemalige Mitarbeiter, Manager und andere, die ihre Karriere auf die App aufgebaut haben, sowie Konkurrenten –, die ihre Zeit zur Verfügung gestellt und Erinnerungen mitgeteilt haben, die sie noch nie einem Journalisten erzählt hatten, wäre es nicht möglich gewesen. Die Gründer von Instagram sprachen über mehrere Jahre hinweg gemeinsam und separat mit mir. Facebook gewährte mir mehr als zwei Dutzend persönliche Interviews mit derzeitigen Mitarbeitern und Führungskräften, unter anderem mit dem derzeitigen Chef von Instagram, auch noch nachdem die Gründer das Unternehmen verlassen hatten.
Trotz der Spannungen zwischen den Gründern und der Firma, die sie übernommen hatte, und trotz der zahlreichen kritischen Artikel, die ich als Journalistin für Bloomberg News über Facebook schrieb, waren sich alle einig, es sei wichtig, dass dieses Buch so zutreffend wie möglich wird. Wenn potenzielle Quellen meine Kontaktanfrage an die Gründer oder das Unternehmen weitergaben, um zu fragen, ob es in Ordnung sei, mit mir zu sprechen, bekamen sie meistens ein Ja, obwohl sowohl das Unternehmen als auch die Gründer wussten, dass sie keine Kontrolle über den endgültigen Inhalt dieses Buches haben würden. Diese Entscheidung spricht für sie.
Trotzdem sprachen die meisten Quellen für dieses Buch ohne ausdrückliche Erlaubnis des Unternehmens oder ohne sein Wissen mit mir. Dabei liefen sie Gefahr, gegen die Vertraulichkeitsvereinbarungen zu verstoßen, die Mitarbeiter bei der Einstellung unterschreiben. Tatsächlich muss sogar jeder Nichtjournalist, der die Unternehmenszentrale von Facebook besucht, beim Passieren der Sicherheitskontrollen eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen, bevor er sich mit einem Mitarbeiter treffen darf. Aus diesem Grund gaben die meisten meiner Quellen ihre Interviews, Dokumente und sonstigen Unterlagen nur anonym.
Dieser Kontext ist wichtig, um zu verstehen, warum ich das Buch so geschrieben habe, wie ich es getan habe: Ich präsentiere die Geschichte im Erzählstil aus einer allwissenden Perspektive, die alle erwähnten unterschiedlichen Gedächtnisse beinhaltet. Um meine Quellen zu schützen, sage ich nicht direkt, wer mir welche Information mitteilte. Wenn ich auf Nachrichtenmeldungen aufbaue, zitiere ich die Berichterstattung in den Endnoten. Ich habe mich dafür entschieden, nur dann aus aufgezeichneten Interviews zu zitieren, wenn ich einen Außenstehenden ins Spiel bringe, beispielsweise eine prominente Persönlichkeit oder einen Influencer, deren Perspektive uns besser verstehen lässt, wie sich die App auf die Welt auswirkt.
Seit Beginn des Projekts bat ich um ein Interview mit Mark Zuckerberg für dieses Buch, und hoffte, eins zu bekommen. Ich argumentierte, dass der Facebook-CEO, den ich in den Jahren zuvor schon mehrmals interviewt hatte und den ich bei seiner Aussage vor dem US-Kongress 2018 zehn Stunden lang beobachtet hatte, in der Vorstellung der Öffentlichkeit gewissermaßen zum Bösewicht geworden ist. Ich sagte einem Vertreter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, ein Buch wie dieses sei eine Gelegenheit, sich all die wichtigen Momente anzuschauen, über die wir in der Geschichte von Facebook geschrieben haben, und bei allem nachzubohren, was wir nicht vollständig verstanden, als es geschah.
Es gebe zwar viele unangenehme Fragen, die ich stellen könnte, aber ich würde mit einer einfachen anfangen. Warum wollte Zuckerberg Instagram kaufen? Ich wolle keine Antwort aus seinem Blog, sondern eine persönliche Story. Welche Schritte und Auslöser veranlassten ihn, an einem Donnerstag im April 2012 zu beschließen, er müsse das Telefon in die Hand nehmen und alle Hebel in Bewegung setzen, um das Unternehmen so bald wie möglich zu kaufen? Und es nicht nur zu kaufen, sondern sich zu verpflichten, es unabhängig bleiben zu lassen?
Einen Monat, bevor ich das Manuskript abgeben musste, erhielt ich von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit eine E-Mail von Facebook mit einer Antwort auf diese Frage, die angeblich von Zuckerberg stammte:
„Ganz einfach: Das war ein großartiger Dienst, und wir wollten ihm beim Wachsen helfen.“
Das ist alles, was ich in dieser Angelegenheit zum Zitieren bekam. Um Ihnen die ganze Geschichte zu vermitteln, griff ich daher auf andere Menschen zurück, die sich daran erinnern, was Zuckerberg in entscheidenden Momenten gesagt oder gedacht hat – soweit sich das aus seinen Aussagen gegenüber Kollegen schließen lässt. Einige dieser Erinnerungen wollte ich mit Facebook abgleichen, aber meistens äußerte sich das Unternehmen zu solchen Anekdoten nicht.
Grundsätzlich sollte der Leser nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die in diesem Buch zu Wort kommen, exakt diesen Dialog mit mir geführt haben. In den meisten Fällen gaben mir Personen bei unseren Gesprächen ihre Worte aus dem Gedächtnis wieder, und manchmal erinnerten sich andere genauer an die Details. Dialoge habe ich genauso niedergeschrieben, wie sie mir in Interviews vermittelt wurden, weil ich den Werdegang von Instagram so zu zeigen versuche, wie sich die Beteiligten daran erinnern. Es kann aber sein, dass sich meine Quellen – selbst diejenigen, die sich an ihre Gedanken und Worte erinnern – in vereinfachter oder unzutreffender Form oder auf eine Weise erinnern, die anderen Quellen widerspricht, weil sich die Instagram-Story über zehn Jahre erstreckt. Dieses Buch ist mein bestmögliches Bemühen, die Wahrheit über die Instagram-Story zu liefern, ohne Filter bis auf meinen eigenen.
Einführung: Der ultimative Influencer
In der brasilianischen Stadt São Paulo gibt es eine Freiluft-Galerie für Streetart namens Beco do Batman oder Batman’s Alley. Diesen Namen hatte sie schon lange vor der Schöpfung einer ihrer denkwürdigeren Wandmalereien, die auf gut fünf Metern abgeplatzter Farbe die brasilianische Fußballerlegende Pelé in einer Umarmung mit dem „dunklen Ritter“ zeigt. Dass es sich um Pelé handelt, sieht man nur an dem Trikot mit der Nummer 10, das seinen Namen trägt. Sein Gesicht ist abgewandt und er presst eine Wange an Batmans Maske, vielleicht küsst er ihn oder flüstert ihm ein Geheimnis zu, während Batmans Hand über Pelés unteren Rücken streicht.
An einem Samstag im März steht eine junge Frau, etwa so groß wie die Nummer auf Pelés Trikot, vor dem Wandgemälde. Mit ihrer Sonnenbrille, roten Turnschuhen und einem weiten weißen Top wirkt sie gewollt locker. Ihr Freund fotografiert sie mehrmals, wie sie lächelt und dann den Blick nachdenklich in die Ferne schweifen lässt. Sie gehen zum nächsten Bild und wieder zum nächsten, wobei sie bei den beliebteren Hintergründen geduldig warten, bis sie an der Reihe sind. Dutzende andere Menschen tun das Gleiche, darunter drei werdende Mütter in bauchfreien Tops, die Freunde mitgebracht haben, um die Größe ihrer Babybäuche vor einer surrealen violetten Orchidee zu dokumentieren. Daneben posiert ein blondes kleines Mädchen in paillettenbesetzten blauroten Shorts, mit rotem Lippenstift und einem T-Shirt mit der Aufschrift „Daddy’s Little Monster“ vor einem ominösen Vogel mit einem Baseballschläger in der Hand. Ihre Mutter weist sie an, den Schläger höher und fester zu halten und mehr auszusehen wie Harley Quinn aus der Comic-Reihe „Suicide Squad“. Sie gehorcht.
Entlang der sich windenden Gasse profitieren Händler von den Menschenmassen, denen sie Bier und Schmuck verkaufen. Ein Mann schrammelt auf einer Gitarre, während er auf Portugiesisch singt und hofft, Fans für seine Musik zu gewinnen. Auf sein Instrument hat er ein großes Blatt Papier mit dem Namen seines Social-Media-Accounts und dem Logo der einzigen App geklebt, auf die es hier ankommt: Instagram.
Mit dem Aufstieg von Instagram ist der Beco do Batman zu einer der bedeutendsten touristischen Sehenswürdigkeiten von São Paulo geworden. Auf der Ferienwohnungs-Website Airbnb verlangen Anbieter circa 40 Dollar pro Person für zwei Stunden in der Gasse mit einem „persönlichen Paparazzo“, der hochwertige Aufnahmen von Menschen macht, die sie dann auf Instagram posten; dieser Service gehört zu einem Typus, der zu einem der berühmtesten von Airbnb für Städtereisende auf der ganzen Welt geworden ist.
Der einzige Aufwand für Amateurfotografen ist der Stress der Perfektion. Eine Mutter bändigt zwei kleine Kinder, die sich um eine Coladose streiten, damit ihre Schwester anstehen kann, um vor großen grünblauen Pfauenfedern zu posieren. Der Teenager, der gerade mit den Pfauenfedern dran war, wird wütend auf seinen Freund, weil der die Gelegenheit durch eine unschmeichelhafte Perspektive vertan hat. Aber niemand fotografiert die Fotografierenden; auf Instagram werden die aufpolierten Bilder zur Wirklichkeit und treiben immer noch mehr Besucher an diesen Ort.
Ich kam auf Empfehlung eines Mannes namens Gabriel in die Gasse, der an meinem ersten Abend in Brasilien zufällig in einer Sushi-Bar neben mir saß. Meine portugiesischen Sprachkenntnisse waren so schlecht, dass er für die Restaurantmitarbeiter dolmetschte. Ich erklärte ihm, dass ich hergereist war, um mehr über Instagram und seine weltweiten Auswirkungen auf die Kultur herauszufinden. Während wir sprachen und der Koch Sashimi und Nigiri servierte, fotografierte er jedes Gericht, um es in seiner Instagram-Story zu posten, und klagte gleichzeitig, seine Freunde seien derart besessen davon, ihr Leben zu teilen, dass er sich nicht sicher sei, ob sie überhaupt noch ein Leben führten.
Jeden Monat nutzen eine Milliarde von uns Instagram. Wir nehmen Fotos und Videos von unserem Essen, unseren Gesichtern, unserer Lieblingslandschaft, unseren Familien und unseren Interessen auf und teilen diese in der Hoffnung, dass sie etwas davon wiedergeben, wer wir sind beziehungsweise sein möchten. Wir interagieren mit diesen Postings und miteinander und versuchen so, tiefergehende Beziehungen, stärkere Netzwerke oder persönliche Marken aufzubauen. So funktioniert eben das moderne Leben. Nur selten haben wir Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir dahin gekommen sind und was das bedeutet.
Das sollten wir aber tun. Instagram war eine der ersten Apps, die unsere Beziehung zu unseren Handys vollständig ausnutzten und uns zwangen, das Leben um den Lohn digitaler Bestätigung durch eine Kamera zu erleben. Die Geschichte von Instagram ist eine eindrückliche Lektion darüber, dass sich Entscheidungen innerhalb eines Social-Media-Unternehmens – auf welche Nutzer es hören soll, welche Produkte aufgebaut werden und wie Erfolg gemessen werden soll – dramatisch auf unsere Lebensweise und darauf auswirken können, wer in unserer Wirtschaft belohnt wird.
Ich möchte Sie mit hinter die Kulissen zu den Gründern Kevin Systrom und Mike Krieger nehmen, als sie überlegten, was sie mit der Macht ihres Produkts über unsere Aufmerksamkeit anfangen sollten. Jede Entscheidung, die sie trafen, hatte eine drastische Wirkung, die sich allmählich ausbreitete. Beispielsweise sicherten sie durch den Verkauf ihres Unternehmens an Facebook die Langlebigkeit von Instagram und halfen dem Social-Media-Giganten gleichzeitig, noch mächtiger und respekteinflößender im Vergleich zur Konkurrenz zu werden. Nach dem Verkauf verloren die Instagram-Gründer ihre Illusionen über Facebooks utilitaristische Kultur des Wachstums um jeden Preis und stellten sich dagegen, indem sie sich lieber auf den Aufbau eines sorgfältig durchdachten Produkts konzentrierten, bei dem die Popularität durch die Geschichten bestimmt wird, die Instagram selbst über seine Hauptnutzer erzählt. Dieser Plan funktionierte so gut, dass der Erfolg von Instagram schließlich Facebook und dessen CEO Mark Zuckerberg bedrohte.
Auf die Art, wie die Geschichte für die Instagram-Gründer endete – sie verließen das Unternehmen im Jahr 2018 unter Spannungen –, wird sie für uns nicht enden. Instagram ist mittlerweile derart mit unserem täglichen Leben verflochten, dass man die Story des Unternehmens nicht von seinen Auswirkungen auf uns loslösen kann. Instagram ist zu einem Instrument geworden, mit dem kulturelle Relevanz gemessen wird, sei es in der Schule, in einer auf Interessen gegründeten Gemeinschaft oder in der Welt. Ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung strebt nach digitaler Anerkennung und Bestätigung, und viele Menschen bekommen sie in Form von Likes, Kommentaren, Followern und Markendeals. Innerhalb und außerhalb von Facebook dreht sich die Instagram-Story letzten Endes um die Schnittstelle von Kapitalismus und Selbstwertgefühl – um die Frage, wie weit Menschen gehen, um zu bewahren, was sie aufgebaut haben, und um erfolgreich zu erscheinen.
Die App ist zu einer Prominente produzierenden Maschine geworden, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Mehr als 200 Millionen Instagram-Nutzer haben jeweils mehr als 50.000 Follower; laut Dovetale, einem Unternehmen, das Influencer-Analysen durchführt, kann man auf diesem Niveau seinen Lebensunterhalt verdienen, indem man im Auftrag von Marken postet. Weniger als ein Hundertstel Prozent der Instagram-Nutzer hat mehr als eine Million Follower. In dem riesigen Maßstab von Instagram entsprechen diese 0,00603 Prozent allerdings mehr als sechs Millionen Insta-Stars, von denen die meisten nur durch die App berühmt wurden. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, bedenken Sie, dass Millionen Menschen und Marken mehr Instagram-Follower haben, als die New York Times Abonnenten hat. Marketing mithilfe dieser Menschen, die im Grunde mittels Trendsetting, Geschichtenerzählen und Unterhaltung private Medienunternehmen betreiben, ist inzwischen ein Milliardengeschäft.
All diese Aktivitäten sind in unsere Gesellschaft eingesickert und wirken auf uns ein, ob wir nun Instagram nutzen oder nicht. Unternehmen, die unsere Aufmerksamkeit wollen – von Hotels und Restaurants bis hin zu großen Verbrauchermarken –, ändern die Gestaltung ihrer Räumlichkeiten und die Werbung für ihre Produkte, indem sie ihre Strategien an unsere neue visuelle Kommunikationsweise anpassen, sodass sie ein Foto für Instagram wert sind. Schaut man sich an, wie Geschäftsräume, Produkte und sogar Wohnungen gestaltet werden, sieht man den Einfluss von Instagram auf eine Weise, wie das bei Facebook oder Twitter nicht so leicht der Fall ist.
Zum Beispiel hat der Workspace in San Francisco, in dem ich dieses Buch schreibe, die Bücher in seiner Bibliothek weder nach Titel noch nach Autor geordnet, sondern nach der Farbe des Umschlags: Diese Entscheidung leuchtet ein, wenn einem Instagram-Ästhetik wichtiger ist als das Auffinden eines Buches. Eine in Manhattan gegründete Burgerkette namens Black Tap kreierte riesenhafte Milchshakes, auf denen ganze Kuchenstücke schwammen, und monatelang standen die Menschen bis um die Ecke Schlange, um sie zu kaufen. Zwar schafften die Kunden dieses Dessert nur selten, aber sie verspürten den Drang, es zu fotografieren. In Japan gibt es ein Wort für diese Bewegung des instagramtauglichen Designs: insta-bae. Je mehr insta-bae etwas ist – sei es ein Kleidungsstück oder ein Sandwich –, umso größer ist sein Potenzial für gesellschaftlichen und kommerziellen Erfolg.
In London erklärte mir ein Student, eine größere Anzahl von Instagram-Followern bedeute, dass man mit größerer Wahrscheinlichkeit für eine Führungsposition ausgewählt wird. In Los Angeles sprach ich mit einer Frau, die von Gesetzes wegen noch keinen Alkohol trinken darf, wegen ihrer beträchtlichen Instagram-Gefolgschaft jedoch von Club-Werbern zu exklusiven Veranstaltungen geladen wird. In Indonesien unterhielt ich mich mit einem Elternteil, dessen Tochter in Japan zur Schule geht und jeden Sommer kofferweise japanische Konsumartikel mitbringt, die mittels auf Instagram geposteter Fotos vor Ort verkauft werden. Ich habe mit einem brasilianischen Paar gesprochen, das in der Küche seiner Wohnung eine Bäckereifirma mit Zigtausenden Followern aufgebaut hat, weil die Donuts so geformt sind, dass sie die Worte „I love you!“ bilden.
Instagram befeuert Karrieren und sogar Star-Imperien. Kris Jenner, Managerin der Reality-TV-Familie Kardashian-Jenner, sagt, Instagram habe ihren Job über die Sendung „Keeping Up with the Kardashians“ hinaus in einen sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufenden Content- und Werbezyklus verwandelt. Sie wacht zwischen halb fünf und fünf Uhr morgens in ihrem palastähnlichen Haus im kalifornischen Hidden Hills auf und checkt Instagram, bevor sie irgendetwas anderes tut. „Ich kann buchstäblich auf Instagram gehen und nach meiner Familie schauen, nach meinen Enkeln, nach meinen Geschäften“, erklärt sie. „Ich schaue einfach gleich nach meinen Kindern. Was machen alle? Sind sie wach? Posten sie pünktlich Fotos fürs Geschäft? Haben sie Spaß?“
Der Instagram-Zeitplan wird in Kris’ Büro gepostet, aber sie bekommt auch jeden Abend und jeden Morgen einen Ausdruck davon. Sie und ihre Kinder vertreten zusammen Dutzende Marken, darunter Adidas, Calvin Klein und Stuart Weitzman, außerdem bewerben sie ihre eigenen Kosmetik- und Schönheitsprodukte. Die fünf Schwestern der Familie – Kim Kardashian West, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian – erreichen gemeinsam über eine halbe Milliarde Follower.
An dem Tag, an dem wir miteinander sprechen, ist Kris unterwegs zu einer instagramtauglichen Party zum Thema Pink, um im Auftrag ihrer Schwester Kylie eine Hautpflegeserie zu lancieren. Sie erinnert sich an das erste Mal, als Kylie sie fragte, ob es okay wäre, ein Lippenstift-Business aufzubauen, einfach nur über ihren Instagram-Feed, ohne physische Produkte in Geschäften. „Ich sagte zu ihr: ‚Fang mit drei Farben in deinem Kästchen an, und das müssen Farben sein, die du wirklich liebst‘“, erinnert sich Kris. „Entweder wird es fantastisch und geht weg wie warme Semmeln, oder es wird ein Flop und du trägst für den Rest deines Lebens diese drei Farben.“
Beide waren 2015 in Kris’ Büro, als Kylie den Link zur Website postete. Innerhalb von Sekunden war das Produkt komplett ausverkauft. „Ich dachte, etwas wäre schiefgegangen“, erinnert sich Kris. „Ist das kaputt? Ist die Website zusammengebrochen. Was ist passiert?“
Das war kein Glücksfall, sondern schlicht der Hinweis, dass die Menschen alles tun würden, was ihnen ihre Tochter sagen würde. In den nächsten Monaten warteten jedes Mal, wenn Kylie auf Instagram neue Produkte ankündigte, mehr als 100.000 Menschen auf ihrer Website darauf, dass sie einschlugen. Vier Jahre später, als Kylie 21 Jahre alt war, brachte Forbes sie auf dem Titel und erklärte sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Inzwischen scheint jeder Schönheitsguru auf Instagram seine eigene Kosmetiklinie zu haben.
Diese Zahl – eine Milliarde – hat in unserer Gesellschaft eine gewisse Kraft. Diese Marke bedeutet insbesondere in der Geschäftswelt, dass man einen einzigartigen unantastbaren Status erreicht hat, dass man in einen Ehrfurcht einflößenden und nachrichtenwürdigen Rang gehoben wurde. Als Forbes 2018 in einem Artikel schrieb, das Vermögen von Jenner stehe kurz vor der Schwelle von 900 Millionen Dollar, forderte Josh Ostrovsky, der Inhaber des beliebten und umstrittenen humorigen Instagram-Accounts @thefatjewish, seine Follower auf, für eine Crowdfunding-Kampagne zu spenden, um 100 Millionen Dollar für Kylie zusammenzubringen: „Ich will nicht in einer Welt leben, in der Kylie nicht eine Milliarde Dollar hat“, schrieb er in seiner Bildunterschrift und löste damit einen viralen Strudel augenzwinkernder Nachrichten aus.
Nachdem Instagram von Facebook übernommen worden war – durch einen Deal, der die Branche schockierte –, wurde es die erste mobile App, die eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erzielte. Der Erfolg von Instagram war wie bei allen Start-ups unwahrscheinlich. Als die App 2010 startete, war sie weder ein Beliebtheitswettbewerb noch ein Weg zum persönlichen Branding. Sie fasste Fuß, weil man hier einen Blick in das Leben anderer Leute werfen und sehen konnte, was die anderen gefiltert durch die Handykameras erlebten.
Laut Chris Messina, dem Technologen, der Nutzer Nummer 19 war und das Hashtag erfunden hat, war die Einführung der visuellen Perspektiven anderer Menschen auf Instagram eine atemberaubende Neuerung – vielleicht gleichwertig mit dem psychischen Phänomen, das Astronauten erleben, wenn sie zum ersten Mal die Erde aus dem Weltraum sehen. Auf Instagram konnte man in das Leben eines Rentierhirten in Norwegen oder eines Korbflechters in Südafrika blicken. Und man konnte sein eigenes Leben auf eine Weise teilen und reflektieren, die sich tiefgründig anfühlte.
„Es gewährt diesen flüchtigen Blick auf die Menschheit und verändert die gesamte Sichtweise auf alles und auf dessen Bedeutung“, erläutert Messina. „Instagram hält uns den Spiegel vor und ermöglicht uns allen, mit unseren persönlichen Erfahrungen zum Verständnis dieser Welt beizutragen.“
Als Instagram größer wurde, versuchten seine Gründer, dieses Gefühl des Entdeckens zu bewahren. Sie wurden zu ästhetischen Trendsettern einer Generation und waren dafür verantwortlich, dass wir nun von einer Verehrung visuell fesselnder Erlebnisse durchdrungen sind, die wir mit unseren Freunden und mit Fremden gegen die Belohnung durch Likes und Follower teilen können. Sie investierten massiv in eine redaktionelle Strategie, um zu zeigen, wie Instagram ihrer Meinung nach genutzt werden sollte: als Treffpunkt für verschiedene Sichtweisen und Kreativität. Sie mieden einige von Facebooks spamartigen Taktiken wie etwa das Versenden übertrieben vieler Mitteilungen und E-Mails. Sie widerstanden der Versuchung, Tools hinzuzufügen, die die Influencer-Wirtschaft gefördert hätten. Man kann beispielsweise in ein Posting keinen Hyperlink einfügen oder das Posting von jemandem so teilen, wie das auf Facebook möglich ist.
Und bis vor Kurzem hatten sie niemals die Messgrößen verändert, um es uns zu ermöglichen, sich mit anderen zu vergleichen und eine höhere Ebene der Relevanz zu erreichen. Instagram gab seinen Usern in der App drei einfache Kennzahlen für ihre Leistung an die Hand: die Zahl der „Follower“, eine Zahl für „Following“ und die Zahl der „Likes“ für ihre Fotos. Diese Feedback-Punkte reichten aus, damit das Erlebnis spannend und sogar süchtig machend wurde. Mit jedem Like und jedem Follow bekam ein Instagram-Nutzer eine kleine, befriedigende Belohnung, sodass in den Belohnungszentren des Gehirns Dopamin ausgeschüttet wurde. Mit der Zeit fanden die Menschen heraus, wie man auf Instagram gut wird, und so erschlossen sie sich einen sozialen Status und sogar kommerzielles Potenzial.
Und aufgrund der Filter, die anfangs unsere suboptimalen Handyfotos verbesserten, war Instagram anfangs ein Ort für aufgehübschte Bilder vom Leben der Menschen. Die Nutzer begannen zu akzeptieren, dass grundsätzlich alles, was sie sahen, bearbeitet worden war, damit es besser aussah. Realismus war weniger wichtig als Ehrgeiz und Kreativität. Die Instagram-Community erfand sogar das Hashtag #nofilter, um andere wissen zu lassen, dass sie etwas Unbearbeitetes, Echtes posteten. Der Instagram-Account mit den meisten Followern – 322 Millionen – ist der vom Unternehmen kontrollierte Account @instagram. Das passt, denn Instagram hat den allergrößten Einfluss auf die Welt, die es geformt hat. Im Jahr 2018 erreichte Instagram eine Milliarde monatliche Nutzer – seinen zweiten „1-Milliarde-Meilenstein“. Bald danach verließen die Gründer ihre Arbeitsplätze. Systrom und Krieger stellten fest, dass man selbst dann, wenn man die höchsten Ränge des geschäftlichen Erfolgs erreicht, nicht immer das bekommt, was man will.
Projekt Codename
Kevin Systrom, Instagram-Mitgründer Ich sage immer, dass ich gefährlich genug bin, um zu programmieren, und gesellig genug, um unser Unternehmen gut zu verkaufen. Und ich halte das in unternehmerischer Hinsicht für eine unschlagbare Kombination.1
Kevin Systrom hatte nicht die Absicht, das Studium abzubrechen, aber auf jeden Fall wollte er sich mit Mark Zuckerberg treffen.
Der 1,95 m große Systrom mit seinem braunen Haar, seinen zusammengekniffenen Augen und seinem rechteckigen Gesicht hatte den Gründer eines örtlichen Start-ups bereits früher im Jahr 2005 über Freunde von der Stanford University beim Biertrinken aus Plastikbechern auf einer Party in San Francisco kennengelernt. Zuckerberg wurde durch seine Arbeit an TheFacebook.com, einem sozialen Netzwerk, das er ein Jahr zuvor an der Harvard University gegründet hatte und das sich an Colleges im ganzen Land ausbreitete, zum Wunderkind der Technologiebranche. Studenten nutzten die Website, um kurz mitzuteilen, was sie gerade machten, und um ihren Status dann auf ihren Facebook-„Walls“ zu posten. Die Website war einfach gehalten, ein weißer Hintergrund mit blauem Rand, nicht wie das soziale Netzwerk Myspace mit seinen grellen Designs und wählbaren Schriftarten. Und sie wuchs so schnell, dass Zuckerberg fand, es gebe keinen Grund, weiterzustudieren.
In der Zao Noodle Bar in der University Avenue, etwa eine Meile vom Universitätscampus entfernt, versuchte Zuckerberg, Systrom zu der gleichen Entscheidung zu überreden. Beide waren schon alt genug, um Alkohol zu trinken, aber Zuckerberg – etwa 25 Zentimeter kleiner als Systrom, mit hellen Locken und blasser, rosiger Haut, der stets Adidas-Slippersandalen, weite Jeans und einen Hoodie mit Reißverschluss trug – sah viel jünger aus. Er wollte dem Facebook-Erlebnis neben dem Profilbild weitere Fotos hinzufügen und er wollte, dass Systrom dieses Tool erstellte.
Systrom freute sich, dass Zuckerberg, den er für hyperintelligent hielt, ihn engagieren wollte. Sich selbst hielt er nicht für einen genialen Programmierer. An der Stanford University kam er sich wie ein normaler Mensch unter Wunderkindern aus aller Welt vor und er schaffte in seinem ersten und einzigen Informatikkurs gerade mal eine Zwei. Allerdings passte er in die allgemeine Kategorie dessen, was Zuckerberg brauchte. Er mochte die Fotografie, und eines seiner Nebenprojekte war eine Website namens Photobox, auf der man große Bilddateien hochladen und dann teilen oder ausdrucken konnte, was vor allem nach Partys seiner Studentenvereinigung Sigma Nu geschah.
Photobox reichte aus, um Zuckerbergs Interesse zu wecken, der damals nicht sehr wählerisch war. Die Personalbeschaffung ist beim Aufbau eines Start-ups immer der schwierigste Teil, und TheFacebook.com wuchs so schnell, dass er die Räume mit Leuten füllen musste. Früher in jenem Jahr konnte man Zuckerberg vor dem Informatikgebäude der Universität mit einem Plakat über sein Unternehmen stehen sehen, weil er hoffte, auf die gleiche Art Programmierer zu gewinnen, wie Vereine auf dem Campus Mitglieder warben. Er hatte sich eine Überzeugungsstrategie zurechtgelegt und erklärte Systrom, er biete ihm die einmalige Chance, von Anfang an bei etwas dabei zu sein, das wirklich riesengroß würde. Als Nächstes werde sich Facebook Schülern und schließlich der ganzen Welt öffnen. Das Unternehmen wolle sich noch mehr Geld von Wagniskapitalgebern beschaffen, und eines Tages könne es größer als Yahoo!, Intel oder Hewlett-Packard werden.
Und dann, als das Restaurant Zuckerbergs Kreditkarte durchs Gerät zog, funktionierte sie nicht. Er schob das auf den Präsidenten des Unternehmens, Sean Parker.
Ein paar Tage danach ging Systrom mit der ihm im Rahmen des Entrepreneurship-Programms zugewiesenen Mentorin in dem Vorgebirge in der Nähe des Campus spazieren – Fern Mandelbaum, die 1978 in Stanford ihren MBA in Venture-Investing gemacht hatte. Sie befürchtete, Systrom würde sein Potenzial vergeuden, wenn er alles wegen der Vision eines anderen aufgeben würde. „Machen Sie dieses Facebook-Zeug nicht“, sagte sie. „Das ist eine Modeerscheinung. Das führt zu nichts.“
Systrom fand, sie habe recht. Ohnehin war er ja nicht ins Silicon Valley gekommen, um durch ein Start-up schnell reich zu werden. Er hatte vor, in Stanford eine Ausbildung von Weltrang und einen Abschluss zu bekommen. Er dankte Zuckerberg für seine Zeit und plante dann ein Abenteuer anderer Art: im Rahmen des Entrepreneurship-Programms von Stanford ein Auslandsstudium in Florenz zu absolvieren. Doch sie würden in Kontakt bleiben.
Florenz sprach Systrom auf eine Art und Weise an, wie TheFacebook es nicht tat. Er wusste nicht recht, ob er im Technologiebereich arbeiten sollte. Als er sich in Stanford beworben hatte, hatte er vorgehabt, Bautechnik und Kunstgeschichte zu studieren. Er stellte sich vor, durch die Welt zu reisen und alte Kathedralen oder Gemälde zu restaurieren. Ihm gefiel die Wissenschaft, die hinter der Kunst steht, und dass eine einfache Neuerung – zum Beispiel die Wiederentdeckung der Zentralperspektive durch den Architekten Filippo Brunelleschi in der Renaissance – die Kommunikation der Menschen vollständig verändern kann. Während des größten Teils der Geschichte des Abendlands waren die Gemälde flach und comicähnlich gewesen, aber ab dem 15. Jahrhundert verlieh ihnen die Perspektive Tiefe und machte sie fotorealistisch und emotional.
Systrom mochte es, darüber nachzudenken, wie die Dinge gemacht werden, und er entschlüsselte gerne die Systeme und Details, auf die es ankam, wenn man etwas Hochwertiges herstellen wollte. In Florenz begeisterte er sich für italienische Handwerkskünste; er lernte den Ablauf der Weinherstellung, das Verfahren, Leder für Schuhe zuzuschneiden und zu nähen, und die Techniken, um einen annehmbaren Cappuccino zu fabrizieren.
Schon in seiner geborgenen Kindheit erkundete Systrom seine Hobbys mit geradezu akademischem Eifer und in dem Streben nach Perfektion. Er wurde im Dezember 1983 geboren und wuchs mit seiner Schwester Kate in einem zweistöckigen Haus mit einer langen Einfahrt an einer Allee im vorstädtischen Holliston im Bundesstaat Massachusetts, etwa eine Stunde westlich von Boston, auf. Seine energische Mutter Diane war Marketingvorstand der nahe gelegenen Firma Monster.com und später bei Zipcar, und sie machte ihre Kinder schon in der Zeit mit dem Internet vertraut, als man sich noch über Telefonleitungen einwählen musste. Sein Vater Doug war Personalmanager des Konglomerats, dem die Discounter Marshalls und HomeGoods gehörten. Systrom war ein ernstes, neugieriges Kind, das gerne in die Bücherei ging und auf dem Computer das futuristische, von Dämonen bevölkerte Ego-Shooter-Spiel Doom II spielte. Er lernte zu programmieren, indem er eigene Levels für das Spiel entwickelte.
Er sprang von einer intensiven Leidenschaft zur nächsten und machte Phasen durch, von denen jeder in seiner Umgebung hören musste – manchmal buchstäblich: In seiner DJ-Phase an der Middlesex School kaufte er zwei Plattenspieler und ließ eine Antenne aus seinem Internatszimmer ragen, um sein eigenes Radioprogramm zu senden, in dem er elektronische Musik spielte – damals noch eine Nische. Schon als Teenager mogelte er sich in Clubs, in die man erst ab 21 durfte, um dort seine Idole in Action zu erleben, hielt sich aber doch so weit an die Regeln, dass er dort keinen Alkohol trank.2
Entweder mochten die Menschen Systrom sofort, oder sie schrieben ihn als eingebildet und arrogant ab, als jemanden, der sich aufspielt. Er konnte anderen gut zuhören, brachte ihnen aber auch sehr gern bei, wie man etwas richtig macht. Damit rief er, da seine Leidenschaften so vielfältig waren, entweder Faszination oder Augenrollen hervor. Er gehörte zu den Menschen, die sagen, sie könnten etwas nicht gut, obwohl sie es gut können, oder sie seien nicht cool genug, etwas zu tun, obwohl sie cool genug sind, und bewegte sich auf dem schmalen Grat zwischen Kontaktfreude und falscher Bescheidenheit. Beispielsweise erwähnte er, um ins Silicon Valley zu passen, oft seine Referenzen aus der Highschool-Zeit als Nerd – die Videospiele und seine Programmiertätigkeit –, aber selten, dass er auch Kapitän der Lacrosse-Mannschaft3 oder dafür zuständig gewesen war, Werbung für Partys seiner Studentenverbindung zu machen. Seine Verbindungsbrüder betrachteten ihn als innovativ, weil er virale Videos einsetzte und damit Tausende Besucher einlud. Systroms erste derartige Produktion aus dem Jahr 2004 hieß Moonsplash und zeigte Verbindungsmitglieder, die in freizügigen Kostümen zu „Drop It Like It’s Hot“ von Snoop Dogg tanzen. Bei diesen Veranstaltungen war Systrom immer der DJ.
Eines seiner langanhaltendsten persönlichen Interessengebiete war die Fotografie. In einem Kurs an der Highschool schrieb er, er setze dieses Medium gern ein, „um allen meinen Blick auf die Welt zu zeigen“ und „andere dazu anzuregen, die Welt auf eine neue Art zu betrachten“4. Vor seiner Reise nach Florenz, dem Epizentrum der Renaissance, von der er schon so viel gehört hatte, sparte er, damit er sich nach intensiven Recherchen eine der besten auf dem Markt erhältlichen Kameras mit dem schärfsten Objektiv kaufen konnte. Diese wollte er für seinen Fotografie-Kurs benutzen.
Sein Lehrer in Florenz, ein Mann namens Charlie, war davon nicht beeindruckt. „Du bist nicht hier, um perfekte Fotos zu schießen“5, sagte er. „Gib mir die mal.“
Systrom dachte, der Professor wollte die Kamera anders einstellen. Stattdessen brachte er den stolz gekauften Apparat in sein Hinterzimmer und kam mit einem kleineren zurück, einer Holga, die nur verschwommene quadratische Schwarzweiß-Aufnahmen machte. Sie war aus Kunststoff, wie ein Spielzeug. Charlie erklärte Systrom, in den kommenden drei Monaten dürfe er seine tolle Kamera nicht benutzen, weil ein hochwertigeres Werkzeug nicht unbedingt bessere Kunst hervorbringen würde. „Du musst lernen, die Unvollkommenheit zu lieben“, wies er ihn an.
Über den Winter des Jahres 2005 schoss Systrom hier und da in Cafés Fotos und versuchte, die Schönheit verschwommener, unscharfer Bilder schätzen zu lernen. Die Idee – ein quadratisches Foto, das durch Nachbearbeitung zum Kunstwerk wird – setzte sich in Systroms Hinterkopf fest. Noch wichtiger war die Lektion, dass etwas technisch Komplexeres nicht unbedingt besser ist.
Derweil machte er Pläne für den bevorstehenden Sommer. Im Rahmen des Stanford Mayfield Fellows Program, zu dem er nur knapp zugelassen worden war, brauchte er ein Praktikum bei einem Start-up.6 Wie alle Studenten in Stanford saß er bei der Wiederauferstehung des Internets in der ersten Reihe. Bei der ersten Generation des Internets ging es darum, Informationen und Unternehmen online zu bringen, und dies entfachte Ende der 1990er-Jahre einen goldrauschartigen Spekulationsboom, der 2001 zusammenbrach. Bei der neuen Generation, die Investoren durch den Jargonbegriff „Web 2.0“ von den Fehlschlägen unterschieden, ging es darum, Websites durch Verwendung nutzergenerierter Informationen – zum Beispiel Restaurantkritiken und Blogs – interaktiver und interessanter zu gestalten.
Die meisten angesagten neuen Technologiefirmen befanden sich im vorstädtischen Palo Alto, wo sich Unternehmen wie Zazzle und Film-Loop in der Innenstadt niederließen. Um Mitarbeiter zu bekommen, wollten sie so nahe an Stanford sein wie möglich und eroberten darum leer stehende Immobilien zurück.7 Dort wollten Systroms Kommilitonen hin. Aber Palo Alto im Sommer war langweilig.
In der New York Times las Systrom von einem Trend im Bereich Online-Audio. In dem Artikel wurde ein Unternehmen namens Odeo erwähnt, das im Internet einen Marktplatz für Podcasts einrichtete. Er beschloss, dass er sein Praktikum dort machen wollte. Ins Blaue hinein schrieb er eine E-Mail an den CEO Evan Williams, der seit einigen Jahren bei dem Start-up arbeitete, das seinen Sitz 45 Autominuten nördlich in San Francisco hatte. Williams war in der Tech-Szene bereits durch den Verkauf der Blog-Website Blogger an Google berühmt geworden. Systrom bekam das Praktikum. Jeden Tag fuhr er mit dem Zug in die Stadt, die mit ihren guten Whiskeykneipen und ihrer Livemusik-Szene aufregender war.
Jack Dorsey, der von Odeo gerade erst als Techniker eingestellt worden war, ging davon aus, dass er den 22-jährigen Praktikanten nicht mögen würde, mit dem er den ganzen Sommer würde verbringen müssen. Er stellte sich einen exklusiven Entrepreneurship-Studiengang und ein Elite-Internat an der Ostküste als sterile, uninspirierte Orte vor und dachte, einer davon geprägten Person werde es vermutlich an Kreativität fehlen.
Der 29-jährige Dorsey hatte sein Studium an der New York University abgebrochen, trug ein anarchistisches Tattoo und einen Nasenring und betrachtete sich eher als Künstler. Beispielsweise träumte er gelegentlich davon, Damenschneider zu werden.8 Er war Techniker, aber nur als Mittel zum Zweck – nämlich um mithilfe von Programmcode aus dem Nichts etwas zu kreieren. Und auch, damit er seine Miete bezahlen konnte. Jedenfalls war er nicht der Typ Mensch, der weiß, was er mit einem Praktikanten anfangen soll.
Zu Dorseys Überraschung wurden er und Systrom echte Freunde. In dem Loft in der Brannan Street gab es nur wenige Mitarbeiter, und die meisten waren Veganer, sodass er und Systrom sich anfreundeten, während sie zum nächsten Schnellrestaurant gingen, um Sandwiches zu kaufen.9 Es stellte sich heraus, dass beide einen sehr speziellen Musikgeschmack hatten und hochwertigen Kaffee zu schätzen wussten. Beide liebten außerdem die Fotografie. Im Silicon Valley gab es nicht viele Techniker, mit denen Dorsey über solche Dinge sprechen konnte. Und es schmeichelte ihm, dass Systrom ihn, den Autodidakten, um Hilfe beim Programmieren bat.
Systrom hatte gewisse Marotten. Sobald er die Programmiersprache JavaScript besser beherrschte, legte er Wert darauf, seine Syntax und seinen Stil zu verbessern, damit der Code schön anzusehen war. Für Dorsey ergab das keinen Sinn, und in der Hacker-Kultur des Silicon Valley, die davon besessen war, Dinge schnell zu erledigen, war das fast schon ein Sakrileg. Es war egal, ob man Textzeilen bildlich gesprochen mit Klebeband zusammenheftete, solange sie nur funktionierten. Niemanden außer Systrom interessierte es, ob der Code eine schöne Struktur aufwies.
Systrom neigte dazu, von seinen anderen hochtrabenden Interessen zu schwärmen, die zu entwickeln Dorsey nie die Chance gehabt hatte. Trotzdem sah Dorsey in dem Praktikanten ein Stückchen von sich selbst, denn er schien genug über Kultur zu wissen, um sich darüber Meinungen zu bilden, und er versuchte nicht bloß, ein Rädchen in einer Maschinerie zu sein oder reich zu werden – im Gegensatz zu den anderen mit einem Wirtschaftsstudium. Dorsey war neugierig, was Systrom machen würde, sobald er sich ein bisschen entspannen würde. Allerdings erfuhr er später, dass Systrom vorhatte, nach dem Studium einen Job bei Google zu bekommen. Im Produktmarketing. Zahlen, dachte Dorsey. Er war wohl doch ein typischer Stanford-Mann.
In seinem letzten Studienjahr in Stanford – zwischen Odeo und Google – verdiente sich Systrom nebenher ein bisschen was, indem er im Caffé del Doge in der University Avenue in Palo Alto Espressi aus der Maschine ließ.10 Eines Tages kam Zuckerberg herein und wunderte sich, dass der Student, den er einstellen wollte, in einem Café arbeitete. Der CEO kam schon damals mit Zurückweisung nicht gut zurecht. Unangenehm berührt bestellte er und zog dann weiter.
Schließlich begann TheFacebook.com, das inzwischen nur noch Facebook hieß, im Oktober 2005 auch ohne Systroms Hilfe Fotos anzubieten. Die zwei Monate später eingeführte Erfindung, dass man auf Fotos Freunde taggen konnte, erwies sich als für das Unternehmen noch ergiebiger. Auf einmal bekamen Menschen, die Facebook noch nicht nutzten, per E-Mail Mitteilungen, dass auf der Website Fotos mit ihren Gesichtern zu sehen waren, und waren dann versucht, weiterzuklicken, um sie anzuschauen. Dies war eine der bedeutendsten Manipulationen von Facebook, um mehr Menschen dazu zu bringen, das soziale Netzwerk zu nutzen, auch wenn das eine Spur gruselig war.
Systrom schmerzte diese verpasste Gelegenheit. Inzwischen nutzten über fünf Millionen Menschen Facebook und ihm wurde klar, dass er wohl den falschen Weg eingeschlagen hatte. Er versuchte, das ein Stück weit rückgängig zu machen, und nahm Kontakt mit einem Mitarbeiter auf, der unter Zuckerberg Produkte betreute. Diese Person antwortete jedoch irgendwann nicht mehr auf seine E-Mails und er dachte, das heiße, dass Facebook nicht mehr an ihm interessiert war.
Das Odeo-Team legte unter Dorsey als CEO ein neues Produkt zur Status-Aktualisierung namens Twttr („Twitter“ ausgesprochen) auf. Systrom hatte den Kontakt gehalten und die Website oft genutzt, um seine Freunde und früheren Kollegen zu unterstützen, indem er postete, was er gerade kochte oder aß oder was er sich gerade anschaute, obwohl auf der Website nur Text möglich war. Ein Mitarbeiter von Odeo sagte ihm, irgendwann würden Stars und Marken aus der ganzen Welt darüber kommunizieren. Die spinnen doch, dachte sich Systrom. Niemand wird dieses Ding benutzen.11 Er konnte sich nicht vorstellen, was das für einen Nutzen bringen sollte. Und jedenfalls versuchte das Unternehmen nicht, ihn wieder einzustellen.
Die wenigsten Menschen bekommen jemals die Chance, in der Anfangsphase in ein Kult-Unternehmen einzutreten. Systrom vergab seine beiden Chancen und entschied sich stattdessen für etwas weniger Riskantes. Nach den Studienabschlüssen in Stanford in Management und Technik zu Google zu gehen war für ihn gewissermaßen wie ein Aufbaustudium. Er würde ein Grundgehalt von 60.000 Dollar – was im Vergleich zu dem Vermögen, das ihm Facebook geboten hätte und das sein Leben verändert hätte, mager war –, aber auch einen Crashkurs in der Logik des Silicon Valley bekommen.12
Google war 1998 gegründet worden, 2004 an die Börse gegangen und hatte genug Millionäre produziert, um das Silicon Valley aus seinem Elend nach dem Platzen der Dotcom-Blase herauszuziehen. Als Systrom im Jahr 2006 eintrat, hatte das Unternehmen circa 10.000 Mitarbeiter. Es war sehr viel funktionaler und etablierter als das winzige Odeo, und es wurde überwiegend von ehemaligen Stanford-Studenten geleitet, die datenorientierte Entscheidungen trafen. Diese Kultur war es, die Marissa Mayer, eine Webdesignerin, die später CEO von Yahoo! wurde, 41 Blautöne ausprobieren ließ, um herauszufinden, welche Farbe den Hyperlinks des Unternehmens die meisten Klicks bescheren würde. Eine eher violette Schattierung siegte über eher grünliche Töne und trug zur Steigerung des Jahresumsatzes um 200 Millionen Dollar bei.13 Scheinbar unbedeutende Änderungen konnten Großes bewirken, wenn man sie auf Millionen oder Milliarden Menschen anwendete.
Der Suchkonzern führte Tausende derartige Tests – als A/B-Tests bekannt – durch, indem er verschiedenen Segmenten seiner Nutzerbasis verschiedene Produkterlebnisse vorführte. Bei Google stellte man sich vor, für jedes Problem gebe es eine richtige Lösung, die sich durch quantitative Analyse ermitteln lasse. Die Methoden des Unternehmens erinnerten Systrom an die Wunderkinder in seinem Informatikkurs, die versuchten, durch übertrieben Kompliziertes Eindruck zu machen. In solchen Fällen passierte es leicht, dass das falsche Problem gelöst wurde. Beispielsweise hätte ein Google-Mitarbeiter, der sich mit Fotografie befasst, wohl eher versucht, die beste Kamera zu bauen, als das eindrucksvollste Foto zu machen. Charlie wäre beunruhigt gewesen.
Spannender fand es Systrom, wenn Google-Mitarbeiter aus den klar umrissenen Methoden ausbrachen und ihrer Intuition folgten. Er schrieb Werbetexte für Gmail, während das Team herauszufinden versuchte, wie man den Nutzern die E-Mails schneller zukommen lassen könnte. Ihre Lösung war kreativ: Sobald jemand auf Gmail.com ging und mit dem Eintippen des Benutzernamens begann, begann Google mit dem Download der Daten in das Eingangs-Postfach, sodass er bereits stattfand, während das Passwort eingetippt wurde. Sobald man auf „Anmelden“ klickte, lagen einige E-Mails bereits zum Lesen bereit, sodass sich das Nutzererlebnis verbesserte, ohne dass eine schnellere Internetverbindung nötig gewesen wäre.
Google war nicht daran interessiert, Systrom Produkte gestalten zu lassen, weil er keinen Abschluss in Informatik hatte. Das Verfassen der Werbetexte langweilte ihn dermaßen, dass er einem jüngeren Kollegen beibrachte, mit den Espressomaschinen des Unternehmens Latte Art zu kreieren. Irgendwann wechselte er in das Übernahmeteam von Google, wo er beobachtete, wie das Unternehmen kleinere Firmen hofierte und dann aufkaufte. Er hielt PowerPoint-Präsentationen, in denen er Ziele und Marketingchancen analysierte. Dabei gab es nur ein Problem: Im Jahr 2008 stürzte die US-Wirtschaft durch geplatzte Hypotheken in eine Krise, sodass Google nichts kaufte.
„Was soll ich denn machen?“, fragte Systrom einen Kollegen.
„Fang doch an, Golf zu spielen“, schlug der Kollege vor.
Fürs Golfspielen bin ich zu jung, beschloss Systrom. Es war Zeit, etwas anderes zu machen.
Als Systrom 25 war, hatte er gelernt, wie wachstumsorientiert Facebook war, wie desorganisiert Twitter war und wie verfahrensorientiert und akademisch Google war. Er hatte deren Chefs kennengelernt und verstand, was sie antrieb, und das entkleidete sie ihres Mysteriums. Von außen sah es aus, als werde das Silicon Valley von Genies geleitet. Von innen war jedoch klar, dass alle ebenso verletzlich waren wie er und sich unterwegs etwas ausdachten. Systrom war weder ein Nerd noch ein Hacker noch ein Zahlenfreak. Aber vielleicht war er nicht weniger dafür qualifiziert, Unternehmer zu sein.
Da er immer noch zu risikoscheu war, um ohne Gehalt etwas Neues anzufangen, nahm er eine Stelle als Produktmanager bei einem winzigen Start-up namens Nextstop an, das eine Website für Menschen betrieb, die ihre Reisetipps teilen wollten. Indessen versuchte er, sich abends und an den Wochenenden in Cafés eine neue Fähigkeit anzueignen: mobile Apps zu erstellen.
Die Cafés in San Francisco waren im Jahr 2009 voll von Menschen wie Systrom, die nebenher herumbastelten und darauf setzten, dass das Mobiltelefon den nächsten technologischen Goldrausch einläuten und viel größere Chancen als das Web 2.0 mit sich bringen würde. Nachdem Apple 2007 das iPhone eingeführt hatte, begannen die Smartphones die Art zu verändern, wie die Menschen die Online-Welt betrachteten. Das Internet war nicht mehr nur dafür da, Aufgaben wie E-Mail und Google-Suche zu erledigen, sondern es war nun etwas, das sich mit dem Alltagsleben verflechten ließ, denn die Menschen trugen es in der Tasche bei sich.
Entwickler konnten nun völlig neue Arten von Software anbieten, die überall dabei sein konnte, wo die Menschen hingingen. Große Web-Dienstleister wie Facebook und Pandora gehörten im Frühjahr 2009 zu den beliebtesten Apps, aber auch Gimmicks wie Bikini Blast, das gewagte Hintergrundbilder für das Handy anbot, und die App iFart, die verschiedene Furzgeräusche machte, je nachdem, welche Taste man drückte.14 Der App-Wettlauf war ein rechtsfreier Raum vor allem von Männern unter 30 in San Francisco, die Ideen auf den Markt warfen, um zu sehen, was Bestand haben würde.
Systrom dachte, er könne das, was ihm an technischer Kompetenz fehlte – er wusste nicht wirklich, wie man eine App erstellt, höchstens eine mobile Website –, durch seine relative Vielseitigkeit wettmachen, denn die, so hoffte er, würde ihm helfen, auf Ideen zu kommen, die für normale Menschen unterhaltsamer und interessanter sein würden. Er lernte die App-Entwicklung einfach durch die Praxis, genauso wie er es gelernt hatte, DJ zu sein, in den Milchschaum eines Latte macchiato ein Blattmuster zu malen oder besser zu fotografieren. Er erstellte eine Reihe beliebiger Tools, beispielsweise einen Dienst namens Dishd, mit dem man Gerichte statt Restaurants bewerten konnte. Dabei half ihm sein Stanford-Kommilitone Gregor Hochmuth, der ein Tool erstellte, mit dem man das Web nach Begriffen in Speisekarten durchsuchen konnte, sodass der Nutzer nach einer Zutat suchen konnte, zum Beispiel „Thunfisch“, und dann alle Restaurants fand, die sie anboten.
Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte er eine mobile Website namens Burbn, die nach dem Kentucky-Whiskey benannt war, den er gerne trank, und perfekt zu Systroms Vorstadtleben passte. Dort konnte man mitteilen, wo man gerade war oder wo man hingehen wollte, sodass Freunde auch dorthin kommen konnten. Je öfter ein Nutzer ausging, umso mehr virtuelle Preise wurden ihm verliehen. Die Hintergrundfarben waren unattraktiv, braun und rot wie eine Bourbon-Flasche mit rotem Wachssiegel. Um einem Posting ein Bild hinzuzufügen, musste man es per E-Mail versenden, eine andere technische Möglichkeit gab es nicht. Trotzdem war die App für den Wettlauf im Silicon Valley gut genug.
Im Januar 2010, als er bereits entschlossen war, seine App anzupreisen und die Kündigung bei Nextstop zu rechtfertigen, machte sich Systrom zu einer Party für ein Start-up namens Hunch in der Madrone Art Bar im Panhandle-Viertel in San Francisco auf. Dort würde es vor Wagniskapitalgebern nur so wimmeln, vor allem weil die Führungskräfte von Hunch bereits erfolgreich gewesen waren:15 Caterina Flake war da, eine Mitgründerin von Flickr, einer Website zum Speichern und Teilen von Fotos, die im Jahr 2005 für angeblich 35 Millionen Dollar an Yahoo verkauft worden war, und Chris Dixon, der 2006 ein von ihm gegründetes Sicherheitsunternehmen verkauft hatte.16
Cocktails schlürfend lernte Systrom zwei bedeutende Venturekapitalisten mit dicken Brieftaschen kennen: Marc Andreessen, einen Mitgründer von Netscape und Chef von Andreessen Horowitz, einer der angesagtesten Wagniskapitalfirmen des Silicon Valley, und Steve Anderson, der einen viel stilleren Investment-Laden im Frühstadium namens Baseline Ventures leitete.
Anderson gefiel es, dass Systrom mit seiner Herkunft aus Stanford und Google sowie einer selbstbewussten Persönlichkeit noch keine Investoren für seine App-Idee hatte. Anderson war gern der Erste, der etwas bemerkte. Er lieh sich Systroms Handy, um eine E-Mail an sich selbst zu schicken: „Nachhaken.“
Ab diesem Zeitpunkt trafen sich die beiden alle paar Wochen im Grove in der Chestnut Street, bestellten Cappuccino und sprachen über das Potenzial von Burbn. Bislang hatte Systroms Programm nur ein paar Dutzend Nutzer – seine Freunde und deren Freunde. Er sagte, er brauche circa 50.000 Dollar, um ein richtiges Unternehmen aufzuziehen. Anderson war an dieser Gelegenheit interessiert, aber nur unter einer Bedingung.
„Das größte Risiko bei Ihnen ist, dass Sie Einzelgründer sind“, sagte Anderson zu Systrom. „Ich investiere normalerweise nicht in Einzelgründer.“ Ohne eine weitere Person an der Spitze, so argumentierte er, würde niemand Systrom sagen, wenn er sich irrte, oder ihn zur Verbesserung seiner Ideen drängen.
Systrom meinte daraufhin, er sei einverstanden und werde in der Konditionsvereinbarung zehn Prozent Kapital für einen etwaigen Mitgründer abzwacken. Und so nahm das Unternehmen, aus dem Instagram werden sollte, seinen Anfang.
Die naheliegende Person für den gemeinsamen Aufbau eines Unternehmens war Hochmuth, der Apps bastelte. Aber der war bei Google glücklich. „Warum redest du nicht mit Mikey?“, schlug Hochmuth vor.
Mike Krieger hatte in Stanford zwei Jahrgänge unter Systrom studiert, und er kannte ihn von dem Mayfield-Fellowship her. Systrom war Krieger ein paar Jahre zuvor bei einer Networking-Veranstaltung von Mayfield zum ersten Mal begegnet, und dieser hatte ihn, nachdem er Systroms Odeo-Namensschild gelesen hatte, über das Unternehmen ausgefragt. Dann war Krieger eine Weile verschwunden, während er an seinem Masterabschluss in „Symbolic Systems“ arbeitete – dem berühmten Studiengang in Stanford, der sich mit der Psychologie von Menschen befasst, die mit Computern interagieren. Er schrieb seine Abschlussarbeit über Wikipedia, das gewissermaßen eine Gemeinschaft von Freiwilligen kultiviert hatte, die sein Online-Lexikon aktualisierten und bearbeiteten. Im Jahr 2010 arbeitete er bei dem Instant-Messaging-Dienstleister Meebo.
Systrom mochte Krieger recht gern. Er war ein gutmütiger, besonnener, stets lächelnder und etwas erfahrenerer Techniker als er; er hatte glattes braunes Haar, das gerade lang genug war, um schlaff zu erscheinen, ein glatt rasiertes ovales Gesicht und eine rechteckige Brille. Kurz zuvor hatten sich Systrom und Krieger an Wochenenden in San Francisco in einem Café namens Coffee Bar getroffen, sich gegenseitig von Nebenprojekten erzählt und Ratschläge ausgetauscht. Krieger war einer der ersten Burbn-Tester gewesen und Burbn gefiel ihm, weil es nicht nur Status-Aktualisierungen, sondern auch visuelle Medien beinhaltete.
Ebenso wenig wie Systrom hatte Krieger geahnt, dass er in der Welt der Start-ups landen würde. Er war mit gelegentlichen Abstechern nach Portugal und Argentinien in Brasilien aufgewachsen, weil sein Vater bei dem Getränkehersteller Seagram arbeitete. Außerdem machte er gern Musik und spielte zwölfsaitige Gitarre. Auf der Highschool hatte er sich ein bisschen mit Website-Gestaltung beschäftigt, aber nie war er einem Technologie-Unternehmer begegnet. Nachdem er 2004 in die Vereinigten Staaten gekommen war, um in Stanford zu studieren, begriff er schnell, dass diese Branche zu ihm passen würde.
Krieger hatte vor, bei dem mittelgroßen Unternehmen Meebo anzufangen, dann aufzusteigen, indem er zu einem kleineren Unternehmen mit größeren Herausforderungen wechselte, und schließlich ein paar Jahre später, sobald er genug wissen würde, selbst ein Unternehmen zu gründen. Einstweilen spielte er in Cafés mit der Entwicklung von iPhone-Apps herum. Die erste entwickelte er mit der Hilfe eines talentierten befreundeten Designers, und sie hieß Crime Desk SF. Sie legte offizielle Verbrechensdaten aus San Francisco über ein Kamera-Tool, um auf die wirkliche Welt zu blicken und zu sehen, was in der Nähe geschehen war. Sie hatten zu viel Aufwand getrieben, um die App schön zu machen. Leider wollte niemand sie benutzen.
Krieger hatte Systrom erklärt, er wolle aushelfen, falls Systrom jemals bei Burbn noch jemanden brauchen würde. Nach der Investition von Anderson sagte Systrom zu Krieger, die Idee bestehe darin, daraus ein richtiges Unternehmen mit echter finanzieller Verantwortung zu machen, und er fragte ihn, ob er offizieller Mitgründer sein wolle.
„Notier mich als interessiert“, sagte Krieger. Es schien ihm naheliegend: Er könnte in San Francisco arbeiten, anstatt ins südlich gelegene Meebo im Silicon Valley zu pendeln, er könnte beim Aufbau von etwas in der coolen neuen Szene der mobilen Apps helfen und er könnte das mit diesem Typen tun, mit dem er ohnehin gerne redete.
Krieger hatte bei wichtigen Entscheidungen oft ein starkes Bauchgefühl. Aber er versuchte immer, strategisch vorzugehen, wenn er andere auf seine Seite bringen wollte. In diesem Fall wusste er, dass seine Eltern in São Paulo sich Sorgen machen würden, wenn er eine solch spontane berufliche Entscheidung treffen würde, wo er doch nur ein Einwanderungsvisum besaß. Darum legte er ihnen die Idee schrittweise vor.
„Ich glaube, ich fände es interessant, zu einem frisch gegründeten Start-up zu gehen“, sagte er ihnen auf Portugiesisch und tat so, als wäre das etwas, was er eventuell tun würde, wenn sich die passende Gelegenheit böte.
Ein paar Tage später rief er wieder an.
„Ich habe einen interessanten Mann kennengelernt!“ Er erklärte, wer Systrom war und woran er arbeitete.
Am Ende der Woche rief er schließlich seine Eltern an, um ihnen mitzuteilen, dass er nach seinen ganzen Nachforschungen beschließen würde, Mitgründer von Systroms Unternehmen Burbn zu werden. Seine Eltern hatten den Eindruck, ihr Sohn habe sich für diese Entscheidung Zeit genommen, und unterstützten ihn darin.
Die nächste Partei, die er überzeugen musste, war der US-amerikanische Staat. Im Januar 2010 nahm sich Krieger eine Einwanderungsanwältin, die Erfahrung mit Visa für Brasilianer hatte (auch wenn die meisten bisherigen Klientinnen Friseusen waren). Er beantragte die Umschreibung seines Einwanderungsvisums auf Burbn. Die Beamten, die seinen Fall bearbeiteten, sahen zwar, dass sich Burbn Geld beschafft hatte, waren aber dennoch misstrauisch – gab es einen Businessplan?
Natürlich nicht. Die Unternehmensgründung sollte ihnen ermöglichen, das Gleiche wie Facebook zu tun: versuchen, das Produkt zu einem Teil der alltäglichen Gewohnheiten seiner Nutzer zu machen, und erst dann versuchen, damit Geld zu verdienen. Aber das konnten Krieger und Systrom natürlich nicht sagen. Sie erklärten der Behörde, sie hätten vor, irgendwann mit einer Art lokalem Couponsystem für Kneipen, Restaurants und Geschäfte Geld zu verdienen, wenn ihre Freunde meldeten, dass sie dort seien. Sie erklärten, zu ihren Konkurrenten würden unter anderem Foursquare und Gowalla gehören. Außerdem legten sie ein Diagramm vor, das prognostizierte, dass sie im dritten Jahr wahrscheinlich eine Million Nutzer haben würden. Sie lachten darüber, wie unwahrscheinlich das war.
Während sie darauf warteten, zu erfahren, ob es legal wäre, gemeinsam an Burbn zu arbeiten, probierten Krieger und Systrom aus, ob sie wirklich gerne zusammenarbeiteten. Sie verbrachten zwei Abende die Woche bei Farley’s, einem Café in Potrero Hill, das an den Wänden Werke örtlicher Künstler ausstellte. Sie programmierten kleine Spiele, die nie veröffentlicht werden sollten, unter anderem eines, das auf dem Gefangenendilemma basiert, einer politischen Spieltheorie, die erklärt, wieso rationale Menschen möglicherweise auch dann nicht kooperieren, wenn sie es tun sollten.
Das machte zwar Spaß, aber es war nicht Burbn. Monate vergingen, und Krieger wurde klar, dass Systrom sein Geld verbrauchte und seine Fortschritte verzögerte, während kein Ende des Wartens absehbar war. Krieger las stundenlang in den Einwanderungsgesetzen nach und war von Horrorstorys besessen, die Menschen in Internetforen posteten.
„Kev, vielleicht solltest du dir einen anderen Mitgründer suchen“, riet Krieger mehrmals.
„Nein, ich will wirklich mit dir arbeiten“, antwortete Systrom immer. „Wir kriegen das schon hin.“
Systrom hatte schon genug Start-ups mit vergifteten Beziehungen zwischen den Mitgründern gesehen, um zu wissen, wie selten es ist, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann. Beispielsweise versuchten die Twitter-Gründer ständig, sich gegenseitig zu untergraben. Dorsey war schon nicht mehr CEO des Unternehmens. Die Mitarbeiter beschwerten sich, er habe sich alle Ideen und Erfolge von Twitter auf die Fahnen geschrieben, es aber vermieden, Mitarbeiter zu führen. Dorsey nahm sich für Hot-Yoga- und Nähkurse frei. „Du kannst entweder Damenschneider oder der CEO von Twitter sein“, sagte Ev Williams laut Nick Biltons Buch „Hatching Twitter“ einmal zu ihm.17 „Beides zusammen geht nicht.“ Im Jahr 2008 arbeitete Williams mit dem Verwaltungsrat von Twitter an der Machtübernahme und setzte Dorsey ab.
Die Facebook-Story war sogar noch dramatischer. Der Mitgründer Eduardo Saverin, der sich von Entscheidungen des Unternehmens immer mehr ausgeschlossen fühlte, als das Team im Jahr 2005 nach Palo Alto umzog, sperrte das Bankkonto von Facebook18 – was vielleicht der wahre Grund war, weshalb Zuckerbergs Kreditkarte bei seinem ersten Essen mit Systrom nicht funktionierte. Zuckerbergs Anwälte dachten sich eine komplizierte Finanztransaktion aus, um Saverins Besitzanteil zu verwässern, und lösten damit einen Prozess und eine dramatische Hollywood-Adaption der Geschichte aus, den Film „The Social Network“, der 2010 in die Kinos kam.
Unternehmensgründer im Silicon Valley waren aggressiv, ehrgeizig und gefühllos, Krieger war ein guter Zuhörer, ein aufmerksamer Partner, ein fleißiger Arbeiter und nach den vielen gemeinsamen Testläufen ein guter Freund. Systrom wollte nicht das Risiko eingehen, sich mit jemand anderem zusammenzutun.
Während dieser ganzen Zeit versuchte Systrom, für sein Projekt weitere Unterstützer zu finden. Über den Kontakt durch Ronny Conway, einen Partner der Firma, den er von Google her kannte, gelang es ihm, Andreessen Horowitz zu einem Beitrag von 250.000 Dollar zu überreden. Sobald Anderson von Baseline diese Zahl hörte, wollte er einen ebenso großen Besitzanteil haben und stockte darum seine Investition ebenfalls auf 250.000 Dollar auf. Plötzlich hatte Systrom eine halbe Million Dollar, mit der er arbeiten konnte.
Anderson versuchte, weitere Interessenten für Burbn zusammenzutrommeln, und schrieb E-Mails an ein gutes Dutzend Kollegen bei anderen Firmen, aber jeder, der nicht persönlich von Systrom bezaubert war, hatte kein Interesse. Es gebe mehrere beliebtere ortsbasierte Apps, zum Beispiel Foursquare und Gowalla, und Fotos reichten als supertolle Funktion, die Menschen anlockte, nicht aus, sagten ihm die VCs. Burbn habe soziale Qualitäten, aber Facebook sei in diesem Bereich schon so dominierend, dass es sinnlos sei, dagegen anzugehen. Status-Updates – darüber, was man tat und wohin man ging – waren bei Twitter bereits sehr beliebt.
Darum wandte sich Systrom an seinen früheren Mentor Dorsey und ließ ihn wissen, dass er gerade ein Unternehmen gründete. Die beiden trafen sich im Good Hotel in der Nähe von Dorseys neuestem unternehmerischen Abenteuer Square. Dorsey stellte ein Gerät her, das man in seinen Computer oder in sein Handy stecken konnte und womit man im Internet überall mit seiner Kreditkarte bezahlen konnte. Der Nasenring war verschwunden. Dorsey war viel gediegener gekleidet – frische weiße Designerhemden von Dior und ein schwarzes Jackett, vielleicht als Reaktion auf das Misstrauen seitens des Verwaltungsrats von Twitter.
Dorsey stellte Systrom so ziemlich die gleichen Fragen wie die VCs, zum Beispiel warum man Burbn statt Foursquare nutzen sollte. Natürlich hat er es nach dem Bourbon benannt, dachte Dorsey im Gedenken an Systroms gehobene Interessen. Natürlich hat er die modischste Programmiersprache benutzt. Systrom, der immer noch lernte, wie man gängige iPhone-Apps erstellt, verkaufte die Idee, dass eine App, die in HTML5 für das mobile Internet erstellt wurde, einen Marktvorteil habe, aber Dorsey war sich da nicht so sicher. Doch in diesem Fall war das persönliche Verhältnis wichtiger als Investmentlogik. Eigentlich, so dachte sich Dorsey, kam es ja nicht darauf an, was Systrom zusammenbaute. Es gab sowieso keine Maßstäbe oder Modelle dafür, was im mobilen Bereich die Oberhand behalten würde. Und Systrom hatte ihn exakt zum richtigen Zeitpunkt gefragt.
Noch nie war jemand auf die Idee gekommen, Dorsey zu bitten, sein Geld in ein Start-up zu stecken. Falls er den Burbn-Deal machen würde, dann wäre das sein erstes „Angel-Investment“ – so nennt man im Silicon Valley eine kleine Investition einer reichen Person in ein Start-up in der Frühphase. Das wäre eine coole Verwendung seines neu erworbenen Vermögens, und gleichzeitig würde er Systrom unterstützen, der seiner Meinung nach einen äußerst guten Geschmack hatte. Systrom würde Burbn verstehen, was immer daraus werden sollte.
Dorsey bot Unterstützung in der Größenordnung von 25.000 Dollar. Seine Werbetrommel sollte sich als weit wertvoller erweisen als das Geld.
Schließlich genehmigte der Staat im April 2010, fast drei Monate nach dem Antrag, Kriegers Visum. In seiner ersten Woche in dem neuen Unternehmen ging Systrom mit ihm frühstücken und machte ihm ein Geständnis: Er sei sich nicht sicher, ob Burbn das richtige aufzubauende Produkt sei.
Systrom erklärte, die Idee komme bei ihren jungen Hipster-Freunden in Großstädten an, die zu Musikveranstaltungen und in Restaurants gingen. Die Preise, die Burbn für „soziales“ Verhalten vergab, seien unterhaltsam, weil das Erlebnis dadurch süchtig machend und zu einem Wettbewerb wurde. Aber alle, die keine jungen Stadtbewohner seien, bräuchten sie vielleicht gar nicht zu nutzen. Selbst Dorsey hatte sich erst angemeldet, nachdem Systrom ihn um Feedback gebeten hatte. Systrom dachte daran, wie erschreckend es für das Odeo-Team gewesen sein musste, auf den Aufbau von Twitter umzuschwenken, dass aber diese Entscheidung eindeutig richtig gewesen war.19 Was war wohl ihr Twitter?
Krieger war überrascht. Gerade war er ein großes Risiko eingegangen, indem er in Systroms Firma gekommen war, um an Burbn zu arbeiten, und das nicht nur, weil er dafür einen sichereren Job aufgegeben hatte. Wenn sie ein neues Unternehmen gründeten und ihnen bei der Arbeit daran das Geld ausging, würde er wieder im Visumverfahren oder zurück in Brasilien landen. Bevor sie es komplett verwarfen, so Krieger, sollten sie vielleicht versuchen, es zu verbessern. Das taten sie auch und erstellten eine Version der App für das iPhone.
Die Mitgründer wuchsen aus ihren Besprechungen in örtlichen Cafés heraus und gingen in den klapprigen Co-Working-Space an einem Kai in der Nähe des Baseballstadions von San Francisco, wo auch die anderen kleinen Start-ups Threadsy, TaskRabbit und der Word-Press-Schöpfer Automattic saßen.
Das war ein seltsamer, zugiger Ort mit einer Kakofonie an Geräuschen: schreiende Möwen und bellende Seelöwen, vor allem aber die Geräusche anderer junger Menschen, die kreativ und manchmal auch unproduktiv sowie durch Red Bull und Alkohol ermutigt waren. Von der Decke hing ein riesiges Steuerrad – Seefahrtskitsch, aber auch eine Gefahr, denn bei einem Erdbeben konnte es herunterfallen. Das nahe gelegene Wasser war kalt. Nur wenige Touristen waren mutig genug, sich am Kiosk Kajaks zu mieten. Aber an Freitagnachmittagen, wenn sich draußen Ingenieure zur Happy Hour versammelten, betrank sich unweigerlich jemand zu sehr und beschloss, in die Bucht von San Francisco zu springen.
Krieger und Systrom tippten weiter und versuchten, ihre Kollegen zu ignorieren, wobei sie sich fragten, ob sich die anderen weniger Sorgen darum machten, ihnen könnte das Geld ausgehen. Die Burbn-Gründer zogen aus den geselligen Ereignissen auf andere Weise Vorteil. Die Hausverwaltung sagte ihnen, wenn sich jemand Essen liefern lassen würde, könnten sie sich das, was übrig blieb, nach 13:30 Uhr kostenlos nehmen. Wenn sie vorher Hunger bekamen, kauften sie bei der örtlichen Bodega Sandwichs zum Sonderpreis von 3,40 Dollar.
Sie mussten sparen, weil sie nicht wussten, wie lange es dauern würde, Burbn erfolgreich zu machen – oder ob es überhaupt je erfolgreich sein würde. Ein paar Monate später zerschlug ein Treffen mit Conway von Andreessen, dem Sohn des berühmten Angel-Investors Ron Conway, ihre Hoffnungen noch mehr.
„Was macht ihr da noch mal?“, fragte Conway. Systrom versuchte, Burbn noch einmal zu erklären – eine unterhaltsame Art, zu sehen, was Freunde gerade machen, und im richtigen Leben zu ihnen zu gehen! Man bekommt Anregungen, wo man als Nächstes hingeht!





























