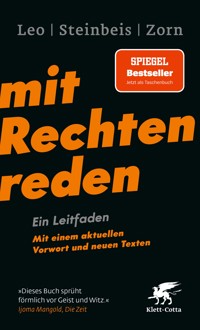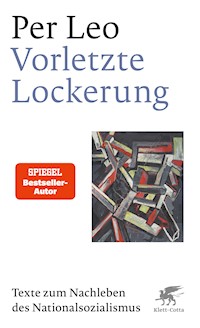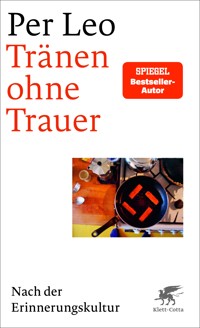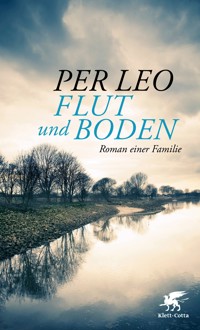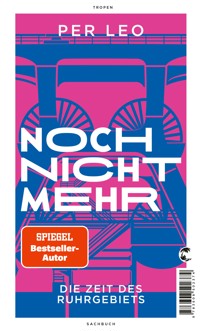
15,99 €
Mehr erfahren.
Das Ruhrgebiet: Wie aus dem rauchenden Pott das Land der Zeit wurde Worin besteht die Einheit des Ruhrgebiets? Seit jeher lässt sich darauf keine eindeutige Antwort finden. Doch nach dem Ende der Montanindustrie hat sich die Fragestellung verschoben – von der Realität der Arbeitswelt hin zur Identität im Wandel. Zwischen produktiver Zerstörung und unvollendetem Projekt war, so zeigt dieser Essay, an Emscher und Ruhr das Neue von heute immer schon schnell das Alte von morgen. Wo einst Zechen, Hochöfen und Arbeitersiedlungen Stoff für Reportagen lieferten, regt der vollzogene Strukturwandel heute eher zum Nachdenken an. Der Philosoph Wolfram Eilenberger hat kürzlich behauptet, das post-industrielle Ruhrgebiet existiere noch gar nicht. Der Historiker Per Leo setzt nun dagegen, dass es sich im Moment des Niedergangs neu erfand: als Laboratorium einer Geschichtskultur »von unten«. Wie eine Vergangenheit erforschen, die kaum schriftliche Quellen hinterlassen hat? Kann die Vorgeschichte eines Nachlebens Erinnerung sein? Ist, frei nach dem Düsseldorfer Beuys, jeder Ruhrmensch ein Historiker? Dieses Buch begibt sich auf Spurensuche und fördert dabei überraschende Antworten zutage
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Per Leo
Noch nicht mehr
Die Zeit des Ruhrgebiets
Tropen Sachbuch
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung einer Abbildung von © FinePic®, München
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50237-4
E-Book ISBN 978-3-608-12243-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
I. Ruhrschnellweg
Prolog: Frei nach Tolstoi
Der flüchtige Referent
Lichtwellen oder Visionen
Erster Hauptsatz forever
Bitemporale Identitätskrise
II. Spuren am Hellweg
Nach der Zukunft beginnt die Stadt
Die Schul von Essen
LUSIR
oder das Grinsen der Erinnerung
Land der Zeiten, Narbenpark
Epilog: Gelsenkirchener Rasen
Verwendete Literatur
Anmerkungen
Motto
Prolog: Frei nach Tolstoi
Der flüchtige Referent
Lichtwellen oder Visionen
Erster Hauptsatz forever
Bitemporale Identitätskrise
Nach der Zukunft beginnt die Stadt
Die Schul von Essen
LUSIR oder das Grinsen der Erinnerung
Land der Zeiten, Narbenpark
Epilog: Gelsenkirchener Rasen
Bildverzeichnis
Dank
We both know what memories can bring
They bring diamonds and rust
Joan Baez
Bellingham, Ballverlust
90 plus 5
Die hatten nicht genug
Weiser
Weiser für Burke
Der Schotte, der Schotte – der Schotte!
Der Schotte!
Der Schotte mit dem Bart.
Oliver Forster, Nachspielzeit im Ruhrgebiet[1]
I. Ruhrschnellweg
Prolog: Frei nach Tolstoi
Glückliches Bielefeld. Wenn im Rest des Landes der ebenso unverwüstliche wie schlichte, man könnte auch sagen: der recht deutsche Witz die Runde macht, eine Stadt namens Bielefeld existiere gar nicht, dann ruft das bei den Bielefeldern ja höchstens ein Schulterzucken hervor. Sie wissen eben, dass manche Leugnung mehr über den Leugner als über das Geleugnete verrät. To be or Bielefeld – Bielefeld gibt es nicht, also bin ich: Wer das nötig hat, denkt der Bielefelder, der erhöht sich selbst doch auf Haaresbreite über den Meeresspiegel. Außerdem weiß man in Bielefeld die Wirklichkeit auf seiner Seite.
Ein Ehepaar kehrt zurück aus dem Sommerurlaub. Wird nun die Frau, wie die Protagonistin eines schlechten Romans, beim Passieren des Ortsschildes zu ihrem Mann sagen: »Schau mal, Schatz, da sind wir ja schon in Bielefeld, wo wir bekanntlich trotz aller Nachteile wohnen. Weißt du, als ich gerade seinen Namen las, da wurde mir ganz warm ums Herz. Es macht mir nämlich gar nichts aus, dass die alliierten Bomber unsere Stadt dem Erdboden gleichgemacht haben. Im Gegenteil, so kann man sie wenigstens nicht mit dem schönen Bad Salzuflen verwechseln. Und dass wir ununterbrochen ganz normal sind, das unterscheidet uns doch aufs Angenehmste vom katholischen Paderborn. Auch haben wir uns noch nie so peinlich benommen wie Detmold, als es 2010 partout nicht Kulturhauptstadt Europas werden wollte. Blass, wie es ist, nenne ich darum Bielefeld ohne Zögern meine Heimat.«
Man steckt nicht drin im anderen, aber ein vernunftbegabtes Wesen, das tatsächlich solche Sätze sagt, ist noch schwerer vorstellbar als ein Schriftsteller, der sie sich bloß ausdenkt. Die meisten Orte sind schließlich im Laufe der Zeit so mit ihrem Namen verwachsen, dass man dessen Bedeutung nicht mehr wortreich herbeireden muss. Bielefeld ist eben Bielefeld, weswegen man einfach »Bielefeld« sagt, wenn man Bielefeld meint oder etwas Informatives über Bielefeld mitteilen möchte. Zum Beispiel im Hinblick auf seine zahlreichen Fließgewässer. Schaue man genauer hin, so lockt etwa der lokale Naturschutzverein, könne man in Bielefeld »jede Menge faszinierende, glitzernde und plätschernde Natur im Stadtgebiet entdecken, meist am Stadtrand«.[1] Nun muss man andernorts zwar weder an den Stadtrand radeln noch allzu genau hinschauen, um sich vom glitzernden Nass faszinieren zu lassen – aber wer hat, der hat. Und wer sich seiner selbst gewiss ist, braucht auch keinen Vergleich zu scheuen. Darum war es höchstens ein bisschen geschummelt, jedenfalls nicht gelogen, als man um 1900 – der ortsansässige Apotheker August Oetker hatte gerade die Backpulververmarktung revolutioniert – eine Postkarte mit der Aufschrift drucken ließ: Bielefeld, das westfälische Venedig.
Und so ließen sich noch viele informative Sätze über die mittelgroße Stadt an der Lutter bilden, die belegen, dass man dort quasi alles kennt, nur den Selbstzweifel nicht. Zum Beispiel: Ohne die innovative Kombination von Modernisierungstheorie und Fußnotenvermehrung, derer sich die Bielefelder Schule der Sozialgeschichte rühmt, hätte die Historiographie ihr vorwissenschaftliches Stadium womöglich nie verlassen. Oder: Die Landesplanung stuft Bielefeld als Oberzentrum ein, worunter man in der Raumordnung und der Wirtschaftsgeographie einen zentralen Ort der höchsten Stufe versteht, usw.
Doch genug von Bielefeld. Am Ende ist Bielefeld, frei nach Tolstoi, allen anderen glücklichen Städten – Venedig, Barcelona, Bad Salzuflen, Kirchheim a. d. Weinstraße – viel zu ähnlich, um einen Nicht-Bielefelder auf Dauer zu interessieren. Überlassen wir Bielefeld also den Scherzbolden und den Krimi-Autoren. Lassen wir Bielefeld hinter uns. Folgen wir der bald immer stärker befahrenen A 2 weiter nach Westen. Biegen wir auf die A 42 ab. Oder auf die A 40, die früher mal Ruhrschnellweg hieß. Lauschen wir unseren Herzen. Und wir werden merken, wie sich allmählich das Glück verzieht. Als hätte der Himmel seine Stubenfenster aufgerissen, wird die Luft nun mit jeder Minute reiner, bis sie schließlich, kurz hinter Dortmund, ganz frei ist vom Feinstaub der Selbstzufriedenheit, von den Abgasen des Lokalstolzes, vom Smog des gemütlichen Eigensinns. In dem zerklüfteten Ballungsraum, der sich hier jetzt auftut und bis ins Rheinland erstreckt, ist man nämlich alles Mögliche – gradlinig und schräg, herzlich und herzschwach, positiv bekloppt und negativ bescheuert, nur eines sicher nicht: heiter und gelassen selbstbewusst.
Hier wissen die Städte, wie sie heißen, aber nicht, wer sie sind. Zu unvollendet, um sich selbst in der Differenz zu finden, zu träge, um sich zur Megacity zu vereinen, hat keine von ihnen die Gravitationskraft eines Zentrums, während die geballte Saugkraft aller verhindert, dass irgendwo auch nur eine Mitte entsteht. Ihre Namen tragen diese Städte wie eine Geschmacksverirrung der Eltern. Man teilt sie aus infrastrukturellen Gründen und zu Verwaltungszwecken mit, aber erst in Verbindung mit Stadtteilnamen wie Borbeck, Schalke, Witten oder Hochlamarck, mit Institutionskürzeln wie Uni, Fernuni, PH oder KWI, vor allem aber mit Vereinsbezeichnungen wie VfL 1848, FC 04, BVB 09, MSV oder Rot-Weiß erreichen sie auch die Herzen ihrer Bewohner. Ohne die Hilfe solcher Stützwörter fehlt ihnen einfach der Klang, den Namen wie »Paris«, »Venedig« oder »Bielefeld« ganz mühelos erzeugen, sobald sie auch nur ausgesprochen sind.
Was die Liebeslieder der Fankurven am Wochenende auf Sportplatzgröße verkleinern, das hebt im Alltag der Titel einer Region auf das Niveau von Fotobildbänden und Reiseführern. Als wollten sie den schwachen Sound ihrer Eigennamen frisieren, betonen diese Städte nämlich bei jeder Gelegenheit ihre geographische Verwandtschaft. Das klingt zwar noch immer nicht altehrwürdig oder gediegen, aber immerhin nach Großfamilie. Bottrop im Ruhrgebiet, Bruder von Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, Cousin von Bochum im Ruhrgebiet, hört gerne zu, am liebsten in Gesellschaft von Schwager Moers im Ruhrgebiet, wenn Tante Duisburg im Ruhrgebiet mit ihrer Bläsercombo ein Konzert gibt; besucht zu Weihnachten und Ostern pflichtschuldig Oma Essen im Ruhrgebiet, obwohl ihr Lebensabschnittspartner, der Prominentenanwalt Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet, einen ganz schön nerven kann; liegt sich seit Ewigkeiten mit Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet wegen einer Lappalie in den Haaren; fährt jeden Sommer mit den Geschwistern Dortmund und Hagen am Rande des Ruhrgebiets in den Urlaub, meist nach Sylt oder auf die Malediven; und sagt über Recklinghausen im Ruhrgebiet: backt extrem leckere Zitronenrolle, aber die langen Haare standen ihr besser.
Man kann sich vielleicht vorstellen, was hier los war, als kürzlich behauptet wurde, das Ruhrgebiet existiere gar nicht. So eine Verwandtschaft ohne Behördenstempel ist ja eine sehr flüchtige Angelegenheit. Erst recht, wenn man bedenkt, dass der westliche Teil der Region historisch zum Rheinland, der östliche zu Westfalen gehört, ihr südlicher Teil den nördlichen an Alter und Wohlstand übertrifft und sie außerdem von drei Kreisstädten aus extern verwaltet wird. Wo der Name »Bielefeld« wie eine Rinde mit der Stadt gewachsen ist, da hängt der Name »Ruhrgebiet« an 53 Städten wie eine Maurerhose ohne Gürtel. Rutscht sie runter, fühlen sich alle nackt. Und außerdem war es kein Witz. Wie auch? Aufgestellt hatte die negative Existenzbehauptung ja kein Geringerer als einer der – laut Verlagswerbung – »besten Philosophen des Landes«, also ein von Berufs wegen ernsthafter Mensch. Und geäußert hatte er sie auch nicht in Form einer plumpen Verneinung, sondern in bestem Philosophendeutsch.
Das Wort »Ruhrgebiet«, so Wolfram Eilenberger kurz und bündig, sei ein »sprachliches Zeichen ohne bestimmbaren Referenten«.[2] Bämm! Das saß. Und es kam im Geltungsbereich des unbestimmbaren Referenten gar nicht gut an. Abgesehen von den üblichen Querulanten und zwölf Hochbegabten, wurde der Philosophensatz dort nämlich einhellig zurückgewiesen. Von den einen mit wütendem Trotz, von den anderen mit zerknirschtem Schweigen. Ein bisschen fühlte man sich allerdings auch ertappt. Nicht wie ein Hochstapler mit falschem Namen, schließlich war niemand betrogen worden – eher wie ein Partytänzer, der plötzlich die Blicke der anderen spürt und ahnt, dass seine Einbildungskraft mal wieder besser in Form war als sein Rhythmusgefühl.
Mal wieder? Mal wieder.
Der spitze Zweifel eines auswärtigen Beobachters war im – sogenannten?! – Ruhrgebiet ja keine neue Erfahrung. Schon 1958 hatte der spätere Nobelpreisträger Heinrich Böll geschrieben, die »Provinz« namens Ruhrgebiet sei »weder in ihren Grenzen noch in ihrer Gestalt genau zu bestimmen«.[3] Anders als den nur der Wahrheit verpflichteten Philosophen hatte diese Behauptung den Schriftsteller aber nicht davon abgehalten, das Unbestimmbare in aller Ausführlichkeit zu schildern – und zwar konsequenterweise weniger durch das, was es auszeichnet, als durch das, was ihm fehlt. Dabei ist ein merkwürdiger Text herausgekommen, der jedoch in seiner ganzen Verschlossenheit einen guten Einstieg in unser Thema bietet. Denn wer verstehen will, warum im Ruhrgebiet die Zeit so machtvoll herrscht, sollte zuvor gesehen haben, wie hoffnungslos alle Versuche – als sei man Gott, ein Adler oder ein Hauswart – gescheitert sind, die Region als dreidimensionalen Raum zu erfassen.
//
Auch Wolfram Eilenberger, Heinrich Böll und der Autor dieses Buchs sind durch eine vorgestellte Verwandtschaft verbunden: Wir gehören zur Familie der schreibenden Ruhrgebietsgäste. Ein jeder von uns hat eine gewisse Zeit in der Region verbracht und dann versucht, sich dichtend und denkend einen Reim auf sie zu machen. Auf ihre merkwürdig diffusen Grenzen. Auf die umso schärfer gezogene Unterscheidung von Innen und Außen. Auf das starke Gefühl eines Woanders-Seins – das allerdings mehr mit dem Kopf des Auswärtigen zu tun hat als dem Verhalten der Hiesigen. Denn im Ruhrgebiet zu sein, das hieß auch immer schon: in Kontakt mit Menschen, die schwer in Ordnung sind.
Aber wie es sich für eine Familie gehört, stehen ihre Mitglieder untereinander in jeweils besonderen Beziehungen. Heinrich Böll ist für dieses Buch eine Art Vater. Und was macht man mit Vätern? Man ermordet sie zum Beispiel, auch wenn es heute meist symbolisch geschieht. Und so auch hier – als ein Akt der Selbstermächtigung gegenüber dem König der schreibenden Ruhrgebietsgäste. Wolfram Eilenberger spielt dagegen die Rolle eines älteren Bruders. Und wie geht man mit älteren Brüdern um? Schwankend. Man tritt in ihre Fußstapfen und behauptet, das Gehen erfunden zu haben. Wie aber verhalten sich zwei Brüder zu ihrem Vater? Nun, in der Regel unterschiedlich. In unserem Fall war es jedenfalls so, dass der Ältere das väterliche Erbe antrat, bevor der Jüngere den Vater tötete. Sollte sich jemand über die Reihenfolge wundern: Unter Dichtern und Denkern sind derlei Freiheiten üblich. So viel zu uns. Aber der anderen Familie sei noch eine Mitteilung in eigener Sache gemacht.
Achtung, Ruhrgebietsbewohner! Dieses Buch hat zwei Teile. Der erste reiht sich ein in eine Serie von Texten, die Ihre Heimat aus der Außenperspektive thematisieren. Oder genauer gesagt: aus der Vogelperspektive, denn bei aller Verschiedenheit ging und geht es dabei immer darum, einen äußerst komplizierten Sozialraum in seiner Ganzheit zu erfassen. Und diesen Versuch haben Menschen des Ruhrgebiets, lange schon, bevor sie es so nannten, genauso unternommen wie dessen Gäste.
Im ersten Teil steigt dieses Buch also hoch in den Himmel – und, als sei es ein Heißluftballon, sogar höher als normalerweise üblich. Denn mehr noch als für das Geschehen am Boden interessiert es sich zunächst für das, was die Vögel unter ihm sehen und gesehen haben, soll heißen: eher für den Diskurs über das Ruhrgebiet als für das Ruhrgebiet selbst. Doch während aus der Luft – abgesehen von den Brieftauben, die sind bestochen – vor allem das Unfertige, Unscharfe und Unausgeglichene, das Paradoxe, Widersprüchliche und Absurde, das Rohe, Schmutzige und Düstere der Region wahrnehmbar wird, kann man am Boden nach ihren verborgenen Schätzen suchen. Hier besingen Froschchöre die Schönheit von Sumpfdiamanten, die nur im weichen Morast von Lippe, Ruhr und Emscher zur Härte reifen konnten, hier sammeln Bienenschwärme den köstlichen Nektar der Rostblumen, die in den verwaisten Erztaschen der Hütten und anderen Verstecken des Reviers auf Bestäubung warten. Und dieser Perspektive ist der zweite Teil des Buchs gewidmet. In ihm wird nicht mehr über das Ruhrgebiet geredet – vielmehr quakt und summt es aus zwei Standorten im Ruhrgebiet: der alten Hellwegstadt Essen und der ewig jungen Emscherperle Gelsenkirchen.
Doch wie alle sinnvollen Unterscheidungen bilden Außen und Innen, Oben und Unten, Dunkel und Hell zusammen ein Ganzes. Und so verhält es sich hoffentlich auch mit den beiden Teilen dieses Buchs. Sie sind sogar dreifach miteinander verbunden. Nicht nur durch die Einheit von Himmelblick und Bodenpraxis, sondern auch durch ein doppeltes Interesse: an dem Schemen namens Ruhrgebiet und am Fluchtstoff namens Zeit.
Nun denn – Vorhang zu, Licht aus.
Der flüchtige Referent
Heinrich Böll schreibt über das Ruhrgebiet wie ein Hausmeister, der lieber auf seinem Schlüsselbund musiziert, als den Konzertsaal zu öffnen. Ständig klimpert er mit Wörtern herum, die einfach nicht zum Gegenstand passen wollen. Das beginnt schon mit dessen Bezeichnung. Denn so unschuldig nüchtern der Begriff »Provinz« auch klingt, er benennt doch genau das, was das Ruhrgebiet – wie Böll noch im selben Satz feststellt – gerade nicht ist: eine exakt umgrenzte Verwaltungseinheit. Die provincia Germania inferior endete am linken Rheinufer, weswegen durch das heutige Moers eine befestigte Römerstraße führte, durch das heutige Duisburg aber höchstens ein Trampelpfad zu den reizenden Töchtern der germanischen Sugambrer; die Grenze zwischen den preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen wiederum trennte Mülheim, Oberhausen und Essen von Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund; und in der Bundesrepublik gehört das Ruhrgebiet, sollte es denn existieren, in drei etwa gleich großen Teilen zu den nordrhein-westfälischen Regierungsbezirken Düsseldorf, Arnsberg und Münster.
Als der Journalist Heinrich Hauser die Region 1928 für eine Reportage bereiste, fragte er sich unwillkürlich: »Wie und wo beginnt das Revier?«[1] Und so haben es Unzählige nach ihm getan. Es ist die typische Frage eines Reisenden, der wissen will, ob er schon angekommen ist. Auf Inseln, auf Landgütern und Planeten, an Küsten, an Ufern und Gebirgsrändern, in Schlössern, in Staaten und Provinzen ist sie leicht zu beantworten. Im Ruhrgebiet nicht.
Man könnte Böll die schlampige Wortwahl nachsehen, wäre sie nicht der Auftakt einer Symphonie, die vom ersten bis zum letzten Ton verzweifelt nach ihrem Thema sucht. Statt die Phänomene einer fremdartigen, womöglich verstörenden Welt durch Bilder und Vergleiche, durch Adjektive und Lautmalerei, durch Tonfall und Rhythmus in Literatur zu verwandeln, läuft der – unbestreitbare – Reichtum der Schilderung bei Böll immer wieder nur auf den einen trostlosen Befund hinaus: Anderswo gibt es Dinge, die es hier nicht gibt. Wenn sich das Ruhrgebiet fassen lässt, so klappert die Schreibmaschine in Köln, dann nur über seine Mängel.
Dass die Sonne »wie mattes Gold hinter einer Dunstglocke schwebt«, könnte ein atmosphärisches Detail sein. Aber das darf es nicht, denn noch während das Bild in den Kopf des Lesers sinkt, ist es schon verschluckt von einer ebenso starken wie sachfernen Behauptung, die ihren Ursprung allein im Kopf des Autors hat. »Die Sonne«, verkündet Böll, »würde scheinen, wenn man sie nur ließe.«[2] Sie scheint im Ruhrgebiet also nicht auf eine besondere, vielleicht merkwürdige, jedenfalls vorstellbare Weise – sie scheint gar nicht, was verwundert, nachdem der Autor sie gerade noch anschaulich beschrieben hat. Auch die »Rauchfahnen der Kokerei« könnten einfach nur sie selbst sein, oder sie könnten an die Sonntagszigarre des auf dem Sofa liegenden Großvaters erinnern oder wirken wie ein Dampfschiff, das sich trotz heiß laufender Maschinen nicht vom Fleck rührt, aber das ist ihnen verboten, weil der Autor will, dass sie eigentlich etwas anderes sind, nämlich ein »Ersatz für die weißen Wolken«, die es im Ruhrgebiet leider nicht gibt.[3] Genauso gibt es hier keinen Sommer, sondern nur einen gleichnamigen »klimatologischen Begriff« für jene Monate in der Jahresmitte, die »zwar Wärme, aber wenig Licht« bringen.[4] Was die Besonderheit des Sommers im Ruhrgebiet sein könnte, muss bei Böll als Indiz dafür herhalten, dass es richtige Sommer nur außerhalb des Ruhrgebiets gibt. Und auch die Städte werden hier zwar mit dem »Verwaltungsbegriff Stadt« bezeichnet, aber »von Stadt« haben sie nichts. Denn eine richtige Stadt »ist Landschaft«, richtige Städte haben eine »Physiognomie«, richtige Städte gibt es im Ruhrgebiet nicht.[5]