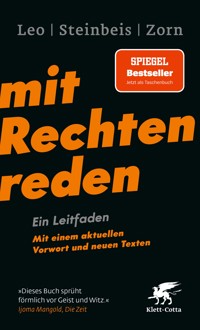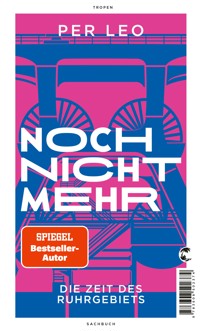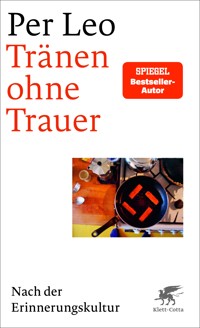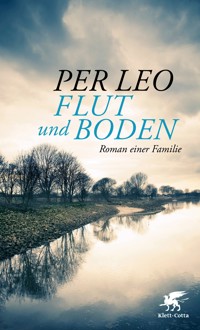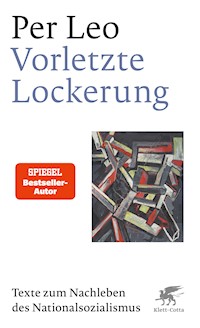
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Leo hinterfragt die deutsche Erinnerungskultur wie keiner vor ihm.« Peer Teuwsen, NZZ am Sonntag Der Ton dieser Texte ist unverwechselbar. Sie mahnen nicht zur Erinnerung, sie warnen nicht vor Wiederholung. Vielmehr zeigen sie, dass Geschichte konkret und lebendig werden muss, wenn sie im Sinne Nietzsches dem Leben dienen soll. Ob er berichtet oder analysiert, erzählt oder streitet, lobt oder dankt – Leo findet zur Sprache, wo sonst die Phrasen blühen. Der Nationalsozialismus hat zwei Geschichten: seine Vergangenheit und die Fortdauer von etwas, das nicht vergeht. Per Leos Schreiben bezeugt beides. Ausgehend von der eigenen Familiengeschichte wendet sich der Historiker immer stärker der Gegenwart zu. Er spricht nun auch als Chronist, der beobachtet, wie sich die jüngste Geschichte in ihrem Nachleben spiegelt. Die Texte dieses Bandes lesen sich daher wie das Protokoll eines Wandels. Aus dem Kind der alten Bundesrepublik, das im Nachdenken über die Vergangenheit zu sich selbst findet, ist ein Bürger der neuen Bundesrepublik geworden. Seine Fragen gehen uns alle an. Wie spricht man von einem Entsetzen, das kulturell längst tausendfach überformt ist? Ist Björn Höcke wirklich das Spiegelbild von Joseph Goebbels, oder erschreckt uns nur seine Maske? Was tun, wenn uns Hitler fasziniert? Wie verträgt sich die Erinnerung an den Holocaust mit den Konflikten einer Einwanderungsgesellschaft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Per Leo
Vorletzte Lockerung
Texte zum Nachleben des Nationalsozialismus
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Die Abbildungen im Text stammen von mauritius images/World Book Inc. (S. 25), aus dem Privatbesitz von Alexa Geisthövel (S. 33) und aus dem Privatbesitz von Per Leo (S. 74).
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98078-3
E-Book ISBN 978-3-608-12138-4
Inhalt
Vorwort
Herkunftsgymnastik
Am Bordstein der Geschichte. Ein Schuss
BD
R
. Bericht aus Mitteldeutschland
I.
II.
III.
IV.
Ein fiktives Telefonat mit Yael Reuveny
Fake News: Nazienkel schändet Holocaustmahnmal
Deutschlandreise, 27. Januar 2015
O święcim ist nicht Auschwitz. Ein Reisebericht
Schwarze Hefte, weiße Weste. Zur Lage der Heideggerkritik
Über Nationalsozialismus sprechen. Ein Verkomplizierungsversuch
I.
II.
III.
IV.
V.
Gegenwartsübungen
Gekrönter Dichter rät zu Schmähkritik
Glatzi in der Zeitung für Deutschland!
Cool down. Rechte Verlage auf der Buchmesse
Einsichten in den Bürgerkrieg
Den Kampf annehmen, ohne ihn zu führen
1.
2.
3.
4.
5.
»Rollenspiele irritieren«. Interview mit Benjamin Moldenhauer
Israelkritik für deutsche Patrioten. Brief an Behzad Karim Khani
1. Patriotismus
2. Imperium
3. Integration
4. Feindschaft
5. Ideologie
6. Palästina
7. Ächtung
Verzeichnis der Erscheinungsorte
Anmerkungen
Vorwort
Am Bordstein der Geschichte. Ein Schuss
Fake News: Nazienkel schändet Holocaustmahnmal
Oświęcim ist nicht Auschwitz. Ein Reisebericht
Über Nationalsozialismus sprechen. Ein Verkomplizierungsversuch
Cool down. Rechte Verlage auf der Buchmesse
Einsichten in den Bürgerkrieg
Den Kampf annehmen, ohne ihn zu führen
Israelkritik für deutsche Patrioten. Brief an Behzad Karim Khani
Das Dämonische besitzt im Leben kein reales Äquivalent.
Walter Serner
Mystify me
Grabinschrift A. H.
Vorwort
Die Frage kam entwaffnend direkt. Ob ich von der deutschen Zeitgeschichte besessen sei, wollte der Journalist aus Zürich wissen. Er klang wie ein Ethnologe, der mit professionellem Wohlwollen eine höchst seltsame Kultur bestaunt. Die Indizien waren erdrückend, daher versuchte ich gar nicht erst, den Verdacht zu entkräften. Ich hatte ihm schließlich soeben gestanden, dass das Buch, über das wir uns unterhielten, auch Ausdruck eines missglückten Abschieds war. Nachdem ich mich – zunächst als Historiker, dann als Schriftsteller – zuvor schon in drei Büchern mit den Voraussetzungen, der Geschichte und den Folgen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hatte, sollte der Text eigentlich nur einen Band mit verstreuten Schriften einleiten. Ein letztes Buch, ein letzter Text zu diesem Themenkomplex, das war der Plan. Doch er misslang. Satz für Satz entglitt die Einleitung meiner Kontrolle, bis sie sich schließlich in einen langen Essay verwandelt hatte, der im Sommer 2021 unter dem Titel Tränen ohne Trauer eigenständig veröffentlicht wurde.
Wenn der Sammelband nun mit zweijähriger Verspätung endlich erscheint, so hat sich an der mit ihm verbundenen Hoffnung aber nichts geändert. Der Stoff, der mich fast ein Vierteljahrhundert lang gefesselt hat, soll kein Lebensthema werden. Auch darum handelt der Roman, an dem ich derzeit arbeite, von nichts mehr und nichts weniger als der unfreiwilligen Europareise eines verkrachten Geigenhändlers, magischer Arbeitstitel: Erstes Buch ohne Nazis. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Selbstbeschwörung tatsächlich funktioniert; trotzdem rollte meine Frau ungläubig mit den Augen, als ich ihr mitteilte, ich müsse vor dem Urlaub »nur noch kurz« ein Vorwort für den Band zum Nationalsozialismus schreiben. Und ich konnte es ihr genauso wenig verdenken wie dem Schweizer Journalisten seine freche Frage.
Nun, against all odds, hier ist es. Möge es nicht nur kurz genug, sondern auch das letzte seiner Art sein.
Das vorliegende Buch versammelt Texte, die sich auf keinen gemeinsamen Gattungsbegriff bringen lassen. Konzeptionelle Überlegungen stehen neben literarischen Phantasien, Essays neben Reden, Zeitungsartikel neben Briefen, reale Interviews neben fiktiven Gesprächen. Wenn es dennoch ein Gravitationszentrum gibt, um das all diese Texte kreisen, dann ist es das hartnäckige Nachleben, das der Nationalsozialismus fast achtzig Jahre nach seinem Ende noch immer unverdrossen führt. Die Formulierung ist absichtlich unscharf. Sie soll nur darauf verweisen, dass es sich um einen historischen Stoff handelt, der weiterhin Macht über unsere Köpfe und Herzen ausübt. Der durch keine These einholbaren Vielfalt, mit der das tagtäglich geschieht, entspricht die Verschiedenheit der Schreibanlässe und Stile. Und eigentlich haben wir es sogar mit zwei Stoffen zu tun, oder genauer gesagt, mit zwei historischen Aspekten: der Zeit des Nationalsozialismus als solcher und der Bedeutung, die man ihr in der Gegenwart jeweils beimisst.
Lange waren diese beiden Aspekte so eng miteinander verflochten, dass sie sich nur mit Mühe auseinanderhalten ließen. Aus den Zeitgenossen des Dritten Reichs waren schließlich umstandslos Bürger der Bundesrepublik und der DDR geworden; die »Aufarbeitung« des Nationalsozialismus folgte immer auch der politischen Notwendigkeit, Verantwortung für vergangenes Unrecht zu übernehmen; das Entsetzen über unvorstellbare Verbrechen und der Wille, das Entsetzliche zu begreifen, waren oft zwei Seiten einer Medaille; und unsere Verfassung gründete ebenso in der radikalen Abgrenzung von »1933«, dem Jahr, in dem die geschwächte Republik Hitlers Willkürherrschaft gewichen war, wie unser moralischer Kompass – wenn auch mit Verspätung – darauf abzielte, dass der Exzess von Unrecht und Gewalt, für den der Name »Auschwitz« steht, sich niemals wiederhole. Doch mit dem Abstand zum Abgrund traten die Zeit des Nationalsozialismus und ihre Bedeutung für die Gegenwart – unvermeidlich – immer weiter auseinander.
1986 hatten sich im Historikerstreit noch zwei Zäsurideen unversöhnlich gegenübergestanden: hier die einen, die mit Habermas davon überzeugt waren, dass die Bundesrepublik ihre Identität nur durch den endgültigen Bruch mit der Vergangenheit, und komplementär dazu die Eingliederung in den Westen, finden könne – dort die anderen, die im Schlussstrich unter die Vergangenheitsbewältigung die Voraussetzung für eine Rückbindung des jungen Staates an die lange Geschichte seiner Nation erkannten. Diese Alternative war schon damals falsch, aber sollten wir nicht allmählich den Versuch wagen, das von ihr verdeckte Problem zu begreifen? Demokratien leben ja nicht nur von der liberalen Gründung in Verfassung und Gesetz, sondern auch vom Diskurs über eine Geschichte, die das eigene, unvermeidlich partikulare Gemeinwesen von anderen, ebenso unvermeidlich partikularen Gemeinwesen unterscheidet. Und so sehr ich in das Lob eines universalistisch gesinnten Verfassungspatriotismus einstimmen möchte, so wenig ist damit die Frage beantwortet, welche Rolle der Bruch mit der Vergangenheit, den das Habermas-Lager damals als Norm durchsetzte, zukünftig für unser politisches Selbstverständnis spielen soll. Ich neige jedenfalls zu der Ansicht, dass die negative Identität Deutschlands als Staat des »Nie wieder« und als Gesellschaft, die einen fatalen historischen »Sonderweg« hinter sich gelassen hat, auf Dauer nicht in der Lage sein wird, das für eine Republik unverzichtbare Minimum an zivilem Pathos zu entfachen.
Vielleicht ist es an der Zeit, das Grundgesetz von den Fesseln seiner Vorgeschichte zu lösen, um es verstärkt im Licht seiner eigenen Geschichte zu betrachten. So wie das Gebot, keine unschuldigen Menschen zu ermorden, auch schon 1942 galt, so brauchen wir heute umgekehrt die Drohkulisse des Zivilisationsbruchs womöglich gar nicht mehr, um uns über die Grundlagen unseres Zusammenlebens zu verständigen. Die Bundesrepublik zählt zu den robustesten Demokratien der Welt. Sollte es zu ihrem Schutz nicht genügen, den Geist ihrer Verfassung ernst zu nehmen, sie mit Leben zu füllen und ebenso stolz auf ihr Gelingen zurückzublicken wie sich demütig ihrer noch unerfüllten Versprechen zu erinnern? Auch wenn es gute Gründe gibt, sich in Forschung und Bildung weiterhin mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und seiner Opfer zu gedenken – Deutschland und die Welt haben sich in den letzten 30 Jahren so fundamental verändert, dass die in der alten Bundesrepublik geprägten und inzwischen hegemonial gewordenen Muster der post-nationalsozialistischen Selbstkritik längst keine Orientierung mehr stiften. Im Gegenteil, gelöst vom Realitätsbezug ihrer Entstehungsbedingungen, entfalten sie zunehmend ideologische Wirkung.
Wenn Bundespräsident Steinmeier, um mit einem aktuellen Beispiel zu beginnen, noch im Oktober 2021 an der Gedenkstätte Babyn Jar in Kyiv behaupten konnte, wir Deutschen wüssten »um unsere Verantwortung vor der Geschichte«, während er kurz zuvor die Gaspipeline Nord Stream 2 als deutsch-russisches Versöhnungsprojekt gewürdigt hatte; wenn der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung meint, »unsere hart erkämpfte Erinnerungskultur« immer dann beinhart verteidigen zu müssen, sobald sich Personen mit arabisch-muslimischer Einwanderungsgeschichte grenzwertig zu Israel äußern, während er die antisemitischen Triggersätze des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans Georg Maaßen mit stummer Duldsamkeit quittierte; wenn Politiker und Leitartikler das Dogma von der Singularität des Holocaust unter der Hand zu einem Bekenntnissatz deutscher Leitkultur umdeuten; wenn Aktionskünstler und Satiriker Beifall heischend ihre tadellose Gesinnung ausstellen, indem sie sich als Reinkarnationen von Kurt Tucholsky und Winston Churchill gerieren und mit dramatischer Geste vor einem neuen »1932« oder der Wiederholung des »Appeasement« warnen; wenn sich auf der Frankfurter Buchmesse 2017 antifaschistische Linke und Aktivisten der Identitären Bewegung wechselseitig mit dem Schlachtruf »Nazis raus!« niederbrüllen; wenn Wladimir Putin seinen Angriffskrieg als »Spezialoperation« zur Ausrottung des ukrainischen »Nazismus« verschleiert, während der Historiker Timothy Snyder die komplizierte historische Wahrheit zwar nicht genauso verdrehte, aber für einen Wissenschaftler doch unzulässig simplifizierte, als er dem deutschen Gewissen ins Stammbuch schrieb, der russische »Faschismus« führe wie seinerzeit Hitler einen »Vernichtungskrieg« gegen die Ukraine, ohne auf die eklatanten Unterschiede hinzuweisen: dann sind all das Symptome dafür, dass die nationalsozialistische Vergangenheit sich von einem Anlass der produktiven Selbstbefragung in einen inhaltsleeren Dämon verwandelt hat, den man beliebig heraufbeschwören kann, um das eigene Anliegen moralisch zu veredeln und das Gewissen der anderen zu manipulieren. Wo einmal mühsame Arbeit an der Geschichte geleistet wurde, lehren immer häufiger Geistertänze vor historischer Kulisse das Gruseln.
Dabei gibt es Dämonen ja wirklich – nur eben nicht als reale Wesen, sondern als Figuren in unseren Köpfen und Mächte in unseren Herzen, auf der Bühne und im Traum, im Film und in der Literatur. Eindringlich warnte Walter Serner den Hochstapler vor der Versuchung, in die Rolle eines Dämons zu schlüpfen. Weil nichts entlarvender sei, als von den Tatsachen im Stich gelassen zu werden, riet er ihm stattdessen, sich allein durch die Treue zur gewählten Maske den Ruf des Dämonischen zu erarbeiten: »Das wird dir umso mehr nützen, als man es nicht kontrollieren kann, aber doch nicht aufhört, auf seine Emanation zu warten.«[1] Wir werden uns politisch erst dann selbst vertrauen, so ließe sich Serners ästhetischer Zynismus vielleicht zur Einsicht wenden, wenn wir aufgehört haben, die Welt der Gegenwart als Propheten eines großen Untoten dämonologisch zu deuten.
Ein Wort noch zur Form des Buchs. Während sich jeder der hier versammelten Texte als eigenständiger Versuch lesen lässt, die lebendige Arbeit an der Geschichte unter immer neuen Bedingungen fortzusetzen, stellen die ihnen vorangestellten Kommentare einen Zusammenhang her. Die einzelnen Beiträge sind nur lose chronologisch geordnet, aber die kursivierten Zwischentexte deuten an, dass es eine Verbindung des Unverbundenen gibt. Sie liegt in der Doppelnatur der historischen Zeit, die für uns ja nicht nur in sachlicher Objektivität einen Gegenstand des Wissens darstellt, sondern auch mit drängender Gegenwärtigkeit ein Mittel der Sinnstiftung. Doch auch die Gegenwart des Vergangenen hat zwei Dimensionen, sie ist ebenso gebunden an ein individuelles Bewusstsein wie an eine politische, kulturelle oder soziale Lage. Für dauerhafte Kindheits- und Jugenderinnerungen, die – wie ein Dorf in eine Landschaft – in eine solche Lage eingebettet sind, hat der Schriftsteller W. G. Sebald den Sehnsuchtsbegriff der Zeitheimat geprägt. Wer sich die Mühe macht, die hier versammelten Texte und Zwischentexte nacheinander zu lesen, wird vielleicht bemerken, dass dieses Buch insgesamt ebenso melancholisch wie hoffnungsfroh gestimmt ist. Es handelt vom Verlust einer Zeitheimat. Und zugleich ist es das Protokoll einer allmählichen Ankunft im eigenen Land.
Mülheim a. d. Ruhr, im September 2022
Herkunftsgymnastik
Am Anfang steht eine Entdeckung. Doch was unserer Runde in der geschilderten Szene vor Augen trat, war keines der notorischen Geheimnisse, die man der Vergangenheit angeblich in Kellern und auf Dachböden entreißen muss, um zu seinem Trauma zu finden. Es war die Macht, mit der die Geschichte uns weiterhin durch ihre Bilder bannt. Solange die Magie des Nationalsozialismus noch lebendig ist, werden wir mit ihm leben müssen. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob ihre Kraft abstoßend oder anziehend wirkt. A force, so habe ich es im Physikunterricht in Alaska gelernt, is a push or a pull. And for every action there is an equal and opposite reaction. Aber auch Nachleben enden, nur nicht mit einem Exorzismus, einem Schlussstrich oder dem Tod, sondern durch Abkühlung. »Es gibt Erfahrungen«, schreibt der Kriegsteilnehmer Reinhart Koselleck, »die sich als glühende Lavamassen in den Leib ergießen und dort gerinnen. Unverrückbar lassen sie sich seitdem abrufen, jederzeit und unverändert.«[1] Für uns Nachgeborene ist diese Geschichte aber kein Schicksal mehr. Sie hat nicht unsere Existenz geformt, wohl aber die Welt, in die wir hineingewachsen sind, und die Mythen, die wir uns über sie erzählen. Noch immer spendet sie Wärme, stiftet Abhängigkeit, vermittelt Orientierung, verbraucht Sauerstoff, schafft Nähe, erzeugt Enge, trennt die einen von den anderen. Wie ein Herdfeuer, um das herum einst Familien und Stadtstaaten gegründet wurden. Heute, wo die Flüche verlassener Ahnen keinen Schrecken mehr verbreiten, müsste das aber nicht so sein. Gut möglich, dass die Glut unter den Händen unserer Kinder erlischt. Wollen wir es hoffen?
Am Bordstein der Geschichte. Ein Schuss
Geht es uns mit Hitler nicht ein wenig wie mit den Beatles? Natürlich, die einen kann man nicht hassen, den anderen nicht lieben. Aber hier zählt etwas anderes: Es gibt vor beiden kein Entrinnen. Man besuche eine Durchschnittsparty in einer Durchschnittsstadt auf einem proteinhaltigen Durchschnittsplaneten, und nach durchschnittlich 23 Minuten wird man hören: genau. Man zappe an einem Freitagabend mit zehnsekündiger Frequenz durchs Fernsehprogramm, und nach durchschnittlich 23 Minuten wird man sehen: eben. Es gibt Dinge, um die muss man sich nicht bemühen. Also sollte man sie kommen lassen. Es mag Jahre her sein, dass man seine drei Beatles-CDs das letzte Mal auch nur entstaubt hat; aber an einem Sonntagmorgen, die Landstraße so leer wie der Kopf noch voll von der vergangenen Nacht, hört man im Autoradio Here Comes the Sun, und plötzlich ist er wieder da: der taufrische Zauber des Unvergänglichen. Es wäre leicht zu zeigen, dass sich über gute Ehen Ähnliches sagen ließe. Aber über Hitler?
Ja, auch über Hitler. Sie müssen sich nur an folgende Regeln halten. Sehen Sie möglichst wenig fern. Wählen Sie einen Beruf, der Sie nicht zwingt, die deutsche Außenpolitik zu rechtfertigen. Gönnen Sie sich, es sollte bis dahin bezahlbar sein, 2033 ein Jahr Urlaub im Weltall. Und vor allem, googlen Sie niemals den Namen Bruno Ganz. Kurz gesagt, meiden Sie alle inneren und äußeren Zustände, in denen Hitler schon auf Sie wartet. Warten Sie lieber auf ihn. Lassen Sie sich von Hitler überraschen!
Es muss um den 20. April im Jahr 75 nach der Machtergreifung gewesen sein, einem echten Frühlingstag. Lauer Wind trug Vogelgezwitscher ins Wohnzimmer, wo sich eine aufgeweckte Runde zum Sonntagsfrühstück versammelt hatte. Je ein Redaktionsmitglied der F. A. Z., der Berliner Zeitung und der BILD, zwei akademische Enkel des großen Thomas Nipperdey, ein Princeton-Stipendiat und ein angesagter Trendforscher sorgten, inmitten einer Schar kürzlich entbundener oder gezeugter Kinder, für ein ebenso prickelndes wie thematisch schwangeres Gesprächsklima. Jedenfalls lag es nicht nur am Champagner, dass wir vom Designflash des Biedermeier zu Blumenbergs Deutung der Gnosis hüpften, von Heinz von Foersters Erzählstimme zur Wiedergeburt des Tante-Emma-Ladens aus dem Geist der Kybernetik, von ewiger Frage zu ewiger Frage, von The Wire oder Kir Royal zu Brandt oder Schmidt, und von dort wie von selbst zu Schnappschüssen berühmter Politiker. Unser Nachbar, einer der Journalisten, eilte in seine Wohnung und kam mit einer formvollendeten Trashperle wieder: einem vergilbten Polaroid, das Wolfgang Thierse, struppig und frontal, vor kahlem Hintergrund zeigte. Es war ihm aus einem antiquarisch erworbenen Buch buchstäblich in die Hände gefallen. Muss ich erwähnen, dass uns sein Anblick faszinierte? Wir ahnten allerdings nicht, dass die Epiphanie des ewigen Bundestagspräsidenten nur die Vorband des eigentlichen Sonntagskonzerts sein sollte. Sicher wäre Thierse ungehalten, würde man ihn einen Steigbügelhalter Hitlers nennen. Aber – normative Kraft des Kontrafaktischen! – dieses eine Mal war er es tatsächlich: anachronistisch, vollkommen schuldlos und so zufällig wie alles, worum es nun gehen soll. Denn hätte meine Frau sich ohne dieses kleine Thierseleuchten wohl der Pappschachtel erinnert, die ihr ein älterer Herr vor vielen Jahren geschenkt hatte, mit dem schelmischen Hinweis, sie »als Geschichtsstudentin« werde sicher etwas damit anzufangen wissen?
Wir öffneten die Schachtel und sahen: ein Bild wie Tausende, ein Sandkorn aus der Jugendzeit der mobilen Fotografie. Die Beiläufigkeit des abgebildeten Moments, der knappe weiße Rand um das in vielfachem Grau erscheinende Sujet, das Miniaturformat lassen einen Amateur als Urheber vermuten. Doch ebenso gut könnte es ein professionell abgefeuerter Schnappschuss sein, einer von unzähligen, die ihr Ziel verfehlten: Schärfe, Kontrast und das ungewöhnliche Maß von 8 x 5,4 cm sprechen für eine an Kamera und Vergrößerungsgerät geübte Hand. Ist es je in einem Album archiviert worden? Auf der Rückseite findet sich kein Abriss am Papier, der auf die Verwendung von Klebstoff schließen ließe; nur eine mit hartem Bleistift schnell gesetzte 19. Nicht auszuschließen ist allerdings die Verwendung von durchsichtigen Fotoecken, die – 1926 vom Etikettenhersteller Herma entwickelt – 1931 unter dem Namen Transparol in den Handel gekommen waren. Auch ohne Datierung ließ sich nämlich genau sagen, wann und wo dieses Foto entstanden ist, ganz zwanglos gab es die Umstände seiner Entstehung preis.
Wir schauten genauer hin und sahen: ein Bild wie keines, ein Goldkorn im kalten Strom technisch reproduzierbarer Wirklichkeit. Schon dass Hitler Cut und Zylinder trägt, lässt keinen Zweifel über Ort und Datum der Aufnahme zu. Wir mussten das Internet gar nicht bemühen, um sicher zu sein, dass es am 21. März 1933 in Potsdam aufgenommen worden war, einem Sonntag, wie hätte es anders sein sollen, am ersten Frühlingsanfang nach der nationalen Erhebung. Selbst die Aufnahmezeit ließe sich annäherungsweise ermitteln, denn wir wissen, dass es gleich, unmittelbar nach dem abgebildeten Moment, zu einer historischen Szene kommen wird. Jedes bundesrepublikanische Schulbuch hat sie verewigt; da konnte es nicht verwundern, dass sich in unserer Bibliothek allein sieben Druckerzeugnisse fanden, die sie in den heiligen Kanon der von den Deutschen »niemals« zu vergessenden Anblicke aufgenommen hatten: eine Handreichung für den nordrhein-westfälischen Geschichtsunterricht, ein Ausstellungskatalog, zwei Gesamtdarstellungen des Nationalsozialismus sowie drei politische Bildungsschriften der dafür zuständigen Bundeszentrale, alle zwischen 1981 und 1993 erschienen. Die Fotoszene zeigt den Moment, in dem der kürzlich ernannte Reichskanzler seinen Ernenner, den soeben eingetroffenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, mit devoter Verbeugung empfängt. Huldvoll, in ordenbehangener Uniform, Pickelhaube und schwarzem Handschuh nimmt dieser Hitlers nackt zum Gruß entbotene Hand entgegen, im Hintergrund scheint ein Gardesoldat den Akt bewachen und bezeugen zu sollen. Erst im Lichte dieses berühmten Fotos, einer Ikone des Jahres 1933, erhellt sich das Geschehen auf dem kleinen Foto aus der Pappschachtel.
Eine Atmosphäre angespannter Erwartung. Die Menschenansammlung, deren Ausschnitt wir sehen, steht an einer Bordsteinkante. Schon hat sie sich als Ganzes nach halblinks orientiert, die Richtung, aus der in Deutschland Autos kommen. Die Hindenburgrichtung. All die soeben noch mit sich selbst und einander beschäftigten Einzelnen scheinen von einer plötzlichen Sammlung ergriffen, wie eine Schulklasse, die im Gang den Schritt des Lehrers hört, ein Orchester, das kurz vor dem Auftakt, im Übergang von träger Ruhe zu höchster Konzentration, ein letztes nervöses Zucken durchzieht. Noch sieht man Köpfe von vorne und von hinten, noch suchen Nachzügler in der zweiten und dritten Reihe ihre Plätze, noch wirken die Gendarmen wie ungeduldige Theaterdiener nach dem letzten Pausenläuten. Allein Hitler hat sich schon in Positur gebracht, den Rücken durchgedrückt, die Augen über dem fast karikaturhaft anmutenden Ensemble aus strengem Mundbogen und schwarzem Oberlippenblock starr in die Ferne gerichtet, als blicke er der Vorsehung ins Auge, die dieser Tage wieder einmal Gericht über seine Zukunft hält.
Unser Wissen um das, was da gerade geschieht, verleiht der Historizität des Anblicks allerdings einen zutiefst ironischen Zug. Den zufälligen Moment können wir ja nur deshalb so unwahrscheinlich genau lesen, weil er sich vor den Kulissen einer historischen Freiluftbühne ereignet. Weil sich das Geschehen an ein Drehbuch und an ein Programm hält. Nur Sekunden nach dem verstohlenen Schnappschuss wird sich das gesamte Arsenal der zeitgenössischen Speichertechnologien zu einem nie dagewesenen Sturm erheben. Deutschland und die Welt sollen in die Geiselhaft der nun kühl kalkuliert entstehenden Bilder genommen werden, vor allem jenes einen, das die heuchlerische Unterwerfungsgeste des Gefreiten vor dem Marschall zeigt. Es ist die erste Schlacht des Propagandagenerals Goebbels, und er besteht sie mit Bravour. Die Farce gelingt, der Brückenschlag zum alten Reich, zu Adel, Militär und Kirche, wird geglaubt; sie hinter sich wissend, kann Hitler zwei Tage später im Parlament den Dolchstoß gegen Weimar wagen.
Ansichten dieser Art sind nicht alltäglich. Wie oft kommen sich privater Blick und kollektives Gedächtnis schon so nah, dass ein anonymes Bild all seine Geheimnisse abwirft und im Licht des Offenbaren zu strahlen beginnt? Man kann sich Ähnliches am ehesten in den verstaubten Archivkisten eines Sportfotografen vorstellen, eines Protokollanten annoncierter Geschichte. In hellblauer Trainingsjacke, ein grauer Himmel glotzt durch das gläserne Zeltdach des Münchener Olympiastadions, beugt sich Franz Beckenbauer zu einem Fan im Rollstuhl herunter – solche Bildkontakte, in denen das Historische und das Kontingente sich berühren, liegen bestimmt in manchem Keller verborgen. Es ist der Zufallsmoment vor dem berühmten Großereignis, sei es das WM-Endspiel 1974 oder der »Tag von Potsdam« 1933, den nur die Fotografie selbst zum Ereignis machen kann.
Dass wir es mit einem solchen zu tun hatten, war uns sofort klar, als das kleine Schwarzweißbild seine Runde um den Frühstückstisch drehte. Doch es war ebenso klar, dass hier nicht nur der Zufall vom Licht der Geschichte erfasst wurde. So stark wie geheimnisvoll ahnten wir nämlich auch die gegenläufige Bewegung – die Verschmutzung der Geschichte durch die Macht der Kontingenz. Es schien, als habe der Zufall durch dieses Foto nicht nur seine Anwesenheit in Goebbels Geschichtsposse bekunden, sondern sie auch in lästerlicher Absicht durchkreuzen wollen. Je länger wir diesen bis vor Kurzem verschollenen Schnappschuss betrachteten, desto ehrfürchtiger wurde uns bewusst, dass hier ein genialer Geist Regie geführt hatte. Der Zufall musste das berühmte Bild, das wenige Augenblicke später entstehen und kurz darauf um die Welt gehen sollte, schon vor seiner Aufnahme bis ins Detail gekannt haben! Wie sonst hätte er dem Bild eine Ordnung geben können, die nichts anderes ist als eine kongeniale Travestie der goebbelschen Propaganda, eine der verlogenen Inszenierung untergejubelte Epiphanie der Wahrheit.
Das beginnt schon beim Wetter, einer echten Schicksalsgröße für Freiluftaufführungen. Der Handschlag zwischen Präsident und Kanzler wird in gleißendem Licht stattfinden: auf der Memorialikone wirft Hitlers Ohr einen scharfen Schatten auf seinen Hals, heller Pomadenglanz verdoppelt seine Scheitellinie. Noch kurz zuvor aber ist die Sonne von Wolken verhangen: Licht und Stimmung unseres Bildes sind düster, eher einem nicht enden wollenden Winter entsprechend als einem gerade beginnenden Frühling. Doch mehr noch: Hat der Zufall die demiurgische Inszenierung nicht sogar mit einem eigenen Bildprogramm unterwandert? Man möchte es fast glauben, wenn man die präzise Komik des Fotos auf sich wirken lässt.
Es liegt in der Natur von Massenfotos, Menschen verdeckt und beschnitten zu zeigen. Umso auffälliger, dass im Gewusel der Menschenfragmente vier Personen in unversehrter Gänze zu sehen sind. Es sind dies Hitler, ein Nachbar zu seiner Rechten und zwei zu seiner Linken. Wo steht der Führer und Reichskanzler? Natürlich zentral, schließlich hat sein Anblick den Fotografen gelockt. Aber je länger man dem routinierten Voyeursreflex widersteht, immer wieder nur auf den scharfen Schnäuzer glotzen zu wollen, desto spürbarer wird die Macht, mit der hier jemand anderes in die geometrische Mitte gerückt wurde. Es ist das Blumenmädchen links von Hitler. Und fast penetrant drückt uns der Zufall aufs Auge, dass diese Mitte bedeutsam ist. Ein ganzes Feuerwerk von Alleinstellungsmerkmalen brennt er ab, um die Besonderheit dieses Mädchens zu markieren. Es wird zunächst als solches betont: durch ihr Geschlecht, durch ihr Alter, durch ihre Größe, vor allem aber durch ihre Kleidung sticht sie aus dem grau-schwarzen Haufen der Männermäntel hervor. An diesem bitterkalten Frühlingsanfang – eingekeilt von einem Zweifrontenhoch über Frankreich und Russland herrscht in Deutschland am 21. März 1933 strenger Frost – trägt dieses Mädchen nichts als ein helles, luftiges Sommerkleid! Aber es scheint nicht zu frieren; im Gegenteil, sein Anblick strahlt eine ruhige Wärme aus, wie eine Erdquelle im isländischen Stein. Aber der Zufall hat auch mit allen Mitteln des räumlichen Arrangements gearbeitet. Das Bildzentrum wird verstärkt durch die symmetrische Anordnung der vorderen Personen: Zusammen bilden sie einen Pfeil, an dessen Spitze das Mädchen steht. Sein Nachbar zur Linken gehört zwar zu dem Quartett der ganz sichtbaren Personen, aber als einziger von ihnen dreht er den Kopf nach hinten, und zwar nach halbrechts unten – und auch das ist bedeutsam. Dank dieser Bewegung wird das Mädchen nämlich zur einzigen aller abgebildeten Personen, die in der Sichtachse einer anderen Person steht. Und das in einem Bild, das Hitler und eine Menschenmenge zeigt! Schließlich markiert der Zufall die scheinbar unscheinbare Hauptperson auch noch durch ein Programm von Dingsymbolen. Inmitten all der Zylinder, Gendarmenhelme, Nonnenhauben, Wollmützen, Schirmkäppis und Hüte sind nur die drei Köpfe in der Bildmitte unbedeckt. Gleichzeitig sind die Träger dieser drei Köpfe die einzigen, die etwas in der Hand haben. Während aber die beiden Männer ihren Zylinder vor der Körpermitte halten, hat das Mädchen den Hindenburg zugedachten Blumenstrauß bis unter das Kinn gehoben. Damit sind die Proportionen des Rahmenarrangements in dessen Zentrum auf den Kopf gestellt: Die Blumen des kleinen Mädchens sehen auf die Zylinder der großen Männer herab, als wären es die Füße ihres Throns.
Man sieht, für den aufmerksamen Betrachter weisen tausend Finger auf diesen geheimen Mittelpunkt. Allein das Paar, das Hitler mit dem kleinen, aber mit allen Mitteln der Kunst erhöhten Mädchen bildet, dieser versteckte Biss ins Gesicht aller kinderküssenden Diktatoren, ist hinreißend gelungen. Doch es gibt ja noch einen zweiten Nachbarn Hitlers, und zieht man ihn hinzu, geht man endgültig in die Knie vor dieser Zufallsmeisterschaft. Weniger markiert als das Blumenmädchen, ist er doch ihr präzises Pendant. Alt, groß und unendlich verloren steht er da. Genauso steif wie Hitler, aber nicht eben erst zu Haltung gekommen, sondern wie hineingestellt in diese Szene. Selbst unter dem zugeknöpften Mantel scheint er zu frieren; die Augen irgendwo in den beiden tiefschwarzen Höhlen versunken, verliert sich der Blick im Inneren; wie eine Schmähung hockt ihm der Zylinder auf dem Kopf, man denkt an einen Buchhalter um 1830, den ein sardonisches Schicksal auf die Duellwiese geschoben hat; ein lebendiger Toter.
Neben der geometrischen Bildmitte gibt es aber noch ein weiteres Aufmerksamkeitszentrum. Es befindet sich, wiederum so angemessen wie präzise, genau in der Mitte von Hitlers Körperachse. So wie der Zufall alle erdenklichen Mittel der Ikonographie aufgeboten hat, um die Bildmitte neben Hitler zu besetzen, so hat er auch einen genialen Einfall, um die Aufmerksamkeit von Hitlers exoterischem Körperzentrum – dem Schnäuzer – auf seinen geheimen Mittelpunkt abzulenken. Die rechte Hand Hitlers, die Hindenburghand – ausgerechnet! möchte der Fußballkommentator in uns schreien, ausgerechnet das Gravitationszentrum der gleich einsetzenden goebbelschen Handshakefarce! –, ist extrem unscharf. Weil sie sich ruckartig an der Zylinderkrempe bewegt, ist sie nur als verschwommener Schemen zu erkennen. Angesichts der gravitätischen Entschleunigungstendenz der gesamten Szene und der Tiefenschärfe des Bildes ein geradezu lächerlich brutaler Kontrast. Und nur die Hand! Noch der Ärmelsaum und die Manschette, die sich durch ihr hartes Weiß von der angrenzenden Hautfarbe abhebt, sind weitgehend scharf zu erkennen. Was hat sich der Zufall nur dabei gedacht? Gemahnt das Zucken von Potsdam etwa schon an den Tremor von Berlin? Der verlogene Anfang an das schreckliche Ende?
—
Nachdem unsere Runde das kleine Foto ausgiebig bestaunt und gedeutet hatte, stellte sich nun wie von selbst die Frage nach seinem weiteren Schicksal. Schließlich ist es ein Ding, und als solches hat es Anspruch auf seinen Platz in der Welt. Wo aber konnte der sein? Denn für Bilder aus dem Dritten Reich gibt es ja leider nur geweihte Orte: Schautafeln, Schulbücher, Dokumentarfilme; und alle diese Bilder stammen von den Nazis, sagte Nipperdeys akademischer Enkel und wirkte dabei etwas ratlos. Es ist wirklich absurd, sagte Princeton nickend, die Propaganda des Dritten Reichs hat dessen Untergang ziemlich unbeschadet überlebt; Goebbels hätte seine Freude an uns. Wie immer begriff die Bildzeitung am schnellsten. Rundfunkräte, Lehrplankommissionen, Kuratoren – alles Priester eines goebbelschen Reliquienkults! Aus eigener Erfahrung wisse sie allerdings, dass man die manipulative Macht von Bildern nicht überschätzen dürfe. Genau das tun wir aber doch, entfuhr es der F. A. Z., die damit das Senkblei der Ambivalenz in unsere nassforsche Intuition geworfen hatte. Die Zeitgenossen hätten schließlich die Propaganda zwangsläufig mit ihrer Lebenswirklichkeit verglichen: wer Angst hatte oder trauerte, der wusste, dass Goebbels log; wer meinte, es gehe ihm unter Hitler besser als vorher, dem bestätigte Goebbels nur, was er ohnehin schon wusste. Nur wir Nachgeborenen, vollendete dankbar die Berliner Zeitung den Gedanken, nur wir nehmen die Propaganda für bare Münze! Wir glotzen die immer gleichen Glasperlen aus Goebbels Illusionsfabrik an, als würden aus schönen Lügen schlimme Wahrheiten, wenn man nur das moralische Vorzeichen austauscht. Wir meinen uns im Recht, bestätigte Nipperdeys Enkel, wenn wir aus dem Engel der Vorsehung einen Dämon des Bösen machen. Dabei ist beides gleich falsch. Frohlockend schwante der Bildzeitung Unheil. Hieße das nicht, fragte sie, dass es ein Akt des moralischen Widerstands wäre, Brandsätze in den Bildbestand des Bundesarchivs zu werfen? Nein, ganz im Gegenteil, warf – subtil wie immer – das German Department Princeton ein: Wir müssen die Bilder bis zur Unkenntlichkeit beschmutzen, sie bis zur Auflösung verflüssigen. Läuft doch aufs Gleiche hinaus, schnodderte die Bild zurück. Nein, korrigierte sie Princeton sanft, Bilder ließen sich nicht so einfach aus der Welt schaffen; aber wie ihre Makellosigkeit von der fortdauernden Macht der Bilder über uns, so zeuge deren Befleckung von unserer Macht über sie. Flecken aber seien Ereignisse in der Zeit, und als solche dürfe man sie nicht in das museale Streulicht der Ewigkeit zerren. Um Epiphanien zu bleiben, denn nichts anderes seien große Fotos als die paradoxe Möglichkeit einer Gegenwartsdauer, müssten sie wohnen. Am besten in einer Wohnung, wo es einmal mehr dem Zufall überlassen bleibe, ob man ihren Winkel findet oder, wie der Blick der meisten Besucher, am herrlichen Jugendstilstuck hängen bleibt. Da lächelte die F. A. Z., beugte sich zu Princeton hinüber und hauchte ihm ein Praktikumsangebot ins Ohr. Schluss mit dem Gesäusel, aufhängen! Die Aufforderung des angesagten Trendforschers sprach uns allen aus dem Herzen. Und so besitzt das Foto neben den historischen Indices – Cut, Zylinder, Bordsteinkante – auch einen Index seines gegenwärtigen Gebrauchs: ein kleines Loch in der Mitte des oberen Randes. Eine Wohnspur, wenn man so will. Sie rührt von der Reißnadel her, die es seit über drei Jahren an unserer Wohnzimmerwand befestigt. Kommen Sie uns also ruhig besuchen, wenn Sie es mal sehen wollen. Fragen Sie beiläufig, ob wir zu den Ehepaaren zählen, die ihr Hochzeitsfoto aufgehängt haben. Haben wir, da hinten, gleich neben dem Führer.
Weil er die Wissenschaft von der Literatur trennt, ist dieser Text ist biographisch bedeutsam. Mit ihm ging eine etwa zehnjährige Übergangszeit zuende, in der ich in Bibliotheken und Archiven leidenschaftlich geforscht und fast wie ein normaler Historiker geschrieben hatte. Im Studium habe ich gelernt, dass nichts den Mythos des Dritten Reichs so wirksam entkräftet wie die Arbeit an der Geschichte. Und davon bin ich nach wie vor überzeugt. Vor den Fragen, die ein Ereignis ohne Vorbild aufwirft, flüchtet sich das Denken ja gerne in Phrase, Kitsch und Theorie. Und dagegen hilft nur mühsames Quellenstudium, hartnäckiges Unterscheiden und störrische Geduld. Doch gegen den Mythos der Wissenschaft hilft (wenn man kein Talent zur Philosophie hat) nur die Kunst. Das gilt insbesondere für Gegenstände, die uns mindestens so sehr bannen wie wir sie. Wo Ereignisse der Geschichte, und auch Vorgeschichten, sich erforschen lassen, da muss man vom Nachleben, von der Macht der Vergangenheit über die Gegenwart, erzählen. Gegen die Mythen der Geschichte hilft Wissenschaft, gegen die Mythen der Wissenschaft hilft Literatur. Doch was hilft gegen den Mythos der Biographie?
BD5R. Bericht aus Mitteldeutschland
I.
Ich schrieb bereits an der Geschichte meines Großvaters, als mir klar wurde, dass ich seinen ältesten Bruder nicht länger ignorieren konnte.
Bis zu diesem Zeitpunkt war das Interesse an der eigenen Familie wenn auch leidenschaftlich, so doch kühl gewesen. Wie ein Leichnam hatte sie vor mir gelegen. Binnen weniger Jahre, die mir rückblickend wie ein einziger langer Moment erscheinen, waren die Alten gestorben, die Jungen bankrott gegangen, das Haus verkauft worden, und meine Eltern redeten nicht mehr miteinander. In dieser Situation kam mir der Verdacht, Großvater sei ein schlechter Mensch gewesen, sehr gelegen. Er verwies auf ein verborgenes Geschwür, das man nur sorgfältig freilegen und sezieren musste, wollte man diesen totalen Zusammenbruch erklären. Ich empfand daher nichts weniger als Dankbarkeit und Erleichterung, als deutlich wurde, in welchem Ausmaß Großvaters Biographie mit dem Aufstieg und dem Fall des Dritten Reichs verbunden war. Dankbarkeit dafür, dass die tödliche Krankheit endlich einen Namen hatte und sich die vielen kleinen Katastrophen nun zu einem sinnvollen Ganzen fügten, Erleichterung darüber, dass das vor mir noch niemand bemerkt zu haben schien. Indem ich mich zu ihrem Pathologen machte, blieb mir meine Familie erhalten. Jedes Archiv, das ich fortan besuchte, jede Gerichtsakte, die ich studierte, jedes Interview, das ich führte, füllte das medizinische Bulletin, dessen Abschlussbefund im Grunde schon mit der Beschriftung feststand: Großvater war ein dicker Nazi.
Als mein Vater mir jedoch eines Tages den Lebensbericht seines Onkels zukommen ließ, bekam das Bild meiner Familie einen Riss. Die langweilige Geschichte bekam einen zweiten, einen Gegenpol, und allmählich begann sich der Grundriss einer Dramaturgie abzuzeichnen. Jedem, der Martin und seinen Bruder Friedrich, meinen Großvater, gekannt hatte, musste schließlich aufgefallen sein, wie verschieden, ja gegensätzlich die beiden waren. Hier eine freundliche Kauzigkeit, da eine Fassade aus Misstrauen und Strenge; hier bescheidener Erfolg trotz widriger Umstände, da lebenslange Abhängigkeit von der Familie; hier ein Meister der Selbstbeschränkung, der sich eine Welt nach seinem Maß erschuf; da ein Träumer, der sich vor der Welt verpanzerte, nachdem ihre Eroberung missglückt war; hier die Verankerung des Denkens in den Sinnen, Goethes bester Zug, da Schillers schlechtester, das Schwadronieren ohne Beobachtung. Wie ein Sinnbild dieser Gegensätzlichkeit wollte mir dabei der Umstand erscheinen, dass es dieselbe Herrschaft war, die dem einen seine Zeugungsfähigkeit raubte, während sie dem anderen für ein paar Jahre seines langen Lebens die Illusion schenkte, gebraucht zu werden.
Aber waren diese Gegenüberstellungen nicht meiner Sicht geschuldet, dem beschränkten Horizont des Nachgeborenen, der sich das Bild der Geschichte nach seinen Bedürfnissen entwirft und nur mühsam versteht, dass die Zeitgenossen die ›historische‹ Dramatik ihres Lebens fast immer übersehen müssen? Es steht fest, dass die Gegensätzlichkeit der beiden Brüder nie zum Gegensatz wurde; dass zwischen ihnen kein einziger Streit überliefert ist; dass erzählt wird, der eine habe den anderen aus einer misslichen Lage bei der Gestapo befreit; dass sie einander bis ins hohe Alter über die innerdeutsche Grenze hinweg schrieben: der Jüngere oft umständlich um Selbsterklärung bemüht, der Ältere immer souverän, aber beiderseits in einem verbindlichen Tonfall, der sich, nachdem sie kurz nacheinander gestorben waren, in den Briefen ihrer Witwen zu einer ausgesprochenen Herzlichkeit steigerte. Aber sagen uns nun diese Tatsachen etwas über das Verhältnis der beiden Brüder? Nein. Dagegen, wenn Martin mitteilte, seine Großmutter sei für ihn ein reiner Strom von innerer Kräftigung und Freude gewesen, während auf ihrer Beziehung zu Friedrich von Anfang an der Schatten des Missverstehens gelegen habe – sagt das etwas? Ist das eine Abgrenzung, ein Versuch, die eigenen Gefühle als die eines anderen, eines geliebten Menschen, auszuweisen? Vielleicht.
Letztlich sind all dies nur Deutungen, Dramatisierungen, Behauptungen. Keine Geschichte kommt ohne sie aus. Die nun folgende Geschichte aber hätte ohne einen Unterschied, der ganz unbestreitbar existiert, gar nicht erzählt werden können: Der eine nahm sein Leben mit ins Grab, der andere schrieb es auf.
II.
Ich weiß nicht, ob es nur mir, dem eingeweihten Leser, so geht, oder ob die Art der Schilderung den Zauber erzwingt. Eine kaum überschaubare Menge von Dingen, Sinneseindrücken, Personen und Begebenheiten schüttet Martins biographischer Bericht aus, doch alles scheint zueinander zu passen, jedes Detail strebt zu einer Mitte. Gut zehn Jahre vor meiner Geburt fügte der Großonkel in diesem Text Orte, die mir seit meiner frühesten Kindheit vertraut sind, zum Bild eines traumhaften Landes zusammen, das für mich nur als Ahnung existiert, für ihn immerhin als Erinnerung. Und was für eine!
Man stelle sich eine weite, flache Landschaft vor. So groß ist sie, dass ganze Staaten, Länder und Landstriche nach ihrem sinnfälligsten Merkmal, der Nähe zum Meeresspiegel, benannt sind: Niedersachsen, die Niederlande, die norddeutsche Tiefebene. In einer solchen Landschaft ist Abstand vom Meeresspiegel nur an wenigen Stellen entlang der großen Flüsse zu haben. Der Besitz von elf Meter Höhe ist ein Privileg. Kein Wunder, dass es ein reicher Mann war, der sich hier, am Weserhochufer im äußersten Norden des Staates Bremen, eine prächtige Villa aus gelbem Backstein bauen ließ. Nachdem es seiner Reederei über 20 Jahre als Kontor gedient hatte, verkaufte Friedrich Bischoff das Haus 1909 an seine Cousine Elisabeth Lange, Martins Großmutter. Ein Telefon verband ihre Wohnung im Hochparterre mit den beiden oberen Stockwerken, die von der Tochter Gesine, ihrem Mann, dem Gymnasialprofessor Heinrich Leo, und den drei Söhnen bezogen wurden. Hier verbrachte Martin den größten Teil seiner Kindheit und Jugend. Hier ist die Mitte, zu der seine Erinnerung immer wieder zurückkehrt. Hier, wo sich nicht nur das Ufer über den Fluss erhebt, sondern auch ein Haus über die Stadt und das Land.
Die Mitte ist der Turm.
Der Turm beherrschte ganz eindeutig das hohe Ufer, und unter seiner Herrschaft standen auch wir, schreibt Martin. Ihm, dem Turm, sei es zu verdanken, dass für ihn und seinen fast gleichaltrigen Bruder Heinrich das Hinauf- und Hinunterschauen zur natürlichen Lebenseinstellung geworden sei und nicht das Hin- und Herblicken in der Umgebung rechts und links. Das ist zunächst ganz wörtlich gemeint. Seiner Lage und Architektur wegen wirkt schon das Haus als solches auf Bewohner und Gäste wie ein Turm. Ihn zu betreten erfordert bereits einen Anstieg. Der Eingang liegt am Ende einer hohen Steintreppe, die sich wie ein schattiger Höhlenschlund in das Haus gräbt. Erst recht aber zwingt die Flussseite den Blick in die Vertikale. Das Grundstück ist lang, schmal und steil. Befindet man sich im Haus oder im oberen Teil des Gartens, muss man einfach immer wieder hinuntersehen zur Weser, auf der sich gewaltige Frachtschiffe zum Hafen oder in die Nordsee schieben. Unten, im Obstgarten, dreht man sich dagegen oft unwillkürlich um, legt den Kopf in den Nacken und prüft, ob zwischen den Wipfeln des Uferhangs die stumpfe Turmspitze erkennbar ist; und solange der Garten noch direkt in den Strand mündete, wird man gar nicht anders gekonnt haben, als beim Bad in der Weser dem Haus, das von hier wie eine goldene Krone auf der bewaldeten Böschung aussah, mit einem kurzen Blick nach oben die Reverenz zu erweisen.
Eine weitergehende Bedeutung erhält das Wort vom Hinauf- und Hinunterschauen, wenn vom Turm selbst die Rede ist. Übten Haus und Grundstück einen geradezu physischen Zwang aus, den Nachbarn keine Beachtung zu schenken, so war man hier oben über das rechts und links erhaben. Hier war man frei, seine Aufmerksamkeit zu verschenken. Hier konnte man sich orientieren. Nicht im wörtlichen Sinn wie ein Reisender, der die Lage seines Ziels finden will, auch nicht im metaphorischen wie ein Erstsemester, der Alternativen prüfen muss, um die Richtung seiner Karriere festzulegen. Sondern im symbolischen Sinn. Der Turm war für Martin der Ort, der es ihm gestattete, seine Idee vom Menschsein zu verwirklichen. Er glaubte, dass man die Welt nur begreifen könne, wenn man sich selbst zu ihrem Mittelpunkt gemacht hat. Wie den meisten Konditionalsätzen Goethes hätte er auch diesem zugestimmt: Willst du ins Unendliche schreiten, geh im Endlichen nach allen Seiten. Zu diesem Zweck muss die Welt sich in alle Richtungen ausdehnen, sie muss rund werden. Und zwar erfahrbar rund: Ob die Erde an sich eine Kugel ist, spielt dabei keine Rolle, solange sie für den einzelnen Menschen zum runden Raum wird. Zugleich darf dieser Raum nicht eintönig sein oder leer, wie der Himmel und das Meer vom Ausguck eines Segelschiffs, sondern voll mannigfaltiger Erscheinungen, die sich wahrnehmen und sammeln, vergleichen und bewerten, ordnen und begreifen lassen. Nur wenigen Menschen, daran lässt Martin keinen Zweifel, ist es vergönnt, das zu finden, was ein solcher Ort in besonders privilegierter Weise bereitstellt. Und selbst wenn er einem geschenkt wird – man kann ihn nicht einfach in Besitz nehmen. Man muss ihn zunächst aushalten. Denn er mutet dem Menschen eine Steigerung seiner Existenz zu, eine Erfahrung, die er zum bloßen Überleben nicht braucht. So sah sich das sechsjährige Kind bis an den Rand des Unerträglichen gefordert, als der Vater das erste Mal die schwere Falltür zum Turmpodest öffnete und sich plötzlich der Himmel auftat. Als endlose Leere wölbte er sich über dem Jungen und als Abgrund lag der Garten unter ihm. Nur langsam gewöhnte er sich an diese Höhe. Wie ein erweitertes Geländer gab ihm dabei der Horizont ringsum einen ersten Halt. Erst als der Schwindel sich nach mehreren Aufenthalten gelegt hatte, wurden die Bewegungen freier, das eiserne Geländer bald unnötig. Nun erst erschien der Reichtum der ganzen Welt so nah zum Greifen wie unten die Schiffe auf dem Fluss. Und allmählich wurde der Turm zu der Beobachtungsstation, die Martin erst 13 Jahre später räumen sollte, als er zum Studium nach Marburg aufbrach.
Einmal erobert, entlastete die Höhe des Turms das Kind von den Zumutungen der Ebene. Preußen, das war jetzt nicht mehr nur die Gefahrenzone hinter dem nördlichen Ende der Weserstraße, wo Piner Blaukopp, dem blaubemützten Anwärter auf das Gymnasium, der glühende Hass der dort wohnenden Proletarier entgegenschlug. Es war auch der Aumunder Kirchturm, der wie ein freundlicher Nachbar herüber grüßte. Und es war der grüne Teppich aus Park, Wald und Feldern, der zum märchenhaften Gut der Urgroßmutter in Fähr gehörte. Oldenburg, das war nicht mehr nur das Großherzogtum, auf dessen unbekanntem Gebiet einen am anderen Ufer die Weserfähre absetzte, ohne dass man dort etwas anzufangen gewusst hätte. Es war auch die 40 Kilometer entfernte Stadt, deren Umrisse man mit dem Feldstecher, einem Trieder-Binokel von C. P. Goerz, fast so deutlich erkennen konnte wie die des Bremer Doms. Und es war ein riesiger, bis zum Horizont reichender Halbkreis, den in der Osternacht unzählige Feuer erleuchteten. Nicht der Besuch, die Besucher eines Osterfeuers waren für diesen Jungen das größte Erlebnis: Besonders eindrucksvoll war es, schreibt Onkel Martin, wenn neben einem Osterfeuer in der Ferne eine Rakete aufstieg, die mit ihrem Feuerregen den haushohen, dunklen Reisigberg, in dem auch Teertonnen und alte, unbrauchbar gewordene Möbel brannten, samt den um das Feuer versammelten Menschen für Augenblicke deutlich sichtbar werden ließ. Durch Anblicke wie diesen bildete sich mit der Zeit bei Martin eine Haltung aus, die er Zuschauerbewusstsein nennt. Sie bestimmte zunehmend auch sein Leben am Boden.
In Vegesack im Staate Bremen gab es, wie vielerorts im Deutschen Reich, eine sogenannte fünfte Jahreszeit, in der die Stadt von einem Volksfest beherrscht wurde. In unmittelbarer Nähe des Hauses, dort wo auf Höhe des Hotel Bellevue die Breite Straße auf die Weserstraße traf, baute der Schausteller Heinrich Dralle jedes Jahr am ersten Wochenende im September ein Karussell auf. Sobald es dämmerte, wurde es von einer Vielzahl Petroleumlampen beleuchtet, die Frau Dralle jeden Tag putzte. Die dem frühabendlichen Karussell gewidmete Schilderung gehört zu den subtilsten Passagen der gesamten Erinnerungen. Hier zeigte sich, dass der Turm ein Lehrmeister für Martin war.
Wie alle anderen Kinder warf auch er das Marktgeld, das der Vater ihm und seinem Bruder Heinz auf den Pfennig genau ausgezahlt hatte, nicht ins Sparschwein. Doch es sind nicht die Fahrten auf dem Karussell, nicht Blasmusik und Laufballons, Zündplättchen und Knallkorken, Schmalznudeln und türkischer Honig, die er in den Mittelpunkt seines Berichts über den Vegesacker Markt stellt. Es ist eine Stimmung. Ein Ereignis, das nur stattfinden konnte, weil er gelernt hat, selbst im dichten Getümmel der Begehrlichkeiten aufmerksam zu bleiben. Der kaum zehnjährige Junge schaut einem Karussell zu. Dass jeder Sinn seine eigenen Gesetze hat, weiß Martin bereits seit er, angelehnt an das schmiedeeiserne Turmgeländer und bewaffnet mit dem Feldstecher des Vaters, die wuchtigen Hammerbewegungen der Werftarbeiter am gegenüberliegenden Ufer verfolgt und dabei ihre Schläge erst deutlich später gehört hat. Nun gehen die verfeinerten Sinne aber noch einen Schritt weiter. Sie spielen und tanzen miteinander und bemerkten plötzlich Dinge, die kaum noch mitteilbar sind:
Eines Tages fiel mir auf, als ich draußen vor dem Karussell stand, dass unter dem Zeltdach in der Mitte des Ganzen eine Reihe von Figürchen in einer Art von kleinem Saal sich aufhielt. Jede einzelne war verschieden von allen anderen und obwohl sie meistens paarweise angeordnet waren, machte jede eine Tanzgebärde, in der sie erstarrt zu sein schien. Das wurde aber anders, wenn die Musik der Orgel den Püppchen in die Glieder fuhr und wenn nun unten das Karussell sich in Bewegung setzte. Aus der großen Welt, die in Bewegung geraten war, übertrug sich etwas wie ein außerordentlich anmutiger, sublimierter Extrakt in den kleinen Saal und ließ die darin befindlichen Püppchen lebendig werden, bis die Musik verklungen war und das Karussell wieder stillstand. Was Wunder, dass bei diesem Beobachten auch die Musik, die immer damit verbunden war, Melodien aus »Carmen«, »La Traviata« und anderen Opern unter anderem, sich unvergesslich tief in die Seele einprägte. Dieses Geschehen, an dem ich oft und oft sehr aufmerksam teilnahm, führte nun dazu, dass Gefühle des Vertrauens, der Hochachtung und der Wertschätzung während des stillen Anschauens in mir wuchsen und sich zu bestimmten Formen ausgestalteten, die ohne das Zusammentreffen all der Umstände, in denen sie Gestalt gewannen, in dieser besonderen Weise gar nicht hätten zustande kommen können. Gerade, dass ich in heller Wachheit teilnahm an Geschehnissen, deren innerer Zusammenhang mir nur ganz undeutlich zum Bewusstsein kam, führte nun zu Gelegenheiten, im vollen Miterleben mit den Einzelheiten doch noch etwas mehr gewissermaßen zu sehen, als sich mechanisch nüchtern beschreiben lässt. Zwischen den Kindern, die da in der Kreuzung Weserstraße – Breite Straße umherliefen oder -standen und den Mitgliedern der Familie Dralle, die jedes Jahr das Karussell wieder aufbauten, in Stand halten und in Betrieb nehmen mussten, bildete sich durch solche zusätzlichen Beiträge von allen Seiten her, wie sie als Gefühle des Vertrauens, der Hochachtung und der Wertschätzung geschildert worden sind, eine menschlich warme Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses und der wechselseitigen Förderung in Bezug auf gute Laune und Wohlwollen heraus, die in der Erinnerung durchaus gleichberechtigt neben alles treten kann, was in der Schule gelernt werden musste, um gedanklich mit den Ereignissen des Lebens einigermaßen fertigzuwerden.
Der lange Satz voll gewichtiger Substantive wirkt ein wenig hilflos. Es ist nicht einfach, Gefühle zu beschreiben. Doch die Art des Versuchs ist bemerkenswert. Man hat es ja nicht mit einem unbeholfenen Geständnis zu tun oder mit unsicherer Lyrik. Es geht um mehr als nur Gefühle. Vielmehr spiegelt sich die Darstellung des Gefühls in der Darstellung von etwas anderem (ohne deshalb aber zur Metapher zu werden). Ebenso ausführlich und präzise will Martin die Stimmung wiedergeben wie zuvor eine anschauliche Erscheinung. Worum es ihm geht, ist ein Zustand, der Grenzen unwichtig werden und dennoch nicht verschwinden lässt: die Grenzen zwischen den einzelnen Sinnen, zwischen innerer und äußerer Welt, zwischen einander unbekannten Menschen. Doch keine rauschhafte Aufhebung des Unterschiedenen ist gemeint (dionysisch war ein Modewort), sondern seine harmonische Orchestrierung. Man kennt den geheimnisvollen Mechanismus nicht, der die große Bewegung der Holzpferde mit der kleinen Bewegung der tanzenden Puppen verbindet. Man weiß nur, dass Pferde und Tänzer um die gleiche Mitte kreisen und ihre Bewegung exakt so lange andauert wie die Musik der Drehorgel. Damit treten Bild und Ton in ein ganz eigenartiges Verhältnis: Sie sind weder so deutlich geschieden wie bei den Hammerschlägen am anderen Ufer, noch sind sie so eins wie bei einem einstürzenden Haus aus Bauklötzen. Vielmehr sind sie einander ähnlich. Die Musik entspricht dem Anblick ebenso wie die kleinen Bewegungen den großen, ohne dass man zu sagen wüsste, ob eines das andere verursacht. Ebenso entspricht die äußere Welt der inneren. Nur deshalb kann Martin ja behaupten, er sähe das, was er kurz später als Gefühl bezeichnet. Und auch die Stimmung der anderen Anwesenden entspricht der eigenen, alle haben teil an einer Atmosphäre des freundlichen Wohlwollens. Hätte man Martin genötigt, diese Wahrnehmung einer Harmonie mit nur einem Wort zu benennen, er hätte gesagt: ein Erlebnis.
Erlebnis ist ein urdeutsches Wort. Es bezeichnet die Gleichzeitigkeit von Anschauung und Gefühl. Goethe baute eine ganze Erkenntnistheorie auf die Idee, dass die Natur sich dem Menschen in Form von Erlebnissen mitteilt. Das Erleben hebt den Gegensatz von innerer und äußerer Welt auf. Die Erregung von Gefühlen durch die Phantasie – romantische Träumerei. Der Segelsport der Bremer Großkaufleute, den man vom Turm aus sehen konnte – ein zufälliger Sinnesreiz: Er berührte uns nicht, obwohl wir aus der Anschauung manches kannten, schreibt Martin. Dagegen das entfernte, vom Raketenlicht beleuchtete Osterfeuer – das war ein Erlebnis. Weil es sich erleben ließ, wäre Martin auch nie auf die Idee gekommen, das Karussell als das zu benennen, was es bei nüchterner Betrachtung ja zweifellos war: eine Maschine. Denn Maschinen ließen sich nicht anschauen (damals noch nicht, erst Ernst Jünger entkräftete dieses Vorurteil). Maschinen verführten oder verschreckten, bestenfalls waren sie nützlich; wollte man sich ihnen nicht ausliefern, musste man vor ihnen fliehen. Gerade ein Jahrmarkt war voll von ihnen: Maschinen, das waren die mit Starkstrom betriebenen Berg- und Tal-Achterbahnen, die Teufelsräder und die amerikanischen Vergnügungspaläste auf dem großen Sedanplatz, wo auch Keuneckes Wurstpalast stand, in dem man unter einer langen Fassade von im überirdischen Lichte rötlicher Bogenlampen erstrahlenden Säulengängen Bratwürste direkt vom Rost kaufen konnte.
Die Unterscheidung zwischen Karussell und Achterbahn ist fein, aber eindeutig. Sie trennt nicht den Menschen von der Technik, sondern sie umreißt das menschliche Maß. Zwei Feinde hat dieses Maß: das zu Kleine, den Zufall, und das zu Große, die Hybris. Wer sich dem Zufälligen überlässt, macht es sich zu leicht. Er nimmt die Bodenperspektive ein und folgt dem, was ihm rechts und links vor die Füße fällt: der Meinung der Nachbarn, dem lautesten Schrei, dem hellsten Licht, dem Duft von Bratwürsten. Umgekehrt gilt es, nicht mehr beherrschen zu wollen, als man überblicken kann. Wer sein Maß überschreitet, wer anmaßend wird, macht sich einseitig und verliert so die Mittellage. Doch wiederum sind die Unterschiede fein: Der Besitz von Reichtum ist etwas anders als seine endlose Vermehrung, eine Stadtrepublik wie Bremen ist kein Leviathan, und eine Kutsche kein Automobil. Die Auswahl dieser Beispiele aus Martins Welt habe ich getroffen, doch die Maximen stammen, natürlich, von Goethe: Erwirb, was dir gehört, begreife, was du kennst, werde, was du bist. Man kennt sie. Doch Menschen, die nach ihnen ihr Leben organisieren, kennt man nur noch aus Erinnerungen.