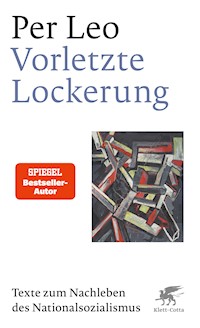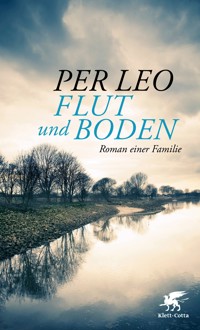15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie können wir uns von Hitler emanzipieren, ohne den Nationalsozialismus zu vergessen? »Leo hinterfragt die deutsche Erinnerungskultur wie keiner vor ihm. Ich habe seit Jahren kein so intensives, dringliches und brillant geschriebenes Buch mehr gelesen.« Peer Teuwsen, NZZ am Sonntag, 26.09.2021 Auf unsere Erinnerungskultur sind viele Deutsche stolz. Tatsächlich aber diente sie oft nur der eigenen Entlastung. Und sie hat unser Geschichtsbewusstsein verengt. Per Leo weitet es wieder, indem er den Blick öffnet: in die USA und zur DDR, nach Israel und Polen, zurück in eine unaufgeräumte Vergangenheit, nach vorne in ein unvollkommenes Einwanderungsland. Dieses radikale Buch verbindet eine Provokation mit einem Angebot. Es irritiert unseren Läuterungsstolz, und zugleich verlockt es zu einem frischen Blick auf die eigene Geschichte. Im Umgang mit dem Nationalsozialismus haben die Deutschen manches geleistet, sie sind aber auch vielen Illusionen erlegen. Heute droht eine Vergangenheit, die umso häufiger beschworen wird, je weniger man von ihr weiß, den Blick auf die Gegenwart zu verstellen. Migration und Wiedervereinigung haben unser Land so verändert, dass wir lernen müssen, anders auf uns selbst zu blicken. Weniger provinziell, weniger zwanghaft, weniger egozentrisch. Weltoffener, vielfältiger, neugieriger. Ein Leitmotiv, das uns dabei den Weg weisen könnte, ist für Leo das deutsch-jüdische Verhältnis. Wer bereit ist, die routinierte Betroffenheit über den Holocaust hinter sich zu lassen, wird auf eine verblüffende Vielfalt stoßen. Denn »die Juden« gibt es nicht – und auch hierzulande kann man viel, viel mehr sein als bloß »kein Nazi«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Per Leo
Tränen ohne Trauer
Nach der Erinnerungskultur
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Ruppe Koselleck, VG Bild-Kunst: ICH KANN BEIM BESTEN WILLEN KEINFISCHSTÄBCHEN ERKENNEN
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98219-0
E-Book ISBN 978-3-608-11664-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Der Wille zum Maß
Vom Abgrund
1986 und wir
Blick auf den Untergang
Im Schatten der Tat
Das Licht der Opfer
Aufklärung West
Blind für die Morgenröte
Post-arische Trauerschleier
Trugschluss naher Osten
Kurzschluss Naher Osten
Sturz in die Geschichte
East of Erinnerung
Incipit Comoedia
Danksagung
Anmerkungen
Der Wille zum Maß
Blick auf den Untergang
Blind für die Morgenröte
Sturz in die Geschichte
Nur soweit die Historie dem Leben dient,
wollen wir ihr dienen.
Friedrich Nietzsche
Don’t cry – work
Rainald Goetz
Der Wille zum Maß
Vom Abgrund
Vom Nationalsozialismus wird in Deutschland oft maßlos, selten genau gesprochen. Die Beliebigkeit des alltäglichen Geredes und die Vermessenheit seines Anspruchs stehen jedenfalls in keinem Verhältnis zu Wissen und Problembewusstsein, zu Urteilskraft und Sorgfalt, den vereinten Kräften, die ein historischer Gegenstand von solchem Gewicht eigentlich erforderte. Wer aber die Tugenden der Historie nicht kennt, wird gar nicht merken, dass er sich an der Geschichte verhebt. Es ist gute Sitte in unserem Land, mit dem Nationalsozialismus hundertmal auf andere zu zeigen, bevor man auch nur die komplizierte Frage ahnt, was er womöglich mit einem selbst zu tun haben könnte. An Hitler waren vor allem Hitler und der Nachbar schuld, und Auschwitz würde man den Juden nie verzeihen.[1] Wo nach dem Krieg kein Deutscher ein Nazi gewesen sein wollte, da versteht man sich mittlerweile so gut auf die Kunst des nachträglichen Ungehorsams, dass Linke wie Rechte, Liberale wie Autoritäre einander darin überbieten, heroischen Widerstand gegen den Anbruch des Vierten Reichs zu leisten. Und wenn das Heimischwerden syrischer Kriegsflüchtlinge auch daran scheitern kann, dass man ihnen voller Stolz ihr neues Land in einer KZ-Gedenkstätte vorstellt, dann kann es ein Zeichen gelungener Integration sein, dass ein »Migrationshintergründler« gelernt hat, nach zehn Minuten Internetrecherche den »Nazihintergrund« einer »biodeutschen« Mitbürgerin bloßzustellen.[2]
Es gibt für die Leichtfertigkeit, mit der wir uns auf den Nationalsozialismus beziehen, und die damit verbundene Unempfindlichkeit gegen die Schwerkraft des Historischen nachvollziehbare Gründe. Dass es in Deutschland irgendwann leichter wurde, über die Verbrechen des Dritten Reichs zu sprechen, war ein Fortschritt, nachdem man sich lange sehr schwer damit getan hatte. Aber heute ist es umgekehrt. Das entschiedene Nein zu Hitler ist so leicht zu haben, dass es schwerfällt, dankend abzulehnen. Musste vor 40 Jahren die schuldbelastete Vergangenheit aus ihrem Panzer gebrochen werden, liegt das Problem nun eher in ihrer schamlosen Zudringlichkeit. Um es auf den Begriff zu bringen, wäre allerdings ein Maßstab nötig, mit dem sich eben nicht die Vergangenheit selbst, sondern unser Verhältnis zu ihr beurteilen ließe. Zum Glück gibt es ihn schon seit fast 150 Jahren.
Friedrich Nietzsche hat das zweite Stück seiner »Unzeitgemäßen Betrachtungen« unter den Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben gestellt. Die damit angesprochene Leitfrage, wann der Umgang mit der Geschichte hilft und wann er schadet, ist auch die meine. Und sie sollte die unsere sein. Weil aber zum »Leben« die Vielfalt und der Wandel gehören, kann es auf diese Frage keine pauschale Antwort geben. Sie lässt sich immer nur mit Blick auf eine konkrete Lage und daher vergleichend stellen. Bekanntlich hat Nietzsche zu diesem Zweck eine Typologie der Haltungen entworfen, mit denen ein Mensch, ein Staat oder eine Kultur sich die Vergangenheit dienstbar machen kann: Es gibt eine monumentale Historie, die durch Erinnerung an große Vorbilder zum Handeln ermutigt; eine antiquarische Historie, die sich der Pflege eines lebendigen Erbes verschreibt; und eine kritische Historie, die über eine belastete Geschichte wacht, um sie auf Abstand zu halten. So wie alle Arten der Historie ihre Berechtigung haben und auch nebeneinander bestehen können, so muss jede von ihnen sich die Frage gefallen lassen, ob sie hier und jetzt eher schadet oder nützt. Was gestern angemessen war, kann heute maßlos sein, was in der einen Hinsicht zu wenig ist, kann in der anderen zu viel sein. Alles hat seine Zeit und seinen Ort, auch die Historie – wenn sie dem Leben dienen soll.
Da Nietzsche das Leben aber nicht, wie es bald Mode werden sollte, als Kampf, sondern gut goetheanisch als Wachstum begreift, als Entfaltung einer Möglichkeit, ist auch das Maßgebot kein Aufruf zur Selbstverkleinerung, sondern im Gegenteil, ein Mittel zur Steigerung des eigenen Vermögens. Die Geschichte ist hier ebenso radikal von der Gegenwart her gedacht, wie diese auf eine Zukunft hin entworfen ist.
Seine eigene Zeit sah Nietzsche vor allem durch ein Übermaß an historischer Bildung gekennzeichnet. Weil sie die Phänomene der Vergangenheit »rein und vollständig erkennen« und in »ein Erkenntnisphänomen auflösen« wolle, gilt seine »unzeitgemäße« Kritik einer Historie, die den lebendigen Zusammenhang der Zeiten zerschnitten hat und dadurch die menschliche Entfaltung erschwert.[3] Das Selbstverhältnis der historischen Zeitlichkeit sei, so Nietzsche, einem Subjekt-Objekt-Verhältnis von forschender Gegenwart und erforschter Vergangenheit gewichen.
Unsere Lage ist eine ganz andere. Von einem Übermaß an historischer Bildung kann beim besten Willen keine Rede sein. Und doch ist die Vergangenheit in unserem Land oft auf eine so hemmungslose Weise präsent, dass sie allmählich, wie mir scheint, dessen Entfaltung hemmt. Hemmungen aber machen auf Dauer entweder verzagt – oder sie rufen starke polemische Affekte hervor.
Nietzsche war immerhin so zart, seinen Affekt gegen den Historismus als »quälende Empfindung« zu bezeichnen. Nun steht auch bei gütigster Betrachtung die Geschichtswissenschaft heute in einem weniger glänzenden Licht da als im späten 19. Jahrhundert (hier widerspricht meine Frau), und der Autor dieses Buchs ist leider nicht der wirkmächtigste Denker seiner Epoche, sondern nur einer von unzählig vielen Schriftstellern der Gegenwart (hier stimmt sie zu). Dies eingestanden, will er dann aber auch bekennen, dass er für sein Buch keine bessere Bezeichnung wüsste als die Nietzsches für das seine. Eine »Naturbeschreibung meiner Empfindung« nannte er es.[4]
Widerwillen und Missmut haben den bundesrepublikanischen Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit von Anfang an begleitet, oft aus schlechten, doch manchmal auch aus guten Gründen. Originalität kann in dieser Hinsicht jedenfalls niemand reklamieren. Aber vielleicht ist es an der Zeit, die guten Gründe des Unbehagens etwas deutlicher, nicht unbedingt lauter, aber doch pointierter auszusprechen. Mit »revisionistischer« Absicht? Wenn die Infragestellung von Rechtsstaat, Demokratie und Westbindung gemeint ist, dann nicht. Wenn ein Ende der ernsthaften Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus gemeint ist, dann auch nicht. Aber wenn man es wörtlich versteht, als prüfenden Blick auf eine Geste deutscher Selbstgefälligkeit: dann schon.
»Unzeitgemäß«, schreibt Nietzsche drei Jahre nach der Reichsgründung, »ist diese Betrachtung, weil ich etwas, worauf die Zeit mit Recht stolz ist, ihre historische Bildung, hier einmal als Schaden, Gebreste und Mangel der Zeit zu verstehen versuche, weil ich sogar glaube, daß wir alle an einem historischen Fieber leiden und erkennen sollten, daß wir daran leiden.«[5] Mit Blick auf den historischen Abgrund, an dessen Rand sie gegründet wurde, hat die Bundesrepublik ein unvermeidlich komplizierteres Verhältnis zu ihrer Vergangenheit entwickelt als das Kaiserreich zu der seinen. Der Geschichtsschaden unserer Zeit, auf den sie aber zugleich mit Recht stolz ist, lässt sich daher nicht auf einen einfachen Ausdruck bringen. Doch wer »historische Bildung« durch »monumentale Erinnerung an ein Großverbrechen, antiquarische Gleichgültigkeit gegen das Bewahrenswerte und kritische Furcht vor Wiederholung« ersetzt, der ahnt vielleicht, in welche Richtung dieses Buch sich aufmacht.
Und wie 1874 stammt auch 2021 die Diagnose des »historischen Fiebers« nicht nur von einem Historiker als Arzt, sondern auch von einem Patienten, der jedoch, wenn die Diagnostik mehr sein will als eitle Belehrung oder Nabelschau, eigentlich nur »wir alle« sein können. Wir bundesdeutsche Zeitgenossen. Weil aber am Ende ein jeder für sich selbst denken muss, wird man meine »Naturbeschreibung« vielleicht am besten verstehen, wenn man sie als persönliche Fieberkurve eines pandemischen Leidens betrachtet – unseres Leidens an der Geschichte. Er wolle, sagt Nietzsche, »gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit« wirken.[6] Und im Rahmen meiner eigenen, viel kleineren Möglichkeiten will ich das auch. Doch um den Verlauf eines Zeitfiebers zu notieren, muss man zuvor eine Tafel der eigenen Zeitlage erstellt haben. Darum wird es am Anfang dieses Buchs noch nicht um meine Affekthitze gehen, sondern um eine eher kühle Vermessung unseres historischen Koordinatensystems. Denn mehr noch als bei anderen Vergangenheiten brauchen wir, wenn es um den Nationalsozialismus geht, eine doppelte Zeitachse.
»Alle deutsche Geschichte«, schreibt der Historiker Thomas Nipperdey im Oktober 1986, »ist mittelbar zu Hitler. Mittelbar auch zur Bundesrepublik. Aber unmittelbar ist sie auch etwas ganz anderes, nämlich sie selbst. Beides gehört zu unserer Identität, zu unserem Erbe. Geschichte beunruhigt unsere Identität. Aber sie stabilisiert sie auch. Und diese vergessene Wahrheit soll zu ihrem Recht kommen.«[7] Diese Sätze formulieren einen leisen Einspruch. Sie richten sich gegen die Position, die Jürgen Habermas im sogenannten Historikerstreit vertreten hatte, ohne deswegen aber Partei für dessen Kontrahenten Ernst Nolte zu ergreifen. Nipperdey schlägt sich auf keine Seite, er befragt den Streitgrund. Der von Habermas so heftig vertretene Einspruch des kritischen Erinnerns gegen die Normalisierung der Nationalgeschichte beruht für ihn ebenso auf einer falschen Alternative wie die Forderung, sich als Historiker zwischen Gegenwartsengagement und historistischer Distanz zu entscheiden. Nipperdey war ein kritischer, politisch denkender Historiker, der dem Historismus nahestand, aber auch wusste, dass die historische Wissenschaft des 19. Jahrhunderts von seiner eigenen Zeit durch einen Abgrund getrennt war. Und diesen Abgrund, der die mittelbare von der unmittelbaren Geschichte scheidet, gälte es immer noch zu bedenken, vielleicht sogar stärker denn je.
1986 konnte sich ein Geschichtsdenken, das gegen den Ruf zur Entscheidung auf dem Recht der Unterscheidung bestand, kaum Gehör verschaffen. Aber seitdem sind 35 Jahre vergangen, in denen sich viel verändert hat. Wir könnten heute nicht nur auf Nipperdey hören, wir sollten es auch wirklich tun.
Ziehen wir also zwei Zeitachsen, die beide den gleichen Ursprung haben: das Jahr 1945. Man kann sich dieses Jahr als den Rand einer tiefen Schlucht vorstellen, eines Abgrunds, dessen anderer Rand sichtbar, aber außer Reichweite ist. Von hier aus verläuft die eine Zeitachse horizontal. Auf ihr wächst der Abstand zum Abgrund, ohne dass die Verbindung zu ihm je abreißen könnte. Die andere Zeitachse führt uns jedoch zugleich nach oben, zunächst in sanfter, kaum merklicher Steigung, bald schon aber hinein in ein allmählich steiler werdendes Gebirge, von wo aus sich dem Auge Höhenmeter für Höhenmeter das Gebiet hinter dem Abgrund erschließt. Während wir uns, so ließe sich das Bild übersetzen, immer weiter vom Nationalsozialismus entfernen, ohne ihn aber als unseren Ausgangspunkt zu verlieren, gewinnen wir zugleich den Raum einer Geschichte zurück, in der Hitler nicht mehr der Autor, sondern nur noch ein Großkapitel ist.
1986 mochte es zwingend erschienen sein, den historischen Fokus auf die deutschen Verbrechen zu legen. Aber seitdem haben wir mit dem Abstand auch an Höhe gewonnen. Wer nach dem Ort des Nationalsozialismus in unserer Gegenwart fragt, darf also nicht nur den Abgrund im Auge haben, dessen Nähe wir aus der Höhe immer deutlicher sehen, aber kaum mehr fühlen können – er muss auch auf die Bergfreunde Habermas und Nolte achten, die in trauter Seilschaft weit unter uns in der Wand kraxeln. Um diesen doppelten Zeitbezug zu verdeutlichen, wird das nun folgende Kapitel zunächst die Differenz markieren, die uns vom Jahr 1986 trennt: den zweidimensional gewachsenen Abstand zum Abgrund. Und erst wenn das geschehen ist, kann die dann einsetzende Naturbeschreibung meiner historischen Empfindung sich auf die Zäsur von 1945 besinnen.
Diese Beschreibung beginnt, wie es sich für ein richtiges Fieber gehört, mit einer Abwehrreaktion gegen die Zeit, in die der Autor hineingewachsen ist, und einem Lob der Medizin, die ihm half, es zu lindern (Blick auf den Untergang). Der anschließende Gang durch die Zeit, auf die er wirken möchte, ist nicht frei von Rückfällen. Doch allzu viele durften es nicht sein, denn wie Gegenwarten es nun mal an sich haben, ist auch die unsere ein unübersichtliches und oft gefährliches Gelände, dessen Begehung Ausdauer und Umsicht erfordert (Blind für die Morgenröte). Der Ausblick auf die kommende Zeit ist schließlich von mildem Optimismus gestimmt. Er ahnt die Genesung, das Wachsen neuer Kräfte, die Vermehrung der Möglichkeiten. Aber er deutet auch an, wie unwahrscheinlich alles Gute ist (Sturz in die Geschichte).
Übertragen auf das Land, das wir alle sind, könnte die Unwahrscheinlichkeitsformel so lauten: Die alte Bundesrepublik hat sich, um ihre bescheidenen Kräfte zu entfalten, mit einem engen Horizont umgeben. Doch wenn uns die neue Republik gelingen soll, dann werden wir ihn weiten müssen. Dazu bedarf es nur einer kleinen Kopfbewegung, gegen die allerdings ein starker Instinkt Widerstand leistet. Mit der Höhe wächst die Angst vorm Absturz, das ist unvermeidlich. Wer aber trotzdem den Blick zu heben wagt – den wird das Heimweh zum Gipfel ziehen. Und wie den Alpenstrandläufer nach Süden: das Fernweh in die Zukunft.
1986 und wir
Ist die Singularität des Holocaust eine Tatsache? Das zweitägige Massaker in der Schlucht von Babij Jar, die Selektionen an der Rampe von Auschwitz-Birkenau, die Tötungsmaschinerie der Gaskammern, die Spurenauslöschung in den Krematorien, die Deportationszüge, die aus ganz Europa ins besetzte Polen rollten, die Sklavenarbeit, die der Ermordung oft vorausging, die Todesmärsche in den letzten Kriegswochen: All das sind Tatsachen. Aber dass der Völkermord an den europäischen Juden ein singuläres oder, wie es auch heißt, ein unvergleichliches Ereignis war, ist keine Tatsache, sondern ein Satz. Tatsachen lassen sich leugnen, Sätze nicht. Sätze kann man nur bestreiten.
In diesem Buch soll es eigentlich um etwas anderes gehen. Sein Thema ist nicht die Singularität des Holocaust, sondern die vielfältige Präsenz des Nationalsozialismus im Leben der Bundesrepublik Deutschland. Doch um darüber mit freiem Kopf schreiben zu können, war eine Beschäftigung mit dem Singularitätssatz nötig. Denn wenn das Leben das Maß der Historie ist, dann ist heute in Deutschland nicht die Rede, wohl aber das Geschwätz von der Singularität des Holocaust ein Symptom der Maßlosigkeit. Um das Gewicht der Rede gegen die Anmaßung des Geredes wieder fühlbar zu machen, wird der Historiker daher, bevor er in den Erzählton wechselt, zunächst etwas tun, das ihm nur in echten Notlagen erlaubt ist: Er wird angestrengt nachdenken. Dass er sich dazu aber überhaupt gezwungen sah, hatte auch mit den Umständen zu tun, unter denen dieses Buch geschrieben wurde. Es ist nämlich, in zwei mehrwöchigen Schüben, im Sommer 2020 und im Spätwinter 2021 entstanden, oder anders gesagt: nach der ersten und im Übergang von der zweiten zur dritten Welle der Coronapandemie. Vermutlich würde man eine solche Zeitangabe auch in 30 Jahren noch verstehen, denn wie die meisten Großkrisen wird wohl auch diese schon bald mit ihrem Datum verwachsen sein.
Aber würde man es in 30 Jahren auch noch verstehen, wenn es stattdessen hieße: Dieses Buch wurde zu der Zeit geschrieben, als in Deutschland ein schon lange schwelender Streit über das Verhältnis von Kolonialismus und Nationalsozialismus, von Rassismus und Antisemitismus, von Holocaust und Kolonialverbrechen plötzlich entflammte? Wird man im Rückblick sagen können, dass in den Debatten um den postkolonialistischen Theoretiker Achille Mbembe, den Umgang mit der propalästinensischen Boykottbewegung BDS, die Rückgabe von Raubkunst aus Afrika, die Bücher des Kolonialhistorikers Jürgen Zimmerer, des Kulturwissenschaftlers Michael Rothberg oder des Antisemitismusforschers Steffen Klävers Fragen aufgeworfen wurden, deren Erörterung unser Land verändert hat?[8] Begann 2020 eine Auseinandersetzung über unsere Geschichte, die Mentalitäten und Diskurse in Deutschland auf Dauer prägen wird? Erleben wir derzeit gar den Beginn eines zweiten Historikerstreits? Die Stimmen, die das für wahrscheinlich halten, werden jedenfalls lauter.[9] Manche beschwören es sogar. »Uns steht«, heißt es in einem exemplarischen Meinungsstück des Publizisten Stefan Laurin, »ein Historikerstreit bevor, der in seiner ideologischen Wucht weit über die Vorgängerdebatte aus den 80er Jahren hinausgeht.« Der Sachverhalt, der diesen Fanfarenstoß rechtfertigt, klingt wie eine Straftat: »Relativierung der Shoah«.[10]
Auf den ersten Blick ist die Analogie zum Historikerstreit gar nicht mal unplausibel.[11] Damals wie heute ging es um die Bewertung der deutschen Geschichte vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Damals wie heute wurde das größte seiner Verbrechen, der Völkermord an den europäischen Juden, ins Verhältnis gesetzt zu anderen Großverbrechen. Wo Jürgen Habermas 1986 scharfen Einspruch einlegte, als Ernst Nolte gefragt hatte, ob es womöglich einen »kausalen Nexus« zwischen der »asiatischen Tat« des Gulag und Auschwitz gebe, da entzündet sich der Streit 2020/21 an einer Frage, deren Muster der Buchtitel Von Windhuk nach Auschwitz? pointiert zum Ausdruck bringt.[12] Damals wie heute betraf die Kritik an solchen Fragen die Vermutung, das frühere Ereignis, hier die Massengewalt in der Sowjetunion beziehungsweise der Genozid an den Nama und Herero, könne in einer bedingenden, wenn nicht sogar ursächlichen Beziehung zum späteren, dem Holocaust, stehen. Und damals wie heute begründen die Kritiker ihr Bestehen auf der Singularität des Holocaust mit dem Verdacht, die Gegenpartei setze die normative Bindung der Bundesrepublik an den Westen aufs Spiel.
Doch wie immer man diese neu entflammte Debatte über die deutsche Geschichte im Rückblick auch bewerten wird, sollte sie sich tatsächlich intensivieren, wäre es zu begrüßen, wenn sie anders verliefe als der Historikerstreit. Denn eines fand 1986 nach übereinstimmender Meinung gerade nicht statt: eine Fachdiskussion unter Historikern. Wenn zwar die vier attackierten Wissenschaftler – Ernst Nolte, Michael Stürmer, Andreas Hillgruber und Klaus Hildebrand – Historiker waren, der Initiator der Kontroverse, Jürgen Habermas, und die schärfste Stimme seiner Partei, Rudolf Augstein, aber nicht, dann ist das mehr als ein Detail am Rande. Dass die einen den anderen unterstellten, den Nationalsozialismus aus der deutschen Geschichte »entsorgen« zu wollen, während diese jenen vorwarfen, die Deutschen in die »Geschichtslosigkeit« zu verbannen; dass sie sich wechselseitig schmähten, »konstitutionelle Nazis« oder geschichtsblinde »Moralisten« zu sein; dass die Kontrahenten oft noch Jahrzehnte später nicht zu einer persönlichen Aussprache bereit waren; dass die eine besonnene Stimme im Tumult, Thomas Nipperdey, den Streit schlicht ein »Unglück« für die deutsche Geschichtswissenschaft nannte, und die andere, Christian Meier, 2011 resigniert feststellte, aus heutiger Perspektive sei die Sache »kaum mehr zu verstehen« – all das wird man ehesten begreifen, wenn man sich die verwickelte Asymmetrie dieses Streits vor Augen hält.[13] Denn während die eine Seite mit mehr oder weniger politischen Absichten über Geschichte sprach, betrieb die andere mit mehr oder weniger wissenschaftlichen Mitteln Politik. In einer solchen Konstellation konnte kaum etwas Sinnvolles herauskommen.
Aber war der Historikerstreit deswegen überflüssig? Durchaus nicht. Mit etwas hermeneutischem Wohlwollen, das im Scheitern einer Debatte oder eines Textes nicht nur den Mangel, sondern auch die verfehlte Möglichkeit sieht, ließe sich im Rückblick sogar ein moderat positiver Saldo ziehen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wurden 1986 Fragelöcher aufgerissen, die bis heute nicht geschlossen sind. Wie sich etwa das »verfassungspatriotische« Zugehörigkeitsgefühl zu einem Staat, der seine Identität durch eine scharfe Zäsur mit der Vergangenheit gefunden hat, zur langen Geschichte seiner Nation verhält: diese Frage ist heute im Grunde genauso unbeantwortet wie vor 35 Jahren. Und mit Blick auf die unvollendete Wiedervereinigung, den Prozess der europäischen Integration und die Realität der Einwanderungsgesellschaft könnte man sogar sagen: Sie ist unbeantworteter denn je. Zum anderen aber ist es der Habermaspartei damals gelungen, in scharfer Opposition zum »geistig-moralischen« Wendeklima der frühen Ära Kohl eine geschichtspolitische Norm zu etablieren, die trotz aller Revisionsversuche seitdem nie mehr ernsthaft angezweifelt worden ist. Das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, so könnte man diese Norm umschreiben, soll in Deutschland nie wieder normal werden. Der Nationalsozialismus bleibt ein unverdauliches Erbteil unserer Geschichte, das sich auch auf Dauer nicht im »konventionellen« Selbstverständnis eines affirmativen Nationalismus auflösen darf. In diesem einen Punkt konnte auch Christian Meier dem Gezänk schließlich etwas Gutes abgewinnen. »Jetzt wurde – und offenbar endgültig«, so Meiers Fazit nach 25 Jahren, »die Probe aufs Exempel gemacht, daß diese Vergangenheit wirklich nicht vergehen will. Daß man sich überhebt, wenn man mit dieser Last zu jonglieren versucht.«[14]
Nur wurde diese Norm damals nicht mit solch olympischer Gelassenheit formuliert. Angesichts des Widerstandes von der einen Seite konnte sich der Wille, den Nationalsozialismus nicht vergehen zu lassen, nämlich nur bilden, indem die andere Seite ein historisches Sachurteil in ein politisches Bekenntnis verwandelte. Die Forderung, dass es für Deutschland nach dem Dritten Reich keine nationale Normalität mehr geben dürfe, war nicht zu trennen von der kategorischen Aussage, dass der Holocaust ein singuläres Verbrechen war. Doch diese Bindung der deutschen Identität an den Singularitätssatz hatte zur Folge, dass die absolute Bedeutung des Holocaust im gleichen Maße zu einem Politikum wurde, wie dessen komplexe Realität aus der politischen Öffentlichkeit verschwand. Das Ausschlussverhältnis zeigte sich musterhaft in dem Skandal, den der Bundestagspräsident Philipp Jenninger mit seiner Rede zum Gedenken an die Pogrome von 1938 auslöste. Statt mit den üblichen Pathosformeln der jüdischen Opfer zu gedenken, hatte Jenninger am 10. November 1988 unpathetisch über die Tätergesellschaft gesprochen, indem er in erlebter Rede die subtile Alltäglichkeit des Antisemitismus darzustellen versuchte. Womöglich tat er es ungeschickt, aber ein Rücktrittsgrund konnte das nur für eine Öffentlichkeit sein, die im realistischen Sprechen über ein absolutes Ereignis einen Akt der Entwürdigung sah.
Im Windschatten der Skandalisierung hat sich der Singularitätssatz am Ende der alten Bundesrepublik dann rasch zum Topos verselbständigt, einem Gemeinplatz, dessen Verständnis keinen Kontext, einer Behauptung, deren Geltung keine Begründung mehr erfordert. Als Günter Grass sich 2012 über eine deutsche U-Boot-Lieferung für Israel empörte, da floss die »letzte Tinte« ziemlich ungehemmt. Doch zur Kennzeichnung seines Heimatlandes, dessen Vergangenheit er infamerweise mit der angeblichen Bedrohung des Weltfriedens durch die israelische Atombombe verknüpfte (und folglich verglich!), genügte ihm die Phrase von »ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind«.[15]
Seit der Singularitätssatz zu einem Anker unserer politischen Kultur geworden ist, entfaltet er hierzulande die Wirkung eines ungeschriebenen Verfassungsartikels. Wer ihn durch profane Rede verletzt oder durch ergebnisoffenen Vergleich auf den Prüfstand stellt, setzt sich daher immer dem Verdacht aus, an die Grundfesten unserer Republik rühren zu wollen. Im Kontext der Kolonialismusdebatte brachte der Kunsthistoriker Horst Bredekamp diesen verfassungsähnlichen Rang unmissverständlich auf den Begriff, als er sich schockiert über den Vergleich von »Auschwitz« und »Namibia« zeigte und dagegen das Holocaustgedenken als »raison d’être unserer Gemeinschaft« beschwor.[16]Raison d’être bedeutet Daseinszweck oder Existenzgrund. Wir gedenken des Holocaust, also sind wir. Deutlicher kann man kaum sagen, dass dieser Staat auf Furcht gebaut ist.
Wer die eigene Norm nicht als souveräne Setzung oder freiwillige Selbstbindung begreifen kann, weil er seine Identität auf deren Verletzung gründet, der muss sich immer wieder aufs Neue vor sich selbst warnen. Doch so verständlich die Wiederholungsfurcht vor dem Hintergrund der deutschen Katastrophe auch sein mag, vernünftig ist sie gerade nicht. Denn die Norm des Normalisierungsverbots ist ja kein Selbstzweck. Sie drückt nur das Postulat aus, die Menschenwürde und, davon abgeleitet, Grundrechte und Demokratie zu schützen. Die raison d’être von Postulaten aber besteht in ihrer universellen Geltung. Und es gehört wesentlich zur Universalität des Postulats, dass man dessen Anerkennung nicht erzwingen kann, ohne sich selbst zu widersprechen. Die Bindung des Sollens an die Furcht vor dem Versagen beruht also wenn nicht auf einem Irrtum, so doch auf einer Illusion. Und die Formel zu ihrer Auflösung könnte lauten: Um den Bruch mit der eigenen Vergangenheit als geschichtspolitische Norm zu etablieren, mag die Verabsolutierung eines historischen Verbrechens nötig gewesen sein; doch die Anerkennung des Postulats, das sich in dieser Norm zeigt, hat nur zwei unhistorische Voraussetzung: Freiheit und Vernunft.
—
Wer sich gegenwärtig auf den Historikerstreit beruft, sollte allerdings nicht nur dessen zwiespältiges Erbe im Auge behalten, sondern auch einen gravierenden Unterschied zwischen den Debattenlagen von 1986 und 2021. Wenn der Historikerstreit so sehr auf Bewertungsfragen fokussiert war, dann hatte das nämlich nicht nur mit dessen geschichtspolitischer Tendenz zu tun. Es lag auch daran, dass über das Ausmaß der Gewalt, die im Nationalsozialismus und im Stalinismus geherrscht hatte, zwar keinerlei Zweifel bestand, aber die Ereigniskomplexe selbst höchstens in Ansätzen erforscht waren. Seitdem hat sich der historische Wissensstand jedoch in drei Hinsichten grundlegend verändert.
Erstens sind die Streitgegenstände von 1986, die Massengewalt in der stalinistischen Sowjetunion und im Nationalsozialismus, heute sehr gut erforscht. Wenn das auch nicht im gleichen Maße für die Kolonialverbrechen gilt, so hat sich aber, zweitens, der historische Horizont inzwischen so stark geweitet, dass die transnationale Weltgeschichte zu einem Paradigma der europäischen Geschichtswissenschaft geworden ist. Und wie jedes Paradigma erzeugt auch dieses Vielfalt. So besteht etwa zwischen den quellengestützten Synthesen, die zu einem insgesamt differenzierten Urteil über die Epoche der europäischen Imperien tendieren, und der theoriegeleiteten Kritik des Postkolonialismus ein ähnlich produktives Spannungsverhältnis wie seinerzeit zwischen der empirischen Sozialgeschichte und dem Marxismus.[17] Drittens schließlich hat die Verbindung von Holocaustforschung und vergleichender Völkermordforschung ein viel genaueres Verständnis für die komplexen Bedingungen, die vielfältigen Faktoren und den Prozesscharakter genozidaler Gewalt ermöglicht.
Bündelt man diese drei Wissensbestände nun in einer Gesamtperspektive, dann ließe sich über die historischen Beziehungen von Kolonialverbrechen und Holocaust durchaus erkenntisstiftend nachdenken. Allerdings dürfte dabei auch deutlich werden, dass die historische Linie von »Deutsch-Südwest« nach »Auschwitz« viel zu grob gezogen ist. Das Problem könnte vermutlich präziser formuliert werden, wenn man den Holocaust nicht über abstrakte Denkfiguren mit den Konzentrationslagern und Mordaktionen in den Kolonialgebieten in Verbindung brächte, sondern erst einmal fragte, in welchem welthistorischen Kontext er überhaupt stattfand. Dazu wäre aber eine doppelte Blickverschiebung nötig.
Zunächst ist es bei zeitlich und geographisch weit auseinander liegenden Ereignissen ratsam, die Fragerichtung umzudrehen. Wir neigen dazu, unsere Alltagserfahrung auf die Geschichte zu übertragen, indem wir chronologisch denken und das frühere Ereignis im Hinblick auf das spätere für einen »Anfang«, einen »Ursprung« oder eine »Ursache« halten. Wenn das Gebrüll des Gatten dem Vasenwurf der Gattin vorausgeht, darf man ein Kausalverhältnis unterstellen. Wenn aber ein Gewaltgeschehen sich Anfang des 20. Jahrhunderts im Südwesten Afrikas ereignet hat und das andere Jahrzehnte später in Mittelosteuropa, dann hilft die Alltagsanalogie nicht weiter. Zwei Ereignisse, die innerhalb weniger Sekunden im selben Raum stattfinden, kann man sich noch als Verbindung zweier Zeitpunkte vorstellen. Doch für Ereignisse, zwischen denen mehr als 30 Jahre und mehr als 10 000 Kilometer liegen, gilt das offensichtlich nicht. Vielmehr müsste man andersherum fragen, welche Bezüge sich vom späteren Ereignis aus in dem »Erfahrungsraum« (Reinhart Koselleck) der Vergangenheit, der als solcher immer ein Chaos aus unendlich vielen Punkten ist, überhaupt belegen lassen.
Eine solche Blickumkehr würde allerdings noch einen zweiten Schritt erfordern: die Relativierung des nationalhistorischen Deutungsrahmens. Dass der Holocaust vor allem ein Ereignis der deutschen Geschichte war, steht außer Zweifel. In welchem Maße der Erfahrungsraum, in dem dieses Verbrechen verübt wurde, aber nationalgeschichtlich strukturiert war, ist dagegen eine völlig offene Frage. Dass »Windhuk« für »Auschwitz« allein deswegen von Relevanz sein soll, weil die Täter in beiden Fällen Deutsche waren, wäre jedenfalls eine voreilige Annahme. Sie ist nicht unplausibel, aber ob und inwiefern sie zutrifft, ließe sich nur auf dem Weg mühsamer Quellenforschung klären. Pointiert gesagt: Dass die Konzentrationslager und der Völkermord in Südwestafrika Auschwitz zeitlich vorausgingen, ist für die Vergleichsperspektive weniger relevant als die Frage, welche Rolle diese Ereignisse im Alltagswissen jener Deutschen spielte, die für die Ingangsetzung der Judenmorde verantwortlich waren. Wie erhellend es umgekehrt ist, den nationalgeschichtlichen Blick auf den Holocaust um eine transnationale Perspektive zu ergänzen, haben etwa lokalhistorische Studien gezeigt, die nachwiesen, in welchem Maße aus den Reihen der osteuropäischen Bevölkerungen ab Sommer 1941 nicht nur ausführende Gehilfen, sondern auch aktive Mittäter des Genozids kamen.[18]
Dass bei der Betrachtung staatlicher Massengewalt nach wie vor die nationale Perspektive überwiegt, hat aber auch sachliche Gründe. Für den geschichtswissenschaftlichen Geltungsanspruch gibt es keine Adresse. Für den moralischen Anspruch auf Anerkennung, den politischen Anspruch auf Repräsentation und den rechtlichen Anspruch auf Entschädigung kollektiver Leiderfahrungen aber sehr wohl. Und wie auch immer man die realgeschichtliche Frage nach ihrem Zusammenhang beurteilt: Im Fall des Holocaust wie in allen Fällen deutscher Kolonialgewalt kann der Adressat solcher Ansprüche nur die Bundesrepublik Deutschland sein, der Staat, der in moralischer, juristischer und politischer Hinsicht die Nachfolge des Kaiserreichs sowie der formal erst 1945 aufgelösten Weimarer Republik angetreten hat.
So leicht die Unterscheidung dieser Ansprüche aber theoretisch fällt, so schwer ist es, sie im Pulverdampf der Debatte auseinanderzuhalten. Weil die freie Öffentlichkeit außer dem Strafrecht keine Grenze kennt, bringt sie aus sich selbst die Tendenz hervor, Ansprüche vor allem wirksam zu formulieren. Und darum fördert sie auf allen Seiten expressive, aktivistische und polarisierende Sprechmuster, die sich am besten in der ersten Person formulieren lassen. Ich klage ein Unrecht an! Wir fordern Gerechtigkeit! Ich zeige meinen Standpunkt! Wir wollen gehört werden! Als solche sind die Einseitigkeit, die Übertreibung und die Taktlosigkeit solcher Meinungsäußerungen gar kein Problem, denn im freiheitlichen Staat ist die Vernunft genauso wenig souverän wie die Regierung. Umso wichtiger aber wäre es, diese Mittel, um den angemessenen vom maßlosen Gebrauch zu unterscheiden, als das zu bezeichnen, was sie sind. In unserem Fall wäre vor allem der kritische Hinweis geboten, dass die Ansprüche von Moral, Gerechtigkeit und Repräsentation nicht nur wirksamer formuliert werden können als die unvermeidlich komplexeren Geltungsansprüche der Wissenschaft, sondern auch dazu tendieren, sich zu ihrer Durchsetzung der Wissenschaften zu bedienen. Bis zu einem gewissen Grad ist das unvermeidlich. Um beispielsweise den Anspruch auf Restitution eines völkerkundlichen Exponats zu klären, muss man ja wissen, woher es stammt und unter welchen Umständen es im 19. Jahrhundert den Besitzer gewechselt hat. Dazu bedarf es wissenschaftlicher Expertise. Aber dass etwa die Kunsthistorikerin Bénédict Savoy auch Gutachten in postkolonialen Restitutionsfragen verfasst, heißt nicht, dass sich ihr Fach oder gar die Geschichtswissenschaft als Ganzes auf Nützlichkeitsfragen reduzieren ließe. Es gibt ein schützenswertes Eigenrecht der Realgeschichte, und je stärker es sich Gehör verschafft, desto besser kann man der Instrumentalisierung historischen Wissens begegnen. Ein Beispiel mag das verdeutlichen.
In der öffentlichen Debatte werden derzeit äußerst wirksam die beiden Großbegriffe »Antisemitismus« und »Rassismus« gegeneinander in Stellung gebracht. Die anthropometrische Vermessung, die Segregation, die Ausbeutung und in extremen Fällen auch die Ermordung der Kolonialbevölkerungen folgten, so heißt es, einer anderen Logik als die Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus. Diese Unterscheidung ist historisch zutreffend. Aber sie fällt nicht zusammen mit der Unterscheidung von Antisemitismus und Rassismus.
Der Holocaust war ein antisemitisches Verbrechen, zu dessen notwendigen Voraussetzungen die rassistische Definition einer Opfergruppe gehörte. Ob jemand als »Jude« galt oder nicht, entschied im Dritten Reich über Leben oder Tod. Diese in den ersten Jahren des Nationalsozialismus durchaus umstrittene Definitionsfrage wurde 1935 mit den Nürnberger Gesetzen entschieden, und zwar im Paradigma eines bevölkerungspolitischen Rassismus. Erst die Quantifizierung von »Blutsanteilen« gab dem Antisemitismus eine Form, die antisemitisches Verwaltungshandeln ermöglichte. Und genau diese Form wurde im Gefolge der Wannseekonferenz de facto bestätigt – mit ebenso tödlicher wie rettender Konsequenz. Der Status eines »Mischlings 1. Grades« oder das Leben in »privilegierter Mischehe« hatten unter gewissen Bedingungen schon vorher Schutz vor staatlicher Diskriminierung geboten, nun schützten sie in bestimmten Fällen vor Ermordung; dagegen konnte kein blondes Haar, kein christliches Bekenntnis und kein Eisernes Kreuz einen »Volljuden« vor der Deportation bewahren.[19]
Und genauso wenig darf man übersehen, dass der Völkermord an den europäischen Juden unvorstellbar gewesen wäre ohne den Kontext eines Ressourcen- und Vernichtungskriegs, dem in Mittel- und Osteuropa auch ein deutsch-völkischer Siedlungsrassismus seine Ziele diktierte. Nur hatte dieser Rassismus einen anderen Kontext als die Schädelvermessungen in Subsahara-Afrika. Dort diente der anthropologische Rassismus, wie pervertiert es uns heute auch vorkommen mag, einem wissenschaftlichen Zweck, in dem sich wiederum ein politisch-ökonomisches Interesse spiegelte. Die kategoriale Ungleichheit indigener Gruppen als Tatsache auszuweisen war nicht zu trennen von der Absicht, deren Siedlungsräume zum eigenen Vorteil zu bewirtschaften und zu verwalten. Dagegen zielte der Rassismus im Nationalsozialismus nicht nur auf die Objektivierung und Kontrolle von Bevölkerungsgruppen, sondern auch auf die radikale Umgestaltung des deutschen »Volkskörpers« und die Neuformierung eines imperialen Großraums in Mittel- und Osteuropa. Weil aber beide Tatbestände auf jeweils eigene Weise einer rassistischen Logik folgen, ist es wahrscheinlich, und zum Teil auch schon belegt, dass der frühere Sachverhalt Teil des Erfahrungsraums war, in dem der spätere stattfand. Aber in welchem Umfang und wie vermittelt das im Einzelnen der Fall war, lässt sich, wie gesagt, nur durch Quellenarbeit herausfinden.
Wenn die wissenschaftliche Erforschung von Staatsverbrechen immer wieder von deren moralischer, rechtlicher und politischer Bewertung kolonialisiert (!) wird, dann ist das sachlich nicht zu begründen. Aber mit Blick auf die Ansprüche, die aus ihnen hervorgehen, ist es durchaus nachvollziehbar. Und auch warum in der deutschen Öffentlichkeit so besonders vehement darauf bestanden wird, den historischen Blick im Container der Nationalgeschichte zu halten, lässt sich erklären. Denn auch das dürfte eine Folge des Historikerstreits sein, oder genauer gesagt: der geschichtspolitischen Frage, die sich in ihm zeigte, und der Dynamik, die sie nach der Wiedervereinigung entfaltete. Die epochale Katastrophe des Nationalsozialismus nicht nur als Ereignis der deutschen Geschichte anzuerkennen, sondern sie auch aus dieser Geschichte abzuleiten, war kaum zu trennen von der normativen Forderung, den Pfad dieser Geschichte zu verlassen und sich in die historische Traditionslinie des »Westens« einzureihen. Das öffentliche Bestehen auf der Singularität von Auschwitz und das kritische Forschungsparadigma des »deutschen Sonderwegs« sind zwei Seiten derselben Medaille. Während aber 1986 die Eindämmung eines – tatsächlich oder vermeintlich – wieder erstarkenden Nationalismus ein reines Diskursereignis gewesen war, erschien das Anliegen mit der Wiedervereinigung plötzlich in einem ganz anderen Licht. Bis zum Mauerfall hatte die Unmöglichkeit eines deutschen Nationalstaats die Norm des Nationalismusverbots gleichsam in der Wirklichkeit verankert. Und es gab nicht wenige, die wie Günter Grass bereit waren, die deutsche Teilung nicht nur faktisch zu akzeptieren, sondern sie auch als einen Sühnepreis zu betrachten, den Deutschland für die Verbrechen des Nationalsozialismus zu entrichten hatte. Doch diese Lage änderte sich zwischen November 1989 und März 1990 dramatisch. Die Debattenfrage, ob es angesichts der deutschen Vergangenheit ein deutsches Nationalbewusstsein geben dürfe, verwandelte sich innerhalb weniger Wochen in das Problem, wie die Norm des Nationalismusverbots sich zur Realität des nun möglich gewordenen Nationalstaats verhalten solle.
Wenn das nationalismuskritische Lager die Wiedervereinigung am Ende trotz aller Vorbehalte mehrheitlich akzeptierte, dann nur, weil auch die vergrößerte Bundesrepublik den Bruch mit der Nationalgeschichte nicht revidierte. Außenpolitisch waren mit der Westbindung, der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und der europäischen Integration die Richtungsentscheidungen der alten Bundesrepublik de iure bestätigt worden. Und in der historischen Selbstdarstellung des neuen Nationalstaats etablierte sich de facto ein Gleichgewicht von »konventionellen« und »kritischen« Repräsentationsformen. Wer heute in Berlin vom Alexanderplatz zur Siegessäule fährt, passiert zuerst das wiederaufgebaute Stadtschloss der Hohenzollern, das Zeughaus mit dem Deutschen Historischen Museum und die Zentrale Gedenkstätte in der Neuen Wache bevor er dann das Holocaustmahnmal, das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma und das Ehrenmal der Roten Armee erreicht. Es ist auch die Wachsamkeit gegen alle – tatsächlichen oder vermeintlichen – Versuche, die Zäsur in der deutschen Geschichte zu kaschieren, die unseren historischen Blick nach wie vor an den Nationalstaat fesselt.
Dass in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit viel stärker als andernorts das heroische Deutungsmuster der »Opfer und Helden« vom normativen Deutungsmuster »Verantwortung und Erinnerung« eingehegt wird, hat seine guten Gründe. Aber es hat auch seinen Preis. Wo in vielen Ländern des Westens eine produktive Spannung zwischen einer mythologischen Selbsterzählung und deren Kritik durch die historische Forschung besteht, herrscht in Deutschland eine andere Lage. In dem Auftrag, die mahnende Erinnerung an den Nationalsozialismus zu kultivieren, haben Geschichtswissenschaft und politische Öffentlichkeit hier ein gemeinsames Ziel. Anders als in »konventionellen« Nationalstaaten zielt der kritische Impuls unserer Historiker weniger auf die Irritation eines positiven Mythos als auf die Verteidigung einer negativen Norm. Diese Tendenz führt zu dem bemerkenswerten Umstand, dass Historikerinnen, die diese Norm – vermeintlich oder tatsächlich – in Frage stellen, etwa indem sie das Kaiserreich nicht als Vorgeschichte des Dritten Reichs, sondern der Bundesrepublik behandeln, oder indem sie Kolonialverbrechen mit dem Holocaust vergleichen, in der deutschen Öffentlichkeit mit einer Schärfe angegriffen werden, die ausländischen Kollegen oft den Atem verschlägt. Aber genauso bemerkenswert ist der Umstand, dass auch diese Abweichungen vom disziplinären Mainstream meist im Rahmen der Nationalgeschichte verbleiben. Kaum ein Historiker vertritt – nach der stillen Selbstauflösung der Bielefelder Schule – heute noch die Sonderwegsthese. Aber als Deutungsmuster scheint ihre Macht ungebrochen.