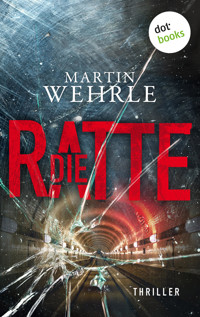4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mosaik
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In vielen Firmen herrscht das Diktat der Unvernunft. Mitarbeiter müssen tun, was ihnen gesagt wird, weil es ihnen gesagt wird – auch wenn es der letzte Unsinn ist. Regeln ersetzen den gesunden Menschenverstand. Das Betriebsklima orientiert sich vor allem an der Laune der Chefs. In seinem neuen Buch zerrt Martin Wehrle ans Licht, womit Unternehmen ihre Mitarbeiter heute in den Wahnsinn treiben. Mit Erfahrungsberichten, unglaublichen Beispielen aus seiner Praxis und seiner typischen erfrischenden Sprache holt er die Leserinnen und Leser dort ab, wo sie täglich herausgefordert sind, und eröffnet Möglichkeiten, dem Wahnsinn entgegenzutreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
In vielen Firmen herrscht das Diktat der Unvernunft. Mitarbeiter müssen tun, was ihnen gesagt wird, weil es ihnen gesagt wird – auch wenn es der letzte Unsinn ist. Regeln ersetzen den gesunden Menschenverstand. Das Betriebsklima orientiert sich vor allem an der Laune der Chefs. In seinem neuen Buch zerrt Martin Wehrle ans Licht, womit Unternehmen ihre Mitarbeiter heute in den Wahnsinn treiben. Mit Erfahrungsberichten, unglaublichen Beispielen aus seiner Praxis und seiner typischen erfrischenden Sprache holt er die Leserinnen und Leser dort ab, wo sie täglich herausgefordert sind, und eröffnet Möglichkeiten, dem Wahnsinn entgegenzutreten.
Autor
Der Erfolgsautor Martin Wehrle ist Deutschlands bekanntester Karriere- und Lebenscoach. Seine Bücher haben rund um den Globus begeisterte Leser gefunden, zuletzt erschienen die Bestseller Der Klügere denkt nach sowie Sei einzig, nicht artig!. An seiner Karriereberater-Akademie gibt er Erfahrungen weiter und bildet mit großem Erfolg Coachs aus. Firmen schätzen ihn als unterhaltsamen Redner und Podiumsteilnehmer.
Über seinen YouTube-Kanal »Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps« erreicht er jährlich mehrere Millionen Menschen.
Außerdem von Martin Wehrle im Programm:
Geheime Tricks für mehr Gehalt ( auch als E-Book erhältlich)
Bin ich hier der Depp?! ( auch als E-Book erhältlich)
Viel Fleiß, kein Preis ( auch als E-Book erhältlich, auch unter dem Titel »Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger?!« erschienen)
Sei einzig, nicht artig! ( auch als E-Book erhältlich)
Der Klügere denkt nach ( auch als E-Book erhältlich)
Martin Wehrle
Noch so ein Arbeitstag, und ich dreh durch
Was Mitarbeiter
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Martin Wehrle
Copyright © 2018 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Cover: *zeichenpool
Covermotiv: istockphoto/Ryzhi
Illustrationen: istockphoto/Rhyzhi
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
MZ ∙ Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-21125-7V003
www.mosaik-verlag.de
Inhalt
Vorwort: Haben Sie Mr Hyde gesehen?
1. Firma mit Knall: Ich bin ein Mitarbeiter, holt mich hier raus!
Mich fragt ja keiner!
Warum Arbeit so oft aus der Kurve fliegt
Wahrer Irrsinn
Beim nächsten Meeting drehe ich durch!
Die Hexenjagd auf Low-Performer
Wahrer Irrsinn
2. Arbeit ohne Grenzen: Wer hat meinen Feierabend geklaut?
Der Mann, der in seiner Firma schlief
Das Fließband läuft im Kopf
Wahrer Irrsinn
Die Kunst der Selbstausbeutung
Wenn Arbeit alle Deiche sprengt
Der Welpenschutz
Wahrer Irrsinn
3. Führung mit Schnuller: Bin ich denn hier im Kindergarten?
Willkommen im Mitarbeiter-Gespräch!
Das späteste Feedback der Welt
Wahrer Irrsinn
Meinungsfreiheit mit Maske
Das Arsenal der Motivationskünstler
Mach dich zum Hampelmann!
Wahrer Irrsinn
4. Die Spar-Schweinerei: Hilfe, mich jagt ein Kostenkiller!
Es fährt ein Zug nach Nirgendwo
Die unfreiwilligen Putzteufel
Wahrer Irrsinn
Und raus bist du!
Wenn das Sparschwein regiert
Kafka und die Puppe
Wahrer Irrsinn
5. Die Lügen-AG: Warum die Wahrheit bei uns VW fährt (abgasfrei!)
Der Markt heiligt die Mittel
Wir sind keine Gauner – nur ausgeschlafen!
Wahrer Irrsinn
Der Mörder unterm Firmendach
Die VW-Affäre: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts!
Wahrer Irrsinn
6. Elefant im Bewerbungszirkus: Mein Interview mit Irren
Als Bettler im Vorstellungsgespräch
Ein Grabstein namens Stellenausschreibung
Der kleine Übersetzer: Stellenausschreibung – Deutsch
Wahrer Irrsinn
Das Ende der Märchenstunde
Absage mit Holzhammer
Fiese Fehlgriffe: Darum werden die Besten nie eingestellt
Wahrer Irrsinn
7. Die Prozess-Lawine: Diese Bürokratie bringt mich noch um!
Quartals-Irrsinn: Kapitalismus trifft Planwirtschaft
Das 40-Augen-Prinzip
Wahrer Irrsinn
Ohne Doktortitel geht hier nichts!
Die fünf Flüche der Bürokratie
Wahrer Irrsinn
8. Sklavenfron statt Mindestlohn: Wie meine Firma mich eiskalt austrickst
Ein Witz namens Mindestlohn
Die zehn Tricks der Gehaltsdrücker-Kolonne
Der höllische Arbeitgeber
Wahrer Irrsinn
Nürnberger Prozesse: So geht’s zu in der Arbeitsagentur
Leiharbeit: Menschenware zum Tiefstpreis
Der Überlassungs-Trick
Wahrer Irrsinn
9. Frauenförderung mit Trick: Ich werde bevorzugt – beim Kaffeekochen!
Die Schwangerschafts-Spione
Macht die Quote alles schlimmer?
Wahrer Irrsinn
Die verschwundenen Bewerberinnen
Der Zicken-Verdacht
Wahrer Irrsinn
10. Tschüs, Kapitalismus: Was die Arbeitswelt noch retten kann
Der Fluch der maßlosen Gier
Von Kapitalismus und Kartoffelkäfern
Sechs Richtige, um die Arbeitswelt zu retten
1. Mehr individuelle Abgrenzung
2. Mehr kollektive Abgrenzung
3. Mehr Einfluss für Gewerkschaften und Betriebsräte
4. Mehr Staat und weniger Wildwuchs
5. Mehr Sinnorientierung in den Firmen
6. Mehr Arbeit für Sinn – und weniger für Gewinn
Coaching-Sprechstunde: 45 Mitarbeiter-Fragen aus der Praxis
Weiterführende Literatur
Quellenverzeichnis
Register
Vorwort: Haben Sie Mr Hyde gesehen?
Warum interessiert Sie dieses Buch? Hegen Sie den Verdacht, dass Sie bei der Arbeit durchdrehen? Überprüfen Sie es in nur zwei Minuten. Wie oft stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Haben Sie es satt, jeden Tag in Meetings zu sitzen, in denen Arbeitszeit verbrannt und nur eines bewegt wird: die Lippen?
Hat sich Ihr letztes Mitarbeiter-Gespräch – wie oft wurde es verschoben? – mal wieder als »Nullrunde« entpuppt, auch inhaltlich?
Hören Sie pausenlos, dass Mitarbeiter in Ihrer Firma »Mitunternehmer« sind – während Ihr Entscheidungsspielraum nicht einmal zur Bürotür reicht und der Gewinn zuverlässig an Ihnen vorbeirauscht?
Sind die Arbeitsfluten bei knapper Personalstärke so sehr angeschwollen, dass Sie Überstunden aus Notwehr leisten?
Ist Ihr Chef ein Meeting-Nomade, der jeden Flecken auf den Tapeten der Sitzungsräume besser kennt und öfter sieht als seine Mitarbeiter?
Haben Sie als Frau den Verdacht, dass »Chancengleichheit« sich nicht auf Gehalts- und Karrierechancen bezieht, sondern auf Ihren Vortritt beim Kaffeekochen?
Haben Sie als Mann den Verdacht, dass das Ausschöpfen der Elternzeit Ihrer Karriere etwa so sehr dient wie ein aus Ihrer Ecke geworfenes Handtuch beim Boxen?
Gleicht Ihre Arbeit einem bürokratischen Hindernislauf, bei dem Sie stolpern über Richtlinien, Reportings und ähnlichen Käse?
Hat sich das Controlling in Ihrer Firma zum Selbstzweck erhoben und braust wie ein riesiger Mähdrescher über alles hinweg, um zu kürzen, wo nichts mehr zu kürzen ist?
Und wurde Ihnen im Vorstellungsgespräch eine höchstvernünftige Firma präsentiert, die Ihnen nach Ihrem Eintritt so nie wieder begegnet ist?
Wenn Sie ein- bis zweimal genickt haben, drehen Sie nur gelegentlich durch. Wenn Sie drei- bis viermal genickt haben, führt der Irrsinn bereits die Geschäfte. Und wenn Sie öfter bejaht haben, sage ich: Herzliches Beileid – und Kopf hoch, denn Sie sind nicht allein!
Die durchgedrehte Arbeitswelt ist mein Spezialgebiet, als Karriereberater sitze ich an der Quelle: Unzählige Mitarbeiter berichten mir, was wirklich abgeht an ihren Arbeitsplätzen. Dann zerplatzen die Sprechblasen der Firmen-PR. Dr. Jekyll, das freundliche Firmen-Maskottchen, verwandelt sich in Mr Hyde, einen begnadeten Motivations-Killer.
Zum Beispiel hat mir neulich der Industriekaufmann Jan Nidder[1] (34) berichtet, wie er nach drei Wochen Urlaub zurück zur Arbeit kam. Seine Kollegen in dem Energiekonzern freuten sich riesig, auch weil sie in Arbeit fast erstickten (dank Personalkürzungen). Er krempelte die Ärmel hoch und legte los.
Mittags in der Kantine lief ihm sein Chef, ein passionierter Meeting-Bewohner, über den Weg. Er steuerte direkt auf ihn zu und meinte gönnerhaft: »Herr Nidder, sind Sie denn immer noch hier?«
»Immer noch?«
»Der August ist schon fast zu Ende!«
»Wie meinen Sie das?«
»Na, Sie wollten doch in Sommerurlaub fahren. Jetzt wird’s Zeit!«
Fast wäre Nidder das Tablett aus der Hand gefallen: Sein Chef hatte nicht bemerkt, dass er drei Wochen abwesend war! Fortan spielte er mit dem Gedanken, einfach zu Hause zu bleiben: »Vielleicht fällt’s nicht auf. Und ich bekomme mein Gehalt bis zur Rente weiter.«
Wer die Führungsrichtlinien dieses Konzerns liest, dem vermittelt Dr. Jekyll ein ganz anderes Bild: »Wertschätzung«, »Individualität«, »Mitarbeiterorientierung«– es hagelt Führungs-Kuschelvokabeln, die im Alltag nur leere Worthülsen sind. Meine Erfahrung:
Je lauter eine Firma Compliance predigt, desto mehr wird beschissen. Je lauter sie die Gerechtigkeit preist, desto willkürlicher geht es zu.
Ich kenne sogar einen Zulieferer, der eine Richtlinie gegen Bürokratie erlassen hat. Kanonendonner für Pazifismus.
Mein erstes Buch zum Thema, Ich arbeite in einem Irrenhaus, erschien vor sieben Jahren und zerrte Mr Hyde ans Licht. Über 150 Wochen stand es in der Spiegel-Bestseller-Liste, sprang in Titelgeschichten von »Stern«[2] und »Bild«[3] und beförderte mich auf die Talk-Sofas bei »Markus Lanz« und »Maischberger«. Ein großer Erfolg für mich? Inhaltlich leider nicht:
Ich hatte mehr Ehrlichkeit in den Unternehmen gefordert, herausgekommen ist: Diesel-Gate.
Ich hatte mehr Personal gefordert, herausgekommen ist Mainz, wo die Bahn durch Kürzungen »das größte Chaos der Firmengeschichte«[4] verursachte.
Ich hatte gerechtere Löhne gefordert, herausgekommen ist ein Mindestlohn, der mit tausend Tricks umgangen wird.
Ich hatte den Führerschein für Führungskräfte gefordert[5], ans Licht gekommen sind mittlerweile Chefs, denen nicht mal der größte Serienmord der deutschen Geschichte aufgefallen war, obwohl am Arbeitsplatz verübt.
Und ich hatte realistischere Ziele und Termine gefordert, herausgekommen ist der Flughafen Berlin-Brandenburg, wo auch über 2300 Tage (!) nach der geplanten Eröffnung nur eines abgehoben hat: die Selbstüberschätzung der Bauleiter[6] .
Die Wirtschaft boomt, aber die Qualität der Arbeit leidet. Vorgesetzte spielen sich zu Vormündern auf, Überstunden breiten sich wie eine Seuche aus, und Jahres-Endgespräche sorgen für Endzeit-Stimmung. Wer in aktuelle Studien schaut, erkennt mehr denn je den Fingerabdruck Mr Hydes:
Sechs von zehn Mitarbeiter geben an, ihrer Firma nicht zu vertrauen. Die Bezahlung? Finden sie unfair. Die Führung? Finden sie unfähig. Und die Chancengleichheit? Sehen sie als Märchen, das oft erzählt, aber kaum gelebt wird.[7]
Obwohl Rekordgewinne sprudeln und Fachkräfte angeblich fehlen, werden immer mehr Arbeitsplätze zu Schleuderstühlen. Nahezu jede zweite Neueinstellung ist »befristet«, es soll nach Lust und Laune gefeuert werden können. Motto: Frist – oder stirb![8]
Zumindest eine Produktion funktioniert perfekt: die von Albträumen. 80 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer leiden laut einer DAK-Studie an Schlafstörungen. Dabei geben sich die Firmen alle Mühe, ihre Mitarbeiter zu ermüden, aber die 1,8 Milliarden Überstunden pro Jahr wollen als Schlafmittel nicht recht taugen.[9]
In diesem Buch haben Arbeitnehmer aller Branchen ausgepackt, vom Azubi bis zum Manager. Erst lesen Sie, was Beschäftigte durchdrehen lässt – ehe ich Ihnen am Ende erkläre, woran das ganze System krankt. Und wie die Arbeitswelt doch noch zu retten ist.
Ich wette, so manches Erlebnis wird Ihnen verdächtig bekannt vorkommen. Chefdarsteller trifft Mitarbeiter, diese Begegnung endet oft mit leichtem Schwindel. Sie wissen, was ich meine? Dann sind Sie wohl auch schon mal durchgedreht!
P. S. Wenn Sie Durchgedrehtes in Ihrer Firma erleben, schreiben Sie mir gern über meine Homepage www.karriereberater-akademie.de. Wertvolle Tipps zu Karriere- und Bewerbungsthemen bekommen Sie auch über meinen YouTube-Kanal »Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps«.
Der Durchdreh-Reim
Der Himmel hinterm Firmentor
kommt dem, der drin ist, höllisch vor.
1. Firma mit Knall: Ich bin ein Mitarbeiter, holt mich hier raus!
In diesem Kapitel erfahren Sie …
warum Kundenfreundlichkeit Sie Kopf und Kragen kosten kann,
warum von zehn Projektterminen mindestens elf ins Wasser fallen,
welche heimlichen Spielregeln dafür sorgen, dass Meetings sind, wie sie eben sind
und wie ein Mitarbeiter zum »Terroristen« wurde, obwohl er doch nur seinen Job machen wollte.
Mich fragt ja keiner!
Als der Filialleiter sie zu einem Vier-Augen-Gespräch bat, dachte Emma Zauner (26) an nichts Böses. Warum auch? Seit zwei Jahren galt sie als gute Fee des Coffee-Shops. Die Kunden schwärmten von ihrer Herzlichkeit, jedem gab sie an der Theke das Gefühl, der wichtigste Mensch der Welt zu sein.
Dabei half ihr gutes Gedächtnis. Sie begrüßte Stammkunden mit Namen und las ihnen die Wünsche von den Lippen ab: »Wieder Käsesahne, Herr Meyer – und einen Pfefferminz-Tee dazu?« Und Herr Meyer, ein Rentner, der jeden dritten Tag kam, strahlte übers ganze Gesicht: »Sie kennen mich perfekt!«
Der Filialleiter räusperte sich und kam zur Sache: »Also, Frau Zauner, wir hatten neulich einen Qualitätsmanager aus der Zentrale hier. Der hat Ihnen inkognito eine Stunde bei der Arbeit zugeschaut.«
Emma Zauner wusste, dass es gelegentlich solche Kontrollen gab, und sie hatte ein gutes Gewissen. »War er zufrieden?«
Die Miene ihres Chefs verfinsterte sich. »Es gibt Kritik an ihrem Umgang mit den Kunden.«
»Wie bitte? Ich bin doch zu jedem freundlich!«
»Das bestreitet niemand.«
»Und die Kunden mögen mich.«
»Das bestreitet auch niemand.«
»Aber?«
Ihr Chef kratzte sich am Ohr. »Sie verstoßen gegen die Service-Richtlinien. Sie wissen doch, was die Geschäftsleitung vorschreibt: Wenn ein Kunde nur etwas zu trinken bestellt, müssen Sie etwas zu essen anbieten. Und umgekehrt.«
»Aber das mache ich doch!«
»Leider nicht regelmäßig. Der Qualitätsmanager hat in einer Stunde vier Verstöße registriert.«
Emma Zauner grübelte, ehe ihr Gesicht sich aufhellte: »Das kann ich erklären: Ich kenne meine Stammkunden. Ich weiß, wer nie etwas zum Kuchen trinkt – oder nie etwas zum Kaffee isst.«
»Das weiß unser Qualitätsmanager aber nicht. Die Vorschrift ist eindeutig.«
»Aber was denken die Stammkunden von mir, wenn ich ihnen jeden Tag wieder ein Getränk anbiete – und sie mich jeden Tag wieder daran erinnern, dass sie keines wollen? Das wäre doch unhöflich.«
»Das wäre korrekt! Außerdem müssen Sie die Kundenwünsche abwarten. Oft haben Sie ihnen Bestellungen in den Mund gelegt. Das gefiel dem Qualitätsmanager gar nicht.«
Das Unfassbare geschah: Emma Zauner, die Heldin ihrer Kunden, kassierte eine Abmahnung – wegen »Serviceverstößen«. Ihr Filialleiter gab zu verstehen, eines seiner eigenen Jahresziele sei, den Service zu verbessern – diese Abmahnung sende auch »ein Signal nach oben«.
Was hat dieser Coffee-Shop mit Ihrem Arbeitgeber zu tun? Fragen Sie sich einfach:
Wofür werde ich in meiner Firma mit einer höheren Wahrscheinlichkeit belohnt?
a)Dafür, dass ich die Wünsche meines Kunden perfekt erfülle und ihm helfe, seine Ziele zu erreichen?
b)Dafür, dass ich die Wünsche meines Chefs perfekt erfülle und ihm helfe, seine Ziele zu erreichen?
Also, wohin fließt die Energie: zum Kunden? Oder zum Chef? Sehen Sie! Viele Arbeitgeber sind zu Arbeitverhinderern geworden, es herrscht ein Diktat der Unvernunft. Mitarbeiter müssen tun, was ihnen gesagt wird, weil es ihnen gesagt wird – auch wenn es der letzte Humbug ist. Die Regelwerke sind wie Gefängniszäune, sie schließen den Verstand aus.
Der schwerste Fehler, den Sie als Mitarbeiter 200 Jahre nach Beginn der Industrialisierung begehen können? Sie nutzen Ihren Kopf nicht zum Nicken, sondern zum Denken!
Ein paar Beispiele, wie ich sie jede Woche von meinen Klienten höre:
Wer sein Management auf ein Problem hinweist, wird selbst mit diesem Problem verwechselt. Dann ist der Termin eben nicht zu eng gelegt, sondern der Mitarbeiter zu langsam. Und basta.
Wer die Kundenfreundlichkeit ernster als seine Firma nimmt, wie Emma Zauner, bekommt keinen Orden, sondern wird zur Ordnung gerufen; »Extrawürste« sprengen die Richtlinien.
Und gerade neulich hat mir ein junger Ingenieur erzählt, wie es sich ausgewirkt hat, dass er seinen Chef bei Meetings mehrfach vor einer Fehlentscheidung warnte: Sein nächstes Mitarbeiter-Gespräch geriet zum Kriegsgericht – angeklagt als Deserteur.
Es ist ein Hohn: Überall singen die Firmen das hohe Lied vom modernen Mitarbeiter, überall schwärmen sie vom »Mitunternehmer« und vom »Wissensarbeiter«. Doch hinter den Firmentoren drehen sich die Zeiger in die falsche Richtung, die Fließbänder der Bürokratie bringen den Taylorismus zurück: Standard schlägt Verstand.
Vorgesetzte diktieren Abläufe, Dienstwege bremsen zeitnahe Entscheidungen aus, und ein Parcours aus bürokratischen Fallstricken verhindert zwar nicht, dass ein Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit kommt, ganz sicher aber, dass er pünktlich zum Arbeiten kommt. Und keiner bemerkt mehr die Ironie, wenn es nach dem dritten Meeting des Tages heißt: »Zurück an die Arbeit!«
Erwachsene Menschen, nach Feierabend geschäftsfähig als Lebenspartner, Eltern oder Häuslebauer, geraten in ein riesiges Entmündigungsverfahren. Auch wenn sie von ihrem Fach mehr als die Vorgesetzten verstehen: Ihre Meinung ist nicht gefragt, ihr Handeln vorgegeben.
Diese Infantilisierung kostet Innovationen: Während bei Toyota in Japan jeder einzelne Mitarbeiter 62 Verbesserungsvorschläge im Jahr einbringt, liegt die Quote in Deutschland bei 0,6 Ideen.[10] Alle 383 Arbeitstage wird eine Idee geäußert, hurra! Ein deutscher Mitarbeiter müsste 103 Jahre arbeiten, ehe er auf dieselbe Zahl wie ein Japaner im Jahr kommt.
Warum sagen 70 Prozent der Arbeitskräfte von sich, dass sie lediglich »Dienst nach Vorschrift« leisten?[11] Warum sind die DAX-Konzerne im Durchschnitt deutlich über 100 Jahre alt, also Relikte aus dem Kaiserreich?[12] Und warum werden die Großkonzerne der Gegenwart– Google, Facebook, Alibaba– stets auf anderen Kontinenten gegründet? Weil es an einer Unternehmenskultur fehlt, in der denkende Mitarbeiter willkommen sind. Innovation ist nicht mehr »made in Germany«– Innovation ist »late in Germany«.
Will ich also behaupten, dass sich seit der Industrialisierung nichts getan hat? O doch, ein paar Fortschritte gibt es zu vermelden:
Damals wurde unqualifizierten Arbeitskräften das Denken verboten – heute verbietet man es den qualifizierten.
Damals sorgte das Fließband dafür, dass kein Mitarbeiter auf dumme (also: eigene) Ideen kam – heute besorgen das Richtlinien und Vorgesetzte.
Damals gab es unmenschliche Arbeitszeiten – heute gibt es moderne Medien und unbezahlte Überstunden.
Seit der Industrialisierung haben durchgedrehte Firmen einen großen Schritt gemacht. Leider in die falsche Richtung!
Der Durchdreh-Reim
Der Kunde steht im Mittelpunkt,
bis dass ein Chef dazwischenfunkt.
Warum Arbeit so oft aus der Kurve fliegt
Stellen Sie sich vor, Sie steuern einen Wagen und rauschen mit 180 Sachen über die Autobahn. Doch obwohl Sie der Fahrer sind und die Straße im Blick haben, ist es Ihnen strengstens untersagt, die Geschwindigkeit oder die Route zu ändern. Ob ein Stau vor Ihnen auftaucht, ein Geisterfahrer naht oder Blitzeis lauert – Ihr Kommando lautet: »weiterfahren«.
Denn ehe Sie losgefahren sind, saß ein Manager kurz auf dem Beifahrersitz und hat die Straße überblickt. Da war: kein Stau, kein Geisterfahrer, kein Blitzeis. Auf dieser Basis hat er eine Fahrzeit kalkuliert. Dabei war er sehr optimistisch, weil Manager immer sehr optimistisch sind.
»Gute Fahrt!«, wünschte er Ihnen noch – und stürzte sich ins nächste Meeting. Nun sind Sie allein auf der Straße und sehen, wie die Verkehrslage sich entwickelt. Verdammt, es beginnt zu schneien, Ihre Reifen drehen durch. Und leuchten da vorne nicht schon die Bremslichter eines Staus?
Was tun? Wenn Sie weiterfahren, knallt’s. Wenn Sie bremsen, gefährden Sie das Ziel und verstoßen gegen eine Vorschrift.
Genau so funktioniert meiner Erfahrung nach das Management der Gegenwart: Die Ziele werden von langer Hand festgelegt, wie zu Zeiten der Industrialisierung, während sich die Wirklichkeit von immer kürzerer Hand wandelt. Doch die Mitarbeiter dürfen ihre Route nicht selbst verändern. Bremsen? Verboten. Die Termine? In Stein gemeißelt.
Moderne Management-Theorie, etwa das Stärken der Mitarbeiter (»Empowerment«), bleibt, was sie ist: Theorie. In der Praxis werden viele Firmen von blinden Verkehrs-Leitzentralen regiert:
Das Management macht Vorgaben, die sich auf eine Realität beziehen, die längst überholt ist. Doch es pocht darauf, stur wie ein Kind, das weiter an den Nikolaus glauben will, obwohl Papi beim Outing den weißen Bart in der Hand hielt.
Einen solchen Fall hat mein Klient Wolf Opitz (36), ein Bauingenieur, erlebt. Seine Geschäftsleitung hatte für ein Einkaufszentrum eine Bauzeit von 18 Monaten kalkuliert, eine äußerst zuversichtliche Annahme.
Wolf Opitz erinnerte seine Geschäftsleitung daran, dass Schwierigkeiten beim Bauen die Regel waren. Lapidare Antwort: »Wir schaffen das schon!« Vollmundig teilte seine Verkehrs-Leitzentrale dem Kunden mit, in 18 Monaten könne eröffnet werden.
Was jetzt folgte, war die reinste Geisterfahrt: »Es ging los damit, dass wir nicht genügend neue Mitarbeiter fanden – Fachkräftemangel am Bau«, erzählte Wolf Opitz. »Dann hat sich der Baubeginn verzögert, weil Anlieger protestiert haben. Und schließlich gab es große Schwierigkeiten mit der Elektrik.«
Was tat Opitz? Er meldete die aktuelle Verkehrslage immer an sein Management. Und was tat das Management? Es funkte immer denselben Spruch zurück: »Das Ziel gilt weiter – Sie müssen das schaffen.«
Opitz suchte das direkte Gespräch mit seinem Geschäftsführer: »Der Termin ist unmöglich zu halten.«
»Wollen Sie unseren Kunden im Regen stehen lassen und uns lächerlich machen?«
»Aber ich hatte doch von Anfang an gesagt, dass …«
»Zeitschinden ist doch Ihr Job als Bauleiter.«
»Ich war nur realistisch!«
»Sie müssen den Termin unter allen Umständen halten!«
»Soll ich denn bei der Elektrik pfuschen? Soll ich Schwarzarbeiter aus Osteuropa einstellen? Soll ich …«
»Die Details sind Ihre Sache. Aber eine Verspätung wäre tödlich für uns. Auch für Sie!«
Die Drohung war nicht zu überhören. Sein Management zwang ihn, das kurzfristige Ziel wichtiger als die Interessen des Kunden zu nehmen. Also ließ er pfuschen. Also holte er zweifelhafte Arbeitskräfte. Also ermöglichte er einen »Fertigstellungstermin«, zu dem noch nichts wirklich fertig war.
Doch was passierte, als in dem Einkaufszentrum schon kurz nach der Eröffnung die Lichter flackerten und die Alarmanlage versagte? Wolf Opitz wurde zu seiner Geschäftsführung zitiert und stand am Pranger! Erst hatte ihn die Verkehrsleitzentrale gezwungen, über den Standstreifen zu rasen. Und nun, da der Strafzettel kam, sollte er persönlich dafür haften.
Wie sieht es in Ihrer Firma aus?
Orientieren sich die Ziele an der Realität – oder an den Wunschvorstellungen des Managements?
Werden Entscheidungen der Realität angepasst, wenn die sich verändert? Oder soll sich die Realität, mitsamt Mitarbeitern, gefälligst nach den Zielen richten?
Und werden Sie ernst genommen, wenn Sie ein Ziel in Frage stellen und auf Hindernisse hinweisen? Oder laufen Sie Gefahr, als Bote der schlechten Nachricht Ihren Kopf unfreiwillig zu verlieren?
Sogar Weltkonzerne rauschen an der Realität vorbei: Wie ich aus erster Hand weiß, schärfte das VW-Management seinen Ingenieuren ein, die Abgas-Grenzwerte bei den Dieselfahrzeugen seien einzuhalten, obwohl das durch den gesetzten Rahmen unmöglich war. Offenbar sollte nach dem Pippi-Langstrumpf-Motto verfahren werden: »Ich mach mir die Welt (bzw. den Wert), wie sie (bzw. er) mir gefällt!«.
Oben wird gedacht, unten wird gemacht: Zu Zeiten der Industrialisierung war diese Arbeitsweise sinnvoll. Damals reichte es, als Manager einmal im Jahr auf die Straße zu blicken und den ungelernten Mitarbeitern den Kurs vorzugeben – es herrschten ja kaum Verkehr und Bewegung. Mittlerweile sieht das anders aus:
Heute sind viele Mitarbeiter fachlich besser ausgebildet als ihre Chefs und dichter am Kunden dran.
Heute gleichen die Märkte einem aufgewühlten Meer: Trends werden an die Oberfläche gespült und wieder verschlungen, neue Kundenwünsche branden an, der Renner von heute ist der Flop von morgen. Die Mitarbeiter registrieren das zuerst.
Und heute kreuzen Konkurrenten aus aller Welt wie Piraten über das Meer der Globalisierung, entern Märkte, klauen Ideen und erobern Kunden. Nur wer schnell reagiert, hat noch eine Chance.
Kann man ein modernes Unternehmen noch wie eine Fabrik anno 1850 führen? Was passiert, wenn der Funkkontakt zur Realität abreißt? Dann gerät die Fahrt zur Irrfahrt, und ganze Konzerne zerschellen, von Schlecker bis Quelle, von Hertie bis Horten. Aus Großunternehmen werden Großinsolvenzen.[13]
Die Manager landen weich in ihren Abfindungs-Airbags, zum Beispiel ging der Chef des Pleitefliegers Air Berlin mit 4,5 Millionen nach Hause.[14] Härter fühlt sich der Aufprall auf der Straße an– für die Mitarbeiter.
Der Durchdreh-Reim
Ein Mitarbeiter, der noch denkt,
der wird mit Maulkorb eingeschränkt!
Wahrer Irrsinn
Betr.: Wie ich zum »Attentäter« wurde
Ich musste sofort an Gerhard Schröder denken, den Ex-Bundeskanzler: Als junger Mann soll er am Zaun des Kanzleramts gerüttelt und gerufen haben: »Ich will da rein!« Ähnlich ging es mir eines Morgens, als ich meinen Mitarbeiter-Ausweis vergessen hatte und vorm Tor meines Konzerns stand.
Erst dachte ich noch: Kein Problem, die Pförtner kennen mein Gesicht seit 14 Jahren, die lassen mich rein. Doch ein bulliger Kerl vom Werkschutz knurrte: »Ohne Ausweis setzen Sie keinen Fuß auf dieses Gelände!«
»Aber ich muss hier rein«, protestierte ich. »In 15 Minuten beginnt ein wichtiger Termin mit einem großen Kunden. Es geht um einen Auftrag.«
»Dann brauche ich Ihren Personalausweis für ein Ersatzdokument.«
»Der ist auch in meiner Brieftasche. Und die habe ich vergessen.«
Er schüttelte den Kopf. »Keine Chance!«
Was sollte ich tun? Mein Arbeitsweg dauerte im Morgenverkehr 1 ½ Stunden, ich konnte nicht mal eben nach Hause fahren. Ich appellierte an den gesunden Menschenverstand: »Wo liegt das Problem? Sie kennen mich, ich betrete das Firmengelände jeden Morgen!«
Der Sicherheitsmann kniff die Augen zusammen. »Und was, wenn Sie gestern entlassen worden sind? Sie könnten ein Attentäter sein!«
Allmählich wurde ich sauer. »Mein Chef erwartet mich für eine wichtige Präsentation vor einem Kunden. In 15 Minuten. Ich werde ihn jetzt anrufen.«
Fünf Minuten später kreuzte mein Chef am Eingang auf und verbürgte sich für mich.
»Wir haben unsere Vorschriften«, gab der Torwächter zurück.
Mein Chef rief seinen eigenen Vorgesetzten an. Der kam ebenfalls zum Tor geeilt und forderte meinen Einlass. Der Mann vom Werkschutz hielt lautstark dagegen. Mittlerweile verfolgten Schaulustige die Szene. Eine Frau wisperte ihrer Kollegin zu: »Der hat wohl was Schlimmes ausgefressen!« Dabei wollte ich nur zur Arbeit!
Obwohl mich alle kannten, obwohl ein wichtiger Termin anstand, obwohl es für die Firma um viel Geld ging: Die verschärften Sicherheitsvorkehrungen hatten Vorrang. Ich durfte das Werksgelände nicht betreten, galt als potenzieller Attentäter.
Gerhard Schröder hatte mit seinem Rütteln am Zaun schließlich Erfolg. Ich dagegen musste abziehen wie der letzte Straßenköter: mit einem Fußtritt verjagt, unerwünscht auf dem Gelände der eigenen Firma.
Der Auftrag des Kunden ging natürlich flöten.
Sascha Reibach, Projektleiter
Betr.: Warum meine Fortbildung ein Reinfall war
»Datenbanken sind doch Ihr Ding«, sprach mein Chef mich an. »Wie wäre es mit einer Fortbildung zum Thema?«
Überrascht sah ich ihn an. Seit fünf Jahren hatte ich keine Fortbildung mehr genehmigt bekommen. Unser Fortbildungsetat schien weniger Geld zu enthalten als das Sparschwein meiner fünfjährigen Tochter.
»Sehr gerne«, beeilte ich mich zu sagen, ehe er es sich anders überlegte.
»Nur eine Sache ist da noch«, hob er vorsichtig an.
Sofort rechnete ich damit, dass ich den Kurs selbst bezahlen, ihn erst in zehn Jahren belegen oder vorher den neuen Weltrekord in Überstunden aufstellen sollte.
»Und zwar?«, fragte ich.
»Der Kurs soll an einem Samstag stattfinden. Wäre das okay für Sie?«
Erleichtert stimmte ich zu, denn meine Samstage verbrachte ich ohnehin oft mit Arbeiten, die während der regulären Geschäftszeiten nicht zu schaffen waren.
»Worum genau geht es in dem Kurs?«, fragte ich.
»Das fragen Sie mich?«, gab er verwundert zurück. »Denken Sie sich was Schönes aus.«
»Ich soll mir was ausdenken?«
»Klar – Sie sollen den Kurs doch für die Kollegen halten!«
Wahrscheinlich habe ich ein Gesicht gezogen, das mich bestens für die Geisterbahn qualifizierte. Na wunderbar! Nach fünf Jahren durfte ich endlich wieder zu einer Fortbildung, aber die hatte drei Haken: Ich musste sie selbst halten; ich wurde nicht dafür bezahlt; und mein Samstag war auch noch futsch.
Und doch habe ich eine wichtige Lektion gelernt: »Sag nie Ja zu deinem Chef, ehe du ganz genau weißt, was er von dir will!«
Anja Schlier, Informatikerin
Betr.: Wie mir mein Feierabend abhandenkam
Meine Arbeit schwappte immer öfter übers Ufer des Feierabends: Mails aus der Firma, Handy-Anrufe, alles dringend. Mehrfach hatte mich mein Chef ins Büro zurückbeordert: »Wir brauchen Sie hier, es brennt!« Mittlerweile war ich schon hypernervös und nahm Tabletten gegen den hohen Blutdruck.
Ich musste meinen Feierabend besser verteidigen. Aber wie? Meine Frau schlug vor: »Schalt einfach dein Smartphone ab – dann hast du Ruhe!« Gesagt, getan. Am nächsten Abend besuchten wir eine Theateraufführung, Brechts Stück »Herr Puntila und sein Knecht Matti«. Das Theater war ausverkauft, mein Handy hübsch ausgeschaltet. Meine Frau und ich genossen einen entspannten Abend.
In der Pause lief ich zum Ausschank, um zwei Gläser Sekt zu holen. Da raschelte es an der Decke, und eine tiefe Stimme dröhnte: »Eine dringende Nachricht für einen unserer Gäste! Herr Ralf Straub wird gebeten, in seiner Firma anzurufen.« Als ich meinen Namen hörte, schwappte mir der Sekt über. War das ein schlechter Traum? Doch die Stimme wiederholte: »Herr Ralf Straub soll sich bitte bei seinem Chef melden!«
Mein Rückruf ergab: Ich musste in der Firma vorbeischauen. Auf dem Weg zum Ausgang fühlte ich Blicke in meinem Nacken brennen. Verdammt, warum hatte ich bloß beim Mittagessen in der Kantine erwähnt, wie ich meinen Abend verbringen wollte.
Eine ältere Dame rief mir hinterher: »Ihr Chef sollte sich schämen.« In Wahrheit schämte ich mich, denn jetzt musste meine Frau das Stück alleine zu Ende schauen. Ich kam mir vor wie die Figur Matti von Brecht: der Knecht eines Ausbeuters.
Ralf Straub, Außenhandels-Kaufmann
Beim nächsten Meeting drehe ich durch!
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Arbeitszeit verschwenden können. Durch Meetings. Durch Meetings. Und durch Meetings. Früher schlugen die Menschen die Hände überm Kopf zusammen, wenn sie in einen Krieg einberufen wurden. Heute tun sie es, wenn jemand ein Meeting anberaumt. Nicht umsonst lehnt sich der Traum des modernen Angestellten an einen alten Spruch der Friedensbewegung:
Stell dir vor, es ist Meeting– und keiner geht hin!
Alle halten Meetings für Zeitverschwendung. Alle sind genervt vom leeren Gerede. Alle wollen ihre Arbeit verrichten, statt nur darüber zu berichten. Und doch: Alle gehen hin. Viele laden dazu ein. Und einige glauben noch daran, dass nach einem Meeting etwas anders sein könnte als davor. Das stimmt sogar: Wer vor dem Meeting ein Sachproblem hatte, hat danach auch noch ein Beziehungsproblem.
Durchgedrehte Firmen veranstalten Meetings, um Probleme zu lösen. Genauso gut könnte man Kettenrauchen gegen Lungenkrebs empfehlen.
Denn Management-Spezialisten wie Fredmund Malik sagen mit Recht: Eine gute Unternehmenskultur zeichnet sich nicht durch möglichst viele, sondern möglichst wenige Meetings aus.[15] Die typische Sitzung macht Probleme nicht kleiner, sondern größer.
Wer aber versucht, die Meeting-Seuche zu stoppen, gerät vom Regen in die Jauche. So auch Ulla Hansen, eine Marketing-Expertin. Auf ihren Vorschlag, nicht für jeden Fliegenschiss ein Meeting einzuberufen, reagierte ihr Abteilungsleiter mit einem Reflex: »Das können wir nicht allein entscheiden – das müssen wir in großer Runde diskutieren.«
Und so wurde – herrliche Ironie! – ein Meeting einberufen, um zu besprechen, wie viele Meetings eigentlich nötig sind. Als würde man sich in der Raucherecke auf eine Filterlose treffen, um etwas gegen Lungenkrebs zu unternehmen.
Und natürlich galten auch für diese Sitzung die üblichen Meeting-Regeln, die Ihnen sicher bekannt vorkommen:
Zehn Gebote für Durchdreh-Meetings
Gebot 1: Lad zum Meeting alle ein, die zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie verstehen nichts von der Sache – und haben eigentlich keine Zeit.
Gebot 2: Sorg dafür, dass die Einladung möglichst nebulös und unbedingt frei von Zielen bleibt. Also besser »Diskussion der Meeting-Kultur« als: »Wie können wir die Zahl der Meetings reduzieren?«.
Gebot 3: Setz das Meeting niemals eine Stunde vorm Mittagessen an. Meetings dehnen sich so lange aus, wie man ihnen Zeit gibt. Gib ihnen alle Zeit der Welt!
Gebot 4: Hol einen möglichst autoritären Chef an den Tisch, damit ihm alle nach dem Mund reden und niemand auf die Idee kommt, die Wahrheit zu sagen.
Gebot 5: Verzichte auf alles Überflüssige, zum Beispiel auf: Moderation, Einhalten der Tagesordnung und einander ausreden lassen.
Gebot 6: Achte darauf, dass sich bei der Diskussion nicht die stärksten, sondern die lautstärksten Argumente durchsetzen. Positiver Nebeneffekt: Dann haben die meist stilleren Frauen keinen Stich.
Gebot 7: Mach die eigentliche Sache zur Nebensache und das Meeting zum Machtkampf: jeder Abteilung ihre Pfründe, jedem Teilnehmer sein Applaus.
Gebot 8: Sorg dafür, dass jeder kritische Gedanke – »Der Termin wackelt!« – sofort als »Miesmacherei« verurteilt und mit mindestens drei Eimern Zweckoptimismus überstrichen wird.
Gebot 9: Stell sicher, dass eine kleine Klüngel-Runde längst ausgeheckt hat, was nun von großer Runde nach möglichst langem Scheingefecht abgenickt wird.
Gebot 10: Beende das Meeting, ohne jemanden mit konkreten Aufgaben zu behelligen; beim Reden wurde schon genug Zeit verbrannt.
Das Meeting zur Abschaffung der Meetings versammelte die üblichen Verdächtigen, vor allem Oberindianer. Niemand kam auf die Idee, ein paar einfache Mitarbeiter einzuladen und sie zu fragen: »Wie oft sehen Sie Ihren Chef eigentlich noch? Hat er Zeit für Sie und Ihre Anliegen? Oder verschlucken ihn die Meeting-Räume schon am frühen Morgen?«
Zu Beginn des Meetings war Ulla Hansen noch guter Hoffnung: »Ich wusste ja aus vielen Gesprächen, dass die Kollegen von den Meetings genauso genervt waren wie ich. Also habe ich mit Rückendeckung gerechnet.«
Aber dann holte die Wirklichkeit sie ein: »Als Erster hat der Lieblingsabteilungsleiter des Chefs gesprochen. Er hat gesagt: ›Meetings sind die Brücke vom Management zu den Mitarbeitern und umgekehrt. Je mehr es davon gibt, desto besser. Wollen wir die tatsächlich einreißen?‹«
Der Bereichsleiter am Kopfende des Tisches nickte wohlwollend. Ulla Hansen suchte nach einer passenden Antwort. Doch ein Kollege, hinter den Kulissen Meeting-Kritiker, kam ihr zuvor: »Das stimmt schon: Wenn wir nicht mehr miteinander reden, erfahren wir nichts mehr voneinander.« Damit war die Richtung der Diskussion vorgegeben: Ein Meeting-Hasser nach dem anderen ging von der Fahne ab.
Ulla Hansen hielt tapfer dagegen – zum sichtbaren Ärger des Bereichsleiters. Je länger das Meeting dauerte, desto mehr wurde sie als weltfremde Querulantin an den Pranger gestellt. Dieselben Münder, die sie selbst gegen Meetings hatte wettern hören, verteidigten jetzt die »Sitzungskultur«. Lediglich ein paar Marginalien zu Tagesordnungen und Protokollen wurden in Frage gestellt.
Später erfuhr Hansen: Der Bereichsleiter hatte seine Truppe im kleinen Kreis auf den Pro-Meeting-Kurs eingeschworen. Lange, ehe die Sitzung begonnen hatte, stand die Stoßrichtung fest. Und die Unentschlossenen? Schluckten ihre Bedenken runter und schwenkten auf die Seite des Chefs.
Die Wissenschaft hat für dieses Phänomen einen Namen: Surface Acting[16]. Die Meeting-Teilnehmer verhalten sich wie Kinder beim Versteckspiel, die ihre Augen schließen, um nicht gesehen zu werden. Nur dass sie die Augen vor den Problemen verschließen. Und Lösungen sehen, wo keine sind. Studien belegen, dass Menschen in Gruppen zu unberechtigtem Optimismus neigen und die Dauer von Projekten unterschätzen.[17]
Und so passierte nach dem besagten Meeting, was in durchgedrehten Firmen nach jedem Meeting passiert: gar nichts. Die Tagung gegen Lungenkrebs beschloss: Wir rauchen fröhlich weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann qualmen bzw. tagen sie noch heute.
Statt zu arbeiten.
Der Durchdreh-Reim
Gehn viele rein, und nichts kommt raus,
sieht’s ganz nach einem Meeting aus.
Die Hexenjagd auf Low-Performer
Der Abteilungsleiter Jan Albrecht (46) blies seine Wangen auf und stieß zischend Luft aus. Es klang, als ließe ein Teekessel Druck ab. Die Verzweiflung grub sich mit tiefen Falten in seine Stirn. Eigentlich hatte er kein Problem mit seinem Team. Aber seine Firma hatte ihm eines gemacht.
Er war ein wertschätzender Vorgesetzter, förderte die Stärken seiner Mitarbeiter und hielt ihnen den Rücken frei. Der Laden lief wunderbar. Sein Team bestand aus neun Männern und sechs Frauen, und alle packten an, dachten mit, gingen füreinander durchs Feuer. Aber seine Firma, ein Konsumgüter-Konzern, wollte das nicht wahrhaben.
»Ich muss ein Phantom jagen«, klagte er in der Karriereberatung.
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich zurück.
»Unsere Personalabteilung besteht darauf, dass ich mein Team in drei Gruppen einteile: Out-Performer, Normal-Performer und Low-Performer.«
»Sie sollen Low-Performer benennen, obwohl es gar keine gibt?«
»Ich brauche eine Minderleister-Quote von 10 Prozent. Und da ich 15 Mitarbeiter habe, hat die Personalabteilung die 1,5 aufgerundet: Ich muss zwei Mitarbeiter zu Low-Performern stempeln.«
Wieder wölbten sich seine Wangen, und er blies Luft aus. Ich spürte, wie sehr er unter Druck stand.
»Aber es ist doch eine gute Nachricht, dass Sie ein starkes Team geformt haben.«
»Der Personalchef sieht das anders, er hat mir an den Kopf geknallt: ›In jedem Team gibt es Minderleister. Das ist statistisch nachgewiesen!‹«
»Wie sind Sie miteinander verblieben?«
»Er hat mir gedroht: ›Wenn ein Vorgesetzter keine Low-Performer in seinem Team ausmacht, ist er selbst womöglich einer!‹«
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Wer als Vorgesetzter zu viele gute Mitarbeiter hat, macht sich verdächtig. Nicht als vorbildlicher Chef gilt er, sondern als Führungsversager. Wer dagegen die Faulpelz-Quote erfüllt und seine eigenen Leute ans Messer liefert, erntet ein Schulterklopfen. Viele Firmen, besonders große, hantieren mit solchen Quoten.[18]
Der Arbeitsplatz als Rampe, Führung als Selektion. Mitarbeiter werden wie Champignons sortiert: erste Wahl, zweite Wahl, Ausschussware.
Die Firma schwingt sich auf zur Evolution. Die Starken werden befördert und leben auf. Die Schwachen werden gefeuert und sterben aus im Organigramm. Längst läuft auf der Firmenbühne die neue Casting-Show »Deutschland sucht den Super-Mitarbeiter«:
Wer harrt am längsten im Großraumbüro aus?
Wer leistet die meisten Überstunden?
Wer ist auch am Wochenende verfügbar?
Wer verschiebt die meisten Urlaubstage ins nächste Jahr?
Wer hängt die Kollegen am deutlichsten ab?
Wer stemmt noch ein Projekt mehr, übernimmt noch eine Urlaubsvertretung und beantwortet seine Mails nach Feierabend oder am Urlaubsstrand am schnellsten?
Die Mitarbeiter bekommen die Folgen dieser Hexenjagd zu spüren. Der Teamgedanke bleibt auf der Strecke, denn jedem ist klar: »Wenn der Kollege der Low-Performer ist – was ich unterstützen kann –, muss ich es nicht sein.« Oder umgekehrt: »Wenn ich verhindere, dass er der Out-Performer ist, winkt mir dieses Prädikat.« Die Interessen der Firma und der Kunden gehen dabei über den Jordan.
Und wie soll man in einem solchen Klima noch offene Gespräche mit seinem Vorgesetzten führen? Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter, dem das Verhandeln schwerfällt, seinen Chef nicht offen um ein Training bitten. Sonst outet er sich als Verhandlungsversager und muss mit einer Quittung als Low-Performer rechnen.
Und was tut ein fleißiger Mitarbeiter, wenn er von seinem Chef zum Low-Performer erklärt wird? Er denkt: »Meine Leistung war für die Katz!« Er fährt seine Arbeit ein paar Gänge zurück. Wer zwanghaft Low-Performer sucht, wird zwanghaft Low-Performer produzieren. Aber:
Wer stellt die Teams eigentlich zusammen, wer führt und motiviert sie? Dass sich die unfähigsten Mitarbeiter stets unter den fähigsten Chefs versammeln, ist eher unwahrscheinlich.
Der Wert eines Mitarbeiters lässt sich nicht nur am »Output« messen. Gerade neulich habe ich die Entlassung eines Volkswirts erlebt, angeblich mangels Leistung – seine Chefin hatte übersehen, dass er die gute Seele des Teams war und alle zusammenhielt. Nach seiner Entlassung zerbrach das Team.
In der Regel werden die (vermeintlichen) Minderleister aus den Teams entfernt und durch (vermeintlich) bessere Kandidaten ersetzt. Sollte die Qualität des Teams auf diese Weise nicht so sehr zunehmen, dass es eines Tages gar keine »Minderleister« mehr gibt? Aber die Quote gilt weiter – weil das Modell nicht funktioniert.
Der Abteilungsleiter Jan Albrecht blieb hart: Er weigerte sich, zwei Low-Performer zu benennen. Sein direkter Chef meinte: »Sie sind zu weich für diesen Job.« Albrecht erinnerte ihn daran, dass die Ergebnisse seines Teams weit über dem Durchschnitt lagen – eben weil er einen guten Draht zu den Mitarbeitern habe.
»Genau das ist Ihr Problem«, konterte sein Vorgesetzter. »Sie brauchen mehr Distanz zu Ihren Leuten.«
Was er damit meinte, machte er vor: Er benannte selbst zwei »Low-Performer« aus Albrechts Team. Dabei musste er im Intranet nachschauen, welcher Name zu welchem Gesicht gehörte, so wenig kannte er die Mitarbeiter.
Ein halbes Jahr später kündigte Albrecht und wechselte zur Konkurrenz. Die Firma verlor einen ihrer fähigsten Abteilungsleiter. Und zwei seiner besten Mitarbeiter folgten ihm. Raten Sie mal, welche!
Der Durchdreh-Reim
Der faule Sack – Chef, sei gewarnt! –,
ist einer, der durch Fleiß sich tarnt!
Wahrer Irrsinn
Betr.: Warum ich nicht aufs Klo darf
Für eine große Modekette führe ich eine kleine Filiale in einem Einkaufszentrum. Als einzige Angestellte bin ich das Mädchen für alles. Ich schließe morgens die Tür auf, bestelle die Waren, berate die Kunden und halte das Geschäft sauber.
Meine Filiale läuft gut, die Kunden sind zufrieden. Doch neulich bekam ich Ärger: Der Bereichsleiter wollte mich am Nachmittag besuchen und stand vor der verschlossenen Ladentür, eine Minute lang. Als ich zurückkam, blaffte er mich an: »Sie sperren die Kundschaft also während der Geschäftszeiten aus!«
»Soll ich die Tür denn offen lassen, während ich auf der Toilette bin?«
»Was machen Sie auf der Toilette?«, fragte er und sah mich durchdringend an.
Am liebsten hätte ich gesagt: »Dreimal dürfen Sie raten, Sie Schlauberger!« Stattdessen sagte ich: »Sie wissen doch, dass es in unserem Geschäft keine Toilette gibt. Deshalb muss ich auf die öffentliche.«
»Wie oft gehen Sie pro Tag auf die Toilette?«, fragte er bierernst.
»So oft wie möglich«, hätte ich am liebsten gesagt, »damit ich auf Typen wie dich scheißen kann!«
Stattdessen sagte ich: »Höchstens dreimal.«
»Das geht so nicht«, murmelte er und ließ seinen Blick durch die Filiale schweifen. Offenbar suchte er nach einer Ecke, wo sich eine Toilette einbauen ließe. Vielleicht war er ja doch zur Vernunft gekommen.
Doch er deutete auf eine halbleere Wasserflasche hinter meinem Verkaufstresen und meinte: »Kein Wunder, dass Sie so oft müssen! Trinken Sie weniger.«
»Ist das eine dienstliche Anweisung?«, fragte ich scherzhaft.
»Ja«, sagte er ernst – und fuhr zurück in seine Zentrale, wo es ein paar Dutzend Kaffeeküchen und Toiletten gibt.
Juli Schneider, Einzelhandelskauffrau
Betr.: Wie mein Geschäftsführer zum »Müllmann« wurde
Der Ton in unserer Firma war eisig wie Polarwind geworden. Niemand sagte mehr »bitte« oder »danke«. Für Höflichkeit schien die Zeit zu fehlen, seit der Sparbesen die Abteilungen gelichtet hatte. Chefs erteilten keine Aufträge, sondern gaben »Marschbefehle«. Und da die Zeit immer knapp war, fügten sie gern Wendungen wie »Wird’s bald!« hinzu.
Früher hatten mich die Nachbarabteilungen noch um Informationen »gebeten«. Nun wurde »aufgefordert«, eine gewünschte Information »rauszurücken«, natürlich »unverzüglich«. Und vorsichtshalber wies man mich auf die »schwerwiegenden Konsequenzen« hin, falls das Projekt durch mich »ausgebremst« würde. Wer etwas »verbockt« hatte, der wurde neuerdings »gesteinigt«.
Eines Tages schritt unser Geschäftsführer ein: In einer Mail an alle Abteilungen beklagte er den Verlust an Umgangsformen und kündigte Kommunikationsseminare an. Als Ziel gab er an, »den Umgang so zu gestalten, dass wir freundvoll miteinander arbeiten können«. Eine »Unternehmenskultur gegenseitiger Wertschätzung« schwebe ihm vor. Das stand zwar im krassen Gegensatz zu den Entlassungen, klang aber nicht schlecht, fand ich – bis mich unter seinem Namenszug ein kursives PS ansprang, offenbar gewohnheitsmäßiger Teil seiner Signatur:
»Bitte keine Dankesmails – den Posteingang nicht vermüllen.«
Der Mann, der für bessere Umgangsformen kämpfte, sah ein Dankeschön als »Müll«. Offenbar hatte sein Vorbild in der Firma Schule gemacht.
Vielen Dank auch!
Nils Kersting, Ingenieur
Betr.: Wie mein Meeting schmerzhaft endete
Die Meetings unserer Firma zogen sich endlos hin, drei bis vier Stunden waren keine Seltenheit. Das lag vor allem an unserem Chef, einem großen Umstandskrämer. Seine Beiträge und Nachfragen machten das Einfache kompliziert.
Da hatte meine Kollegin Ina eine Idee: »Lasst uns doch mal ein Meeting im Stehen abhalten. Wer steht, fasst sich kürzer. Spätestens, wenn die Knochen zu schmerzen beginnen.«
Unser Chef hatte nichts einzuwenden – auch er fand die Meetings zu lang, was er aber uns in die Schuhe schob. Seine Sekretärin ließ mehrere Stehtische zusammenrücken. Das Meeting begann mit einem Rückblick, der Chef war umständlich wie immer. Doch nach 30 Minuten merkte ich, dass sich alle immer kürzer fassten, auch er. Die Rechnung schien aufzugehen.
Unser Chef, Anfang 60, zog immer öfter Grimassen und fasste sich an die Wirbelsäule. Nach einer knappen Stunde sagte er: »Mein Kreuz tut zu sehr weh!« Er verließ den Sitzungsraum.
Ich strahlte Ina an: Der Plan war aufgegangen! Voller Freude rafften wir unsere Unterlagen zusammen und wollten zurück an die Arbeit. Da kam uns der Chef entgegen. Er trug einen Stuhl vor sich her und ließ sich darauf plumpsen: »Weiter geht’s!«
Über 2 ½ Stunden haben wir getagt. Er saß wie ein König auf dem Thron, wir standen als Fußvolk im Raum. Alle Knochen taten mir am Ende weh. Nie wieder haben wir eine Sitzung im Stehen abgehalten.
Susanne Münster, Pharmareferentin
2. Arbeit ohne Grenzen: Wer hat meinen Feierabend geklaut?
In diesem Kapitel erfahren Sie …
warum es ein schlechtes Zeichen sein kann, wenn Ihre Firma Ihnen ein Frühstück spendiert,
warum abends im Großraumbüro keiner als Erster gehen möchte,
warum »Dienst nach Vorschrift« viel besser ist als sein Ruf
und wie sich eine Bank dazu durchgerungen hat, ihre Praktikanten schon um 3 Uhr nachts in den Feierabend zu schicken.
Der Mann, der in seiner Firma schlief
»Ich weiß nicht, wie es so weit gekommen ist«, seufzte Gunar Steinke (28). Tiefe Augenränder gruben sich in sein bleiches Gesicht. Seine Wimpern zuckten nervös wie ein flimmernder Bildschirm. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her, als wollte er eine Unwucht ausgleichen.
Ein halbes Jahr zuvor hatte er angeheuert bei einer aufstrebenden Firma der Internet-Branche – und war auf Anhieb begeistert: »Da ging’s total locker zu. Alle liefen rum wie zu Hause, in Jeans und T-Shirt. Die Chefs kamen geradelt.« Sein Arbeitgeber ließ sich nicht lumpen und machte auf Hotel: Morgens lockte ein Frühstücksbuffet mit Obst und frischen Brötchen, Wurst und Käse, Müsli und selbst gepressten Säften. Catering fürs Personal.
Immer seltener frühstückte Steinke zu Hause, seine Freundin saß morgens allein am Tisch. »Das lag auch am firmeneigenen Fitnesscenter«, sagte er. »Es war rund um die Uhr geöffnet, dort trainierte ich jetzt morgens vorm Frühstück. Mein bisheriges Fitnessstudio habe ich gekündigt, meine Freundin ging dann alleine hin.«
In der jungen Firma gab es ein »Work-Life-Balance-Team«, das nur eine Aufgabe hatte: den Mitarbeitern Privates vom Hals zu halten. Man konnte sein Auto in die Werkstatt bringen, Einkäufe erledigen oder Wäsche bügeln lassen – alles wurde von der Firma organisiert. Sogar ein Friseur kam ins Büro.
Gunar Steinke fühlte sich wie ein König, ließ sich bedienen und widmete seine gesparte Freizeit einem guten Zweck: der Arbeit. Immer länger blieb er abends in der Firma, für Abwechslung war gesorgt: Mal spielte er am Tischkicker auf dem Flur, mal nutzte er einen der Massagesessel. Und mal tobte er sich draußen auf dem Beach-Volleyball-Feld aus. Die Firma war ein großer Freizeitpark.