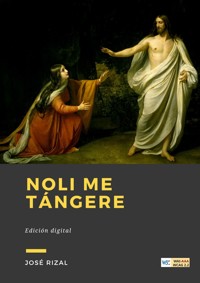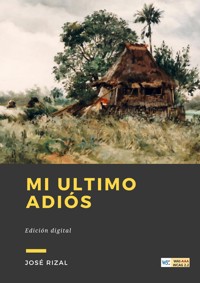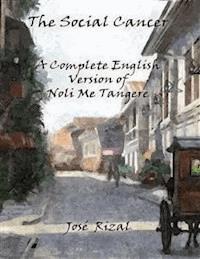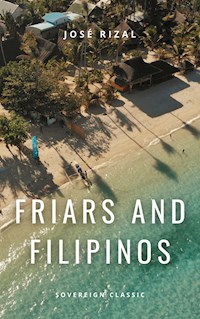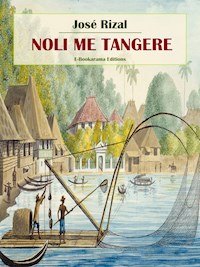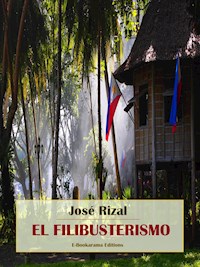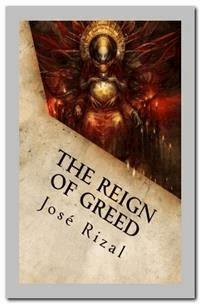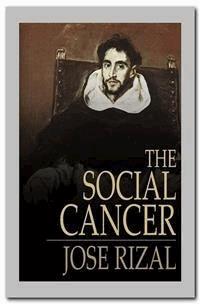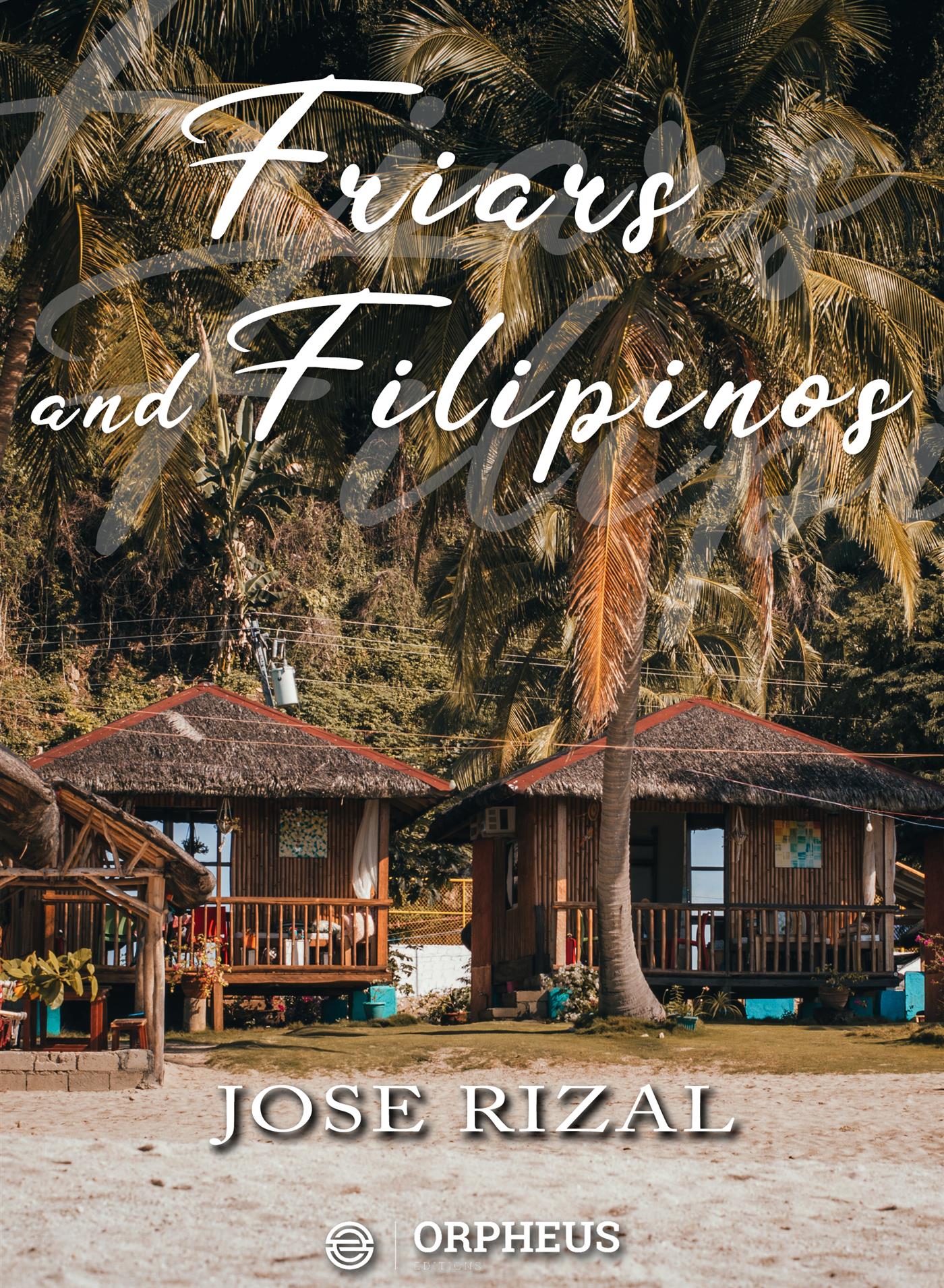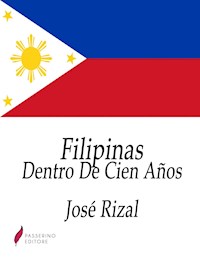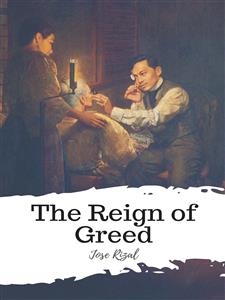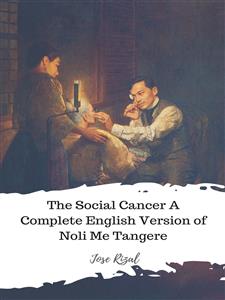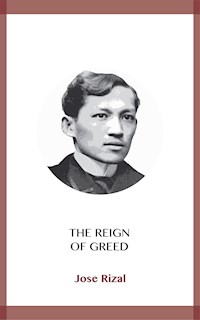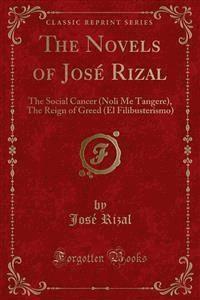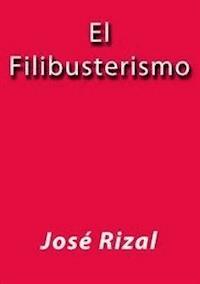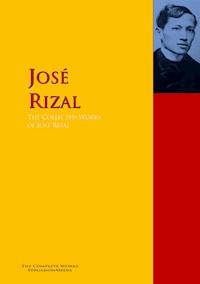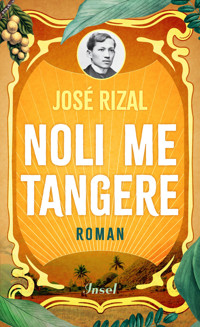
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Fans von Mario Vargas Llosa und Gabriel García Márquez
»Dieser Roman ist wirklich eine Entdeckung!« Thea Dorn
»Die schriftstellerische Fähigkeit, Liebe so auszudrücken – das ist zu Recht ein Jahrhundertroman.« Claudia Roth
Philippinen, Ende des 19. Jahrhunderts: Der junge, idealistische Ibarra kehrt nach sieben Jahren Studium aus Europa in seine Heimat zurück – voller Erneuerungsdrang für sein Land und im Liebesrausch für die schöne María Clara. Doch seine Hoffnungen werden schnell zerschlagen, denn die von ihm so geliebte Gesellschaft ist zerfressen von Korruption, Unterdrückung und religiösem Dogmatismus. Nicht das philippinische Volk hält die Zügel in der Hand, sondern die spanischen Kolonialherren mitsamt ihrem machtbesessenen katholischen Klerus. Ibarras Vorhaben, eine Schule zu bauen, eskaliert zu einer Spaltung zwischen Kirche, Gouverneuren und dem einfachen Volk, und viel zu spät erkennt er, wie sich seine private Fehde mit dem Gemeindepfarrer in eine infernale Intrige verwandelt. Erst als sich auch María Clara von ihm abwendet, wird Ibarra bewusst, welch mächtigem Gegner er sich gegenübersteht.
Noli me tangere ist ein revolutionärer Widerstandsroman und eines der frühesten literarischen Zeugnisse der Kritik am Kolonialismus. José Rizal musste die Veröffentlichung mit dem Leben bezahlen und wurde zum Märtyrer der Philippinen. Mit seiner erzählerischen Opulenz, seinem Humor und seinem unhintergehbaren Glauben an die Menschlichkeit strahlt der Roman weit in die Gegenwart hinein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
José Rizal
Noli me tangere
Roman
Aus dem philippinischen Spanisch von Annemarie del Cueto-Mörth
Mit Nachworten von Lieselotte Kolanoske und Filomeno V. Aguilar Jr.
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 1887 in spanischer Sprache bei der Berliner Buchdruckerei-Actiengesellschaft in Berlin. Der Übersetzung liegt die Ausgabe des Instituto Nacional de Historia, Manila 1978, zugrunde. Wir bedanken uns beim philippinischen National Book Development Board (NBDB) für die Förderung der Übersetzung.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025
© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 1987
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildungen: mauritius images, Mittenwald: Früchte (Sunny Celeste/imageBroker), Palmen (Olga Khoroshunova/Alamy), Rizal (GL Archive/Alamy); Freepik
eISBN 978-3-458-78452-4
www.insel-verlag.de
Motto
»Was? Es dürfte kein Cäsar auf euren Bühnen sich zeigen?
Kein Achill, kein Orest, keine Andromache mehr?« –
Nichts! Man siehet bei uns nur Pfarrer, Kommerzienräte,
Fähndriche, Sekretärs und Husarenmajors.
»Aber ich bitte dich, Freund, was kann denn dieser Misere
Großes begegnen, was kann Großes denn durch sie geschehn?«
Schiller, Shakespeares Schatten
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
1. Eine Abendgesellschaft
2. Crisóstomo Ibarra
3. Bei Tisch
4. Ketzer und Flibustier
5. Ein Stern in dunkler Nacht
6. Capitán Tiago
7. Idyll auf der Dachterrasse
8. Erinnerungen
9. Hinter verschlossenen Türen
10. Das Dorf
11. Die Ortsgewaltigen
12. Allerheiligen
13. Vorboten des Sturms
14. Tasio, Weiser oder Narr
15. Die Sakristane
16. Sisa
17. Basilio
18. Arme Seelen
19. Fährnisse eines Schulmeisters
20. Die Versammlung im Rathaus
21. Geschichte einer Mutter
22. Licht und Schatten
23. Auf dem See
24. Im Wald
25. Im Haus des Philosophen
26. Am Vortag des Festes
27. Nach Sonnenuntergang
28. Korrespondenzen
29. Der Morgen
30. In der Kirche
31. Die Predigt
32. Der Hebekran
33. Freies Denken
34. Das Essen
35. Kommentare
36. Die erste Wolke
37. Seine Exzellenz
38. Die Prozession
39. Doña Consolación
40. Das Recht und die Gewalt
41. Zwei Besucher
42. Das Ehepaar Espadaña
43. Pläne
44. Gewissenserforschung
45. Die Verfolgten
46. Beim Hahnenkampf
47. Zwei Damen
48. Unerklärlich
49. Die Stimme der Verfolgten
50. Elías’ Geschichte
51. Der Wind dreht sich
52. Stelldichein der Schatten
53.
Il buon dì si conosce dal mattino
54.
55. Die Katastrophe
56. Gerüchte und Vermutungen
57.
Vae Victis!
58. Spießrutenlaufen
59. Lieb Vaterland …
60. María Clara heiratet
61. Verfolgungsjagd auf dem See
62. Pater Dámasos Geständnis
63. Christnacht
Epilog
Die Urausgabe von 1887 enthielt folgende Zueignung:
Anmerkungen
Biografische Notiz
Nachwort
Die Geburt einer Nation
Filomeno V. Aguilar Jr.
Fußnoten
Informationen zum Buch
1.
Eine Abendgesellschaft
Ende Oktober gab Don Santiago de los Santos, allenthalben Capitán Tiago genannt, ein Abendessen, und obwohl er es gegen seine Gewohnheit erst am selben Nachmittag angekündigt hatte, sprach man bereits in Binondo[1] und den anderen Stadtteilen bis hinein nach Intramuros von nichts anderem. Capitán Tiago galt als unerhört reich und verschwenderisch, und sein Haus stand jedermann offen gleich seinem Vaterland, nur dem Handel und neuem oder kühnem Gedankengut blieben die Türen verschlossen.
In Windeseile verbreitete sich die Nachricht bei all den Müßiggängern, Wichtigtuern und Tagedieben, die der liebe Gott in seiner grenzenlosen Güte erschaffen hat und die er in Manila so prächtig und zahlreich gedeihen lässt. Die einen liefen nach Schuhcreme, die andern suchten Kragenknöpfe und Krawatten hervor und alle überlegten angestrengt, wie sie den Hausherrn möglichst vertraulich begrüßen könnten, als wären sie alte Freunde, oder wie sie sich, falls nötig, für ihr spätes Erscheinen entschuldigen sollten.
Das Diner fand in einem Haus in der Calle Anloague statt. Da wir die Hausnummer vergessen haben, wollen wir das Haus so beschreiben, dass man es wiedererkennen kann; das heißt, wenn die Erdbeben es verschont haben. Dass sein Besitzer es niederreißen lässt, glauben wir nicht, denn das besorgen hier für gewöhnlich der liebe Gott oder Mutter Natur, die auch für andere Arbeiten dieser Art bei unserer Regierung unter Vertrag steht. – Es ist ein ziemlich großes Gebäude in der landesüblichen Bauweise und liegt nahe einem Seitenarm des Pasig, den viele die Ría de Binondo nennen und der wie alle Wasserläufe in Manila die vielfältigsten Zwecke erfüllt: Er ist Bad, Abwasserkanal, Waschküche, Fischgrund, Transport- und Verbindungsweg und – wenn es dem chinesischen Wasserverkäufer so passt – sogar Trinkwasserbrunnen. Nun verfügt diese mächtige Schlagader des Stadtteils mit seinem pulsierenden Verkehr und seiner lärmenden Betriebsamkeit auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer über nur eine Brücke aus Holz, die sechs Monate lang beschädigt und den Rest des Jahres unpassierbar ist. Weshalb in der heißen Jahreszeit die Pferde diesen dauernden Status quo ausnutzen, um ins Wasser zu springen, sehr zum Befremden des arglosen Zeitgenossen, der in der Droschke eingenickt ist oder sich in philosophischen Betrachtungen über die Errungenschaften des Jahrhunderts ergeht.
Das Haus ist eher niedrig, und seine Linien verlaufen nicht ganz regelgerecht: Ob der zuständige Baumeister schlechte Augen hatte oder ob hier Erdbeben und Wirbelstürme ihre Wirkung gezeitigt haben, kann niemand mit Sicherheit sagen. Eine breite Treppe mit einem grünen Säulengeländer und hier und da mit Teppichen belegt führt zwischen Blumenschalen und Blumentöpfen auf vielfarbigen, bizarr bemalten Piedestalen aus chinesischem Porzellan vom gefliesten Eingang zum Hauptgeschoss.
Niemand ist da, um unsere Karten in Empfang zu nehmen, also steigen wir hinauf, lieber Leser, Freund oder Feind, wenn dich die Musik und das Licht und der beredte helle Klang von Tafelsilber und Porzellan locken und du sehen möchtest, wie man hier in der Perle des Ostens Gesellschaften gibt. Gerne würde ich dir und mir die Beschreibung des Hauses ersparen, aber sie ist nun einmal wichtig, denn wir Menschen sind wie die Schildkröten: Wir werden nach unseren Schalen bewertet und eingeordnet. Deshalb und noch anderer Eigenschaften wegen sind auch die Menschen der Philippinen wie die Schildkröten. Wenn wir hinaufgestiegen sind, stehen wir unversehens in einem weiten Raum, der hier, ich weiß nicht warum, »Caida« heißt und heute Abend als Speisesaal dient, in dem auch das Orchester spielt. Seine lange Tafel in der Mitte ist mit verschwenderischer Pracht geschmückt und scheint dem Eindringling mit köstlichen Genüssen zu winken, während sie dem scheuen jungen Mädchen, der bescheidenen Dalaga, mit zwei tödlich langen Stunden in der Gesellschaft von Fremden droht, deren Sprache und Reden gewöhnlich ein recht merkwürdiges Gepräge haben. Als Gegensatz zu diesen weltlichen Zurüstungen hängen an der Wand dicht an dicht Gemälde religiösen Inhalts wie »Das Fegefeuer«, »Die Hölle«, »Das Jüngste Gericht«, »Der Tod des Sünders« und ganz im Hintergrund, in einem schweren üppigen Rahmen im Renaissancestil, den Arévalo geschnitzt haben könnte, ein sonderbares, riesiges Gemälde, auf dem zwei alte Frauen zu sehen sind. Auf der Inschrift heißt es: »Unsere Liebe Frau vom Frieden und der Guten Reise, die in Antipolo verehrt wird, wie sie als Bettlerin verkleidet die fromme und berühmte Capitana Inés am Krankenlager besucht«.
Verrät das Werk auch weder Kunstsinn noch Geschmack, so ist es dafür umso realistischer: Mit ihrer bläulich gelben Gesichtsfarbe gleicht die Kranke schon einem verwesenden Leichnam, und die Trinkgläser und sonstigen Gefäße, dieses ganze Gefolge eines langen Krankenlagers, sind so peinlich genau dargestellt, dass man sogar ihren Inhalt erkennt. Beim Betrachten dieser Bilder, die den Appetit anregen und bukolische Gedanken einflößen, könnte man meinen, der listige Hausherr wisse sehr wohl, was es mit den meisten seiner Tischgenossen auf sich habe, und nur um seine Gedankengänge ein wenig zu verschleiern, hätte er an der Saaldecke tief herabhängende kostbare chinesische Lampions, leere Vogelkäfige, rote, grüne und blaue Spiegelglaskugeln, schon welke rankende Pflanzen und luftgefüllte getrocknete Fische, Botetes genannt, anbringen lassen. Den Abschluss des Ganzen bilden auf der dem Fluss zugewandten Seite verspielte Bögen aus Holz, halb chinesisch, halb europäisch, durch die man eine Terrasse mit Blumenspalieren und Lusthäuschen sieht, spärlich beleuchtet von kleinen bunten Papierlaternen.
Drinnen im Saal, zwischen gewaltigen Spiegeln und strahlenden Lüstern, sind die Gäste. Dort steht auf einem Podium aus Pinienholz der herrliche Flügel von ungeheurem Wert. Heute Abend spielt niemand auf ihm, was ihn noch wertvoller macht. Dort hängt auch das große Ölporträt eines gutaussehenden Mannes im Frack. Seine symmetrische Gestalt mit ihrer steifen Würde gleicht dem Amtsstab, den seine beringten Hände fest umschließen; das Bild scheint zu sagen: Seht, was ich trage und wie ernst ich bin!
Die Möbel sind elegant, vielleicht ein wenig unbequem und der Gesundheit nicht eben zuträglich: Der Hausherr dachte wohl mehr an die eigene Prachtentfaltung als an das Wohlbefinden seiner Gäste. »Gewiss, die Dysenterie ist etwas Schreckliches, aber dafür sitzt ihr auf Stühlen aus Europa, und das habt ihr schließlich nicht alle Tage«, könnte er sagen.
Es waren schon viele Gäste im Saal, auf der einen Seite die Männer, auf der anderen die Frauen, wie in den katholischen Kirchen und den Synagogen. Die Frauen, einige junge Philippininnen und Spanierinnen, unterdrückten hinter dem Fächer ein Gähnen. Nur hin und wieder wagten sie ein paar leise Worte; bahnte sich eine Unterhaltung an, erstarb sie sogleich in kurzem Raunen, das den Geräuschen in einem nächtlichen Haus ähnelte, in dem Mäuse und Eidechsen umherhuschen. Waren sie vielleicht wegen der verschiedenen Liebfrauenbildnisse an der Wand so schweigsam und andächtig, oder bildeten die Frauen hier eine Ausnahme?
Die Einzige, die sich der jungen Frauen annahm, war eine freundlich aussehende alte Dame, eine Verwandte von Capitán Tiago, die ziemlich schlecht Spanisch sprach. Ihre Gastgeberrolle erschöpfte sich darin, den Spanierinnen ein Tablett mit Zigaretten und Betel anzubieten und den Philippininnen wie ein Priester die Hand zum Kuss zu reichen. Der armen Alten wurde das schließlich zu langweilig, und als draußen ein Teller zerklirrte, nahm sie die Gelegenheit wahr, murmelte: »Jesus, na wartet, ihr Strolche!« und ging eilig hinaus. Und ließ sich nicht wieder blicken.
Bei den Männern ging es schon lebhafter zu. In einer Ecke steckten ein paar Kadetten angeregt flüsternd die Köpfe zusammen, blickten von Zeit zu Zeit im Saal umher und zeigten mit kaum unterdrücktem Lachen auf den oder jenen Gast. Zwei Ausländer dagegen, in weißen Anzügen, gingen schweigend und die Hände auf dem Rücken mit großen Schritten im Saal auf und ab, wie gelangweilte Passagiere auf einem Schiffsdeck. Den lebendigen Mittelpunkt des Interesses jedoch bildete eine Gruppe rund um ein Tischchen mit Wein und englischen Kuchen: Es waren zwei Ordensgeistliche, ein Offizier und zwei Spanier in Zivil.
Der Offizier war ein alter Teniente, ein hochgewachsener, finster blickender Mann, der aussah wie ein in den niederen Rängen der Guardia Civil hängengebliebener Herzog von Alba. Er sprach wenig, dafür aber kurz und bündig. Der eine der beiden Mönche, ein junger Dominikaner, schön, makellos, strahlend wie seine goldgefasste Brille, zeigte einen frühreifen Ernst. Er war der Pfarrer von Binondo und ehemaliger Lehrer am Dominikanergymnasium San Juan de Letrán. Er stand im Ruf eines meisterhaften Dialektikers, und früher, als die geistigen Söhne Guzmáns sich noch mit Laien in spitzfindigen Streitgesprächen zu messen wagten, hatte ihn selbst der brillanteste Gegner niemals zu verwirren oder zu überlisten vermocht und war an Bruder Sybilas Auslegungen gescheitert wie ein Fischer, der Aale mit einem Lasso zu fangen versucht. Der Dominikaner sprach wenig und schien seine Worte sorgfältig zu wägen.
Der andere, ein Franziskaner, sprach dafür umso mehr und begleitete seine Worte mit weit ausholenden Gesten. Obwohl sein Haar schon ergraute, wirkte er noch kräftig und jugendfrisch. Mit dem gutgeschnittenen Gesicht, dem kraftvollen Kinn, dem durchdringenden Blick und der mächtigen Gestalt sah er aus wie ein verkleideter römischer Patrizier. Unwillkürlich wurde man an jene drei Mönche aus Heines »Götter im Exil« erinnert, die zum Herbstäquinoktium um Mitternacht einen See in Tirol überqueren und den Fährmann des Nachens jedes Mal mit einem blanken Taler entlohnen, dessen Eiseskälte ihn schaudern macht. Indes war Bruder Dámaso keineswegs unheimlich wie jene; er war ein fröhlicher Mensch, und wenn auch eine gewisse Schroffheit in der Stimme den Mann verriet, der noch nie ein Blatt vor den Mund genommen hat und seine Worte für der Weisheit letzten Schluss hält, so verwischte sein sorgloses, freimütiges Lachen diesen unfreundlichen Eindruck, ja, man verzieh ihm sogar, dass er keine Strümpfe trug und mit seinen riesigen Füßen und haarigen Beinen einen Anblick bot, der einem Schausteller auf dem Jahrmarkt von Quiapo ein Vermögen einbringen würde.
Der eine der beiden Zivilisten war ein kleiner, schwarzbärtiger Mann, an dem das einzig Bemerkenswerte seine Nase war, ein so großes Riechorgan, dass es jemand anderm zu gehören schien. Der andere, ein blonder junger Mann, war offenbar erst vor kurzem ins Land gekommen. Mit diesem unterhielt sich der Franziskaner angeregt.
»Sie werden schon sehen«, sagte er, »wenn Sie erst ein paar Monate hier sind, werden Sie mir recht geben müssen. In Madrid regieren und auf den Philippinen leben ist zweierlei.«
»Aber …«
»Ich zum Beispiel«, fuhr Bruder Dámaso mit erhobener Stimme fort, um den anderen nicht zu Wort kommen zu lassen, »ich esse hier schon dreiundzwanzig Jahre Reis und Bananen, ich weiß, wovon ich spreche. Kommen Sie mir nicht mit Theorien und schönen Reden, ich kenne den Indio. Sie müssen sich vorstellen, gleich als ich hier ankam, wurde ich in ein Dorf geschickt, in ein kleines zwar, aber mit regem Ackerbau. Ich konnte das Tagalog noch nicht sehr gut, aber ich nahm den Frauen schon die Beichte ab, und wir verstanden uns prächtig. Und als ich nach drei Jahren in ein größeres Dorf versetzt wurde, wo die Stelle durch den Tod des einheimischen Pfarrers frei geworden war, da war ich so beliebt bei den Leuten, dass sie alle weinten, mich mit Geschenken überhäuften und mir mit Musik das Geleit gaben!«
»Aber das zeigt doch nur …«
»Warten Sie, warten Sie, nicht so voreilig! Mein Nachfolger blieb nicht einmal so lange wie ich, und als er wegging, gab es noch mehr Geleit, noch mehr Tränen und noch mehr Musik, und das, obwohl er mehr prügelte als ich und die Pfarrabgaben fast auf das Doppelte erhöht hatte.«
»Aber Sie erlauben …«
»Ich bin noch nicht zu Ende. In San Diego habe ich zwanzig Jahre verbracht, und erst vor ein paar Monaten bin ich dort … weggegangen« (die Erinnerung schien ihn zu verstimmen). »Zwanzig Jahre, das kann wohl niemand bestreiten, sind mehr als genug, um ein Dorf kennenzulernen. San Diego zählte sechstausend Seelen, und ich kannte alle seine Bewohner, als hätte ich sie selber geboren und gesäugt. Ich wusste, auf welchem Bein der eine hinkte und wo den andern der Schuh drückte, ich wusste, wer hinter welcher Dalaga her war, ich wusste, wie viel Liebesgeschichten die oder die gehabt hatte und mit wem, wer der wirkliche Kindesvater war und so weiter … Sie kamen ja alle zu mir in die Beichte, und sie hüteten sich wohl, diese Pflicht zu versäumen. Santiago, unser Hausherr, kann Ihnen sagen, ob ich lüge. Er hat dort große Ländereien, und dort sind wir auch miteinander bekannt geworden. So, und jetzt sollen Sie sehen, wie der Indio ist: Als ich San Diego verließ, gaben mir nur ein paar alte Frauen das Geleit und ein paar Tertiarierbrüder. Und das nach zwanzig Jahren!«
»Aber ich sehe da keinen Zusammenhang mit der Aufhebung des Tabakmonopols«, erwiderte der Blonde, die Pause nützend, als der Franziskaner nach einem Glas Sherry griff.
Bruder Dámaso ließ verblüfft beinahe sein Glas fallen. Er starrte den jungen Mann eine gute Weile an und rief dann aufs Höchste befremdet: »Wie bitte, wie? Ja ist es denn möglich, dass Sie nicht sehen, was so klar zu Tage liegt? Merken Sie denn nicht, Kind Gottes, dass das alles nur deutlich beweist, was für ein Unding die Reformen der Minister sind?«
Diesmal war es der Blonde, der verdutzt schwieg. Der Teniente blickte noch finsterer, und der Kleine wiegte den Kopf, was genauso gut ja wie nein heißen konnte. Der Dominikaner beschränkte sich darauf, ihnen allen den Rücken zuzukehren.
»Glauben Sie …?« brachte der junge Mann schließlich sehr ernst hervor und sah den Mönch neugierig fragend an.
»Ob ich das glaube? Wie ans Evangelium: Der Indio ist doch dermaßen träge!«
»Ah, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche«, der junge Mann senkte die Stimme und rückte den Stuhl ein wenig näher, »dieses Wort interessiert mich außerordentlich. Existiert sie wirklich, diese angeborene Trägheit der Einheimischen, oder entschuldigen wir damit, wie ein fremder Reisender sagte, nur unsere eigene Trägheit, unsere Rückständigkeit und unser Kolonialsystem? Er sprach von anderen Kolonien, deren Bewohner derselben Rasse angehören …«
»Unsinn! Purer Neid! Fragen Sie Señor Laruja hier, er kennt das Land auch, fragen Sie ihn, ob die Unwissenheit und Trägheit der Indios irgendwo ihresgleichen hat!«
»In der Tat«, erwiderte der Kleine, »nirgends auf der Welt werden Sie etwas Trägeres finden als den Indio, nirgends!«
»Und etwas Lasterhafteres und Undankbareres!«
»Oder Ungebildeteres!«
Der Blonde blickte sich unruhig um.
»Meine Herren«, sagte er leise, »ich glaube, wir befinden uns hier bei einem Indio, diese jungen Damen …«
»Ach seien Sie doch nicht so zimperlich! Santiago betrachtet sich nicht als Indio, und außerdem ist er nicht da, aber selbst wenn …! Das sind Flausen von Neuankömmlingen. Lassen Sie erst mal ein paar Monate vergehen; Sie werden schon anders denken, wenn Sie genug Feste und Tanzereien mitgemacht haben, wenn Sie auf diesen Bambuspritschen geschlafen und reichlich Tinola gegessen haben.«
»Ist das, was Sie da Tinola nennen, eine Art Lotusfrucht, die die Menschen so … irgendwie … vergesslich macht?«
»Lotus? Blödsinn!« Pater Dámaso lachte. »Da sind Sie aber auf dem Holzweg! Tinola ist ein einheimisches Gericht aus Huhn und Kürbis. Seit wann sind Sie eigentlich hier?«
»Seit vier Tagen«, erwiderte der junge Mann leicht pikiert.
»Sind Sie hierher versetzt worden?«
»Nein, ich komme auf eigene Faust, um das Land kennenzulernen.«
»Also das ist ein seltsamer Vogel!« Bruder Dámaso betrachtete ihn neugierig. »Auf eigene Faust und wegen solcher Albernheiten! Unglaublich! Wo es doch so viele Bücher darüber gibt … wenn einer nur ein bisschen Verstand hat … so viele Leute haben dicke Bücher darüber geschrieben! Nur ein kleines bisschen Verstand …«
»Hochwürden Pater Dámaso«, unterbrach ihn plötzlich der Dominikaner schroff, »Sie sagen, Sie waren zwanzig Jahre in San Diego und verließen es dann. Waren Hochwürden nicht zufrieden mit dem Dorf?«
Bei dieser Frage, die so natürlich und fast beiläufig klang, verlor Bruder Dámaso unversehens seine gute Laune, und sein Lachen verstummte.
»Nein«, knurrte er nur und ließ sich heftig gegen die Stuhllehne fallen.
Der Dominikaner fuhr in noch unbeteiligterem Ton fort: »Es muss schmerzlich sein, ein Dorf zu verlassen, in dem man zwanzig Jahre gelebt hat und wo man so völlig zu Hause war. Mir jedenfalls fiel der Abschied von Camiling schwer, obwohl ich dort nur wenige Monate verbracht hatte; aber die Oberen taten es zum Besten der Gemeinde … und es war auch zu meinem Besten.«
Bruder Dámaso schien zum ersten Mal an diesem Abend aus der Ruhe gebracht. Plötzlich schlug er mit der Faust auf die Armlehne seines Stuhls, sog scharf die Luft ein und rief: »Entweder es gibt eine Religion oder es gibt keine, also, entweder die Geistlichen sind frei oder sie sind es nicht! Das Land geht verloren, es ist schon verloren!«
Und wieder versetzte er der Lehne einen Fausthieb.
Der ganze Saal blickte erstaunt auf die Gruppe. Der Dominikaner senkte den Kopf, um den Franziskaner über seine Brille hinweg zu betrachten.
Die beiden Ausländer, die durch den Saal schlenderten, blieben einen Augenblick stehen, sahen sich an, zeigten sich in einem kurzen Lächeln die Schneidezähne und nahmen dann ihren Spaziergang wieder auf.
»Er ist verärgert, weil Sie ihn nicht mit Hochwürden angesprochen haben«, sagte Señor Laruja leise zu dem Blonden.
»Was wollen Hochwürden damit sagen? – Was haben Sie denn?« fragten der Teniente und der Dominikaner gleichzeitig.
»Davon kommt ja das ganze Unglück! Die Regierenden halten den Ketzern die Stange gegen die Abgesandten Gottes!« fuhr der Franziskaner fort und schüttelte die derben Fäuste.
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte der Teniente nochmals finster und richtete sich auf.
»Was ich damit sagen will?« wiederholte der Franziskaner aufgebracht und blickte dem Teniente starr ins Gesicht. »Ich werde Ihnen sagen, was ich damit sagen will! Ich will … Ich will sagen, wenn ein Priester den Kadaver eines Ketzers aus seinem Friedhof wirft, dann hat niemand, nicht einmal der König das Recht, sich einzumischen, geschweige denn Strafen zu verhängen. Und dann noch so ein kleiner General, so ein kleiner Unglücksritter …«
»Hochwürden, seine Exzellenz ist Patronatsherr und Vizekönig!« rief der Soldat und sprang auf.
Der Franziskaner war jetzt auch auf den Füßen: »Ach hören Sie schon auf mit Ihrem Patronatsherrn und Vizekönig! Zu anderen Zeiten hätte man ihn die Treppe hinuntergeworfen, wie damals die Kongregation den gottlosen Gouverneur Bustamante. Das waren eben noch glaubensfeste Zeiten!«
»Ich warne Sie, ich gestatte nicht … Seine Exzellenz vertritt seine Majestät den König!«
»Weder den König noch sonst etwas! Für uns gibt es keinen König als den rechtmäßigen …«
»Halt!« rief der Teniente drohend und im Befehlston. »Entweder Sie nehmen das zurück, oder ich mache morgen sofort Seiner Exzellenz Meldung.«
»Gehen Sie doch gleich, gehen Sie!« höhnte Bruder Dámaso und trat mit geballten Fäusten auf ihn zu. »Glauben Sie, nur weil ich das Ordenskleid trage, fehlt mir der Schneid? Gehen Sie schon, ich gebe Ihnen sogar noch meinen Wagen!«
Die Auseinandersetzung nahm eine Wendung ins Komische: Zum Glück griff der Dominikaner ein.
»Meine Herren«, sagte er sehr bestimmt und mit jener näselnden Stimme, die den Mönchen so wohl ansteht. »Man darf die Dinge nicht durcheinanderbringen oder Kränkungen suchen, wo keine sind. Wir müssen in den Worten Bruder Dámasos die des Menschen und die des Priesters unterscheiden. Die des Priesters als solchem, per se, können niemals beleidigen, denn sie sind auf der absoluten Wahrheit gegründet. Bei den Worten des Menschen muss man abermals unterscheiden: die, die er ab irato sagt, die, die er ex ore, jedoch nicht in corde sagt, und die, die er in corde sagt. Beleidigen können nur die Letzteren, und wiederum das je nachdem, ob sie aus einem bestimmten Grund schon in mente vorhanden waren oder ob sie nur per accidens im Eifer des Gesprächs heraus gesagt wurden, ob es …«
»Also ich für meinen Teil und per accidens weiß die Gründe, Pater Sybila«, fuhr der Soldat dazwischen, der sich in einem Gewirr von Unterscheidungen verstrickt sah und befürchtete, er werde zu guter Letzt noch als Schuldiger dastehen. »Ich weiß die Gründe, und Hochwürden werden sie unterscheiden. Als Pater Dámaso einmal aus San Diego abwesend war, bestattete der Kaplan den Leichnam eines sehr ehrenhaften Mannes, jawohl, meine Herren, eines höchst ehrenhaften! Ich hatte verschiedentlich mit ihm zu tun und wohnte als Gast in seinem Haus. Was tut’s, dass er nicht zur Beichte ging, ich beichte auch nicht. Aber zu sagen, er hätte sich das Leben genommen, ist eine Lüge, eine Verleumdung! Ein Mann wie er, mit einem Sohn, den er über alles liebt und auf den er seine ganze Hoffnung setzt, ein Mann, der auf Gott vertraut, der seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft kennt, ein aufrechter und rechtschaffener Mann, der nimmt sich nicht das Leben. Das sage ich jedenfalls, und seien Sie mir dankbar, Hochwürden, dass ich hier verschweige, was ich sonst noch denke.« Damit wandte er dem Franziskaner den Rücken und fuhr fort: »Nun denn, dieser Priester da misshandelte nach seiner Rückkehr ins Dorf den armen Kaplan und ließ dann den Leichnam wieder ausgraben und aus dem Friedhof schaffen, um ihn weiß Gott wo zu verscharren. Aus Feigheit erhob sich keine Stimme im Dorf, allerdings wussten nur wenige davon, der Tote hatte keine Angehörigen, und sein einziger Sohn ist in Europa. Aber Seine Exzellenz erfuhr es, und da er ein redlicher Mann ist, verlangte er die Bestrafung, und Bruder Dámaso wurde in ein besseres Dorf versetzt. Das ist die ganze Geschichte. Und jetzt treffen Sie Ihre Unterscheidungen, Hochwürden.«
Damit verließ er die Gruppe.
»Es tut mir sehr leid, dass ich unwissentlich an eine so heikle Angelegenheit gerührt habe«, sagte Pater Sybila bekümmert. »Aber schließlich, wenn die Versetzung im Grunde ein Gewinn war …«
»Was hat man da schon zu gewinnen! Und was man beim Umzug verliert … und die Papiere … und die … und alles, was verloren geht?« stieß Bruder Dámaso hervor, der sich vor Zorn nicht zu fassen wusste. Es dauerte eine Weile, bis sich die Wogen der Erregung wieder glätteten.
Inzwischen waren weitere Gäste eingetroffen, darunter ein bejahrter Spanier mit einem lahmen Bein und einem sanften, arglosen Gesicht. Er stützte sich auf den Arm einer stark geschminkten ältlichen Philippinin mit Löckchenfrisur, die nach der europäischen Mode gekleidet war.
Doktor de Espadaña und Gemahlin, »La doctora« Doña Victorina, wurden von den Herren am Tischchen freundlich begrüßt und nahmen bei ihnen Platz. Auch einige Journalisten und ein paar kleine Ladeninhaber waren gekommen, begrüßten einander und wanderten unschlüssig auf und ab.
»Wie ist er denn eigentlich, der Hausherr?« fragte der blonde junge Mann Señor Laruja. »Ich bin ihm noch nicht vorgestellt worden.«
»Es heißt, er sei weggegangen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen.«
»Hier braucht es keine Vorstellung«, mischte sich Bruder Dámaso ein.
»Santiago ist ein guter Kerl.«
»Das Pulver hat er nicht erfunden«, fügte Laruja hinzu.
»Sie auch, Señor Laruja!« tadelte Doña Victorina mit honigsüßer Stimme und fächelte sich. »Wie konnte der Arme auch das Pulver erfinden, wenn es doch schon längst die Chinesen erfunden haben?«
»Die Chinesen? Sind Sie toll?« rief Pater Dámaso. »Aber nicht doch: Ein Franziskaner hat es erfunden, einer meines Ordens, Bruder Soundso Savalls, im … siebenten Jahrhundert.«
»Ein Franziskaner! Dann war er sicher als Missionar in China, dieser Pater Savalls«, erwiderte die Dame, die sich nicht so ohne weiteres von ihrer Meinung abbringen ließ.
»Schwarz, wollten Sie wohl sagen, Señora«, versetzte Bruder Sybila, ohne sie anzusehen.
»Das weiß ich nicht, ich habe nur wiederholt, was Bruder Dámaso sagte, und er sagte Savalls.«
»Na schön! Savalls oder Schewaz, was macht das schon aus? Wegen eines Buchstabens wird er noch kein Chinese!« meinte der Franziskaner verdrossen.
»Und im vierzehnten Jahrhundert, nicht im siebenten«, ergänzte der Dominikaner zurechtweisend, als wollte er den andern in seinem Stolz verletzen.
»Meinetwegen. Ein Jahrhundert mehr oder weniger macht auch noch keinen Dominikaner aus ihm!«
»Aber ich bitte Sie, Hochwürden«, sagte Pater Sybila lächelnd.
»Umso besser, dass er es erfunden hat, da hat er seinen Mitbrüdern diese Arbeit erspart.«
»Und Sie sagen, Pater Sybila, das war im vierzehnten Jahrhundert?« fragte Doña Victorina wissbegierig. »Vor oder nach Christus?«
Zum Glück für den Befragten betraten in diesem Augenblick zwei weitere Personen den Saal.
2.
Crisóstomo Ibarra
Aber es waren nicht etwa schöne junge Mädchen in festlichen Kleidern, die die Aufmerksamkeit aller auf sich zogen, selbst die Bruder Sybilas; es war auch nicht Seine Exzellenz der Generalkapitän mit seinen Adjutanten, der den Teniente aus seiner Versunkenheit so aufschreckte, dass er ein paar Schritte nach vorne tat, während Bruder Dámaso wie versteinert dasaß: Eingetreten war nur das lebendige Vorbild des Gemäldes mit dem Frack, und an seinem Arm ging ein junger Mann in Trauerkleidung.
»Guten Abend, meine Herrschaften, guten Abend, Hochwürden«, sagte Capitán Tiago und küsste den Geistlichen die Hand, die völlig vergaßen, ihm den Segen zu erteilen: Der Dominikaner hatte die Brille abgenommen, um sich den Neuankömmling anzusehen, und Bruder Dámaso, kalkweiß im Gesicht, starrte den jungen Mann mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ich habe die Ehre, Ihnen Don Crisóstomo Ibarra vorzustellen, den Sohn meines verstorbenen Freundes«, fuhr Capitán Tiago fort. »Er ist soeben aus Europa angekommen, und ich habe ihn abgeholt.«
Bei diesem Namen wurden überraschte Rufe laut; der Teniente vergaß, den Hausherrn zu begrüßen, er ging auf den jungen Mann zu, der mit den anderen Herren die üblichen Redensarten austauschte, und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Abgesehen von seinem schwarzen Anzug dort mitten im Saal war nichts Auffallendes an ihm. Sein kraftvoller Wuchs, seine Züge, seine Bewegungen jedoch atmeten diesen Duft einer gesunden Jugend, deren Körper und Geist gleichermaßen wohlgebildet sind. Sein offenes, heiteres Gesicht hatte einen schönen Bronzeton und zeigte deutlich Spuren spanischen Blutes, seine Wangen waren leicht gerötet, vielleicht von seinem Aufenthalt in den kalten Ländern.
»Ja ist denn das möglich«, rief er freudig überrascht, »der Pfarrer aus meinem Dorf! Pater Dámaso, der liebe Freund meines Vaters!«
Alle Blicke waren auf den Franziskaner gerichtet: Dieser rührte sich nicht.
»Verzeihen Sie, ein Irrtum«, sagte Ibarra verwirrt.
»Kein Irrtum!« stieß Dámaso endlich zornig hervor. »Aber dein Vater war niemals mein lieber Freund!«
Ibarra zog langsam die ausgestreckte Hand zurück, blickte ihn bestürzt an und wandte sich um. Da sah er sich dem Teniente gegenüber, der ihn immer noch forschend musterte.
»Junger Mann, sind Sie der Sohn von Don Rafael Ibarra?«
Der junge Mann verbeugte sich.
Bruder Dámaso richtete sich im Sessel auf und sah den Teniente scharf an.
»Willkommen zu Hause, und mögen Sie hier glücklicher sein als Ihr Vater«, sagte der Teniente mit zitternder Stimme. »Ich habe ihn gut gekannt, und ich kann sagen, er war einer der ehrenhaftesten und achtbarsten Männer im Land.«
»Ihre freundlichen Worte für meinen Vater nehmen mir die Zweifel an seinem Schicksal, über das ich als sein Sohn noch gar nichts Näheres weiß«, entgegnete Ibarra bewegt.
Die Augen des Alten füllten sich mit Tränen, er machte abrupt kehrt und ging rasch davon.
Der junge Mann fand sich nun ganz allein mitten im Saal; der Hausherr war verschwunden, und niemand war da, der ihn mit den jungen Damen bekannt gemacht hätte, von denen ihn viele sehr interessiert betrachteten. Nach kurzem Zögern sprach er sie mit einfachem, natürlichem Anstand an.
»Sie erlauben«, sagte er, »dass ich mich über die strengen Regeln der Etikette hinwegsetze. Sieben Jahre war ich fort, und nun, da ich zurückgekehrt bin, kann ich nicht widerstehen, den reizendsten Schmuck meiner Heimat, die Frauen, zu begrüßen.«
Da keine den Mut aufbrachte, ihm zu antworten, blieb dem jungen Mann nichts anderes übrig, als sich zu entfernen. Er ging auf eine Gruppe von Männern zu, die, als sie ihn kommen sahen, einen Halbkreis bildeten.
»Meine Herren«, sagte er, »wenn man in Deutschland als Unbekannter auf eine Gesellschaft kommt und niemand da ist, der einen einführt, so ist es dort üblich, dass man selbst seinen Namen nennt und sich den anderen vorstellt, worauf diese das Gleiche tun. Gestatten Sie mir also, dass ich von dieser Sitte Gebrauch mache, nicht um hier fremde Bräuche einzuführen, denn die unseren sind auch sehr schön, sondern weil ich mich dazu gezwungen sehe. Ich habe bereits dem Himmel meine Reverenz erwiesen und den Frauen meines Landes, und jetzt möchte ich auch meine Mitbürger begrüßen. Meine Herren, ich bin Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin.«
Die anderen nannten ihre Namen, die zumeist nicht sonderlich bedeutend und mehr oder weniger unbekannt waren. Nur der eines jungen Mannes, der sich mit einer knappen Verbeugung vorstellte, klang vertraut.
»Habe ich vielleicht die Ehre, mit dem Dichter zu sprechen, dessen Werke mir die Begeisterung für mein Vaterland wachgehalten haben? Mir wurde gesagt, Sie schreiben nicht mehr, aber niemand wusste, warum.«
»Warum? Weil man nicht die Inspiration anruft, um zu lügen und zu Kreuze zu kriechen. Gegen einen Bekannten von mir wurde sogar ein Verfahren eingeleitet, weil er eine Binsenwahrheit in Verse gefasst hatte. Man hat mich Dichter genannt, aber keiner soll sagen, ich wäre ein Narr.«
»Und darf man wissen, was für eine Wahrheit das war?«
»Er sagte, der Sohn des Löwen sei auch ein Löwe. Beinahe hätten sie ihn in die Verbannung geschickt.«
Und der seltsame junge Mann ging davon.
Fast im Laufschritt kam ein freundlich lächelnder Mann, nach landesüblicher Art gekleidet, aber mit Brillantknöpfen auf der Hemdbrust, herbeigeeilt und schüttelte Ibarra die Hand.
»Señor Ibarra, ich wollte Sie unbedingt kennenlernen. Capitán Tiago ist ein guter Freund von mir, ich kannte Ihren Herrn Vater …, ich bin Capitán Tinong, ich wohne drüben in Tondo, wo Sie stets willkommen sind, ich hoffe, Sie beehren mich mit Ihrem Besuch. Speisen Sie doch morgen mit uns«, sagte er strahlend und händereibend.
Ibarra war überwältigt von so viel Liebenswürdigkeit. »Danke«, gab er herzlich zurück, »aber ich fahre gleich morgen nach San Diego.«
»Wie schade! Nun, dann eben, wenn Sie zurückkommen.«
»Es ist angerichtet«, verkündete einer der Lohnkellner. Die Gäste begaben sich in langem Zug zu Tisch; die Frauen nicht ohne sich gehörig bitten zu lassen, namentlich die Philippininnen.
3.
Bei Tisch
Jele jele bago quiere
Bruder Sybila schien sehr zufrieden. Sein Gang war gelassen, und von seinen schmalen, verkniffenen Lippen war der Ausdruck der Verachtung gewichen. Er ließ sich sogar herbei, mit dem hinkenden Doktor de Espadaña zu sprechen, der nur einsilbige Antworten gab, da er ein wenig stotterte. Der Franziskaner war grässlicher Laune, er schob die Stühle mit dem Fuß aus dem Wege und stieß einem Kadetten sogar den Ellbogen in die Seite. Der Teniente war ernst, die andern plauderten angeregt und lobten die prächtige Tafel. Nur Doña Victorina rümpfte verächtlich die Nase, aber gleich darauf fuhr sie wütend herum und zischte wie eine Schlange: »Haben Sie keine Augen im Kopf?«
Der Teniente war ihr auf die Schleppe ihres Kleides getreten.
»Doch, Gnädigste, und sogar bessere als Sie, aber ich habe mir nur eben Ihre Löckchen da angesehen«, erwiderte der Offizier nicht gerade galant und ließ sie stehen.
Instinktiv und vielleicht aus Gewohnheit gingen die beiden Geistlichen auf das obere Ende der Tafel zu, und es kam, wie es kommen musste – wie bei den Bewerbern um einen Lehrstuhl, die den Gegner in höchsten Tönen preisen, aber das Gegenteil zu verstehen geben und dann sehr ungehalten sind, wenn sie den Lehrstuhl nicht ergattern.
»Nach Ihnen, Bruder Dámaso!«
»Nach Ihnen, Bruder Sybila!«
»Der älteste Freund des Hauses … Beichtvater der Verstorbenen … Alter, Amt und Würden …«
»Nun ja, so alt auch wieder nicht, aber dafür sind Sie der Pfarrer von Binondo«, entgegnete Bruder Dámaso säuerlich, ohne jedoch den Stuhl loszulassen.
»Da Sie es befehlen, gehorche ich«, beendete Pater Sybila den Disput und machte Anstalten, sich zu setzen.
»Ich befehle es durchaus nicht«, ereiferte sich der Franziskaner, »ich befehle es durchaus nicht.«
Bruder Sybila überhörte den Einwand und wollte gerade Platz nehmen, als er dem Blick des Teniente begegnete. Auf den Philippinen steht nach geistlicher Auffassung selbst der höchste Offizier noch unter dem geringsten Laienbruder. ›Cedant arma togae‹, Zivilgewalt vor Militärgewalt, sagte Cicero im Senat. ›Cedant arma cottae‹, Priesterrock vor Soldatenrock, sagen die Geistlichen auf den Philippinen. Aber Bruder Sybila war ein höflicher Mensch, deshalb meinte er: »Señor Teniente, wir sind hier in der Welt und nicht in der Kirche, der Platz gebührt Ihnen.«
Aber seinem Tonfall war zu entnehmen, dass ihm der Platz auch in der Welt gebührte. Der Teniente, sei es, weil ihm das Ganze lästig war, sei es, weil er keine Lust hatte, zwischen zwei Klosterbrüdern zu sitzen, winkte ab.
Keiner der Ehrenplatzanwärter hatte an den Hausherrn gedacht. Ibarra sah, wie er zufrieden schmunzelnd die Szene beobachtete.
»Wie, Don Santiago, setzen Sie sich nicht zu uns?«
Aber alle Plätze waren schon besetzt: Lukullus ging leer aus in seinem eigenen Hause.
»Nicht doch, bleiben Sie sitzen«, sagte Capitán Tiago und legte dem jungen Mann die Hand auf die Schulter. »Ich gebe das Fest ja eigens, um der Jungfrau für Ihre Heimkunft zu danken.« Er befahl, die Tinola aufzutragen. »Die Tinola habe ich Ihretwegen bestellt, Sie haben sicherlich schon lange keine mehr gegessen.«
Eine große dampfende Terrine wurde hereingebracht. Der Dominikaner murmelte das Benedicite, auf das fast niemand richtig zu antworten wusste, und begann dann, die Suppe auszuteilen. Aber sei es aus Versehen oder welchem Grund auch immer, Pater Dámaso bekam einen Teller, wo zwischen reichlich Kürbis in dünner Suppe ein fleischloser Hals und ein zäher Flügel schwammen, während die anderen Brust und Keulen aßen, besonders Ibarra, dem die besten Stücke zufielen. Dem Franziskaner entging das nicht, er zerdrückte den Kürbis, nahm ein wenig von der Suppe, ließ klirrend den Löffel fallen und schob den Teller mit einem Ruck von sich. Der Dominikaner unterhielt sich angelegentlich mit dem Blonden.
»Wie lange waren Sie von zu Hause fort?« fragte Laruja.
»Fast sieben Jahre«, antwortete Ibarra.
»So lange, da haben Sie Ihr Heimatland wohl schon ganz vergessen?«
»Ganz im Gegenteil, und obwohl mir schien, meine Heimat hätte mich vergessen, habe ich immer an sie gedacht.«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte der Blonde.
»Ich will sagen, dass ich seit einem Jahr keine Nachrichten mehr von hier erhalten habe, sodass ich jetzt wie ein Fremder bin, der nicht einmal weiß, wie und wann sein Vater gestorben ist.«
»Ach!« rief der Teniente aus.
»Aber wo waren Sie denn, dass Sie nicht telegrafiert haben?« wollte Doña Victorina wissen. »Bei unserer Heirat haben wir nach Spanien telegrafiert.«
»In den letzten zwei Jahren war ich im nördlichen Europa, in Deutschland und Polen, Señora.«
Doktor de Espadaña, der es bis jetzt nicht gewagt hatte zu sprechen, hielt es für angebracht, etwas zu sagen. »In Spanien ka…kannte ich einen Polen aus Wa…Warschau, Sta…Statnitzky mit Namen, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie ihn zu…zufällig getroffen?« fragte er schüchtern und fast errötend.
»Das ist gut möglich«, gab Ibarra liebenswürdig zurück, »aber im Augenblick kann ich mich nicht erinnern.«
»Er war bestimmt nicht zu ver…verwechseln«, fügte der Doktor, mutiger geworden, hinzu. »Er hatte goldblondes Haar und spra…sprach sehr schlecht Spanisch.«
»Das mag wohl sein, aber leider habe ich drüben kaum ein Wort Spanisch gesprochen, außer auf ein paar Konsulaten.«
»Ja wie haben Sie sich dann verständigt?« fragte Doña Victorina erstaunt.
»In der Sprache des Landes, Señora.«
»Sprechen Sie auch Englisch?« wollte der Dominikaner wissen, der in Hongkong gewesen war und gut Pidgin-Englisch konnte, diese Verballhornung der Sprache Shakespeares durch die Söhne des Reiches der Mitte.
»Ich bin ein Jahr in England gewesen, unter Leuten, die nur Englisch sprachen.«
»Und welches Land in Europa gefällt Ihnen am besten?« fragte der Blonde.
»Nach Spanien, meinem zweiten Vaterland, jedes Land des freien Europa.«
»Und, da Sie doch so weit herumgekommen sind … sagen Sie, was fanden Sie am bemerkenswertesten?« wollte Laruja wissen.
Ibarra dachte nach.
»Bemerkenswert, in welcher Hinsicht?«
»Zum Beispiel, was das Leben in diesen Ländern angeht, das gesellschaftliche, politische, religiöse Leben, das Leben dort überhaupt, in seinem Wesen, in seiner Gesamtheit …«
Ibarra überlegte eine Weile.
»Offengestanden, bemerkenswert in diesen Ländern, wenn man vom jeweiligen Nationalstolz absieht … Bevor ich ein Land bereiste, suchte ich seine Geschichte kennenzulernen, seinen Werdegang sozusagen, und danach fand ich alles eigentlich ganz natürlich. Ich habe immer gesehen, dass Wohlstand oder Elend eines Volkes in unmittelbarem Zusammenhang mit seinen Freiheiten oder Vorurteilen stehen, folglich also mit den Opfern oder dem Egoismus seiner Vorfahren.«
»Und sonst hast du nichts gesehen?« fragte höhnisch lachend der Franziskaner, der seit dem Beginn der Mahlzeit kein Wort mehr gesprochen hatte – vielleicht, weil er durch das Essen abgelenkt war. »Da hast du dein Vermögen umsonst vergeudet! So viel weiß schon jeder Bala in der Schule.«
Ibarra starrte ihn an und wusste nicht, was er sagen sollte. Die übrigen Gäste blickten bestürzt vom einen zum andern und befürchteten eine Szene. – Das Essen ist bald vorüber, und Hochwürden haben sich wohl den Magen überladen, hätte der junge Mann am liebsten erwidert, er hielt jedoch an sich und sagte nur: »Meine Herrschaften, die Vertraulichkeit, mit der unser früherer Pfarrer mich behandelt, darf Sie nicht verwundern, so sprach er schon mit mir, als ich noch ein Kind war, und für Seine Hochwürden zählen die Jahre nicht. Ich bin ihm aber dankbar dafür, denn es erinnert mich lebhaft an die Zeit, als Seine Hochwürden in unserem Haus aus und ein ging und dem Tisch meines Vaters Ehre erwies.«
Pater Sybila beobachtete verstohlen den Franziskaner, der zu zittern begonnen hatte. Ibarra erhob sich und fuhr fort: »Sie gestatten, dass ich mich zurückziehe, denn da ich eben erst angekommen bin und morgen schon wieder fort muss, bleibt mir noch vieles zu tun. Das Festmahl ist fast vorüber, und ich mache mir wenig aus Wein und Likören. Meine Herren! Auf Spanien und die Philippinen!«
Und er leerte ein kleines Glas, das bisher unberührt vor ihm gestanden hatte. Der Teniente folgte wortlos seinem Beispiel.
»So gehen Sie doch nicht«, sagte Capitán Tiago leise zu Ibarra. »María Clara wird sicherlich gleich hier sein, Isabel ist gegangen, sie zu holen. Auch der neue Priester aus Ihrem Dorf kommt noch, das ist wirklich ein Heiliger.«
»Ich komme morgen, bevor ich abfahre. Heute habe ich noch einen sehr wichtigen Besuch vor mir.«
Damit ging er, und kurz darauf verschwand auch der Teniente. Unterdessen machte der Franziskaner seinem Ärger Luft.
»Haben Sie das gesehen?« sagte er zu dem Blonden und fuchtelte mit dem Dessertmesser. »Das ist nur der Stolz! Sie können es nicht vertragen, dass der Pfarrer sie zurechtweist. Sie bilden sich ein, jetzt sind sie schon jemand. Das kommt davon, dass die jungen Leute nach Europa geschickt werden. Die Regierung müsste das verbieten!«
»Und der Teniente?« stimmte Doña Victorina mit ein. »Den ganzen Abend hat er ein böses Gesicht gemacht. Gut, dass er weg ist. So alt und noch immer Teniente!«
Die gute Dame konnte die Anspielung auf ihre Löckchen und den gezielten Tritt auf ihre Röcke nicht vergessen.
Am selben Abend schrieb der Blonde das nächste Kapitel seiner »Studien zum Kolonialleben«: »Wie ein Hühnerhals und ein Hühnerflügel auf dem Tinolateller eines Klosterbruders die Freude eines Festmahls trüben können.« Und unter anderen Feststellungen standen auch diese: »Auf den Philippinen ist bei einem Fest oder einem Essen der Gastgeber völlig überflüssig: Sie können ihn genauso gut gleich auf die Straße setzen, und alles geht friedlich weiter.« – »Beim jetzigen Stand der Dinge tut man den Leuten hier noch etwas Gutes, wenn man sie gar nicht aus dem Land lässt noch ihnen Lesen und Schreiben beibringt …«
4.
Ketzer und Flibustier
Ibarra stand unschlüssig vor Capitán Tiagos Haus. Der Nachtwind, der in Manila in dieser Jahreszeit meistens schon recht frisch ist, schien die leichte Wolke des Unmuts von seiner Stirn zu fegen. Er nahm den Hut ab und atmete tief.
Kutschen jagten blitzschnell vorbei, Mietdroschken fuhren träge im Schritt, Passanten verschiedener Nationalitäten gingen an ihm vorüber. Wie jemand, der in Gedanken ist oder nichts zu tun hat, schlenderte er zur Plaza de Binondo, wobei er nach allen Seiten blickte, als wollte er etwas wiedererkennen. Es waren dieselben Straßen wie früher, dieselben weiß und blau abgesetzten Häuser mit ihren weiß getünchten Mauern oder dem grauen Verputz, der nur dürftig den Granit nachahmte. Noch immer leuchtete das Ziffernblatt auf der Kirchturmuhr. Da waren noch dieselben Läden der chinesischen Händler mit ihren schmutzigen Vorhängen und eisernen Stäben, deren einen er einmal des Nachts verbogen hatte, um es den Gassenbuben von Manila gleichzutun. Niemand hatte ihn wieder zurechtgebogen.
»Langsam sind sie«, sagte er zu sich selbst und bog in die Calle de la Sacristía ein.
Die Sorbetverkäufer schrien wie früher ihr »Sórbeteee!«, und die Pechfackeln beleuchteten noch immer dieselben Buden der Chinesen und Marktfrauen, die Esswaren und Obst verkauften.
»Das ist ja unglaublich!« rief er aus. »Das ist derselbe Chinese wie vor sieben Jahren, und die alte Frau ist auch noch hier! Man könnte meinen heute Abend, ich hätte die sieben Jahre Europa nur geträumt … Und, großer Gott, der Pflasterstein von damals ist ja noch immer nicht befestigt worden!«
Tatsächlich war der Stein auf dem Gehsteig an der Straßenecke noch immer lose.
Während er dieses Wunder an städtischer Beständigkeit im Land der Unbeständigkeit betrachtete, legte sich ihm sacht eine Hand auf die Schulter. Er wandte sich um, und da stand der alte Teniente vor ihm, dessen gewohnter finsterer Blick einem fast freundlichen Lächeln gewichen war.
»Junger Mann, sehen Sie sich vor! Lernen Sie aus dem Schicksal Ihres Vaters!« sagte er zu ihm.
»Verzeihen Sie, aber Sie haben meinen Vater wohl sehr geschätzt. Können Sie mir sagen, was mit ihm geschehen ist?« fragte Ibarra.
»Soll das heißen, Sie wissen es nicht?« gab der Offizier zurück.
»Ich habe Don Santiago gefragt, aber er vertröstete mich auf morgen. Wissen Sie es denn?«
»Ja natürlich, alle Welt weiß es! Er starb im Gefängnis.«
Der junge Mann wich einen Schritt zurück und starrte ihn an. »Im Gefängnis? Wer starb im Gefängnis?« fragte er.
»Nun, Ihr Herr Vater doch, er war ja eingesperrt«, erwiderte der Teniente mit einiger Verwunderung.
»Mein Vater … im Gefängnis … eingesperrt im Gefängnis? Was sagen Sie da? Ja wissen Sie denn, wer mein Vater war? Sind Sie …?« Der junge Mann packte den Offizier am Arm.
»Ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Er war Don Rafael Ibarra.«
»Ja, Don Rafael Ibarra«, wiederholte der junge Mann tonlos.
»Und ich dachte, Sie wüssten es«, murmelte der Teniente voller Mitgefühl, als er sah, was in Ibarra vorging. »Ich nahm an, Sie … Aber kommen Sie, fassen Sie sich, hier kann man kein anständiger Mensch sein, ohne im Gefängnis gesessen zu haben.«
»Ich darf wohl nicht annehmen, dass Sie Ihren Scherz mit mir treiben«, entgegnete Ibarra leise nach längerem Schweigen. »Können Sie mir sagen, weshalb er im Gefängnis war?«
Der alte Mann schien zu überlegen.
»Es mutet mich sehr sonderbar an, dass man Sie über Ihre Familienangelegenheiten nicht unterrichtet hat.«
»In seinem letzten Brief vor einem Jahr schrieb mein Vater, ich solle mich nicht beunruhigen, wenn er nichts von sich hören lasse, er sei sehr beschäftigt, und ich solle nur fleißig lernen … Er segnete mich!«
»Dann hat er Ihnen diesen Brief kurz vor seinem Tode geschrieben; es ist nun bald ein Jahr, dass wir ihn in seinem Dorf beerdigten.«
»Weshalb war mein Vater im Gefängnis?«
»Aus einem sehr ehrenhaften Grund. Aber kommen Sie mit mir, ich muss in die Kaserne, ich werde es Ihnen unterwegs erzählen. Nehmen Sie meinen Arm.«
Sie gingen eine Weile schweigend. Der alte Mann dachte nach und strich sich sein Bärtchen, als müsste ihm von dort eine Eingebung kommen.
»Wie Sie selbst wissen«, begann er, »war Ihr Vater der reichste Mann in der Provinz, und obwohl viele Menschen ihn liebten und achteten, wurde er von anderen gehasst und beneidet. Wir Spanier, die wir auf die Philippinen kommen, sind leider nicht das, was wir sein sollten; das gilt genauso für einen Ihrer Großväter wie für die Feinde Ihres Vaters. Der ständige politische Wechsel, der Sittenverfall in den höchsten Kreisen, die Günstlingswirtschaft, die geringen Reisekosten und die kurze Dauer der Reise seit dem Bau des Suezkanals sind an allem schuld. Was aus Spanien hierherkommt, ist hoffnungslos verkommen, und wenn einer darunter ist, der etwas taugt, hat ihn das Land bald verdorben. Nun denn, Ihr Vater hatte unter den Priestern und anderen Spaniern sehr viele Feinde.«
Er schwieg einen Augenblick.
»Ein paar Monate nach Ihrer Abreise begannen die Misshelligkeiten mit Pater Dámaso, ohne dass ich mir den wahren Grund erklären kann. Bruder Dámaso warf Ihrem Vater vor, dass er nicht zur Beichte ging, aber früher hatte er auch nicht gebeichtet, und trotzdem waren sie gute Freunde, wie Sie sich noch erinnern werden. Zudem war Don Rafael ein Ehrenmann und bestimmt weit rechtschaffener als so manche Beichtkinder mitsamt ihren Beichtvätern. Er stellte hohe moralische Ansprüche an sich selbst, und wenn er mir von seinem Ärger mit Bruder Dámaso erzählte, pflegte er zu sagen: ›Señor Guevara, glauben Sie, dass Gott ein Verbrechen, einen Mord etwa, verzeiht, nur weil man es einem Priester sagt, einem Menschen also, dem Schweigepflicht auferlegt ist, und es eher in einem Akt der Zerknirschung als der Reue tut, nur weil man Angst hat, in der Hölle zu schmoren? Weil man ein schamloser Feigling ist, der kein Risiko eingehen will? Ich habe eine andere Vorstellung von Gott, für mich kann man nicht ein Übel durch ein anderes aus der Welt schaffen oder Verzeihung erlangen durch leere Weinerlichkeit und indem man der Kirche Almosen gibt. Schauen Sie‹, sagte er, ›wenn ich zum Beispiel einen Familienvater umbringe, wenn ich eine arme Frau zur Witwe und fröhliche Kinder zu schutzlosen Waisen mache, werde ich dann wirklich der göttlichen Gerechtigkeit Genüge tun, wenn ich mich aufhängen lasse oder das Geheimnis einem anvertraue, der es nicht ausplaudern darf, wenn ich den Priestern, die es am wenigsten nötig haben, Almosen gebe, mir den Ablass erkaufe oder Tag und Nacht herumjammere? Und was wird aus der Witwe und den vaterlosen Kindern? Mein Gewissen sagt mir, dass ich soweit nur irgend möglich den Platz des Ermordeten einnehmen muss, dass ich mich zeit meines Lebens ganz und gar für das Wohl dieser Familie aufopfern muss, die ich ins Unglück stürzte. Und selbst dann, selbst dann – wer kann die Liebe des Gatten und Vaters ersetzen?‹ So dachte Ihr Herr Vater, und nach dieser strengen sittlichen Auffassung handelte er immer, und man kann sagen, dass er niemals jemandem eine Kränkung zugefügt hat. Im Gegenteil, er versuchte mit guten Werken ein gewisses Unrecht wiedergutzumachen, das, wie er sagte, seine Großväter begangen hatten. Aber um auf die Misshelligkeiten mit dem Pfarrer zurückzukommen – die nahmen allmählich eine bedenkliche Form an. Pater Dámaso machte von der Kanzel herab Anspielungen, und dass er Ihren Vater nicht namentlich nannte, ist ein Wunder, denn bei seinem Charakter konnte man auf alles gefasst sein. Ich sah voraus, dass die Sache früher oder später böse enden würde.«
Der alte Teniente machte wieder eine kurze Pause.
»Damals trieb sich in Ihrer Gegend ein ehemaliger Kanonier umher, ein roher, unwissender Kerl, den sie aus der Armee ausgestoßen hatten. Da der Mann jedoch leben musste, aber keine körperliche Arbeit verrichten durfte, denn das hätte ja unserem Ansehen schaden können, erhielt er von ich weiß nicht wem den Posten eines Steuereinziehers für Fuhrwerke. Der arme Tropf war ein völliger Analphabet, und die Indios fanden das nur zu bald heraus; für sie ist ein Spanier, der nicht lesen und schreiben kann, ein Phänomen. Sie legten es darauf an, den armen Teufel zu foppen, der die Steuern, die er einzog, mit Schmähungen bezahlte und dem es nicht entging, dass er das Gespött der Leute war, was diesen schon von Haus aus üblen, rohen Burschen nur noch bösartiger machte. Sie gaben ihm ihre Papiere absichtlich verkehrt herum in die Hand, er tat, als ob er sie läse, und setzte dann auf die erstbeste leere Stelle krauses Gekrakel als Unterschrift hin. Die Indios zahlten, aber lachten ihn aus, er schluckte seine Wut hinunter und nahm das Geld; in dieser Gemütsverfassung machte er vor niemandem Halt und hatte sogar mit Ihrem Vater harte Worte gewechselt.
Eines Tages nun wurde ihm in einem Laden ein Schriftstück eingehändigt, das er drehte und wendete, weil er nicht klug daraus werden konnte, und einer der Schuljungen, die ihm zusahen, prustete plötzlich laut los und zeigte mit dem Finger auf ihn. Der Mann hörte das Gelächter und sah, wie der Spott auf den ernsten Gesichtern der Umstehenden zu tanzen begann. Da war es mit seiner Geduld zu Ende, er fuhr herum und setzte den Jungen nach, die schreiend und johlend davonrannten. Blind vor Wut und außerstande, sie einzuholen, schleudert er ihnen seinen Stock nach, der einen der Jungen so hart am Kopf trifft, dass er hinfällt. Da läuft er zu dem am Boden liegenden Kind und traktiert es mit Fußtritten, und keiner von denen, die gelacht hatten, war Manns genug, einzuschreiten. Zum Unglück kam gerade Ihr Vater vorbei; empört eilt er auf den Steuereinzieher zu, packt ihn am Arm und weist ihn mit scharfen Worten zurecht. Dieser, der zweifellos nur noch rotsah, holt mit der Hand aus, aber Ihr Vater lässt ihm keine Zeit, und mit dieser gewaltigen Kraft, dem Erbteil seiner baskischen Vorfahren … die einen sagen, er habe ihm einen Schlag versetzt, die anderen meinen, es war nur ein Stoß, jedenfalls schwankte der Mann, machte ein paar taumelnde Schritte, stürzte und schlug mit dem Kopf auf einen Stein. Don Rafael hob ruhig das verletzte Kind auf und trug es zum Rathaus. Dem Ex-Kanonier quoll das Blut aus dem Mund, er kam nicht wieder zu sich und starb wenige Minuten später. Natürlich schaltete sich die Justiz ein, Ihr Vater wurde verhaftet, und da erhoben sich alle heimlichen Feinde. Es hagelte Verleumdungen, und er wurde beschuldigt, ein Ketzer und ein Flibustier zu sein. Ein Ketzer zu sein, ist allerorten ein Unglück, noch dazu damals, als der Provinz ein Mann vorstand, der aus der Frömmigkeit eine Schau machte und der mit seiner Dienerschaft in der Kirche laut den Rosenkranz betete, vielleicht, damit alle, die ihn hörten, mitbeteten. Aber ein Flibustier zu sein, ist schlimmer, als ein Ketzer zu sein, und schlimmer, als drei Steuereinzieher zu ermorden, die lesen und schreiben können und sich auf ihr Amt verstehen. Alle ließen ihn im Stich; seine Papiere und Bücher wurden beschlagnahmt. Man warf ihm vor, dass er den liberalen ›Correo de Ultramar‹ und Zeitungen aus Madrid abonniert, dass er Sie in die deutsche Schweiz zu den Protestanten geschickt, dass man bei ihm Briefe und das Foto eines hingerichteten Priesters gefunden hatte und weiß der Himmel was sonst noch. Alles nur Mögliche wurde als belastend angeführt, sogar, dass er das Hemd der Eingeborenen, den Barong tagalog, trug, wo er doch spanischer Abstammung sei. Wäre Ihr Vater nicht der gewesen, der er war, wäre er wahrscheinlich bald freigekommen, denn es gab da einen Arzt, der den Tod des unglückseligen Steuereinziehers einem Gehirnschlag zuschrieb. Aber sein Reichtum, sein Vertrauen in die Justiz und seine Abscheu gegen alles, was nicht Recht und Gesetz war, brachten ihn ins Verderben. Ich selbst wurde, so zuwider es mir ist, jemanden um Gnade zu bitten, beim Generalkapitän, dem Vorgänger des jetzigen, vorstellig. Ich gab ihm zu bedenken, dass ein Mann, der jeden Spanier, arm oder emigriert, ohne Unterschied aufnimmt, ihn beköstigt und beherbergt und in dessen Adern noch das edle spanische Blut fließt, kein auf Umsturz sinnender Flibustier sein könne. Umsonst verbürgte ich mich mit meinem Leben, schwor ich bei meiner Armut und meiner Soldatenehre; ich erreichte nur, dass man mich nach einem schnöden Empfang ungnädig entließ und dass man mir nachsagte, ich wäre ein Narr.«
Der Alte hielt inne, um Atem zu schöpfen, sah seinen Begleiter an, der stumm mit gesenktem Blick zuhörte, und fuhr fort: »Im Auftrag Ihres Vaters unternahm ich die nötigen Schritte für den Prozess. Ich wandte mich an einen hochrenommierten jungen philippinischen Anwalt, aber er lehnte es ab, den Fall zu übernehmen. ›Ich würde den Prozess bestimmt verlieren‹, sagte er. ›Meine Verteidigung wäre nur ein Grund zu einer weiteren Anschuldigung gegen ihn und vielleicht auch gegen mich.‹ Er verwies mich an einen anderen Anwalt, einen Spanier, der höchstes Ansehen genießt und ein wortgewandter, feuriger Redner ist. Ich tat wie geheißen, und der berühmte Anwalt nahm sich der Sache an und führte die Verteidigung mit Brillanz und großem Geschick. Aber die Feinde waren zahlreich, und viele blieben anonym und im Verborgenen. Falsche Zeugen gab es im Überfluss, und ihre Verleumdungen, die sich andernorts vor einer ironischen Bemerkung, vor einem sarkastischen Wort des Verteidigers in nichts aufgelöst hätten, hier nahmen sie feste Gestalt an. Wenn es dem Anwalt gelang, sie aus dem Weg zu räumen, indem er sie gegeneinander ausspielte und ihre inneren Widersprüche aufdeckte, tauchten sogleich neue Anschuldigungen auf. Sie klagten ihn an, er hätte viele seiner Ländereien widerrechtlich an sich gebracht, sie verlangten Schadenersatz von ihm und behaupteten, er wäre mit den räuberischen Tulisanes im Einverständnis, damit sie seine Saat und sein Vieh verschonten. Schließlich hatte sich der Fall dermaßen in sich selbst verwickelt, dass sich nach Ablauf eines Jahres niemand mehr auskannte. Der Gouverneur musste gehen; ein anderer kam, der als rechtschaffen galt, aber leider blieb er nur wenige Monate, und sein Nachfolger hatte nur Interesse an schnellen Pferden.
Die Leiden, die Widerwärtigkeiten, die Härte des Gefängnislebens oder auch der Schmerz über so viel Undankbarkeit untergruben die eiserne Gesundheit Ihres Vaters, und er wurde von jenem Übel befallen, von dem nur das Grab Erlösung bringt. Und als es endlich so weit war, als er, freigesprochen von der doppelten Anklage des Vaterlandsverrates und der Schuld am Tod des Steuereinziehers, entlassen werden sollte, da starb er einsam im Gefängnis. Als ich kam, lag er schon in den letzten Zügen.«
Der Offizier verstummte. Ibarra sagte kein einziges Wort. Inzwischen waren sie am Kasernentor angekommen. Der Teniente blieb stehen, reichte Ibarra die Hand und sagte: »Junger Mann, nach den Einzelheiten fragen Sie am besten Capitán Tiago. Jetzt sage ich Ihnen Gute Nacht, ich muss sehen, wie es in der Kaserne steht.«
Schweigend, aber mit großer Wärme drückte Ibarra die knochige Hand, und schweigend folgte er ihm mit dem Blick, bis er verschwunden war.
Langsam wandte er sich zum Gehen; er sah eine Droschke vorbeifahren und winkte dem Kutscher.
»Hotel Lala«, sagte er mit kaum vernehmbarer Stimme.
Der sieht ja aus, als ob er gerade aus dem Kittchen kommt, dachte der Kutscher und trieb die Pferde an.
5.
Ein Stern in dunkler Nacht
Ibarra stieg hinauf in sein Zimmer, das auf den Fluss hinausging, ließ sich in einen Sessel fallen und sah in den nächtlichen Raum, der sich vor dem weit geöffneten Fenster ausbreitete.
Das Haus am jenseitigen Ufer war hell erleuchtet, und die heiteren Klänge von Streichinstrumenten drangen zu ihm herüber. Wäre der junge Mann nicht so in Gedanken gewesen und hätte er neugierig zum Fernglas gegriffen, um zu sehen, was dort im Lichterglanz vor sich ging, dann hätte er staunend eines jener wunderbaren Traumbilder erblickt, eine jener märchenhaften Erscheinungen, wie man sie zuweilen auf den großen Theatern Europas sehen kann, wo zu den gedämpften Klängen der Musik in einer Flut von Licht, in einer Kaskade von Gold und Diamanten eine hinreißende Schönheit die orientalisch ausgestattete Bühne betritt, eine anmutige Sylphide, die in duftige Schleier gehüllt und umgeben von magischem Glanz kaum den Boden zu berühren scheint. Blumen sprießen bei ihrem Kommen, die Musik rauscht auf, und ein toller Reigen beginnt: Teufel, Nymphen und Satyrn, Geister, Schäferinnen, Engel und Hirten wirbeln zur Schellentrommel im Tanz, und ein jeder legt der Göttin seine Gabe zu Füßen. Ibarra hätte ein wunderschönes Mädchen gesehen, schlank gewachsen, gekleidet in die malerische Tracht der Töchter der Philippinen, und in einem Halbkreis um sie herum das lebhafte Gebärdenspiel einer buntgemischten Gesellschaft: Chinesen, Spanier, Filipinos, Soldaten, Priester, junge Mädchen, alte Frauen … Pater Dámaso stand an der Seite dieses lieblichen Geschöpfes und lächelte verklärt, Bruder Sybila, der nämliche Bruder Sybila, richtete das Wort an sie, und Doña Victorina befestigte im prachtvollen Haar des Mädchens eine Perlenschnur mit Brillanten, deren Feuer in allen Farben des Regenbogens erglühte. Das Mädchen war blass, zu blass vielleicht. Sie hielt die Lider gesenkt, aber wenn sie die Augen aufschlug, strahlte aus ihnen eine makellos reine Seele, und wenn ein Lächeln ihre kleinen weißen Zähne entblößte, mochte man meinen, Rose und Elfenbein wären daneben nur ganz gewöhnliche Dinge. Um den weißen, gleichsam gemeißelten Hals »blinzelten«, wie die Tagalen sagen, die »munteren Äuglein« eines Brillantcolliers durch das zarte Piñagewebe. Nur einer schien für ihre lichte Ausstrahlung nicht empfänglich zu sein: Das war ein junger Franziskaner, hager, abgezehrt, bleich, der sie unverwandt anblickte, von fern, reglos wie eine Statue, fast ohne zu atmen.
Aber Ibarra nahm nichts von alledem wahr. Ihm stand ein anderes Bild vor Augen. Vier kahle, schmutzige Wände umschlossen ein enges Gelass; an einer dieser Wände hoch oben ein vergittertes Fenster; auf dem ekelhaft schmierigen Boden eine Matte, und auf der Matte ein alter Mann im Todeskampf; er atmete schwer, blickte verzweifelt um sich und rief klagend einen Namen. Der alte Mann war allein. Von Zeit zu Zeit drang ein Wimmern oder das Klirren von Ketten durch die Wand … Und dort, weit weg, zur gleichen Zeit ein Festschmaus, fröhlich und ausgelassen: Ein junger Mann lacht und lärmt und gießt den Wein in die Blumen, unter dem Beifall und trunkenen Gelächter seiner Gefährten. Der alte Mann trug die Züge seines Vaters, und der junge Mann glich ihm selbst, und der Name, den der Sterbende so flehentlich rief, war der seine!