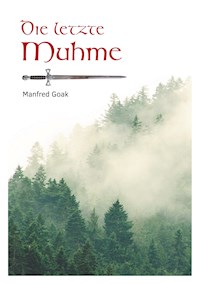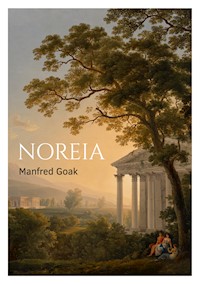
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im mittelalterlichen Salzburg legt ein Bergsturz zwei Skelette frei. Wer sind die beiden Menschen, die in den Katakomben ums Leben kamen? Salzburg - Iuvavum - 800 Jahre zuvor Die junge Römerin Julia heiratet den Mithraspriester Dionysos. Sie verlässt ihre Heimatstadt Iuvavum und folgt ihm nach Rom, wo ein erbitterter Kampf widerstreitender Religionen tobt. Im Amphitheater trifft sie auf ihre totgeglaubte Sklavin Valeria. Das Wiedersehen verläuft anders als erwartet. Dionysos verliebt sich in Valeria und macht sie zu seiner Geliebten. Julia wendet sich von ihm ab und findet Trost bei einer verbotenen Sekte. Sie wird Christin und verlässt Rom. In Iuvavum führt das Schicksal die drei wieder zusammen und fordert ein blutiges Opfer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Goak wurde 1970 in Lilienfeld geboren und wuchs in Hohenberg im oberen Traisental auf. Seit geraumer Zeit lebt er in Salzburg und arbeitet als Chemieingenieur. 2011 hat er mit „Einkaufen mit Frau G“ (erschienen im arovell Kulturverlag) seinen Erstlingsroman veröffentlicht. 2019 folgte mit „Die letzte Muhme“ sein zweiter Roman. Zurzeit arbeitet er an einem historischen Roman, der das bewegte Leben Virgils von Salzburg zum Thema hat.
Im sechsten Regierungsjahr des Kaisers Probus – 282 nach Christi Geburt:
Der Frieden in Noricum ist bedroht. Nördlich der Donau sammeln sich die kriegerischen Alamannen. Zum Äußersten entschlossen sind die Germanen bereit, in die Provinz einzufallen. Was wird ihnen Rom entgegensetzen können?
Im Herzen Noricums, in der Stadt Iuvavum, erträumen sich die Legatentochter Julia und ihre Sklavin Valeria ein Leben in der fernen Hauptstadt. Als der reiche Patrizier Dionysos um die Hand Julias anhält, wähnen sich die freundschaftlich verbundenen Frauen am Ziel ihrer Wünsche. Sie ahnen nicht, dass der Mithrastempel vor den Toren der Stadt entweiht wurde und Dionysos diesen Frevel sühnen will. In Valeria glaubt er die Schuldige gefunden zu haben. Obwohl er sich in die schöne Sklavin verliebt, entführt er sie, um sie im Tempel zu opfern. Im letzten Augenblick flieht Valeria in die winterlichen Wälder.
Die ahnungslose Julia ist verzweifelt, weil ihre Freundin sie allein zurückgelassen hat. Sie heiratet Dionysos und folgt ihm nach Rom. Hier, im Zentrum der Welt, führt das Schicksal die norische Sklavin Valeria, ihre zum christlichen Glauben übergetretene Herrin Julia und den Mithraspriester Dionysos zusammen. Verfeindete Götter und ihre Anhänger kämpfen um die Macht, während Iuvavum unter dem Ansturm der Barbaren zu fallen droht.
Für meine Mutter
Helene Goak 1947 – 2022
Wer bin ich?
Was macht mich aus?
Warum bin ich, wie ich bin?
Ich existiere, aber lebe ich auch?
Menschen
Sie sind
Sie suchen nach
Glück
Anerkennung
Zuneigung
Sie sehnen sich
nach Liebe zu Ihresgleichen oder
zu einem ihrer Götter
Edle Ziele erschaffen Leid
Eifersucht
Gier nach Reichtümern und Macht
Geltungssucht
Hass
Sie fühlen, empfinden, fürchten und hoffen
Sie sterben
Sie leben
Auch ich will leben!
Römische und norische Orte und Gewässernamen
Noricum — römische Provinz an der Donau
Iuvavum — Salzburg
Iuvarus — Salzach
Aenus — Inn
Danuvius (lateinisch) — Donau
Danubia ( norisch) — Donau
Lacus Kymensis — Chiemsee
Lacus Abria — Abersee — Wolfgangsee
Cetium — St Pölten
Ovilava — Wels
Vindobona — Wien
Mons Dea Suleviae — Mönchsberg
Mons Viberis — Plainberg
Nemeton — norisches Heiligtum, meist der norischen Hauptgöttin geweiht
Tiberis — Tiber
Neapolis — Neapel
Norische Stämme
Ambilinen
Ambidravi
Noriker
Karinthi
Germanische Stämme
Alamannen (Suawen)
Markomannen
Inhaltsverzeichnis
Die Legende von Noreia
Salzburg — anno Domini 1052 — drei Tage vor dem heiligen Osterfest
Buch
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
I. Kapitel
Buch
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
II. Kapitel
Buch
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Buch
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
III Kapitel
Die Legende von Noreia
In jenen Tagen, als Cincibili der Große die dreizehn Stämme einte und das Königreich Noricum gründete, unterwarfen sich die Fürsten seinem Willen. Mit gesenkten Häuptern standen sie vor dem steinernen Thron, legten ihre goldenen Halsringe ab und gelobten dem König immerwährende Treue. Nur eine weigerte sich.
Aiofe, die Herrin des Stammes der Ambilinen, bot Cincibili die Stirn und forderte ein Opfer. Auf ewig sollte sich der siegreiche Herrscher an das Land binden. Erzürnt, weil sie es wagte, sich ihm zu widersetzen, zog Cincibili sein Schwert.
Sie lachte und er wusste, dass er diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Er willigte ein und sie nahm ihren Halsreif und verband ihn mit den anderen zwölf zu einem einzigen Reif. Diesen Torques schlang sie um Cincibilis Hals und er schwor sein Blut, sein Herz und sein Leben zu opfern, wenn dem Land Gefahr drohe.
Da senkten sich weiße Schleier über die Erde, der Boden öffnete sich und alles, was war, erbebte. Als sich die Nebel lichteten, ergoss sich gleißendes Licht über das Land und in strahlendem Gold erstand die Eine. Cincibili sank auf die Knie und beugte sein Haupt.
Sie nannte ihren Namen und ihr Name war Noreia.
Noreia!
Sie ist das Geschenk der Götter.
Noreia!
Sie besiegelt das Bündnis zwischen dem Fürsten und dem Land.
Noreia!
Durch ihre Gnade wird den Bewohnern Noricums Wohlstand und
Sicherheit zuteilDie Jahre vergingen und nach Cincibili folgte ein Fürst auf den anderen. Die Menschen lebten zufrieden und ihr Reichtum wuchs. Die Zeit verrann. Im Süden entstand ein mächtiges Reich und warf einen dunklen Schatten auf Noricum. Unaufhaltsam drängten die Römer nach Norden. Sie überschritten die Berge und unterwarfen das Land des Erzes und des Salzes.
Die Geschichte von Noreia kam den Eroberern zu Ohren. Begierig lauschten sie den Erzählungen, die von Reichtum, Gnade und Glückseligkeit handelten. Sie begriffen nichts. Erz, Gold und Macht war alles, was sie verstanden. Mit jeder Erwähnung der Erhabenen wuchs das Verlangen nach Noreias Schätzen. Die Gier der Römer wurde übermächtig und in ihrer Vorstellung entstand eine Stadt. Bei jeder Erwähnung Noreias wuchsen ihre Pracht und ihr Reichtum. Die erlesensten Kostbarkeiten häuften sich hinter Mauern aus Gold. In den Häusern stapelten sich Barren aus Salz und die Straßen waren gepflastert mit Silber und Edelsteinen. All der Wohlstand Noricums bündelte sich in dieser einen Stadt. Ein solch gewaltiger Reichtum musste Rom gehören und so zogen die Eroberer aus, um Noreia zu finden.
Sie suchten lange, aber die Stadt blieb ihnen verborgen. So sehr sie auch baten, befahlen und die Noriker bedrängten, keiner von ihnen gab die Lage Noreias preis. Die Römer folterten Voccio den Alten, den letzten König der Stämme, und verschleppten seine Familie. Aber auch diese Schandtat brachte sie ihrem Ziel nicht näher. Wütend marschierten die Soldaten von Ost nach West, von den Alpen bis in die Ebenen Pannoniens, von den Ufern des Danuvius bis zu den Gestaden des Aenus. Noreia blieb unauffindbar.
Pax Romana brachte den Norikern römisches Recht, römische Sitten und römische Annehmlichkeiten. Sie verließen ihre Siedlungen auf den Hügeln und zogen hinab in die Ebenen, um in römischen Städten zu leben. Mit den Jahren der Besatzung verflüchtigte sich das Interesse an Noreia. Selbst die Noriker schienen die Lage der sagenumwobenen Stadt vergessen zu haben. Fragte man sie, so antworteten sie, dass sich die Wunderbare im Westen auf einer Insel, umspült von den Wassern des Lacus Kymensis, befände. Einen Atemzug später bekräftigten sie dass Noreia im Osten, in den Wäldern südlich der Stadt Cetium, zu finden wäre.
Noreia blieb verschwunden, bis die wilden Horden der Markomannen in Noricum einfielen und die römischen Heere bedrängten.
Salzburg — anno Domini 1052 — drei Tage vor dem heiligen Osterfest
Der letzte Regentropfen verlässt den bleiernen Himmel, durcheilt die dampfende Luft und landet im Schlamm einer Pfütze.
Dieser eine Tropfen bringt den durchtränkten Boden zum Überlaufen. Aus der Tiefe der Erde dringt ein Grollen und Ächzen. Häuser schwanken und die trägen Stadtmauern neigen sich hinab zu den Fluten des Flusses. Sogar die zwei hoch aufragenden Türme des Doms vergessen ihre Heiligkeit und zeichnen Kreise in den Himmel, bis die Glocken in ihren Häuptern ein wahnwitziges Geläut anstimmen. Es folgt ein Augenblick der Stille, so als würde die Welt den Atem anhalten. Mit einem gewaltigen Donner spaltet sich der Berg und stürzt auf die unter ihm liegenden Häuser.
Eine Wolke aus Kalk und Sand erhebt sich in den regengrauen Morgenhimmel und senkt sie sich auf die Holzschindeln der Dächer. Wie frisch gefallener Schnee breitet sich der Staub über den Schlamm der Straßen und bleibt an der Feuchtigkeit der roh verputzen Hauswände kleben.
Zuerst erwachen die Tiere aus ihrer Starre. Hähne krähen und Pferde wiehern mit schrillem Schnauben. Schreie von Männern und Frauen durchschneiden die Luft. Zuletzt besinnen sich die Glocken auf ihre Pflicht und rufen Soldaten, Mönche und Bettler an den Ort des Unglücks.
Die baufälligen Baracken der Ärmsten der Stadt hat der herabgestürzte Fels zermalmt. Wie viele Menschen unter den Trümmern liegen, ist unwichtig. Zehn oder fünfzig Habenichtse weniger auf den Straßen Salzburgs werden keinem der hohen Herren fehlen.
„Der Dauerregen hat den Fels aufgeweicht und überall in der Stadt Steine und Felsbrocken von der schroffen Wand des Mönchsbergs stürzen lassen", sagt der Mann, auf dessen Brustharnisch das Wappen des Erzbischofs prangt. Er packt einen in Lumpen gekleideten Jungen und zieht ihn zu sich. Der spindeldürre Halbwüchsige zappelt und versucht die Hand des Soldaten abzuschütteln. Es gibt kein Entrinnen. Der feste Griff des Mannes ist es gewohnt, Bettler und Tagediebe dingfest zu machen.
„Dort oben!" Der Soldat deutet auf die Stelle, wo sich der hausgroße Brocken gelöst hat. „Der Felsen hat den Aufgang zu einer Höhle freigelegt. Hinauf mit dir und sage uns, was du siehst!"
Der Griff lockert sich und der Junge macht einen Schritt zurück. Zu viele Menschen haben sich an der Unglücksstelle eingefunden und schneiden ihm den Weg in die dunklen Gassen des Armenviertels ab. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als dem Befehl Folge zu leisten.
Der Junge klettert über den Schutt der Häuser und kämpft sich durch das Geröll aus porösem Fels. Ein Sprung und er erreicht die erste Stufe des offen daliegenden Aufgangs. Die in den Fels gehauene Treppe ist breit und glatt poliert, wie die Stufen des Virgildoms. Der Junge wirft einen Blick auf die gaffende Menge und folgt den Stufen hinein ins Innere des Felsen.
Im Berg ist es warm und dunkel. Licht sickert von der Abbruchstelle nach unten und erhellt seinen Weg. Er erreicht die Höhle und wagt sich zu der Stelle, wo der Felssturz ein riesiges Loch zurückgelassen hat. Mit zittrigen Knien starrt er hinunter, über die Menschen hinweg, bis zu den Türmen des Doms. Schwindel befällt ihn. Er macht einen Schritt zurück in die Sicherheit der Höhle. Sein Fuß tritt auf etwas Längliches, Hartes. Das Knacken und Klappern erinnert ihn an etwas, aber er vermag das Geräusch nicht einzuordnen. Er fasst nach unten und bekommt einen schlanken Gegenstand zu fassen. Das Ding fühlt sich glatt und kühl an. Er zieht es zu sich ans Licht.
Ein Schrei, mehr das Bellen eines Hundes als ein menschlicher Laut, entweicht seiner Kehle. Das Tageslicht fällt auf den skelettierten Arm eines Menschen. Erschrocken lässt er den Oberarmknochen fallen.
„Was ist los? Was siehst du?", brüllt der Soldat zu ihm hinauf.
Der Junge blickt zu Boden. Ein Skelett schlängelt sich zu seinen Füßen und daneben noch eines. Vermoderte Stofffetzen und verrostetes Eisen liegen um die Gebeine verstreut. Ein Sonnenstrahl fällt auf die Knochenhand und lässt Gold aufblitzen. Die leeren, dunklen Augenhöhlen fixieren ihn und das Kinn mit den Zähnen klappt drohend nach unten, als er den Ring vom Finger zieht und ihn unter seinem Lumpenhemd verschwinden lässt.
„Was siehst du?", brüllt der Soldat erneut.
Auf den Knien rutscht der Junge zu der Abbruchkante.
„Zwei Knochenmänner, mein Herr!" Ohne sich noch einmal zu den Skeletten umzudrehen, kehrt er zur Treppe zurück und eilt nach unten.
1. Buch
Valeria
1.
Mutter hat mich weggeschickt. Sie hat mir die Tunika so heftig über den Kopf gezogen, dass meine Ohren brannten und ein Büschel meiner Locken in ihrem Saum hängenblieb. Ohne meine Tränen zu beachten, hat sie mich in die Küche gezerrt, mein Haar und mein Gesicht mit Butter eingerieben und die Asche des erkalteten Herdfeuers über meinen Kopf geschüttet. Ich habe geschrien, aber sie hat mich nicht getröstet, sondern mich hart an den Schultern gepackt.
„Still jetzt", hat sie gezischt und mich geschüttelt, worauf mein Weinen zu einem gurgelnden Flehen geworden ist. Gnadenlos hat sie mich zu der Klappe geschleift, durch die die Mägde die Küchenabfälle entsorgen. Mit ihrem Messer hat sie den braunen Karottensack aufgeschnitten und ihn mir über den Kopf gezogen.
Schmutzig und hässlich, in einen Sack gehüllt, habe ich mich an sie geklammert. Das Gesicht voller Ruß, mit tränennassen Augen, am ganzen Leib zitternd, habe ich sie angefleht, aber das Herz meiner Mutter ließ sich nicht erweichen.
„Lauf, lauf in den Wald, wo du hingehörstl" Sie hat mich gepackt und durch die Abfallklappe hinunter auf den Misthaufen gestoßen.
Kopfüber bin ich in Küchenabfällen und stinkendem Unrat gelandet und habe mich umgedreht. Die Klappe war geschlossen. Stumm in mich hinein weinend kroch ich auf allen Vieren durch die Abfälle. In der Schwärze der Nacht konnte ich die Hand vor Augen nicht sehen, dennoch wusste ich, wo ich mich befand. Die Wiese hinter dem Haus, auf der ich bei Sonnenlicht gespielt und gelacht hatte, lag vor mir.
Wie es die Mutter befohlen hatte, lief ich zum Wald, während das Schluchzen und Beben in meinem Inneren die Geräusche der Nacht erstickten. Ich drehte mich um und sah einen roten Schein, der auf den weißen Mauern der Villa flackerte. Schreie von Frauen und Flüche wütender Männer hallten zu mir herüber. Ich lief weiter und das Geschrei verwandelte sich zu einem weit entfernten Grollen.
Als ich den Waldrand erreichte, schlüpfte ich durch die Zweige der Haseln, vorbei an den schuppigen Stämmen der Fichten und den borkigen Wurzelstöcken der Linden. Vor der großen Eiche hielt ich an. Wie am Vortag und den Tagen davor umrundete ich den mächtigen Stamm, warf mich auf den Boden und zwängte mich unter der großen Wurzel durch. In der Höhle unter der Eiche würde mich niemand finden. Sollte mich Mutter suchen, so wie es Julia Tage zuvor getan hatte. Sollte sie rufen und flehen, damit ich zu ihr käme. Ihr Weinen würde mich nicht erweichen. Dann wäre sie es, die zitterte und jammerte!
Wie ein verletztes Tier lag ich in der Höhle, zusammengerollt, und wartete darauf, dass Mutter kommen würde. Es wurde kalt und frostig. Niemand rief meinen Namen und lockte mich aus meinem Versteck. Ich fror und lauschte, aber Mutter kam nicht. Schließlich schlief ich vor Erschöpfung ein.
In der Nacht ist der Wald düster und voller Geräusche. Das Knurren und Schnüffeln seiner Kreaturen und das Stampfen und Kratzen unsichtbarer Bestien ließ mich hochschrecken. Mein Weinen wurde heftiger und verwandelte sich in ein Schluchzen und Jammern.
An der Hand meiner Mutter hatte ich den nächtlichen Wald nicht gefürchtet. Jetzt war ich allein und hatte Angst. Ich kroch tiefer in die Höhle hinein, aber da war etwas. Meine klammen Finger ertasteten das Fell eines Tieres. Zitternd und wimmernd kniff ich die Augen zusammen und hoffte, dass das Tier verschwinden würde. Es blieb, nein, im Gegenteil – es kam auf mich zu. Ein seidenweiches Etwas schlängelte sich um mich, wärmte mich mit seinem Pelz und seinem Atem. Das Tier leckte über meinen Arm. Einsam und ausgestoßen, so wie ich, suchte es meine Nähe. Ich drängte mich näher an den warmen, weichen Körper. Der hechelnde Atem und das schnell schlagende Herz beruhigten mich. So schlief ich ein.
Als es hell wurde, und die Vögel des Tages ihr Lied anstimmten, erwachte ich. Das Tier hatte mich gewärmt und vor dem Erfrieren bewahrt. Es war fort und ich war wieder allein.
Ich kroch aus der Höhle und verließ den Wald. Steif vor Kälte überquerte ich die Wiese. Der Raureif brannte auf meinen nackten Füßen. Die Sonne mühte sich, die Nebel des Morgens zu durchdringen. Ich lief auf die weiß gekalkte Villa zu, mit der hohen Mauer und den vertrauten Hütten in ihrem Schatten.
Verkohltes Holz ragte in den Himmel. Zertrümmerte Eimer, Truhen und Tische lagen überall herum. Stallungen und Hütten, zwischen denen gestern noch Männer und Frauen ihren Geschäften nachgegangen waren, lagen verlassen da. Ich lief zu dem Häuschen, das mein Zuhause war. Die Tür stand offen. Es war verlassen.
„Mutter", rief ich. Dann „Silva!" und all die Namen der Frauen aus der Küche.
Niemand antwortete. Ich war allein. Bei dem Holzstoß, wo die Frauen die Scheite für das Herdfeuer holten, sank ich zu Boden und schrie. Schmutzig, weinend und allein – so fanden sie mich.
Sechs Jahre später im sechsten Regierungsjahr des Kaisers Probus – 282 nach der Zeitenwende – in der Stadt Iuvavum, im Herzen der Provinz Noricum.
2.
Wieder dieser Traum. Mit pochendem Herz rollt sich die junge Frau unter der schweren Felldecke hervor. Sie erhebt sich lautlos und wirft ein paar der Kienspäne in die Glut des Kohlebeckens.
„Der Wind kommt aus Nord und prickelt auf meiner Haut. Bald werden Frost und Eis die ersten Boten nach Iuvavum senden."
Beim Fenster schiebt sie den Vorhang aus grob gewebter Wolle zur Seite. Die Stadt unter ihr schläft. Nur an den Tortürmen der Brücke flackern Fackeln und im Tempel der Venus auf der Spitze des Mons Dea Sullivae brennen Opferfeuer und erhellen die Nacht. Der Himmel ist klar und wolkenlos. Über der Stadt steht die Sichel des halben Mondes und taucht die gekalkten Mauern der Häuser in sein milchig weißes Licht. Die junge Frau fröstelt, schlingt die Arme um ihren sehnigen Körper und versucht dem Angriff des Windes standzuhalten.
„Julia wird mich auslachen, wenn ich ihr erzähle, dass der Traum zurückgekehrt ist. Sie wird ihre dunklen Locken schütteln, ihre rot geschminkten Lippen schürzen und mich verspotten."
Ein neuerlicher Windstoß lässt sie erschauern. Sie läuft zurück zum Bett. Eingewickelt in die Decke schläft Julia. Vorsichtig greift sie unter das Kopfkissen und holt eines der fein gewebten Wolltücher hervor. Sie wirft das Tuch über ihre Schultern und kehrt an ihren Platz am Fenster zurück.
„Sie wird sagen, dass ich endlich einen Priester aufsuchen soll, der mich mit Opfern und Gebeten von diesem Traum befreit." Die junge Frau seufzt und lässt den Blick über die schlafende Stadt schweifen. „Nur allzu gerne wird mich Julia in den Tempel des Merkur begleiten und die silberne Sesterze für die Dienste des Priesters bezahlen. Die Göttin Venus hat Julia, im Gegensatz zu meinen knochigen Schultern und sehnigen Beinen, die weibliche Figur einer römischen Frau geschenkt. Mit dem Selbstbewusstsein ihrer Herkunft wird sie die Blicke der Priesterschüler erwidern und sie auslachen, wenn sie erröten und wie betrunkene Tölpel über den Hof stolpern."
Bei dem Gedanken an den jungen Schüler, der Korbinian heißt und den Valeria von der Küche der Villa Rustica kennt, huscht ein Lächeln über ihre Lippen. Wie ein Hündchen war er Julia hinterhergelaufen, bis er zum Gelächter seiner Mitschüler auf die Nase gefallen war.
„Wie die meisten Römer nimmt Julia weder Merkur noch Jupiter ernst und geht nur in den Tempel, wenn sie sich einen Vorteil davon verspricht", denkt die junge Frau. „Die Leute meines Volkes hingegen beten zu den norischen Göttern, weil ihr Herz es ihnen befiehlt!" Sie seufzt bei dem Gedanken, wie viele Monde sie selbst dem Tempel der großen Mutter Noricums ferngeblieben ist.
Ein Geräusch unten im Hof veranlasst sie einen Schritt zurück in die Dunkelheit des Zimmers zu machen. Sie blickt hinunter zu den im Dunkel liegenden Arkaden. Eine verhüllte Gestalt betritt den Innenhof, schultert ein Bündel Holz und macht sich daran, die Feuerstellen des Statthalterpalastes mit Brennmaterial zu versorgen.
Die junge Frau wartet einige Augenblicke, aber der Mann setzt seinen Weg fort und blickt nicht zu ihr nach oben. Erleichtert atmet sie auf. Sie kennt den Alten, der das Feuer hütet. Er ist befreundet mit der Sklavin der Domina und würde nicht zögern zu behaupten, dass sie sich nachts herumtreibt, statt bei ihrer Herrin zu bleiben. Die Domina würde beim Statthalter erneut um eine andere Sklavin für Julia bitten. Sie müsste in der Küche arbeiten oder gar Iuvavum verlassen, um in der Villa Arsina, weit vor den Toren der Stadt, die Kühe zu hüten.
Lautlos schiebt die Frau den schweren Wollstoff vor das Fenster, eilt zurück zum Bett und streut Asche auf die glühenden Späne. Es ist stockdunkel im Zimmer und mit der Dunkelheit erscheinen die Bilder aus dem Traum. Wie der Frost nach Iuvavum, ist der Traum zu ihr zurückgekehrt und hat sie aus dem Schlaf gerissen. Wie all die Jahre zuvor wird sie dem Drängen der jungen Herrin nicht nachgeben. Sie fürchtet den Traum, aber er birgt die einzige Erinnerung an die verlorene Mutter. Sie lauscht. Der gleichmäßige Atem Julias verrät, dass die Herrin ruhig und traumlos schläft.
Als der Nachtwächter das Zimmer der Tochter des Statthalters betritt, um die Glut des Feuerbeckens neu anzufachen, hat sich die junge Frau dicht an den warmen Körper der Schlafenden geschmiegt und ist eingeschlafen.
3.
„Valeria! Wo steckst du?" Genervt rutscht Julia auf dem Hocker hin und her, um ihr störrisches Haar zu bändigen. „Komm sofort her und hilf mir mit diesen verflixten Bändern. Der Halsabschneider auf dem Markt hinter dem Merkurtempel hat behauptet, sie wären in den fernen Ländern der Parther gewoben. Eine Dupodie hat er mir abgeknöpft. Wenn du mich fragst, haben die plumpen Finger einer norischen Bäuerin die Wolle von Bergschafen gesponnen und sie zu diesen störrischen Stricken verwebt."
Erneut versucht die Frau, ihre schwarzen Locken mit den Bändern zu umschlingen, während ihre Linke den Spiegel aus Silber hält. Als sich das rote Band zwischen ihren Fingern hindurchschlängelt und zu Boden gleitet, wirft sie das gelbe und das blaue hinterher und stampft wütend mit dem Fuß auf.
„Valeria, so hilf mir doch! Wenn du nicht sofort kommst, wird das Fest im Tempel des Merkur ohne mich anfangen!"
„Ich bin ja da, Herrin", sagt eine dunkle, wohlklingende Stimme hinter ihr.
Julia dreht sich um und wäre beinahe über Valeria gestolpert, die auf dem Boden kniet, um die Bänder aufzuheben.
„Endlich, wo hast du denn gesteckt!" Sie seufzt und lässt sich auf dem Hocker nieder.
Ohne zu antworten, beginnt Valeria die dunklen Locken ihrer Herrin zu kämmen.
„Du bist meine Sklavin und außerdem meine beste Freundin. Ich lasse es nicht zu, dass dich der alte Drache in die Küche abkommandiert, wo du Rüben schälst, anstatt dich um mich zu kümmern."
Ein Schmunzeln huscht über Valerias Lippen. Sie kneift ihre Augen zusammen, ihre Stirn legt sich in Falten und die Sommersprossen auf ihren Wangen beginnen zu tanzen.
„Julia, mein Kind, ich bin einzig und allein um dein Wohlergehen bemüht!", zirpt sie mit dunkler Stimme und prustet gleich darauf vor Lachen los.
Die junge Herrin kichert, hält sich die Hand vor den Mund und bemüht sich ernst zu bleiben. Mit den Fingern kämmt sie sich das Haar straff nach hinten und dreht sich mit zusammengekniffenem Mund um.
„Julia, mein Liebes, ich habe deinem Vater versprochen, mich so lange um dich zu kümmern, bis du als Ehefrau an der Seite eines reichen, angesehenen Römers dieses Haus verlässt!" Mit strenger Miene erhebt sie belehrend den Zeigefinger. Nach wenigen Augenblicken ist es um Julias Beherrschung geschehen und sie fällt in Valerias Lachen ein. Die bunten Bänder sind vergessen. Julia springt auf und umarmt die Freundin. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und legt den Kopf an Valerias Schulter.
„Vielleicht tue ich meiner Tante Agrippina unrecht", sagt sie mit einer vom Lachen heiser gewordenen Stimme. „Sie hat sich immer um mich gekümmert und wie es aussieht, hat sie nun endlich einen römischen Adeligen gefunden. Der junge Mann hat den langen Weg von Rom auf sich genommen, um mich in Augenschein zu nehmen."
Plötzlich verstummt das Lachen der beiden Frauen.
„Was wirst du tun? Wirst du mit ihm nach Rom gehen?", fragt Valeria und streicht ihrer Freundin die schwarzen Locken aus dem Gesicht.
Julia hebt den Kopf. „Ach, Rom! Stell dir die Paläste, die Thermen und all die Menschen vor! Ich würde einen Esel heiraten, wenn er nur genug Geld hätte, um mir ein angenehmes Leben in Rom zu ermöglichen!" Sie nimmt den Kopf von Valerias Schulter, um ihr in die Augen zu schauen, aber Valeria hält den Blick gesenkt.
„Du kommst natürlich mit! Ich lasse dich doch nicht hier in der norischen Provinz zurück!"
Valeria nickt, schweigt aber.
„Du wirst die hübscheste Sklavin in ganz Rom sein. Alle werden mich um meine hochgewachsene Begleiterin beneiden. Mit deinen wintergrünen Augen und dem roten Haar wirst du die römischen Männer verrückt machen!"
Valerias Gesichtsausdruck hellt sich auf. In ihren Augen bleibt aber ein sorgenvoller Ausdruck zurück.
„Der Statthalter und deine Tante werden nicht erlauben, dass ich Iuvavum verlasse und mit dir gehe!"
„Lass Vater meine Sorge sein", beruhigt Julia die Freundin. „Er brachte dich zu mir, nachdem sie dich in den geplünderten Mauern der Villa Rustica fanden. Damals hat er mir versprochen, dass du immer an meiner Seite sein würdest. Er gab mir, seiner einzigen Tochter, sein Wort und wird nicht wagen, es zu brechen."
„Aber die Domina, sie hasst mich!", stammelt Valeria.
„Meine Tante wird froh sein, mich unter die Haube gebracht zu haben. Sie kann ihre anderen Sklavinnen herumscheuchen und wird dich schnell vergessen. Warum sollte sie einen Streit mit meinem Vater vom Zaun brechen, nur um dich im Haus zu halten? – Nein, nein, du siehst, es ist beschlossen, du kommst mit nach Rom."
Als Julia sieht, dass Valeria zu strahlen beginnt und sich das dunkle Tannengrün ihrer Augen in schimmerndes Lindgrün verwandelt, nickt sie zufrieden und nimmt auf dem Schemel Platz.
„So, und nun versuche du dein Glück mit den widerborstigen Schleifen!"
Mit flinken Fingern flicht Valeria die farbigen Bänder in Julias Locken, schlingt sie um ihren Kopf, und verknotet sie so, dass sie wie ein kunstvolles Diadem ihre Stirn krönen.
„Der Kaufmann hat dich belogen, die Bänder kommen nicht aus dem Partherreich", sagt sie, als sie sich ihr Werk besieht. „Eine halbe Tagesreise östlich von Iuvavum befindet sich ein norisches Dorf, dessen Frauen diese Art von Bändern aus Wolle weben und mit Färberwaid, Bingelkraut und Ocker färben. Sie sind von guter Machart. Der Preis, den du bezahlt hast, war nicht übertrieben."
Julia betrachtet sich im Spiegel, zupft dort und da an ihrem Haar und schenkt Valeria schließlich ein zufriedenes Lächeln.
„Wie klug du bist und was du alles weißt. Einzig deine Geschicklichkeit bewundere ich mehr als dein Wissen über Noricum! – Ich werde die safrangelbe Tunika, das Geschenk von Tante Agrippina, anziehen. Der Römer wird seine Augen nicht von mir lassen können, so schön werde ich sein!"
„Herrin, vergiss nicht den dicken Pelz umzulegen, wenn du zum Tempel des Merkurs gehst. Heute Nacht war es empfindlich kalt und seit Sonnenaufgang bläst ein eisiger Wind durch die Gassen der Stadt!"
Julia seufzt und nickt ergeben. „Wie könnte ich jemals ohne dich zurechtkommen?"
Plötzlich hält sie inne, dreht sich zu Valeria um und umschlingt ihre Taille mit beiden Armen. „Niemals soll uns etwas trennen können, schwöre mir das!"
„Ich verspreche es", antwortet Valeria.
Vorsichtig streicht sie über Julias kunstvoll geflochtenes Haar. Schließlich entwindet sie sich ihrem Griff und begibt sich hinaus, um dem Statthalter mitzuteilen, dass seine Tochter bereit ist, den Heiratskandidaten zu empfangen.
4.
„Herr, seid Ihr bereit?", fragt der Söldner. Seit vielen Jahren dient er dem Haus Flavius. Den jungen Herrn kennt er besser als seinen eigenen Sohn.
Keine Antwort.
„Dionysos?", fragt er.
Einige Schritte abseits der Straße steht der Angesprochene und starrt auf die Mauern von Iuvavum. Ein Zucken geht durch den Körper, als er seinen Namen hört.
Der Söldner wartet auf das Nicken seines Herrn und schwingt sich in den Sattel.
Der junge Römer mit dem purpurfarbenen Umhang zögert. Er macht ein paar Schritte auf die Gruppe der Reiter zu und wendet sich erneut dem Ziel seiner Reise zu. Zirka ein Milliarium von ihnen entfernt erhebt sich Iuvavum aus dem dichten Nebel.
Einige spitze Tempeldächer und Säulen erheben sich über die abweisende Stadtmauer. Ein langgestreckter Bergrücken schirmt die Ansiedlung gegen Norden und Westen ab. Ein Halbmond aus massivem Gestein schützt die Stadt wie ein natürlicher Steinwall. Die Noriker haben den Ort für ihre Siedlung weise gewählt und Rom tat gut daran, das Oppidum der Unterworfenen nach seinen Bedürfnissen umzubauen.
Dionysos Beine sind steif und schmerzen. Er zieht die Mundwinkel nach unten und seine Lippen verschmälern sich zu einer weißen Linie. Mit Mühe unterdrückt er ein Stöhnen. Er hatte sich für einen geübten Reiter gehalten, aber auf den Pässen lag Schnee. Die Kälte machte das Leder seines Sattels hart wie Stein.
Bei seinem Pferd angelangt, sammelt er seine Kräfte. Auf keinen Fall will er sich von einem der Männer aus der Garde seines Vaters in den Sattel helfen lassen.
Vor vier Tagen haben sie die verschneiten Berge verlassen und sind der Via Claudius Augusta weiter nach Norden gefolgt. Mit jedem Tag wurde es beschwerlicher, sich auf dem Rücken des störrischen Tieres zu halten.
Dionysos gibt den Männern ein Zeichen, zieht sich auf den Rücken des Pferdes und landet hart im Sattel. Mit einem schnellen Blick vergewissert er sich, dass keiner der Männer sein schmerzverzerrtes Gesicht bemerkt hat, aber die Söldner folgen bereits der Straße.
Neben den Reitern fließt der Fluss Iuvarus. Seine Wasser sind klar und grün. Weiße Schwaden steigen von seinen Fluten auf. Die feuchte Kälte kriecht unter Dionysos’ Mantel und durchdringt ihn bis auf die Knochen. Ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Der Tiberius in Rom fließt ruhig und gemächlich. Sein trübes Wasser verbreitet eine schläfrige Wärme. Verglichen mit dieser eisigen Wildnis lässt es sich an seinen Ufern um vieles angenehmer leben.
Die Vorhut seines Gefolges erreicht die Holzbrücke über den Iuvarus. Das Klappern der Pferdehufe auf dem Holz der Brücke vertreibt die tröstlichen Gedanken an das geliebte Rom. Sie überqueren die Brücke und passieren das hoch aufragende Steintor.
Mit einem Schlag ist er hellwach. Sein Vater hatte ihn gewarnt, dass die Einfälle der Alamannen der Stadt zugesetzt haben, aber darauf war er nicht vorbereitet.
Zwar sind die Stadtmauern in ausgezeichnetem Zustand – dafür hatte der Legatus Augustorum pro praetore provinicae Noricae aus eigenem Interesse gesorgt – aber hinter dem Stadttor liegen viele der Gebäude in Trümmern. Ein Großteil der Häuser ist so stark beschädigt, dass sie in Rom nicht einmal den Schweinen zur Behausung gedient hätten. Seit den Siegen von Kaiser Probus haben die Alamanneneinfälle in die Provinz aufgehört. Nur vereinzelt kommt es noch zu Übergriffen durch vagabundierende Germanen. Wegen der andauernden Bedrohung hat sich die Stadt von den vorhergegangen Verwüstungen nicht erholt. Sein Vater, Marcus Sextimus Flavius, hat es sich nicht nehmen lassen, zwei Dutzend Söldner an seine Seite zu stellen, um ihn sicher nach Iuvavum zu geleiten. Dionysos hatte das für übertrieben gehalten. Beim Anblick der verfallenen Stadt ist er froh, die Männer bei sich zu haben. Sie folgen der Hauptstraße ins Herz Iuvavums. Wenige Menschen kreuzen ihren Weg.
„Zumindest sind Soldaten auf den Wehrgängen und Türmen der Stadt zu sehen", denkt Dionysos, als er zurück auf die Mauern blickt.
Sie durchqueren ein Stadtviertel mit notdürftig instand gesetzten Häusern und erreichen die beiden einzigen Gebäude, in denen sich der Glanz Roms widerspiegelt. Der Fries des Merkurtempels ist erst vor kurzem erneuert worden und die Szenen aus dem Leben des Gottes leuchten in satten Farben. Der Palast gleich hinter dem Tempel gehört ohne Zweifel dem Agentes vices praesidis, dem Vertreter des Legaten.
Mit seiner Leibwache durchquert Dionysos den ersten Hof des Palastes und bringt vor den Stallungen sein Pferd zum Stehen. Sofort ist einer der Männer des Statthalters zur Stelle und hilft ihm aus dem Sattel. Dionysos blickt sich um und hebt anerkennend seine linke Augenbraue.
Trotz des rauen Klimas hat sich Aurelius Julius Senecio bemüht, seinem Haus das Flair eines römischen Palasts zu geben. Überall stehen leicht bekleidete Statuen von Jünglingen und Mädchen. Mächtige Vasen aus Stein erheben sich aus Beeten mit buschigen Stauden. Einzig ihrer Herkunft aus den norischen Wäldern ist es zu verdanken, dass sie nicht erfroren sind.
Dionysos berührt den roten Marmor der Statuen, als eine schwere Eichentüre aufschwingt und ein beleibter kurzbeiniger Mann auf ihn zueilt. Die Bordüre seiner Tunika ist mit feinen Goldfäden bestickt. Er hat einen purpurnen Wollmantel über die Schultern geworfen und lächelt ihn freundlich an.
„Willkommen, Dionysos Septimus Flavius! Willkommen in meinem bescheidenen Heim!", sagt der Mann, der sich als Aurelius Julius Senecio vorstellt und Dionysos vom kalten Hof in das beheizte Wohnhaus schiebt. „Ihr müsst verzeihen", fährt Aurelius fort, „aber in Iuvavum kann es um diese Jahreszeit bitterkalt sein. Das ist einer der Gründe, warum wir uns oft in unser geliebtes Rom zurücksehnen!"
„Ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft! Ich muss zugeben, dass ich diese Art der Kälte nicht gewohnt bin", antwortet Dionysos. Er ist froh, dass der Hausherr nach einigen höflichen Floskeln von ihm ablässt und nach einem Diener schickt. Mit einer Verbeugung fordert ihn der Sklave auf, ihm zu folgen.
Aurelius hat auch im Inneren des Hauses nichts unversucht gelassen, römisches Leben und römische Kultur bis ins Kleinste nachzuahmen. Statuen und Büsten stehen dicht an dicht. Die Wände sind mit exotischen Tieren und bunten Blumen bemalt und kunstvolle Mosaike verschönern die Böden. Trotz der Feuerbecken, der Fackeln und des lodernden Kaminfeuers ist es viel zu kühl. Ansonsten hätte sich Dionysos der Illusion hingeben können, er befände sich im Haus einer seiner Freunde in Rom. Weder die Purpurstoffe und die Teppiche an den Wänden noch die dicken Felle an den Fenstern können verhindern, dass die Kälte die massiven Mauern durchdringt. Ein eisiger Wind fegt durch die Gänge und Dionysos ist froh, endlich in seinem Zimmer angelangt zu sein. Der Raum ist groß und durch seine Lage im Inneren des Palast–Komplexes vor dem schneidenden Nordwind geschützt. Weit genug vom Fenster entfernt, steht ein Bett mit weichen Fellen und Decken.
Als der Sklave ihn bittet, ihm in eines der ebenerdigen Bäder zu folgen, fällt die Anspannung der Reise von ihm ab. Das warme Wasser tut seine Wirkung und er kann sich endlich entspannen. Mit geschlossenen Augen genießt er die Wärme. Er wird sich nicht länger als nötig in Iuvavum aufhalten. Wie es der Wunsch seines Vaters ist, wird er die Tochter Aurelius Julius Senecios heiraten. Er fügte sich der Anordnung seines Vaters, als er erfuhr, in welche Region des Reiches ihn seine Brautschau führen wird.
Iuvavum, hoch im Norden, dort wo die Kohorte des Lupercus steht und wo sich der wahre Grund befindet, warum sich Dionysos in diesen abgelegenen Teil des Reiches aufgemacht hat.
5.
„Wie kommt Ihr zu einem griechischen Namen? Ist es nicht so, dass in Rom jeder Bürger, der etwas auf sich hält, einen griechischen Sklaven besitzt, um die Knaben des Hauses in der Kunst der Philosophie zu unterrichten?"
Dionysos nickt bei Julias Worten, ohne ihr in die Augen zu schauen. Mit einem höflichen Lächeln wendet er sich ihrem Vater zu.
„Eure Tochter ist nicht nur hübsch, sondern auch gebildet." Er will mit seiner Schilderung des politischen Lebens in Rom fortfahren, aber Julia schneidet ihm das Wort ab.
„Nun antwortet doch!" Sie erhebt sich aus dem Korbsessel. Der Statthalter hat ihrem Drängen nachgegeben und den Stuhl am Rande der Gasttafel aufstellen lassen. Mit der Bitte, sich ruhig zu verhalten, hat er ihr so die die Möglichkeit geben, dem Mahl beizuwohnen.
„Warum tragt Ihr diesen Namen?"
„Aber mein Kind", wirft Aurelius ein, „du kannst doch unseren Gast nicht so bedrängen! Vergiltst du ihm so seine Großzügigkeit, deine Anwesenheit beim Gastmahl zu dulden?"
„Warum denn nicht? Schließlich soll ich ihn heiraten und ihm nach Rom folgen! Da habe ich jedes Recht der Welt zu fragen!", schnaubt sie ihren Vater an.
Der zuckt entschuldigend mit den Schultern. Ohne auf die Unhöflichkeit seiner Tochter einzugehen, fährt er fort, den Knochen seiner gebratenen Schweinshaxe mit dem Messer zu bearbeiten.
„Nein, nein, lasst sie nur!", entgegnet Dionysos und hebt beschwichtigend die Hand. „Ich werde Eurer Tochter alles erklären, was sie zu wissen wünscht. Von meinem Vater wurde ich dazu erzogen, Rede und Antwort zu stehen und nur die Wahrheit über meine Lippen fließen zu lassen."
Er wendet sich Julia zu und erwidert ihren Blick. „Mein Vater Marcus Sextimus Flavius, war Legat von Rätien und ist nun Konsul in Rom. In Rätien lernte er meine Mutter kennen. Sie entstammt einem alten Geschlecht von griechischen Kaufleuten. Als junge Frau kam sie von Korinth in die Hauptstadt Rätiens nach Curia. Wie Ihr nun begreift, brauchte mein Vater keinen griechischen Sklaven zu kaufen, denn meine Mutter brachte mir alles bei, was ich über Philosophie und Geschichte der Griechen wissen musste."
Als er seinen Blick auf Julia richtet, schlägt sie die Augen nieder und lässt sich zurück in den Korbsessel sinken.
„Ich danke Euch, dass Ihr meine Frage beantwortet habt", sagt sie und widmet sich ihrer Handarbeit.
„Nun erlaubt mir eine Frage. Ich sehe eine junge gebildete Römerin vor mir. Euer Vater hat Euch erzogen, Euren Kopf zu gebrauchen! Das gefällt mir! Nur eines macht mich stutzig. Ihr habt das schimmernde schwarze Haar einer Römerin, dazu feine Gesichtszüge und makellose Haut, wie sie selbst in der Hauptstadt des Imperiums nicht oft zu finden sind. Aber anders als die dunklen Augen Eures Vaters, sind Eure Augen so blau wie das Wasser der Ägäis an einem klaren Sommertag! Wie kommt das?"
Julia hebt überrascht den Kopf und hält einige Augenblicke dem forschenden Blick des Mannes stand. Plötzlich springt sie mit roten Wangen auf und läuft zur Tür hinaus.
Überrascht wendet sich Dionysos an den Herrn des Hauses. „Ich hoffe, ich habe Eure Tochter nicht gekränkt! Ich wollte ihr nur ein Kompliment machen!"
Aurelius ist nicht gewillt, den Kampf um die zarten Stücke des Wildschweinbratens zu unterbrechen und schüttelt ohne aufzublicken den Kopf. Endlich hat er den letzten Bissen in den Mund geschoben und ihn mit reichlich Wein hinuntergespült. Zufrieden steht er auf und tätschelt dem jungen Mann beruhigend die Hand.
„Meine Tochter ist vorlaut und verwöhnt. Leider habe ich es verabsäumt, sie nach dem Tod ihrer Mutter mit strenger Hand zu einer zurückhaltenden jungen Frau zu erziehen. Ihr müsst wissen, die Männer Noricums sind anders als wir. Sie gewähren den Frauen und ihren Töchtern Freiheiten, von denen ihr euch als gesitteter Römer aus gutem Haus keine Vorstellungen machen könnt. Als meine Schwester nach Iuvavum kam, um über die Erziehung Julias zu wachen, war es leider zu spät. Zu viel Zeit hatte sie mit den norischen Sklaven und Hausbediensteten verbracht und es wäre uns nur mit Schlägen und Hieben gelungen, sie in ein fügsames und duldsames Wesen zu verwandeln."
Ja, ich habe bemerkt, dass Eure Tochter über einen starken Willen und eine schnelle Auffassungsgabe verfügt. Anders als die meisten meiner Freunde finde ich dies bei einer Frau interessant. Solltet Ihr euch mit meinem Vater über die Höhe der Mitgift einigen und sollte Julia mit mir nach Rom gehen, wird sie sich dem Leben in der Hauptstadt anpassen und sich gebührend betragen."
„Ich bin froh, dass Ihr so gelassen darüber denkt", antwortet Aurelius. „Ihr müsst verstehen, dass das Leben nach dem Tod meiner Gemahlin nicht einfach für mich war." Er tätschelt noch einmal die Hand des jungen Mannes, geht zurück zu seiner Liege und nimmt den letzten Schluck aus seinem Weinkelch.
„Arsina war eine gute Frau und Julia gleicht ihrer Mutter in vielerlei Hinsicht. Es war wohl diese Ähnlichkeit, die mich davon abhielt, Julia mit der notwendigen Strenge zu erziehen. Wie ihr sicher von Eurem Vater wisst, war meine Gemahlin die Tochter des Legaten Publius Porcius Marinus und wuchs in Ovilava auf. Arsinas Mutter, Julias Großmutter, nannte sich Acca und war eine Norikerin aus edlem Haus. Sie führte ihre Abstammung auf den letzten König der Noriker zurück. Er hieß Voccio und sie behauptete, dass er von den Römern auf grausame Weise getötet worden war. Acca war eine stolze Frau, von beherrschter Art und großer Selbstsicherheit. Die Leute ihres Volkes nannten sie Finuan und sogar die mächtigsten Männer von Ovilava warfen sich vor ihr in den Staub, wenn sie es wollte. Von ihr hat Julia das leuchtende Blau ihrer Augen geerbt!" Mit einer kleinen Geste winkt Aurelius den Mundschenk herbei, lässt sich seinen Weinkelch füllen und nimmt einen großen Schluck.
„Sie hat Julia nach dem Tod meiner Frau oft zu sich geholt. Julia hat ihre Großmutter abgöttisch geliebt! Als sie vor sechs Jahren starb, zählte Julia elf Jahre und wäre beinahe selbst vor Kummer gestorben. Deswegen hat sie so übereilt die Tafel verlassen. Die Erinnerung an ihre Großmutter war wohl zu viel für sie."
„Ich verstehe", sagt Dionysos. „Ich hoffe nur, Eure Tochter nimmt mir meine Ungeschicklichkeit nicht übel!"
„Das glaube ich nicht", antwortet Aurelius. „Woher hättet Ihr all das wissen sollen, wo Ihr doch erst seit gestern in unserer Stadt weilt. Doch nun soll das Vergangene ruhen! Erzählt mir stattdessen mehr von Rom. Ich habe nicht oft Gelegenheit, Neuigkeiten über die Vorkommnisse am Kaiserhof zu lauschen."
6.
„Endlich!", seufzt Valeria, als sie den Reisigbesen in die Ecke stellt und den sauberen Boden betrachtet. „Selbst wenn die Domina auf Knien durch die Küche rutscht, wird sie weder Federn noch Borsten oder ein Körnchen Holzstaub finden."
Sie folgt dem leeren Gang, schleicht am Esszimmer vorbei, als plötzlich die Türe auffliegt und Julia an ihr vorbeistürmt. Weinend läuft die junge Römerin die Treppen hinauf und verschwindet in ihrem Zimmer. Ohne zu zögern, folgt Valeria ihrer Herrin, setzt sich an ihr Bett und wartet, bis die Tränen versiegt sind. Julias Schluchzen wird leiser. Dafür ballen sich ihre Fäuste und trommeln gegen das Kissen, um ihrem Arger über die Dreistigkeit und Frechheiten des jungen Römers Luft zu machen. Als Julias Boxhiebe schwächer werden und schließlich aufhören, streichelt Valeria über den Rücken ihrer Herrin und wartet bis ihre Wut endgültig verflogen ist.
„Er ist der eingebildete Ableger eines römischen Adeligen! Aber zumindest ist er jung und nicht entstellt. Ich wette, er verbirgt unter seiner Tunika einen Schwanz, mit dem er den Schoß einer jeden Römerin zufrieden stellen kann!"
„Aber, Herrin!" Valeria wendet sich ab, um ihr entsetztes Gesicht vor Julia zu verbergen. „Es gehört sich nicht, so über deinen Bräutigam zu sprechen!"
Julia beginnt zu kichern. „Die Frauen deines Volkes waren es, die mich solche Dinge lehrten. Umso verwunderter bin ich, dass du dir die Unschuld und Unerfahrenheit eines kleinen Mädchens bewahrt hast."
„Herrin, ich...", stammelt Valeria und wagt es nicht, Julia in die Augen zu schauen.
„Du brauchst mir nichts erklären! Ich weiß, dass weder dein Körper noch dein Geist bereit sind, mehr als ein kindliches Interesse an einem männlichen Spielgefährten zu haben", fällt Julia ihr ins Wort und kneift sie spielerisch in den Oberarm.
„Dabei könntest du als Sklavin und Norikerin ein unbeschwertes Leben führen und müsstest dir nicht Ehre und Unschuld für einen Gemahl bewahren."
Valeria will etwas entgegnen, aber Julia gebietet ihr mit einer Handbewegung zu schweigen.
„Geh nun und lass mich alleine. Ich will nachdenken, wie ich meinem stolzen Bräutigam seine Überheblichkeit vergelten kann."
Valeria nickt und verlässt das Zimmer. Sie macht sich auf den Weg zur Küche, um Julia Essen zu holen. Vor dem großen Empfangsraum hält sie inne.
„Welch ein Mann vermag Julia so zu reizen, dass sie in Tränen ausbricht?" Sie überlegt, schleicht die Mauer entlang und hält vor der schweren Tür des Speisezimmers. Ihre Neugierde ist zu groß. Um jeden Preis will sie einen Blick auf den Fremden erhaschen. Gerade als sie sich vorbeugt, um durch den Spalt zwischen den Türflügeln zu spähen, schwingen diese auf und der junge Römer steht plötzlich vor ihr. Erschrocken starrt sie in seine schwarzen Augen. Schnell besinnt sie sich und senkt den Blick, wie es sich für eine Sklavin gehört.
„Wen haben wir denn da?", fragt Dionysos mit einem breiten Grinsen auf den Lippen. Er fasst unter Valerias Kinn und zwingt sie ihren Kopf zu heben. Sie wagt es nicht ihn anzuschauen, dennoch streift sie mit ihrem Blick über sein bartloses Gesicht. Seine dunklen Augen funkeln sie an. Die schmale Adlernase und das schwarze, kurz geschorene Haar verleihen ihm eine klassische Schönheit.
„Endlich lerne ich eine der Jungfrauen Noricums kennen! Im ganzen Imperium werden sie wegen ihrer Schönheit gerühmt. Wie heißt du mein Kind?" fragt er.
Noch immer kann er seine Augen nicht von Valerias Gesicht lassen.
„Sie heißt Valeria und ist die Sklavin und Spielgefährtin Julias", antwortet Aurelius, der hinter Dionysos aus der Tür tritt. „Nach dem Überfall der Alamannen auf meine Villa südlich von Iuvavum war sie weinend zwischen den Trümmern herumgeirrt. Sie war das einzig lebendige Wesen weit und breit. Ob Rind, Schaf oder Sklave, alle wurden sie entweder verschleppt oder erschlagen. Die Priester des Merkur meinten, dass sie unter dem Schutz einer mächtigen Gottheit stünde. Also nahm ich sie in mein Haus auf und gab sie Julia zur Spielgefährtin. Mein Plan ging auf. Julia überwand den Tod ihrer Großmutter und seither sind die beiden unzertrennlich."
Dionysos nickt. Langsam lässt er Valerias Kinn los und wendet sich von ihr ab. „Schade! Wahrscheinlich ist sie gar keine Tochter Noricums, sondern ein Balg der alamannischen Barbaren!"
„Nein, mein Sohn, du irrst. Valeria ist die Tochter einer norischen Sklavin. Sironia arbeitete in meiner Villa und war ein stolzes Weib mit feuerrotem Haar und funkelnden Augen." Ein verräterisches Lächeln huscht über das Gesicht von Aurelius. „Valeria gleicht ihrer Mutter wie eine Schwalbe der anderen."
„Ich verstehe", antwortet Dionysos und wendet sich der Sklavin zu. Im Schein der Fackeln schimmert ihr braunrotes Haar in dunklem Rot. Wie zufällig berührt er ihren Unterarm. Ihre milchweiße Haut ist weich und zart und verhöhnt mit ihrer Makellosigkeit die Grobheit des Wollstoffs ihrer Tunika. Sein Herzschlag beschleunigt sich und sein Atem beginnt zu flattern.
Aurelius gibt Valeria ein Zeichen und wartet, bis sie hinter der Tür des Küchentrakts verschwunden ist.
„Sei unbesorgt, mein Sohn", lacht Aurelius. Ihm ist das große Interesse des jungen Mannes an der Sklavin nicht entgangen. „Nach der Hochzeit wird Valeria meiner Tochter nach Rom folgen und in deinen Besitz übergehen!"
7.
Der Bote, der nach Sonnenuntergang Einlass begehrt und um eine Unterredung mit Dionysos bittet, ist in grobes Leinen gekleidet. Äußerlich unterscheidet er sich nicht von den Bediensteten der Villa. Eher aus Langeweile denn aus Interesse winkt Dionysos den Mann heran. Er stellt sich als Marcellus vor und beugt das Knie vor ihm. Dionysos Blick fällt auf den Übermantel des Boten und ist mit einem Mal hellwach. Unscheinbar, damit sie dem ungeschulten Auge verborgen bleiben, sind die Sonne und der Stern des Mithras unterhalb des Mantelkragens eingestickt.
„Lasst uns allein!" befiehlt er den anwesenden Sklaven.
Sobald sie sich entfernt haben, hebt er die Hand zum geheimen Gruß des göttlichen Stiertöters. Der Bote erwidert seinen Gruß auf die gleiche Art.
„Im Tempel ist alles für das Mahl zu Euren Ehren bereitet! Ich erwarte Euch vor den Toren der Stadt!"
Dionysos eilt in seine Gemächer, wirft seinen warmen Mantel über und schlüpft in die gefütterten Stiefel. Er ruft nach dem Befehlshaber seiner persönlichen Leibwache und eilt mit ihm zu den Stallungen. Dem Stallknecht trägt er auf, Aurelius zu berichten, er sei dem Boten seines Vaters gefolgt, um sich ungestört vor den Toren der Stadt mit ihm zu unterhalten.
Dionysos wartet, bis sein Pferd gesattelt ist, und verlässt mit dem Leibwächter die Stadt über das zentrale Stadttor. Hinter der Brücke treffen sie auf den wartenden Marcellus. Dieser hat sie bereits ungeduldig erwartet. Er entzündet eine Fackel und schlägt den Weg nach Süden ein.
„Euer Primus verlangt eher nach mir, als ich angenommen hatte", sagt Dionysos.
„Euer Kommen wurde uns vor Tagen angekündigt", antwortet Marcellus.
Die drei Männer folgen der Via Julia Augusta und gelangen nach kurzem Ritt an eine Furt. Dank des Niedrigwassers bereitet es ihnen keine Probleme, den Fluss zu überqueren. Marcellus zeigt auf einen markanten Hügel. Unmittelbar und schroff erhebt sich dieser aus dem flachen Talgrund.
„Hinter diesem Berg hat euer Gastgeber eines der schönsten und prächtigsten Anwesen Iuvavums. Die Villa Arsina wurde zwar vor einigen Jahren von plündernden Alamannen zerstört, aber Aurelius ließ sie innerhalb eines Monats wieder instand setzen."
Dionysos nickt. Er hat mit Aurelius über die Villa gesprochen und darüber, wie angenehm sich die Sommermonate dort verbringen lassen.
Der Gedanke an den Sommer lässt ihn den Winter noch schwerer ertragen. Kalt schneidet der eisige Wind durch seinen dicken Mantel. Die Dunkelheit der Nacht verdrängt die letzten Strahlen der, hinter den Bergen verschwundenen Sonne. Dionysos zittert und seine Zähne klappern so laut, dass es ihm vor dem Fremden peinlich ist.
„Unser Weg führt uns auf die andere Seite des Mons Aericurae. Das Mithräum befindet sich gut geschützt in einem dichten Wald unterhalb der Bergkuppe."
Sie umrunden die steilen Klippen des Hügels und reiten ein Stück in den Wald. Plötzlich tauchen zwei Männer hinter den Bäumen auf. Sie nehmen sich der Pferde an und weisen den Besuchern den Weg zum Tempel. Ein zufriedenes Lächeln zeigt sich auf Dionysos Lippen.
„Sogar hier an den Grenzen des Reiches wird Gott Mithras in seinem Höhlentempel verehrt. Wie in Rom hält er seinen Sternenmantel schützend über seine treu ergebenen Anhänger.“
Sie sind beim Eingang zur Höhle angelangt. Steile Stufen führen ins Innere des Berges. War es draußen kalt und frostig, herrscht unter der Erde eine behagliche Wärme. In regelmäßigen Abständen knistern Fackeln und verbreiten einen intensiven Duft nach Harz. Der Widerschein des Feuers wirft tanzende Schatten an die gekalkte Höhlendecke und erhellt den weiten Innenraum. Eine Schar von Männern hat sich bereits versammelt. Dionysos folgt der Aufforderung, den Ehrenplatz vor dem niedrigen Steintisch einzunehmen. Der Oberpriester mit dem knöchellangen Sternenmantel und der phrygischen Mütze auf dem Kopf erhebt beschwörend die Arme.
„Wir haben das Stieropfer vorbereitet und warten darauf, dass der Gott es mit uns feiert. Mithras, komme und mische dich unter deine Anhänger!“ Er füllt einen Kelch mit Wein, reicht ihn dem Mann neben ihm und sagt:
„Das Blut des Stieres! Mithras hat es vergossen, um die Welt zu erretten. Nehmt und trinkt davon, das ist das Blut des ewigen Lebens.“ Er greift nach dem Brot, hebt es in die Höhe und spricht:
„Das Fleisch des Stieres! Mithras hat ihn geopfert, um uns seiner ewigen Liebe zu versichern. Nehmt und esst davon, um das Bündnis zwischen Mithras und seinen Anhängern zu erneuern."
Der Kelch wandert von Mann zu Mann und jeder von ihnen nimmt einen Schluck. Das Brot wird herumgereicht und jeder bricht ein Stück herunter. Mit lautlos gemurmelten Worten führen die Jünger den Bissen zum Mund. Als Kelch und Brot bei Dionysos angelangt sind, trinkt und isst auch er davon. Den Rest des Laibes und den leeren Kelch bringt er nach vorne. Er überreicht beides dem Oberpriester und kehrt auf seinen Platz zurück.
Das Stieropfer ist beendet. Der Priester hebt die Arme und spricht den Segen des Mithras. Als Sol Invictus, als unbesiegbarer Sonnengott, ist er zu ihnen zurückgekehrt und weilt in ihrer Mitte. Auf ein Zeichen des Oberpriesters verneigen sich die Männer und verlassen schweigend den Höhlentempel.
„Dionysos! Endlich!" Der Oberpriester erhebt sich. Er reicht Dionysos die Hand und zieht ihn zu sich, um ihn zu umarmen. Mit Tränen in den Augen erwidert jener die Umarmung.
„Lupercus, nach all der Zeit sehen wir uns wieder! Nach deinem Fortgehen aus Rom, glaubte ich, dich nie wiederzusehen!"
Lupercus klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Mir ging es ebenso, aber ich wusste, du würdest kommen." Er löst sich von Dionysos und bittet ihn, sich an seiner Seite hinter dem Altar niederzulassen.
„Wie du siehst, habe ich den Rat unseres Meisters befolgt. Ich bin mit der Legion nach Norden gegangen. Unsere Centurie wurde nach Iuvavum beordert, um die Stadt zu schützen und so habe ich hier eine Gemeinde für unseren Gott aufgebaut."
Dionysos nickt anerkennend. „Was dir gelungen ist, wie ich mich soeben überzeugen konnte! Du hast eine große Zahl von Männern um dich versammelt. Gottgefällig hast du im Tempel des Mithras gewirkt, während ich in Rom gesessen bin und die korrupten Höflinge des Kaisers mit Geschenken und Speichelleckereien bei Laune gehalten habe!"
Lupercus schüttelt bei den Worten seines Freundes den Kopf und berührt dabei den goldenen Stern um seinen Hals.
„Kaiser Probus ist ein gerechter Mann und ein erfahrener Kämpfer. Ich fürchte, dass er sich mit den falschen Leuten umgibt. Es wird gemunkelt, dass er sich mit den Christen eingelassen hat, um Geld und Unterstützung von ihnen zu erhalten."
Dionysos verzieht verächtlich den Mund. „Christen! Ein Haufen alter Männer, Sklaven und Weiber! Der Gedanke, dass sich der Kaiser mit diesem Abschaum einlässt, macht mich wütend!"
Die beschwichtigende Geste seines Freundes hindert ihn daran, die Christen an diesem geweihten Ort lauthals zu verfluchen.
„Ich verstehe deine Wut. Wir sind die Legion und die Krieger. Wir schützen Rom und verleihen Kaiser Probus Stärke. Die Christen verstehen sich nur auf zwei Dinge: Aufs Beten und Sterben! Dennoch dürfen wir sie nicht unterschätzen. Sie dehnen ihren Einfluss aus. Einige der Männer in meiner Centurie haben bereits den Stern des Mithras gegen das Kreuz getauscht."
„Ist das der Grund, warum du mich hierher gerufen hast?" fragt Dionysos.
Wieder berührt Lupercus den Mithrasstern. „Ich habe die Gestirne befragt und sie haben mir den Willen des Stiertöters offenbart. Eine große Gefahr erhebt sich im Norden und lauert darauf, über uns hereinzubrechen. Die Christen haben den Kaiser und mit ihm die Legion geschwächt. Sollte der Feind mit voller Macht zuschlagen, vermögen wir ihm nichts entgegenzusetzen. Noricum und Iuvavum werden fallen. Der Untergang der Stadt und der Verlust der Provinz werden weite Kreise ziehen. Selbst das ewige Rom kann dadurch in den Abgrund gerissen werden."
Ungläubig schüttelt Dionysos den Kopf. „Nun verstehe ich. Deshalb wollte der Großmeister, dass ich nach Iuvavum reise, um dich zu treffen. Was können wir tun, um dieses Schicksal abzuwenden?"
„Ja, es gibt eine Möglichkeit", antwortet Lupercus. „Der Gott selbst hat mir den Ausweg aus Tod und Elend gezeigt. Mithras darf seine schützende Hand nicht von uns abziehen und Iuvavum dem Untergang preisgeben."
„Aber warum sollte er uns im Stich lassen?", fragt Dionysos. „Ich habe dem Blutopfer beigewohnt und gespürt, wie treu ihm seine Anhänger ergeben sind."
Lupercus schüttelt den Kopf. „Der Gott verlangt nach einem Opfer! So, wie er damals den Stier getötet hat, müssen wir das Blut eines Frevlers vergießen." Er hält inne und wählt seine Worte mit Bedacht. „Vor sieben Jahren drang ein Ungläubiger in diesen Tempel ein und entweihte ihn."
Dionysos springt auf und zieht sein Schwert. „Wer hat so etwas gewagt!", ruft er bleich im Gesicht. „Kein Mensch, Römer oder Sklave, wagt es, den Tempel des Mithras zu betreten."
Lupercus schüttelt den Kopf. „Aus Unwissenheit hat ein Mädchen im Tempel Schutz gesucht. Einer der alten Priester hat es dabei beobachtet. Er ist dem Kind gefolgt, aber auf unerklärliche Weise gelang es ihm, zu entkommen."
Lupercus legt seine Hand auf Dionysos Arm und bittet ihn, sein Schwert zurück in die Scheide zu stecken. „Aus dem Kind ist eine Frau geworden. Wenn der Frevel dieser Frau gegen Mithras nicht gesühnt wird, zieht der Gott seinen schützenden Mantel von uns und gibt uns dem Untergang preis."
8.
An diesen ersten Tagen im Februaris ist Valeria, so wie die meisten anderen Sklaven, mit den Vorbereitungen für das bevorstehende Fest beschäftigt. Wieder einmal hat die Schwester des Dominus es geschafft, sie von Julias Seite zu reißen. Der Domina bereitet es anscheinend Freude, die junge Sklavin mit niedrigen Küchendiensten zu quälen.
„Agrippina hasst mich. Boshafter als sie ist jedoch ihre Leibsklavin. Sie spielt sich als Herrin über uns alle auf und verachtet mich", murmelt Valeria vor sich hin. Sie legt das Bündel Holz in der entlegenen Ecke des Gartens auf den gefrorenen Boden. Zitternd wickelt sie sich in das grobe Wolltuch, um sich gegen die schneidende Kälte des Nordwinds zu schützen.
„Die Tage werden länger, aber vom bevorstehenden Frühling ist noch nichts zu spüren." Steif vor Kälte nimmt das Bündel auf und stapft den schneebedeckten Weg entlang zurück in Richtung Küche.
„Mit der Tageslänge wachsen die Kraft der Kälte und die Macht des Schnees", wiederholt sie die Warnung der alten Sklavin Torki. Sie verlachte Valeria, als sie sich von den länger werdenden Tagen dazu verleiten ließ, ihre Felljacke in ihrer Kammer zu lassen. Endlich ist sie bei der Küchentür angekommen. Sie stößt diese mit dem Fuß auf und trägt das Holz zu dem großen Herd in der Mitte der Küche.
„Agrippina würde mich am liebsten umbringen, weil ich mit Julia nach Rom gehen werde, während sie hier in dieser eisigen Einöde Zurückbleiben muss!" Ein warmer Schauer der Vorfreude läuft bei dem Gedanken an die bevorstehende Abreise durch ihren Körper.
Vor zwei Tagen war endlich der Bote aus Rom gekommen und hatte das lang erwartete Schreiben von Dionysos Vater überbracht. Marcus Sextimus Flavius hat in seiner Funktion als Oberhaupt der Familie der Flavier die Höhe der Mitgift für angemessen erachtet und der Verbindung seines Sohnes mit der Tochter des Aurelius Julius Senecio zugestimmt.
„Sobald die Nachricht verlesen wurde, hat sich Agrippina wie eine Wahnsinnige in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt und dafür gesorgt, dass wir seither keinen ruhigen Augenblick mehr haben", denkt Valeria. Sie kniet sich vor den Herd und füllt mit den Scheiten die Brennvorräte auf. Kaum ist sie mit der Arbeit fertig, will sie aufstehen und zurück zu Julia eilen. Da fällt ihr ein, dass sich Agrippina in Julias Gemächern breitgemacht hat. Seit Tagen nervt sie ihre Nichte mit langatmigen Vorträgen und Ermahnungen, wie sie sich als Ehefrau und Hausherrin zu benehmen hat. Der Gedanke an das Gekeife der Domina lässt sie zurück auf den Holzstoß sinken. Hier ist es warm und vor allem ruhig. Bis die Sklavinnen und Köchinnen kommen, um das Abendessen vorzubereiten, wird einige Zeit vergehen. Sie lehnt sich zurück und macht es sich zwischen den Holzscheiten gemütlich. Auf der Stelle nickt sie ein. Sie erwacht erst, als sich zwei Frauen zu unterhalten beginnen.
Möglichst leise kriecht Valeria weiter hinter den Holzstoß und hofft, nicht von ihnen entdeckt zu werden. Sie sprechen leise und in der Sprache Noricums, wie sie es immer tun, wenn keine Römer in der Nähe sind.
Die norischen Sklavinnen haben dafür gesorgt, dass Valeria die Sprache ihrer Mutter nicht vergisst. Es bereitet es ihr keine Mühe, dem Gespräch der beiden Frauen zu folgen. Wie zumeist geht es um Tratsch und Klatsch. Sie schenkt dem Getuschel wenig Aufmerksamkeit, bis sie ihren eigenen Namen hört.
„Der junge Römer hat ein Auge auf unsere kleine Valeria geworfen. Sie ist solch ein Lämmchen, dass sie seine geilen Blicke nicht zu deuten vermag!" wispert die eine.
„Von Karalian habe ich gehört, dass sich der junge Römer angeboten hat, in die Villa Arsina zu reiten, um mit den großen Wägen Felle und allerlei Hausrat nach Iuvavum zu bringen. Und nun rate, wen er sich zu seiner Begleitung ausgewählt hat", kichert die andere. „Unser gnädiger Herr Aurelius hat zugestimmt und einigen anderen jungen Frauen und Männer befohlen, Dionysos zu begleiten. Hinter vorgehaltener Hand hat er gesagt, dass es in der Nacht vor der Hochzeit einem Römer zustehe zu feiern, um sich von seinem Junggesellenleben zu verabschieden!"
„Und was sagt die junge Herrin dazu? Weiß sie etwas von der Verschwörung der Männer?"
„Nein, du kennst doch die Sitten der Römer. Einem Mann ist es erlaubt zu huren und es zu treiben, mit wem er will. Seine Frau hingegen hat sittsam und anständig zu bleiben. So droht der Ehre der Familie keine Gefahr."
Prustend fällt die eine in das Gelächter der anderen ein. Mit einem Mal ist es still.
„Was meinst du? Sollen wir Valeria warnen, um sie vor der Geilheit des Römers zu bewahren? Immerhin ist sie von unserem Blut, und ob sie es will oder nicht, hält unsere Göttin ihre Hand schützend über sie!"
Die andere murmelt etwas, das Valeria nicht verstehen kann. Einen Augenblick später fällt die Tür fällt krachend ins Schloss. Die beiden Frauen haben die Küche verlassen.