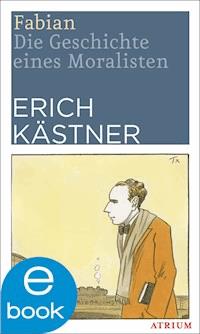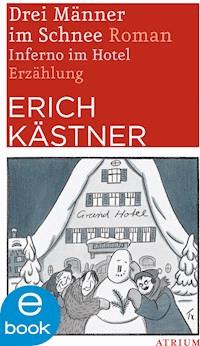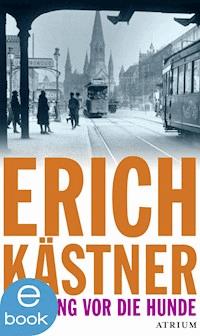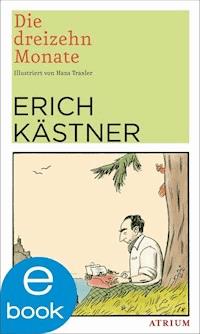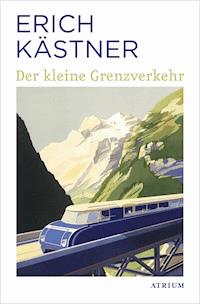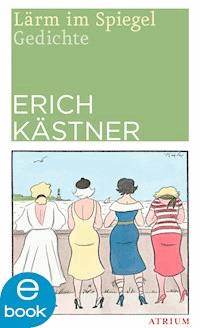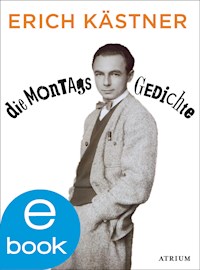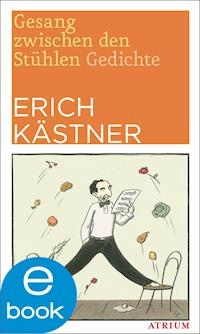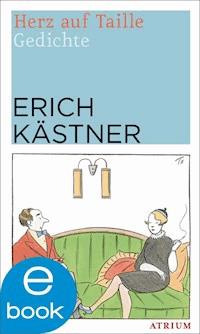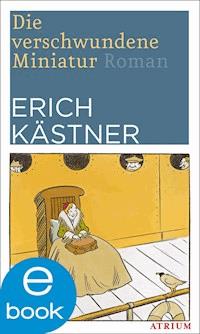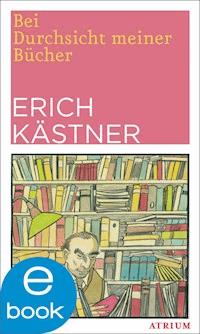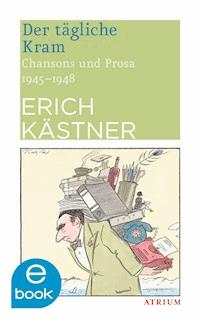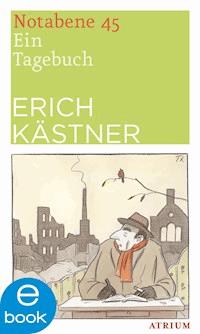
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Zürich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Notabene 45, Kästners literarisches Tagebuch, nachträglich entstanden aus seinen Notizen, die er in der ersten Hälfte des Jahres 1945 anfertigte, ist eine sarkastische und messerscharfe, erschütterte und erschütternde Schilderung der letzten Monate der NS-Zeit und des Alltags in den Zeiten des schwierigen Neubeginns: ein einzigartiges Zeitdokument und ein zeitloser Aufruf zu Mitmenschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Vorbemerkungen
In einem Regal meiner Berliner Bibliothek stand, unauffällig zwischen anderen Bänden, während des Dritten Reiches ein blau eingebundenes Buch, dessen Blätter, wenigstens in der ersten Zeit, völlig weiß und leer waren. In Fachkreisen nennt man solche Bücher ohne Worte »Blindbände«. Es handelt sich um Buchmuster, die dem Verlag und dem Autor dazu dienen, die endgültige Ausstattung des geplanten Werks zu erörtern.
Der unverfängliche Blindband wurde mein Notizbuch für verfängliche Dinge. Die leeren Seiten füllten sich mit winziger Stenographie. In Stichworten hielt ich, als seien es Einfälle für künftige Romane, vielerlei fest, was ich nicht vergessen wollte. Und dreimal begann ich Tagebuch zu führen, jeweils etwa sechs Monate lang, in den Jahren 1941, 1943 und 1945.
Warum ich die Arbeit, noch dazu dreimal, nach kurzer Zeit wieder abbrach, weiß ich heute nicht mehr. Außer allerlei nicht mehr auffindbaren Gründen dürfte mitgespielt haben, dass der Alltag auch im Krieg und unterm Terror, trotz schwarzer Sensationen, eine langweilige Affäre ist. Es ist schon mühsam genug, ihn hinzunehmen und zu überdauern. Auch noch, Jahr um Jahr, sein pünktlicher Buchhalter zu sein, überstieg meine Geduld. Ich begnügte mich mit Stichproben.
Bis Ende November 1943 stand das blaue Buch, aufs sichtbarste verborgen, zwischen viertausend anderen Büchern im Regal. Dann steckte ich es, da die Luftangriffe auf Berlin bedenklicher wurden, zu dem Reservewaschbeutel, der Taschenlampe, dem Bankbuch und anderen Utensilien in die Aktenmappe, die ich kaum noch aus den Händen ließ. So entging es dem Feuer, als im Februar 1944 die anderen viertausend Bücher verbrannten. Und so existiert mein »Blaubuch« heute noch, genau wie das Bankbuch. Beides sind Dokumente. Die Eintragungen im Bankbuch haben mittlerweile jeden Wert verloren, die Notizen im Tagebuch hoffentlich nicht.
Der vorliegende Band enthält die Aufzeichnungen aus ungefähr der ersten Hälfte des Jahres 1945. Es waren, wie man aus der Großen Chronik weiß, bewegte Monate. Das Dritte Reich brach zusammen. Die Sieger bestanden einmütig auf der bedingungslosen Kapitulation. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt und militärisch verwaltet. Seuchen und Bürgerkrieg konnten vermieden werden. Ruhe hieß die erste Bürgerpflicht. Am Leben bleiben hieß die zweite. Der erschöpften Bevölkerung war beides recht. Sie ließ sich regieren, und sie wurde, da der Zivilverkehr stilllag, punktuell regiert. Die Methode war handlich. Da sie sich anbot, brauchte man sie nicht zu erfinden. Mit der Konstruktion und Rekonstruktion der Linien zwischen den Punkten hatte man’s nicht eilig.
Im Wirrwarr jenes Halbjahres bewegte ich mich von Berlin über Tirol nach Bayern. Das Land glich einem zerstörten Ameisenhaufen, und ich war eine Ameise unter Millionen anderer, die im Zickzack durcheinanderliefen. Ich war eine Ameise, die Tagebuch führte. Ich notierte, was ich im Laufen sah und hörte. Ich ignorierte, was ich hoffte und befürchtete, während ich mich tot stellte. Ich notierte nicht alles, was ich damals erlebte. Das versteht sich. Doch alles, was ich damals notierte, habe ich erlebt. Es sind Beobachtungen aus der Perspektive einer denkenden Ameise. Und es sind Notizen, die zum Teil nur aus Stichworten, halben Sätzen und Anspielungen bestehen. Das genügte, weil die Niederschrift nur für mich bestimmt war, nur als Zündstoff fürs eigene Gedächtnis.
Als ich nun, fünfzehn Jahre danach, ans Veröffentlichen dachte, an Leser außer mir selber, musste ich den Wortlaut ergänzen. Meine Aufgabe war, die Notizen behutsam auseinanderzufalten. Ich musste nicht nur die Stenographie, sondern auch die unsichtbare Schrift leserlich machen. Ich musste dechiffrieren. Ich musste das Original angreifen, ohne dessen Authentizität anzutasten. Es war eine mühsame Beschäftigung, eher die eines Konservators als eines Schriftstellers, und ich habe sie so gewissenhaft durchgeführt, wie ich es vermochte. Ich habe den Text geändert, doch am Inhalt kein Jota.
Deshalb ist das vorliegende Buch, was sonst es auch sein oder nicht sein mag, nach wie vor ein Dokument. Es ist das Journal geblieben, das es war. Auch die Irrtümer habe ich sorgfältig konserviert, auch die falschen Gerüchte, auch die Fehldiagnosen. Ich wusste nicht, was ich heute weiß. Was wahr schien, konnte Lüge, und was Lüge schien, konnte wahr sein. Man durfte den Ohren nicht trauen, und noch der Augenschein trog. Man zog Schlussfolgerungen aus Tatsachen, die womöglich keine waren. Man interpolierte Ereignisse, die am Ende gar nicht stattgefunden hatten. Manche Sorge war überflüssig, und manche Hoffnung erst recht. Ich habe nicht daran gerührt. Denn ich bin nicht vom Verschönerungsverein. Vom Selbstverschönerungsverein schon gar nicht. Ich bin kein Feldmarschall, der aus Tagebüchern ein Plädoyer macht, und kein Staatsmann, der Tagebuchblätter in Lorbeerblätter verwandelt. Ein Tagebuch ohne Fehler und Falsches wäre kein Tagebuch, sondern eine Fälschung. Ich bin auch der Versuchung nicht erlegen, mein Journal mit einem Kunstkalender zu verwechseln. Je mehr ein Tagebuch ein Kunstwerk sein möchte, umso weniger bleibt es ein Tagebuch. Kunstgriffe wären verbotene Eingriffe. Wer notiert, was ihm widerfährt, darf keinen anderen Ehrgeiz haben als den, der eigne Buchhalter zu sein. Mehr wäre zu wenig.
»Zündstoff fürs eigene Gedächtnis« sollten die Notizen sein, Material für ein bengalisches Feuerwerk, das ich eines Tages abbrennen würde, ein höllisches Feuerwerk, weithin und lange sichtbar, mit Donnerschlägen und blutigen Zeichen am Himmel und dem aufs Rad, aufs kreisende Flammenrad geflochtenen Menschen. Mit anderen Worten, ich dachte an einen großen Roman. Aber ich habe ihn nicht geschrieben.
Ich kapitulierte aus zwei Gründen. Ich merkte, dass ich es nicht konnte. Und ich merkte, dass ich’s nicht wollte. Wer daraus schlösse, ich hätte es nicht gewollt, nur weil ich es nicht konnte, der würde sich’s leichter machen, als ich es mir gemacht habe. So simpel liegt der Fall nicht. An meinem Unvermögen, den Roman der Jahre 1933 bis 1945 zu schreiben, zweifelte ich sehr viel früher als an der Möglichkeit, dass er überhaupt zu schreiben sei. Doch auch diesen grundsätzlichen Zweifel hege ich nicht erst seit gestern.
Das Tausendjährige Reich hat nicht das Zeug zum großen Roman. Es taugt nicht zur großen Form, weder für eine »Comédie humaine« noch für eine »Comédie inhumaine«. Man kann eine zwölf Jahre lang anschwellende Millionenliste von Opfern und Henkern architektonisch nicht gliedern. Man kann Statistik nicht komponieren. Wer es unternähme, brächte keinen großen Roman zustande, sondern ein unter künstlerischen Gesichtspunkten angeordnetes, also deformiertes blutiges Adressbuch, voll erfundener Adressen und falscher Namen.
Meine Skepsis gilt dem umfassenden Versuch, dem kolossalen Zeitgemälde, nicht dem epischen oder dramatischen Segment, den kleinen Bildern aus dem großen Bild. Sie sind möglich, und es gibt sie. Doch auch hier steht Kunst, die sich breitmacht, dem Ziel im Weg. Das Ziel liegt hinter unserem Rücken, wie Sodom und Gomorrha, als Lots Weib sich umwandte. Wir müssen zurückblicken, ohne zu erstarren. Wir müssen der Vergangenheit ins Gesicht sehen. Es ist ein Medusengesicht, und wir sind ein vergessliches Volk. Kunst? Medusen schminkt man nicht.
Die Nation müsse die Vergangenheit bewältigen, heißt es. Wir sollen bewältigen, was wir vergessen haben? Das klingt nach leerer Predigt. Und die Jugend soll bewältigen, was sie nicht erlebt hat und nicht erfährt? Man sagt, sie erfahre es. Wenn nicht zu Hause, dann in der Schule. Die Lehrer, sagt man, schreckten vor dem schlimmen Thema nicht zurück, wenn auch nur die politisch unbescholtenen. Die Zurückhaltung der anderen, hat einer unserer Kultusminister gesagt, sei begreiflich. Aber bedenklich, hat er gesagt, sei das nicht. Denn sie träten demnächst, soweit sie vorher nicht stürben, in den Ruhestand. Und dann stünden weder sie noch sonst ein Hindernis dem regulären Unterricht in Zeitgeschichte im Weg. Weil ihre Nachfolger zu Hitlers Lebzeiten noch kleine Kinder gewesen und schon deshalb unbescholten seien. Hat er gesagt. Wie sie, ohne selber angemessen unterrichtet worden zu sein, die nächste Generation angemessen unterrichten sollen, das hat er nicht gesagt.
Was nicht gut ist, hat einen Vorzug: Es kann besser werden. Die Historiker sind nicht müßig. Die Dokumente werden gesammelt und ausgewertet. Das Gesamtbild wird für den Rückblick freigelegt. Bald kann die Vergangenheit besichtigt werden. Auch von Schulklassen. Man wird zeigen und sehen können, wie es gekommen und gewesen ist. Doch das Lesen in der großen, in der Großen Chronik darf nicht alles sein. Sie nennt Zahlen und zieht Bilanzen, das ist ihre Aufgabe. Sie verbürgt die Zahlen und verbirgt den Menschen, das ist ihre Grenze. Sie meldet, was im großen Ganzen geschah. Doch dieses Ganze ist nur die Hälfte.
Lebten und starben denn Zahlen? Waren die Reihen jüdischer Mütter, die ihre weinenden Kinder trösteten, während man sie auf polnischen Marktplätzen in deutsche Maschinengewehre trieb, Zahlenketten? Und war der SS-Scharführer, den man danach ins Irrenhaus bringen musste, eine Ziffer?
Die Menschen wurden wie vierteilige Zahlen auf die schwarze Tafel geschrieben und, Schwamm darüber, ausgelöscht. In der Großen Chronik ist für sie alle Platz, doch nur für alle miteinander. Der Einzelne kommt darin nicht vor. Er hat hier so wenig zu suchen wie auf dem Schulglobus meine kleine Tanne hinterm Haus. Man findet ihn in anderen Büchern. Wer in sie hineinblickt, starrt durch kein Teleskop, in kein Mikroskop und auf keinen Röntgenschirm. Das bloße Auge genügt. Bruchteile der Vergangenheit zeigen sich im Maßstab 1:1. Sie wird anschaulich. Der Mensch wird sichtbar. Er erscheint in natürlicher Größe. Er wirkt nicht sonderlich groß? Nein. Nicht einmal aus der Nähe. Gerade aus der Nähe nicht.
Tagebücher präsentieren gewesenes Präsens. Nicht als Bestandsaufnahme, sondern in Momentaufnahmen. Nicht im Überblick, sondern durch Einblicke. Tagebücher enthalten Anschauungsmaterial, Amateurfotos in Notizformat, Szenen, die der Zufall arrangierte, Schnappschüsse aus der Vergangenheit, als sie noch Gegenwart hieß.
Jene Vergangenheit, die unbewältigte, gleicht einem ruhelosen Gespenst, das durch unsere Tage und Träume irrt und, nach uraltem Geisterbrauch, darauf wartet, dass wir es anblicken, anreden und anhören. Dass wir, zu Tode erschrocken, die Schlafmütze über die Augen und Ohren ziehen, hilft nichts. Es ist die falsche Methode. Sie hilft weder dem Gespenst noch uns. Es bleibt uns nicht erspart, ihm ins Gesicht zu sehen und zu sagen: »Sprich!« Die Vergangenheit muss reden, und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden.
In dem Regal, wo meine Tagebücher aus jener Zeit stehen, ist noch Platz. Ich stelle mein Buch neben die andern.
Frühjahr 1961
Erich Kästner
Berlin
7. Februar bis 9. März
Aus der Chronik
4. bis 11. Februar
Konferenz in Jalta zwischen Roosevelt, Stalin und Churchill. Zitat aus der Schlusserklärung: »Wir sind entschlossen, den deutschen Generalstab ein für allemal zu zerschlagen, der immer wieder Mittel und Wege zur Wiedererstarkung des deutschen Militarismus gefunden hat … Erst nach der Ausrottung des Nazitums und des Militarismus wird Hoffnung auf ein anständiges Leben für Deutsche bestehen und auf einen Platz für sie in der Gemeinschaft der Nationen.«
13. Februar
Zerstörung Dresdens durch amerikanische und englische Bombenflugzeuge. Budapest kapituliert vor der russischen Armee.
17. Februar
Großer Luftangriff auf Tokio.
21. Februar
Beginn der Interamerikanischen Konferenz in Mexiko City. Die USA schlagen für Nord- und Südamerika eine gemeinsame Wirtschaftscharta vor.
23. Februar
Die Türkei erklärt Deutschland den Krieg.
5. März
Die deutsche Wehrmacht zieht den Jahrgang 1929, die Sechzehnjährigen, ein.
7. März
Die Amerikaner überschreiten bei Remagen den Rhein.
8. März
Tito wird mit der jugoslawischen Regierungsbildung beauftragt.
Berlin, 7.Februar 1945
Wir waren wieder ein paar Tage in L. an der Havel, und es ging, wie fast jedes Mal, hoch her. Textilkaufleuten verwehrt das Schicksal, Not zu leiden. Da hilft kein Sträuben. Man trägt ihnen, nach Einbruch der Dunkelheit, das Notwendige samt dem Überflüssigen korbweise ins Haus. Man drängt ihnen auf, was es nicht gibt. Bei Nacht kommen nicht nur die Diebe, sondern auch die Lieferanten. Sie bringen Butter, Kaffee und Kognak, weiße Semmeln und Würste, Sekt und Wein und Schweinebraten, und sie brächten den Kreisleiter der NSDAP, wenn er essbar wäre. Karl honoriert so viel Mannesmut und Hilfsbereitschaft mit Kostüm- und Anzugstoffen, und dann ruft er, vom Berliner Geschäft aus, ein Dutzend Freunde und Bekannte an. »Kommt doch am Sonntag für eine halbe Woche aufs Land! Abgemacht? Wir freuen uns!«
Der Gastgeber freut sich. Die Gäste freuen sich. Die Freude ist allgemein. Man lacht und tafelt in einem Landhaus an der Havel, und die russischen Panzer stehen, bei Frankfurt und Küstrin, an der Oder. Man trinkt Sekt und tanzt, und noch gestern saßen wir, in Charlottenburg und Wilmersdorf, im Keller, während zwölfhundert Flugzeuge ihre Bomben ausklinkten. Man raucht Importen und pokert, und ringsum ziehen die Trecks, auf der Flucht aus dem Osten, ins Ungewisse. Man verkleidet und maskiert sich und improvisiert Kabarettszenen, und nicht weit von hier, in Brandenburg und Oranienburg, beginnen die Häftlinge zu hoffen und die Lagerkommandanten zu zittern. Manchmal treten wir, noch halb maskiert und mit vollen Gläsern in der Hand, aus dem Haus ins Dunkel und betrachten, gegen Potsdam hin, die langsam und lautlos sinkenden feindlichen Leuchtkugeln und glitzernden Christbäume. Neulich sagte ich, als wir so am Ufer standen: »Es ist, als komme man ins Kino und der Film habe schon angefangen.« Da ließ eine Frau die Taschenlampe kurz aufblitzen und fragte geschäftig: »Darf ich, bitte, Ihre Eintrittskarten sehen? Was haben Sie für Plätze?« »Natürlich Loge«, antwortete Karl, »Mittel-Loge, erste Reihe!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!