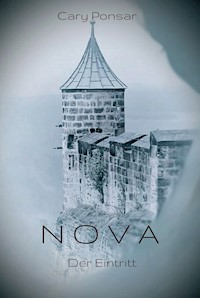
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KAPITELWERK
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nova
- Sprache: Deutsch
Mitten in Frankfurt wird eine junge Frau nach einem feuchtfröhlichen Abend entführt. Als sie wieder zu sich kommt, findet sie sich im kleinen hessischen Ort Büdingen im Jahre 1621 wieder. Im Deutschen Reich tobt der 30 jährige Krieg und das Land ist gespalten zwischen Katholiken und Protestanten. Sie trifft auf zwei junge Männer mit demselben Schicksal. Gemeinsam mit ihnen wird sie festgenommen und auf die Rohnburg gebracht. Dort wird klar, dass es noch einen geheimnisvollen Vierten im Bunde gibt. Dieser befindet sich auf seinem persönlichen Rachefeldzug und hat bereits begonnen, nach der Macht zu greifen. Nicht nur im Jahr 1621, auch aus der bisherigen Gegenwart droht den Vieren Gefahr. Verzweifelt machen sie sich auf, um nach einer Möglichkeit zur Flucht zu suchen und versuchen gleichzeitig, in diesem unbekannten Zeitalter zu überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cary Ponsar
N O V A
Der Eintritt
© 2020 Cary Ponsar
Verlag. KAPITELWERK
Cary Ponsar
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
ISBN
Paperback: 978-3-9822674-3-2
Hardcover: 978-3-9822674-4-9
e-book: 978-3-9822674-5-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bereits bei KAPITELWERK erschienen:
Hör, wie sie schreien (© 2020 Cary Ponsar)
Durch Raum und Zeit,
dem Tod geweiht.
Okay. Womit soll ich anfangen?
Genial, schon die erste Zeile macht mir Probleme. Das kann ja heiter werden. Vielleicht beginnen wir erst einmal mit den Fakten. Fakten sind immer gut.
Heute ist Dienstag, der 11. November 2014, es regnet und mir ist kalt. Was gibt es sonst zu sagen? Vielleicht mal ein paar Infos über mich.
Name? Victoria, aber Vicky ist mir lieber.
Alter? Geboren am 6. November 1991. Vor fünf Tagen dreiundzwanzig Jahre alt geworden.
Wohnort? Geboren in Mainz, wohnhaft in Frankfurt am Main.
Beruf? Super, da haben wir den Salat.
Wieso ich hier im Schlafanzug vor meinem Laptop auf der Couch sitze, während doch eigentlich eine ganze Reihe herrlich primitiver Sendungen zur besten Sendezeit eine willkommene Ablenkung bieten würden? Weil ich verzweifelt bin.
Ich, Vicky Bender aus Frankfurt, bin dreiundzwanzig Jahre alt und habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Super, das klingt nach einer guten Einleitung.
Ich habe mein Abi vor mehr als drei Jahren mehr schlecht als recht bestanden und verplempere seitdem meine Zeit mit Aushilfsjobs. Von Kellnern über Regale einsortieren, Akten in einer Anwaltskanzlei sortieren und eine Millionen Kopien in einem Reisebüro anfertigen, war wirklich alles dabei. Hey, so hatte ich ein bisschen Geld und lag dem deutschen Staat wenigstens nicht auf der Tasche.
Und jetzt? Wir haben, wie schon geschrieben, den 11. November 2014 und seit etwa sechs Wochen bin ich eingeschriebene Studentin im Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Frankfurt. Seitdem will ich mich erhängen.
Es ist nicht so, dass ich dumm wäre. Gut, die Tochter von Einstein bin ich auch nicht gerade. Ich habe mich nur vollkommen darauf verlassen, nach dem Abi plötzlich eine Art Geistesblitz zu bekommen oder eine Vision zu haben, wie meine Zukunft verlaufen soll und was ich wirklich machen möchte. Schon fast witzig, dass sich jemand wie ich, der so unglaublich schlecht in Mathe ist, für BWL eingeschrieben hat.
Daran Schuld ist wohl meine krampfhafte Sehnsucht danach, endlich die Anerkennung meines Vaters zu bekommen. Zumindest ist das die These meiner besten Freundin Annabelle. Vielleicht bin ich von Natur aus auch einfach depressiv veranlagt. Meine Eltern waren noch sehr jung, als ich geboren wurde. Sie haben sich scheiden lassen, als ich vier war.
Da meine Mutter Charlotte eigentlich keine Lust auf eigene Kinder hatte, reist sie seit der Scheidung als Entwicklungshelferin durch Afrika und hilft armen, abgemagerten Kindern. Klingt das etwa verbittert? Das soll es nicht.
Es ist schön, dass sie in ihrem Beruf aufgeht. Wenn überhaupt bin ich wohl neidisch. Ich bin jedenfalls hauptsächlich bei meiner Großmutter aufgewachsen. Meine coole Oma Hilde ist so eine Art alte Version von Annabelle. Mit ihren mittlerweile achtundsechzig Jahren sieht sie noch verdammt gut aus und ist die Emanzipation in Person. Ich liebe diese verrückte, rothaarige Frau mit ihren Sprüchen, wie „Was dich nicht umbringt, macht dich härter“ oder „Nur die Harten kommen in den Garten“, und ihren einhundert knallbunten Parkas über alles!
Mein Vater hat seinen Traum ebenfalls erst nach der Scheidung verwirklicht. Er ist Manager bei irgendeiner GmbH in Düsseldorf, einer Agentur, die im internationalen Marketing tätig ist. Sein Traum beinhaltete außerdem, dass er nochmal geheiratet und mit seiner zweiten Frau Margot vor neun Jahren einen Sohn bekommen hat.
Ich liebe Lukas, meinen Halbbruder, wirklich, aber manchmal frustrieren mich diese kleinen Alltagssituationen, in denen er für ihn der perfekte, anwesende Vater ist. Für mich hat er sich nie hingekniet, damit ich ihm abends in die Arme springen konnte. Mich hat er nicht beim Abendessen gefragt, wie mein Tag war. Meine Schulfreunde kannte er nicht wirklich und welche Namen ich meinen Kuscheltieren gegeben hatte, davon hatte er auch keine Ahnung. Bernhard hat sich immer bemüht, aber da ich ihn meistens nur alle vierzehn Tage sah, blieb er für mich eben Bernhard. Trotzdem hat er etwas mit diesem Bericht zu tun, an dem ich gerade sitze. Als ich letzte Woche zu Besuch bei ihm in Düsseldorf war, hat er mir geraten, doch einfach mal aufzuschreiben, was mich so nervt und „welche zahlreichen Optionen“ ich doch hätte. Pro und Contra. Also, auf los geht’s los.
Ich kann sehr gut zeichnen! Und fotografieren! Aber mal ehrlich, im Vergleich zu diesen ganzen „wirklich Begabten“, von denen ich am Tag der offenen Tür an einer Frankfurter Kunsthochschule umgeben war, gleichen meine Fähigkeiten dann doch eher jemandem, dessen Hände mehrfach gebrochen wurden. Frustrierend. Ich bin schlecht im Umgang mit Zahlen, ekel mich vor sehr vielem, kann nicht lange stillsitzen, bin sehr schusselig und mag eigentlich weder alte Leute noch kleine Kinder. Wer hat einen Job für mich?
Wo ich das Wort ‚Kinder‘ erwähne, könnte ich noch hinzufügen, dass meine dreijährige Beziehung pünktlich zum Studienbeginn in die Brüche gegangen ist. Über Weinkrämpfe bin ich zwar hinweg, aber ich vermisse Roman trotzdem ziemlich. Er ist vor ein paar Wochen mit seinem Marketingstudium fertig geworden (Männer im Marketing, die ich vermisse-Vielleicht ist an Annabelles Vermutung doch irgendwas dran?) und hat sich entschieden, ein Jobangebot aus Paris anzunehmen. Bei dieser Chance stand ich, die Freundin ohne Perspektiven, natürlich im Weg. Naja, was solls. Wir haben uns immer super verstanden, aber es war nicht diese Art von Liebe, bei der du für den Anderen ohne nachzudenken von einer Brücke springen würdest. Trotzdem hoffe ich, er fällt von einer solchen runter und ersäuft in der Seine!
Nachdem Vicky den letzten Satz getippt hatte, musste sie grinsen. Der Text klang so herrlich deprimiert, hiernach würde selbst ihre Stiefmama und Paartherapeutin Margot anfangen zu weinen. Aber so war es. Wozu Glitzer über Kacke streuen. Es blieb trotzdem Kacke.
So, genug über ihre momentane Krise geschrieben. Jetzt würde sie sich den restlichen Abend einer herrlich primitiven Sendung hingeben, bei der ihr Gehirn entspannen konnte und irgendwann tief und fest auf dem Sofa einschlafen. Morgen war auch noch ein Tag, um sich Sorgen über ihre Zukunft zu machen.
Sie hatte noch keine Ahnung, ob sie die Gedankengänge über ihre Situation am Laptop fortsetzen würde und ob der Rat ihres Vaters überhaupt etwas bringen würde. Dass sie allerdings zum letzten Mal in ihrem Leben „Speichern“ klicken würde, hätte sie sich in ihren depressivsten Träumen nicht ausgemalt.
Kapitel 1
Bereits als Kind hatte es von Gabrielas Vater in Polen Schläge für sie und ihre Geschwister gehagelt, wenn sie unnötig viel von sich gegeben hatten. „Provokante Gören!“ hatte ihr alter Herr dann immer gerufen, bevor er explodiert war. Diese Erlebnisse hatten sie geprägt und als sie sich dazu entschloss, Krankenschwester zu werden, behielt sie alte Gewohnheiten bei.
Ja, sie pflegte gerne Menschen und unterhielt sich auch mit ihnen über Gott und die Welt, doch zu viel über die Patienten und ihre tragischen Hintergründe oder Schicksale zu erfahren – Das tat oftmals weh und es führte zu dem, was Gabriela am Wenigsten wollte: Sich Probleme mit nach Hause zu nehmen. Dort wollte sie stets ihre Ruhe haben und die Abende mit ihren beiden Schwestern und deren Familien in Frieden genießen. Sie alle wohnten jahrelang im selben Haus, es gab jede Menge Platz und Gabriela konnte sich so jederzeit mit ihren Neffen und Nichten beschäftigen.
Sie selbst hatte keine Kinder. Weshalb, dass wusste nur Gott allein. Gabriela war nicht hässlich und hatte auch schon zwei längere Beziehungen gehabt – Keine davon hatte jedoch lange genug gehalten, um sich zu etwas wirklich Ernsthaften zu entwickeln.
Nun war sie achtunddreißig und hatte akzeptiert, dass sie eine großartige Tante war und dass Mutter-Sein keinen Platz mehr in ihrem Leben haben würde.
Vor knapp einem Jahr hatte sie den Entschluss gefasst, als Krankenschwester nach Deutschland zu kommen, um jeden Cent zu sparen und irgendwann mit genug Geld nach Polen zurückzukehren. Die Arbeit am privaten Luminas Klinikum in Frankfurt gefiel ihr, man bezahlte sie gut und Gabriela hatte es dank der hervorragenden Zuganbindung nicht weit von ihrem kleinen, gemieteten Apartment zur Arbeit. Hier half ihr die Sprachbarriere sogar bei ihrem Vorhaben, ihre Nase bloß nicht in Dinge zu stecken, die sie nichts angingen.
An diesem Morgen regnete es in Strömen und nachdem sie von der Bushaltestelle zum Eingang des Klinikums gerannt war, fluchte Gabriela und war froh, dass sie noch ein paar Minuten bis zum Schichtbeginn Zeit hatte. So konnte sie sich wenigstens noch schnell die Haare föhnen. Anschließend griff sie im Personalraum ihre weiße Dienstkleidung und ihre Schuhe, zog sich in der kleinen Kabine um und hörte, wie Paulina den Raum betrat. Sie war ebenfalls Polin und wohnte mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern in der Nähe des Frankfurter Flughafens.
„Guten Morgen! Ausgeschlafen? Du siehst ziemlich geschafft aus!“ begrüßte Gabriela sie.
„Ach nein, es ist nur alles zu viel im Moment. Zwar hat Johannes die Kleinen heute gebracht, aber die Nacht war furchtbar! Und dann musste ich auch noch schnell im Altersheim vorbei, weil seine Mutter sich mal wieder geweigert hat, ihre Tabletten zu nehmen und den Laden auseinandergenommen hat. Dazu nun auch noch beginnende Migräne. Ich bin wirklich fertig,“ stöhnte Paulina und ließ den Kopf auf die abgenutzte Tischplatte des Aufenthaltsraums sinken.
„Dann geh doch nach Hause!“ schlug Gabriela vor und tätschelte ihr die Schulter. „Simone und Nicole sind doch auch eingeteilt, also sind wir hier zu dritt. „Los, ruh dich aus! Es ist Mittwoch und soweit ich weiß, hast du sowieso nun zwei Tage frei. Also, leg dich ins Bett und sag deinem Mann, das nächste Mal soll er sich um seine senile Mama kümmern!“
„Du bist ein Schatz,“ sagte Paulina und verschwand, ehe sie es sich anders überlegen konnte.
Der Vormittag verlief relativ ruhig und nachdem Gabriela das Frühstück eingesammelt und mehrere Patienten gewaschen hatte, sah sie schon von Weitem Frau Wiese auf sich zueilen. Oh nein, dachte sie und erkannte, dass es zu spät war, um sich schnell in einem Krankenzimmer zu verstecken.
Frau Wiese kam jeden Tag und besuchte ihren Mann, der als Krebspatient im Luminas behandelt wurde. Sie war, genau wie er, Mitte Sechzig und konnte einem, allein durch ihre schrille und penetrante Stimme, den letzten Nerv rauben. Was sie manchmal veranstaltete und von den Pflegekräften erwartete, grenzte schon fast an Tyrannei.
„Sie da! Entschuldigen Sie bitte!“ rief sie und eilte fuchtelnd auf Gabriela zu. „Ich muss mit Dr. Johann sprechen, auf der Stelle! Die Medikamente, die mein Mann erhält, verursachen ihm extreme Übelkeit. Das kann so nicht weitergehen!“
„Frau Wiese, ich verstehe, dass es schwer für Ihren Mann ist, aber es sind genau die richtigen Tabletten, die Dr. Johann ihm verschrieben hat, das versichere ich Ihnen. Wir verabreichen ihm bereits etwas gegen die Übelkeit,“ versuchte, sie die aufgebrachte Frau zu besänftigen.
„Was Sie sagen, geht mir sonst wo vorbei! Sie sind Krankenschwester! Ich will mit Dr. Johann sprechen, sofort! Sonst gehe ich auf der Stelle zur Ärztekammer, zur Presse und zum Papst, wenn es nicht anders geht! Nur weil mein Mann schon achtundsechzig ist, lohnt es sich wohl nicht mehr, ihn richtig zu behandeln, oder wie sehe ich das? Ich bleibe hier stehen, bis Dr. Johann kommt!“
Entnervt erkannte Gabriela, dass es keinen Sinn hatte, vernünftig mit dieser Frau sprechen zu wollen. Da Sie sowieso in ein paar Minuten Pause hatte und wusste, dass Dr. Johann sich ebenfalls auf dem Weg zum Mittagessen befand, beschloss Sie, ihn vorzuwarnen.
Um fit zu bleiben, benutzte sie immer die Treppen in den fünften Stock, auch wenn Sie so nicht direkt vor dem Speisesaal des Personals herauskam, sondern noch die Abteilung durchqueren musste, auf der sich lediglich die Büros des Krankenhauses befanden. Sie lief vorbei an zahlreichen Türen und gerade, als sie fast am Ende des Ganges angekommen war, hörte sie Dr. Johanns Stimme aus einem der Büros. Die Tür war bloß angelehnt, doch Gabriela wollte nicht bei einem wichtigen Gespräch einfach so hereinplatzen.
Gerade als sie die Hand erhoben hatte, um anzuklopfen, hörte sie die Stimme von Stephan Lehn, dem Geschäftsführer von Luminas Deutschland. „Ich habe mit Professor Stevens gesprochen, er ist wieder zurück in Washington. Dort sind alle stinksauer! Sie haben unseren Standort dafür ausgewählt, weil hier die besten arbeiten, zumindest glaubte man das! Wir wollten damit Geschichte schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes! Ja, die gesamte Luminas Gruppe weltweit wollte das, aber wir in Deutschland wollten diejenigen sein, die es bewerkstelligt haben! Was, verdammte Scheiße, sollen wir jetzt machen?“
Gabrielas Hand hielt inne, so sauer hatte sie den charismatischen Brillenträger, der das Image des Krankenhauses in der Öffentlichkeit immer so perfekt vertrat, noch nie gehört. Nun hörte sie die zögerliche Stimme von Professor Lehmann, dem Leiter der hiesigen Forschungsabteilung, die sich hinter zahlreichen Gängen im Untergeschoss befand.
„Ich weiß es einfach nicht! Und Stevens, dieser Lackaffe, sollte den Ball mal ganz flach halten! Er hat uns doch alle gedrängt, mehrere Personen einzusetzen. Ich war dafür, mal ganz klein anzufangen. Aber er wollte ja der große amerikanische Hengst sein, der irgendwann bei CNN sitzt und von dem unfassbaren Durchbruch erzählt, den Luminas erreicht hat – Und dann auch noch ausgerechnet am kleinen, unbedeutenden Standort Deutschland! Dort, wo er selbst nicht ganz so sehr in der Scheiße sitzt, falls etwas schief gehen sollte. Und genau das ist jetzt eingetreten. Er kann seinen Arsch aus der Ferne natürlich perfekt retten!“
„Es ist eine Katastrophe. Ich hätte niemals gedacht, dass er so durchdreht. Ihn haben wir immerhin schon vor sechs Monaten auf Reisen geschickt. Ja, er ist vollkommen durchgeknallt, aber ich dachte, er würde die Situation am ehesten akzeptieren. Seine Daten zeigen ganz genau, dass er immer unberechenbarer wird! Nur bei Geigenmusik und wenn er sich vor diesem Bild befindet, scheint er in eine Art Melancholie zu verfallen. Sehr merkwürdig. Und auf die einzelnen Testphasen zuvor hatte er stets so gut angesprochen,“ seufzte Dr. Vogt, eine Gabriela ziemlich unsympathisch erscheinende Laborärztin Mitte Vierzig, die von den Pflegekräften aufgrund ihrer überdimensional langen Nase insgeheim oft nur „Geier“ genannt wurde.
„Johann, was sagen Sie dazu?“ schnauzte Lehn den Chefarzt der Onkologie an.
„Was ich dazu sage? Sie sind schuld an der ganzen Misere, Sie alle!“ keifte Dr. Johann auf eine Art und Weise, wie Gabriela es noch nie von dem sonst immer ruhigen, gelassenen Arzt gehört hatte. „Sie schimpfen sich Wissenschaftler, doch was Sie da tun, ist nicht nur unethisch und verstößt so ziemlich gegen jedes Gesetz, es ist eine Katastrophe! Wenn das ans Licht kommt, dann gute Nacht! Wissen Sie eigentlich, was er alles anrichten kann? Was jedes Ihrer kleinen Versuchskaninchen anrichten kann? Das IST bereits ein Weltuntergang! Hätten Sie mich bloß nicht um meinen Rat bezüglich des verdammten Hirntumors gefragt, ich wünschte, ich hätte nie von Nova erfahren!“
„Nun beruhigen wir uns alle! Morgen früh ist eine Telefonkonferenz mit Washington und Dublin angesetzt. Wenn die Mehrheit dafür stimmt, werden die restlichen Probanden unschädlich gemacht. Dann war eben alles ein gewaltiger Griff ins Klo. Aber offenbar haben die beiden anderen Personen sein Schlupfloch aus der ganzen Sache heraus ja noch nicht entdeckt. Und was ihn angeht,“ versuchte Stephan Lehn die Anwesenden zu beruhigen, „was sollte er schon groß anstellen? So helle ist er nicht und im besten Fall wird er für irgendetwas gehängt, wodurch sich alle Probleme in Luft aufgelöst hätten.“
Gabriela hatte genug gehört. Vollkommen verwirrt zog sie sich leise zurück und lief den Flur in die entgegengesetzte Richtung zurück auf ihre Station. Was um Gottes Willen war hier los? Die Ärzte schienen Panik vor irgendetwas zu haben. War eine Versuchsreihe schief gegangen? Wenn ja, was wurde dort bitte untersucht? Sje wusste, dass der gesamte Luminas Konzern sehr viel in die Forschung investierte und dass es, neben einigen reinen Krankenhäusern, auch mehrere wissenschaftliche Standorte gab.
Worte wie „unschädlich machen“ oder „gehängt werden“ hallten in ihrem Kopf nach und ihr lief ein Schauer über den Rücken. Was für einen Begriff hatte Dr. Johann verwendet? 'Nova'? War das der Name des Projekts? Hätte sie doch bloß nichts gehört!
Gabriela war froh bei diesem Unternehmen angestellt worden zu sein, die Forschungsabteilungen aller Luminas-Standorte, wovon es drei in den USA, zwei in Irland und eines hier in Frankfurt gab, waren hoch angesehen für ihre Erkenntnisse der letzten Jahre, besonders im Bereich der Krebsforschung und neuer Behandlungsmöglichkeiten. Aber das, was offenbar Panik bei den Bossen verursachte, klang illegal und höchst gefährlich.
Sie hatte einen dicken Kloß im Hals, als sie die Schwingtür zu ihrer Station aufstieß und versuchte, sich wieder zu beruhigen. Als Frau Wiese erneut auf sie zustürmte und auf sie ein plapperte, nahm sie kein Wort davon wahr, sagte ihr lediglich, sie hätte zu tun und knallte der perplexen Dame die Tür des Personalraums vor der Nase zu.
Kapitel 2
Vicky erwachte, vollkommen in ihrer Decke verknotet, und blinzelte vom Sofa aus ins helle Sonnenlicht, welches ihr im ersten Moment schmerzhaft in den Augen brannte. Oma Hilde war gerade dabei, die Rollläden schwungvoll nach oben zu ziehen und flötete: „Hallo Langschläfer! Hast du mal wieder den Weg in dein Bett nicht gefunden? Student müsste man nochmal sein!“
„Oma,“ stöhnte Vicky und zog sich die Decke über den Kopf. „Wie spät ist es?“
„Halb zehn,“ sagte die ältere Frau mit den knallroten, in die Höhe toupierten Haaren. „Und du hast mir gestern noch erzählt, dass du dich heute Vormittag mit Annabelle und den anderen verabredet hast.“ Sie blickte auf Vickys Laptop, der wohl irgendwann in der Nacht vom Sofa auf den Teppich gerutscht sein musste. „Was hat dich denn so lange wachgehalten? Hast du Bernhards Rat befolgt und dir mal deinen ganzen Frust von der Seele geschrieben? Du weißt, dass du auch jederzeit mit mir darüber reden kannst? Nicht jeder ist so verkorkst wie er und hält das Aufschreiben seiner Gefühle für sinnvoller, als mit jemandem über sie zu sprechen.“
Hilde unterbrach sich und musterte sie nachdenklich. „Deine Mutter hat übrigens angerufen.“
„Aha,“ sagte Vicky und blickte auf das Display ihres Handys.
„Ich soll dir einen Kuss geben und sagen, dass sie sich sehr auf Weihnachten freut. Vielleicht schafft sie es sogar, schon Mitte Dezember zu kommen.“
Als das Mädchen nicht antwortete und anscheinend bemüht war, Desinteresse zu bekunden, seufzte Hilde und sagte: „Wie auch immer, jedenfalls bin ich für dich da, mein Schatz,“ lächelte sie und küsste Vicky, die es gerade geschafft hatte, sich aufrecht hinzusetzen, schwungvoll auf die Wange.
„Oh nein, Oma,“ stöhnte sie, als ihr Blick in den Spiegel an der gegenüberliegenden Wand fiel. „Nicht schon wieder, wann kaufst du dir endlich kussechten Lippenstift?“ rief sie und versuchte vergeblich, sich den perfekten, knallroten Lippenabdruck auf der Backe wegzuwischen.
„Wenn der geeignete Mann in Sicht kommt, der diese Ausgabe wert wäre,“ trällerte Hilde aus dem Flur. „Jetzt gehe ich erst einmal mit Dieter zum Brunch. Wer weiß, vielleicht gehe ich ja nachher nochmal in die Drogerie,“ grinste sie und verschwand mit einem „Hab dich lieb!“.
Vicky ließ sich zurück aufs Sofa fallen, doch nach ein paar Minuten sah sie ein, dass sie wirklich aufstehen musste. Schnell machte sie sich ein Müsli und nahm die Schüssel mit ins Badezimmer, wo sie eine Zigarette rauchte, was Oma Hilde sicherlich wieder auf die Palme bringen würde und gleichzeitig versuchte, die Reste ihres Mascaras aus der beinahe leeren Hülle zu kratzen.
Nachdem sie geduscht und sich die Zähne geputzt hatte, wischte sie über den beschlagenen Spiegel und betrachtete sich darin. Ihre braunen, müden Augen starrten ausdruckslos zurück und Vicky beschloss, dass es doch noch etwas Eyeliner sein müsste. Anschließend band sie sich ihre lockigen, hellbraunen Haare zu einem Dutt zusammen, denn fürs Haare glätten fehlte ihr nun wirklich die Zeit. Zum Glück hatte sie noch genug saubere Sachen im Schrank und nach einigem Umziehen hatte sie sich dann endlich für ihre blaue Lieblingsjeans und einen pinken Pullover mit V-Ausschnitt entschieden.
Vicky eilte die Treppen runter, schnappte sich ihren beigen Wintermantel, die warmen Stiefel und ihren braunen Schal, während sie gleichzeitig eine Nachricht an Annabelle schrieb, dass sie in etwa zwanzig Minuten da sein würde.
Nachdem sie aus dem Bus gestiegen war, betrat Vicky das kleine Café im Frankfurter Stadtteil Bornheim um Punkt 11 Uhr. Es war klein, gemütlich und dunkel und außer Annabelle und Jenny saßen nur noch ein paar ältere Leute an den runden Tischen. Hier trafen sie sich am liebsten, man hatte seine Ruhe und konnte hier, im Gegensatz zu so fast jedem anderen Frankfurter Café, sogar noch rauchen.
„Hey!“ Annabelle sprang auf und umarmte sie. „Wie findest du es?“ fragte sie und schüttelte ihre langen Haare, die nun mal wieder platinblond erstrahlten.
„Wow, hast du gar nicht erzählt! Sieht echt gut aus!“ Vicky fuhr ihr durchs Haar und küsste Jenny auf die Wange. „Noch irgendwas, das ich wissen müsste?!“
Jenny lachte und band ihre dunklen Haare zusammen.
„Naja, es kommen wohl achtzehn Leute sicher und wir haben schon alles geplant. Wir holen Laura um 21 Uhr in ihrer Wohnung ab und fahren dann nach Sachsenhausen. Ich fahre, auf Euch ist ja sonst kein Verlass! In der ersten Bar warten dann sechs Leute auf sie, schreien 'Überraschung!' und sie wird es für eine süße, kleine Begrüßung halten. Um 22 Uhr geht es dann weiter in Bar Nummer Zwei, wo die nächsten sechs Leute sie überraschen. Und um 23 Uhr laufen wir alle zusammen in den Pub, dort sind dann die letzten sechs und je nachdem, wie nüchtern Laura dann noch ist, wird sie sehen, wie froh alle sind, dass sie wieder da ist. Die Tische sind reserviert und wir haben schon eine Menge vorbestellt. Du musst also bloß pünktlich mit uns bei ihr auftauchen.“
„Das wird der Wahnsinn, immerhin erwartet sie eigentlich überhaupt nichts,“ lachte Annabelle. Laura war ein halbes Jahr als Praktikantin an einer Schule in Argentinien gewesen und gestern erst von ihrer Familie am Frankfurter Flughafen empfangen worden. Seit Tagen hatten die Freundinnen herumtelefoniert und geplant, denn sie alle hatten ihre italienische Kindergartenfreundin wirklich vermisst.
Vicky bestellte sich einen Cappuccino und meinte: „Super! Vielleicht kommt Hilde sogar noch vorbei.“ Alle lachten, denn Vickys Oma war der Knaller auf jeder Party.
„Wer hat denn jetzt fest zugesagt?““
Während Annabelle alle Namen aufzählte und Jenny zu fast jedem der Leute einen witzigen Spruch brachte, zündete Vicky sich lachend eine Zigarette an, nippte an ihrer Tasse und wünschte sich, die Zeit möge einfach stillstehen.
Einige Stunden später war es endlich soweit. Die Uhr an Vickys Handgelenk zeigte an, dass es mittlerweile 22:50 Uhr war. Gerade hatte die Gruppe von mittlerweile doch fünfzehn Leuten die zweite Bar verlassen und war auf dem Weg zu einem großen Pub in Sachsenhausen. Die Einzige, die noch voller war als Vicky selbst, war Laura, die Hauptperson. Sie lief vorneweg und musste hin und wieder von den anderen eingesammelt werden, wenn sie mal wieder andere Betrunkene umarmen wollte.
Vicky fühlte sich gut. Nach Ewigkeiten hatte sie sich für eine schwarze, knallenge Jeans und ein beiges, tief ausgeschnittenes Oberteil mit Strass-Steinen und transparenten Ärmeln entschieden. Ihre Haare hatte sie mit einem Lockenstab nochmals in Szene gesetzt und die große Kette um ihren Hals bestand aus fünf riesigen, silbernen Blumen. Nüchtern hatte sie normalerweise Probleme, gerade auf ihren schwarzen High Heels zu laufen, doch betrunken war es komischerweise ganz einfach.
Der Abend lief perfekt, alle einzelnen Überraschungen hatten wie am Schnürchen funktioniert und neben Sekt und Bier hatte Vicky schon einige Cocktails und Kurze intus.
Sie hatte sich bei Annabelle eingehakt und unterhielt sich lauthals über die Schulter mit Steffen, Jennys Bruder und dem schwulsten Homosexuellen, den man sich nur vorstellen konnte.
„Natürlich wirst du vor mir jemanden abschleppen,“ lallte sie. „Durch dein pinkes Neon-Shirt sehen die Jungs ja auch nichts anderes mehr!“ beide lachten und stießen mit ihrem Bier an. Als sie den Pub betraten, drehte Annabelle sich zu ihr um. „Eine Sache sollte ich dir vielleicht noch sagen. Es tut mir wirklich leid, dass ich es vorher nicht getan habe, aber ich schwöre dir, dass ich es in der ganzen Aufregung vergessen habe.“ Vicky versuchte, ihre Freundin so misstrauisch wie möglich anzuschauen, musste dabei aber lachen, als sie ihr Gesicht in dem dreckigen Spiegel an der Wand sah. „Was ist los?“
„Es könnte sein, dass Roman hier ist.“ Annabelle biss sich auf die Lippe und drückte ihr schnell eines der Gläser in die Hand, die schon an der Theke platziert worden waren. Während um sie herum zum dritten Mal an diesem Abend lauthals „Überraschung!“ geschrien wurde und Laura erneut anfing zu jubeln, sah Vicky sie deprimiert an. „Im Ernst?“
„Ja. Ich habe es selbst erst heute Morgen von Steffen gehört, ich wusste nicht einmal, dass er schon wieder bei seinen Eltern ist,“ rechtfertigte Annabelle sich. „Aber es ist so ein schöner Abend und du bist doch mittlerweile darüber hinweg. Bitte sei nicht sauer, du musst ja nicht mit ihm reden.“ Sie umarmte ihre Freundin und lallte ihr ins Ohr: „Außerdem bist du total voll, und eigentlich ist es dir egal, oder?“
Einen Moment lang blickten sie sich ernst in die Augen, dann fingen beide lauthals an zu lachen.
„Du hast ja recht,“ gab Vicky zu. Genau in diesem Moment sah sie Roman durch die Menschenmenge hindurch genau ins Gesicht und ihre Blicke trafen sich. Mist, er sah noch heißer aus als vor ein paar Wochen. Seine braunen Haare waren perfekt gestylt und er sah sie mit diesem nachdenklichen Hundeblick an, bei dem sie ihn am liebsten in den Arm genommen hätte. „Trotzdem brauche ich für das Ganze hier noch einen Drink,“ murmelte Vicky schnell, duckte sich und eilte auf die Bar zu. Als sie versuchte, die dortige Getränkekarte zu lesen, bemerkte sie, wie betrunken sie wirklich war. Frustriert hielt sie sich ein Auge zu und versuchte, die kleine Schrift mit nur einem Auge zu entziffern.
„Brauchen Sie Hilfe?“ fragte eine Stimme neben ihr und während sie sich immer noch ein Auge zuhielt, drehte sie den Kopf in Richtung des Fremden, der lässig auf seinem Barhocker saß.
Der Mann hatte kurze, dunkle Haare und war vermutlich Mitte Vierzig. Er trug eine Brille mit dickem, schwarzen Rand und sah aus, als hätte er sich heute noch nicht rasiert. Sein Hemd war zerknittert und sie hätte ihn sich eigentlich eher in einem Anzug, als leger in Jeans vorstellen können.
Vor ihm auf dem Tresen standen eine Reihe leerer Longdrink Gläser und er hatte sich selbst noch nicht in ihre Richtung gewandt, sondern blickte frustriert ins Leere. Offensichtlich hat da jemand einen beschissenen Abend, dachte sie und versuchte, möglichst nüchtern zu klingen. „Na ja, ich habe meine Brille vergessen,“ log sie und kicherte.
Der Mann hob den Kopf und in dem Moment, als er sie ansah, stieß er erschrocken sein halbvolles Glas um. „Das gibt’s doch nicht!“
Vicky sah ihn verständnislos an und fragte: „Was?“ In dem Moment fiel ihr auf, dass sie sich noch immer ein Auge zuhielt und beeilte sich verlegen, ihre Hand herunter zu nehmen. „Ich… Es tut mir leid, ich habe Sie offensichtlich verwechselt. Aber Sie haben große Ähnlichkeit mit jemandem, den ich sozusagen bildlich vor Augen habe,“ erklärte der aufgeregte Mann.
Plötzlich bemerkte Vicky, dass Roman sich ebenfalls seinen Weg an die Bar gebahnt hatte und sich nun lediglich noch zwei Mädchen zwischen ihnen befanden. Schnell fuhr sie sich mit der Hand durch ihre Locken und drehte sich nun voll zu ihrem Gesprächspartner. „Könnten Sie mir vielleicht vorlesen, was unter „Cocktails mit Wodka“ so alles aufgelistet ist?“ fragte sie und lächelte.
Ihr Gegenüber musterte sie noch einen Moment lang, grinste dann und meinte: „Ich habe eine bessere Idee.“ Mit diesen Worten nahm er seine schwarze Brille ab und setzte sie Vicky auf die Nase. Beide lachten und bestellten sich schließlich jeder einen Screwdriver.
„Ich bin übrigens Stephan.“ Er streckte ihr seine Hand entgegen. „Stephan Lehn.“
Der Mann erzählte, dass er in der Verwaltung eines Krankenhauses arbeitete und heute einen furchtbaren Tag auf der Arbeit gehabt hätte. Daher sei er anschließend direkt hierhergekommen, um sich sinnlos zu betrinken. Das Mädchen hob erneut die Hand und ließ für beide noch zwei Kurze kommen. Sie erzählte ihm, dass sie im Moment keinen Plan von ihrem Leben hätte und obwohl sie den Mann noch nie in ihrem Leben gesehen hatte, zeigte sie anschließend auf Roman und erklärte ihm, dass dann auch noch ihr verdammter Exfreund aufgetaucht sei und ihr wohl den Abend vermiesen wolle, anstatt doch einfach in Paris an einem Baguette zu ersticken. Als Vicky vor Lachen seitlich von ihrem Stuhl zu rutschen drohte, hielt der Mann sie schnell mit der Hand an ihrer Hüfte fest und murmelte: „Dann lass einfach nicht zu, dass er dir den Abend vermiest! Du bist viel zu hübsch, um einem Jungen wie ihm hinterher zu trauern!“
Vicky drehte den Kopf und blickte ihm direkt ins Gesicht, welches nur noch wenige Zentimeter von ihrem entfernt war. Um Himmels Willen, der Typ könnte ihr Vater sein! Wenn sie es sich recht überlegte, war er wohl sogar wirklich im gleichen Alter wie Bernhard. Und eigentlich stand sie überhaupt nicht auf Brillenträger.
Sie sah sich um und erkannte, dass Jonas eng umschlungen mit irgendeiner blonden Frau in einer Ecke stand. Dieser Mistkerl! Sie wandte sich wieder zum Tresen, trank ihren Shot mit Schwung aus und sagte, ohne groß darüber nachzudenken, in Richtung des Mannes. „Dann zeig mir doch, wie gut er noch werden kann.“
Mit diesen Worten drückte sie ihre Lippen auf seine und er erwiderte ihren Kuss sofort. Ob es gut war, konnte Vicky nicht einmal genau sagen, so betrunken war sie.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Roman entgeistert in ihre Richtung blickte. Oh ja, mein Lieber!
Nach einem Moment zog Stephan seinen Kopf zurück, fasste ihr an die Schulter und flüsterte ihr ins Ohr: „Bitte halt mich nicht für einen Aufreißer, der jeden Abend in einer Bar sitzt und so etwas abzieht. Aber du bist der Wahnsinn. Würdest du,“ er hielt inne und schien sich seine Worte zurecht zu legen. „Würdest du mich noch begleiten wollen?“
Vicky konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen und wollte nur noch, dass Roman sah, wie sie mit einem anderen Mann, der allem Anschein nach keine Aushilfe im Supermarkt war, die Bar verließ. „Klar,“ grinste sie und rutschte mit wackligen Beinen von ihrem Barhocker. Während er seinen Mantel um ihre Schultern legte, überlegte sie einen Moment, ob sie Annabelle oder Jenny Bescheid sagen sollte. Ach, was solls! Die beiden hatten ständig irgendwelche One- Night- Stands und erzählten ihr immer erst im Nachhinein davon. Warum sollte sie nicht auch mal das Flittchen der Gruppe sein?!
Sie verließen den Pub und gingen ein paar Meter die Straße hinunter. „Dort um die Ecke stehen normalerweise die Taxis,“ sagte Stephan und führte Vicky, die nun ernsthafte Probleme hatte, noch gerade zu laufen. „Ich tue so etwas normalerweise nicht, weißt du,“ lallte sie und versuchte, sich mit zitternden Fingern eine Zigarette anzuzünden. Stephan blieb im Schatten einer Hauswand stehen und musterte sie einen Moment lang. „Ich auch nicht,“ sagte er mit plötzlich bedauernd klingendem Unterton.
Vicky sah ihn über ihr Feuerzeug hinweg an, grinste und fragte: „Was ist denn los?“
Der Mann antwortete nicht, trat aber einen Schritt auf sie zu. „Tut mir wirklich leid, Kleine. Aber du bist unsere letzte Hoffnung.“
Ehe sie reagieren konnte, schlug er ihr mit einer solchen Wucht mitten ins Gesicht, dass Vicky mit dem Hinterkopf gegen die Fassade des Hauses knallte und bewusstlos zu Boden sackte.
Kapitel 3
Der breitschultrige Mann drehte sich langsam um und musterte die ältere Frau misstrauisch. Er strich seine Weste glatt und kratzte sich gedankenverloren an seinem stoppeligen Kinn. „Langsam müssten Sie doch genug davon haben. Sie wissen genau, was passiert. Versuchen sie etwa mal wieder, ihren Fehler rückgängig zu machen?“
Die Frau räusperte sich, zögerte einen Moment und sagte dann: „Ihr wisst es ganz genau. So etwas wird ihnen nicht noch einmal passieren. Sie werden ihren Fehler wieder gut machen wollen und suchen offenbar ein letztes Mittel, bevor sie die beiden anderen ebenfalls ausschalten. Euch können sie hier nicht mehr wegholen. Vielleicht versuchen sie daher nun, Euch wenigstens von weiteren verhängnisvollen Gräueltaten abzuhalten. Von mir aus lasst mir die Zunge herausschneiden, aber man wird es schaffen, die Ordnung wiederherzustellen, ob es Euch passt oder nicht!“
Seine Augen, die gedankenverloren das Gemälde von 1524 an der Wand gegenüber betrachtet hatten, verdunkelten sich und seine Augen bedachten die alte Hexe mit einer Mischung aus Wut und grenzenloser Bosheit darin. „Sei einfach still. Ich muss nicht einmal meine Hand heben und schon stehst du auf dem Scheiterhaufen. Nicht, dass es langfristig etwas bringen würde, aber ich genieße es einfach jedes Mal von Neuem. Natürlich können wir es auch mal auf eine andere Art und Weise versuchen,“ murmelte er und seine Hand schnellte blitzschnell nach vorne, wo sie sich mit eiserner Härte um die Kehle der grauhaarigen Frau schloss. „Gleich hier,“ flüsterte er, inzwischen nur etwa eine Handbreit von ihr entfernt.
„Nun denn, verzeiht mir meine Worte,“ keuchte sie mit offensichtlich unterdrückter Wut. „Aber die Wahrheit lässt sich nicht verleugnen und diesmal ist es ein Mädchen,“ presste sie zwischen den Lippen hervor.
Der dunkelhaarige Mann lachte spöttisch auf und raunte ihr ins Ohr: „Glaubst du im Ernst, dass mich das kümmert? Los, verzieh dich!“ Die Frau stolperte nach hinten und atmete tief ein. Sie deutete einen Knicks an und eilte schnell aus dem Zimmer.
Wütend schlug der Mann mit seiner Faust gegen die Wand und wandte sich wieder seinem Lieblingsgemälde zu. Es zeigte eine der wunderschönsten Frauen, die er je gesehen hatte. Sie trug ein langes, rotes Kleid mit weißen Stickereien, ihre hellbraunen, gelockten Haare waren kunstvoll geschmückt und fielen ihr leicht über die Schulter. Sie war umringt von allerlei schemenhaft dargestellten Verehrern, mitten in einem festlich geschmückten Ballsaal. Doch trotz allen Feierlichkeiten um sie herum schien sie nur Augen für den Maler zu haben und es war, als würde ihr Blick genau auf den Betrachter gerichtet sein.
Seufzend wandte er seinen Blick ab. Obwohl ihn dieses Bild aus irgendeinem Grund beruhigte, fasste er in diesem Moment den Entschluss, es verbrennen zu lassen. Seine Feinde schienen etwas Neues geplant zu haben, um ihn zu erledigen. Daher musste sein Augenmerk nun voll und ganz auf Wichtigeres gerichtet bleiben, als auf Frauen, Kunst oder Träumereien.
Kapitel 4
Drei Tage war es her, dass Gabriela zuletzt richtig geschlafen hatte. Seit drei Tagen wälzte sie sich nachts nur noch in ihrem Bett herum. Drei Tage lang hatte sie nun schon Angst, auf die Arbeit zu gehen. Seit drei Tagen wusste sie, dass im Luminas etwas ganz und gar nicht mit rechten und legalen Dingen zuging.
Was passierte dort auf der Forschungsstation und im Labor, was so pikant war, dass selbst die amerikanischen Bosse auftauchten und dass selbst so gelassene und ausgeglichene Menschen wie Dr. Johann oder Professor Lehmann die Nerven verloren?
Wenn es etwas mit selbst finanzierter Forschung zu tun hatte, dann konnte es sich doch im schlimmsten Fall um ein gescheitertes Projekt handeln. So etwas konnte doch passieren und war kein Weltuntergang. Irrtum, Dr. Johann hatte es genau so genannt. Einen Weltuntergang. Also musste etwas verdammt schief gegangen sein. Gefährlich schief. Aber wieso beschäftigte sie das so sehr? Es ging sie nichts an, war sozusagen nicht ihre Baustelle. Ihr Leben lang hatte Gabriela nach diesem Motto gelebt. Doch was, wenn es diesmal wirklich an der Zeit war, sich in etwas einzumischen?
Nachdem sie um 5 Uhr morgens immer noch auf ihren Wecker gestarrt hatte, schwang sie sich aus dem Bett und beschloss, ins Krankenhaus zu fahren. Zwar begann ihre Schicht erst um 10 Uhr am Vormittag, aber so konnte es nicht weitergehen. Sie, die sich sonst aus allem heraushielt, würde sonst noch verrückt werden. Während sie in der Bahn saß, ging sie allerlei mögliche Szenarien durch, die zu dem angehörten Gespräch passen könnten. Doch keines davon schien ihr auch nur ansatzweise logisch.
Um 6:08 betrat sie das helle, moderne Krankenhaus durch den Haupteingang, wandte sich nach links und drückte auf den Fahrstuhlknopf. Als sich die Türen öffneten, zögerte sie noch einen Moment, holte dann tief Luft und drückte auf den Knopf neben dem Buchstaben „U“. Du bist vollkommen wahnsinnig, sagte sie laut zu sich selbst und zuckte zusammen, als der Fahrstuhl ruckelnd stoppte und die Türen zur Seite schwangen.
Hier unten war sie zuvor bereits gewesen, denn zu ihrer Linken befand sich das Labor des Luminas Klinikums. Natürlich war um diese Uhrzeit noch niemand hier unten, die Arbeitszeiten von Laborärzten weckten oft den Neid der Kollegen. Rechts befand sich eine große, weiße Tür, der sie vorher nie große Beachtung geschenkt hatte und neben der ein großes Poster hing: „The science of today is the technology of tommorrow“.
Sie ignorierte das fettgedruckte Schild an der Tür, welches warnte: ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN und atmete erleichtert auf, als sie feststellte, dass sie sich, dank des Chips auf ihrem Mitarbeiterausweis, ohne Probleme öffnen ließ. Was solls, ich nix Deutsch, dachte sie.
Verblüfft blieb sie stehen und stellte fest, dass dieser Bereich nochmals um einiges moderner wirkte, als das ohnehin noch immer nagelneu erscheinende Krankenhaus. Gabriela fühlte sich, als befände sie sich auf dem Weg zu einem Raumschiff. Leuchtstreifen am Boden führten in verschiedene Richtungen und das einzig hörbare Geräusch war das leichte Surren einer Klimaanlage.
Vor sich hörte sie gedämpfte Stimmen. Sie bog langsam um eine Ecke und sah, dass etwa fünf Meter vor ihr eine Tür offenstand. Gabriela sah sich um und stellte sicher, dass niemand sie gesehen hatte. Sie schlich noch ein, zwei Meter auf die Tür zu und lauschte.
„Das ist eine Straftat, Sie Idiot!“ brüllte jemand und sie meinte, die Stimme von Professor Lehmann erkennen zu können.
„Ach? Und das, was wir seit Monaten hier machen? Ist das keine Straftat? Neben der Tatsache, dass wir alle unsere Zulassungen verlieren würden, wenn das hier rauskommt, würden wir auch für Jahre in den Knast wandern! Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, um sie vom Krebs zu befreien und nicht, um Laborratten zu erschaffen oder Dinge zu testen, die absolut unnötig sind! Das hier ist etwas für größenwahnsinnige Wissenschaftler, die irre sind, kein Gewissen haben und den Hals nicht vollkriegen!“ Offensichtlich kam dies nun von Dr. Johann, dessen Stimme zwei Oktaven höher lag als sonst.
„Halten Sie die Klappe, Johann,“ stöhnte Lehn und sagte: „Die Anwesenheit des Mädchens ist ein notwendiges Übel in einem ohnehin katastrophal verlaufenen Experiment. Ich bin nicht stolz darauf, aber irgendwie müssen wir es schaffen, Zeller unter Kontrolle zu bringen und dann die gesamte Versuchsreihe möglichst schnell zu beenden. Es war ein Fehler und wir müssen ihn beheben, damit wir nicht geradewegs auf eine Katastrophe zusteuern.“
„Aber Sie haben sie gekidnappt!“ rief Professor Lehmann. „Keiner der Probanden wird von jemandem vermisst werden, darüber waren wir uns einig! Und abgesehen davon, galt als zweite Faustregel: Sie werden nur dann in die Versuchsreihe aufgenommen, also lediglich dann ein Nova, wenn sowieso klar ist, dass sie es nicht mehr lange machen werden. Ein fast ins Jenseits geprügelter Asozialer, ein Kandidat mit Hirntumor und einer, der zu lange im Wasser war. Und wie ist es bei ihr?“ fragte er. „Sie wissen nicht mal, wer oder wie viele sie bereits suchen. Und sie ist ein kerngesundes, junges Ding!“
„Sie war betrunken und hat mich angesprochen, sonst wäre ich gar nicht auf sie aufmerksam geworden!“ rechtfertigte Lehn sich. „Das 'junge Ding' hat sich mir förmlich an den Hals geschmissen!“
„Das sind Worte, die oft von Sexualverbrechern und Gewalttätern verwendet werden,“ spottete Johann leise. „Außerdem: Woher kommt diese Ähnlichkeit? Besteht vielleicht allen Ernstes die Möglichkeit, dass es hier einen Zusammenhang gibt? Oder haben Sie in ihrer Verzweiflung noch schnell ein paar Klonversuche unternommen?!“
„Ach, lecken Sie mich doch,“ schnaubte der Geschäftsführer.
„Diesbezüglich haben wir bereits mit Untersuchungen begonnen und momentan kann ich es mir selbst nicht logisch erklären. Doch selbst der größte Ignorant der Welt,“ Lehmann sah Dr. Johann mit hochgezogenen Augenbrauen an, „muss zugeben, dass man diesen Wink mit dem Zaunpfahl doch nicht einfach außer Acht lassen kann, wenn es um Scheitern oder Gelingen der Nova geht!“ Er räusperte sich und fuhr fort: „Wie ich bereits gesagt habe, es ist ein letzter Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Wenn das Mädchen scheitert und beispielsweise selbst draufgeht, dann müssen wir die beiden anderen Probanden abschalten und eben einfach auf die damaligen Lebensumstände vertrauen. Darauf bauen, dass Zeller sich irgendetwas einfängt, von einem Wolf gefressen oder als Hexer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.“
„Nennen Sie sie nicht ständig Probanden,“ murmelte Dr. Johann, doch Gabriela hörte nicht mehr zu. Sie war inzwischen noch ein Stück nach vorne geschlichen und sah, dass die drei streitenden Männer über einen Schreibtisch am Ende des langen Raumes gebückt zusammenstanden. Gerade, als ihr bewusst wurde, dass es hier wohl unter anderem um illegale Versuchsreihen an Menschen und offenbar auch eine Entführung ging, wurde ihr Blick von einem grellen, grünen Licht zu ihrer Rechten angezogen.
Sie schielte um die Ecke in den Raum hinein und sah, dass sich dahinter ein weiteres Zimmer befand, dessen Tür aufstand und aus welchem ein fortlaufendes, monotones Brummen zu hören war.
Du bist vollkommen verrückt, sagte Gabriela noch zu sich selbst, doch ehe sie wusste, was sie da eigentlich tat, war sie blitzschnell durch die Tür geschlüpft und huschte unbemerkt von den Männern durch die offenstehende Glastür in den abgetrennten Bereich, aus dem das Brummen kam. Sie stand nun mitten in einem, circa vierzig Quadratmeter großen Raum, der komplett in grünes Licht getaucht war und in dessen Mitte mehrere hohe, summende und piepsende Gerätschaften einen großen Kreis bildeten.
Vorsichtig spähte Gabriela zurück, ob die Männer noch am Schreibtisch zusammenstanden und scheinbar stritten sie sich immer noch am anderen Ende des Büros. Sie blickte auf die mannshohe, kapselförmige Vorrichtung vor ihr und bemerkte, dass am oberen Rand ein Monitor angebracht war, auf dem in grünen Buchstaben „Y. 16.11.1621“ zu lesen war. Sie erkannte einen schmalen Durchgang, um in das Innere dieser großen Kapsel zu gelangen und schlüpfte hindurch. Was sie dort sah, lies sie im ersten Moment daran zweifeln, ob sie überhaupt wirklich wach war.
Die Apparate standen so beieinander, dass sie im Inneren einen runden Platz freiließen, welcher einen Durchmesser von bestimmt zwei Metern hatte. Hier waren drei Liegen aufgestellt, an denen tausende verschiedenfarbige Kabel befestigt waren und über jeder davon hingen nochmals drei gleichgroße Monitore, welche unterschiedliche Aufnahmen zeigten. Was Gabriela aber am meisten schockierte, waren die drei Personen, die mitten in diesem futuristischen Konstrukt festgeschnallt worden waren. Sie hatte noch nie zuvor so viele Kanülen und Infusionen an Menschen gesehen! Keiner von ihnen war bei Bewusstsein, weder die beiden jungen Männer, noch das Mädchen mit den lockigen Haaren. Alle hatten eine Art Sauerstoffmaske auf dem Mund und zuckten hin und wieder unkontrolliert mit Armen und Beinen, was offenbar mit dem zu tun hatte, was sich Seltsames auf den Monitoren über ihnen abspielte.
Gerade, als Gabriela ihren Blick nach oben wenden wollte, hörte sie jemanden dicht hinter sich Luft holen. Ehe sie wusste, wie ihr geschah, brannte etwas höllisch an ihrer Kehle und sie sah, wie schwallartig Blut aus ihrem Hals geradewegs nach vorne auf den Boden spritzte. Fassungslos versuchte sie einzuatmen, doch außer einem gurgelnden Geräusch passierte nichts. Sie ging in die Knie und presste verzweifelt beide Hände an ihren Hals. Als die Welt um sie herum langsam verschwand, dachte Gabriela an ihre jüngste Nichte. Hoffentlich würde das kleine Mädchen irgendwann erzählt bekommen, wie glücklich es ihre Tante gemacht hatte, bei ihrer Geburt dabei gewesen zu sein.
Die Krankenschwester war bereits tot, als ihr Körper auf dem Linoleumboden aufschlug. Was sie nicht mehr hören konnte, war das spöttische Zischen des Geiers. Als die drei Männer in die Kapsel gestürzt kamen, wandte sie Frau Dr. Vogt wütend um, drückte dem verdutzten Lehn das kleine, messerscharfe Skalpell in die Hand und sagte: „Bitte sehr. Kümmern sie sich um das Verschwinden der Frau? Das können sie doch scheinbar sehr gut!“
Kapitel 5
Es war, als ob sie vom Blitz getroffen worden war. Vicky war sich nicht sicher, was sie zuerst wahrnahm. War es der Knall, der jeden Zentimeter ihres Kopfes auszufüllen schien oder das gleißende Licht, von dem sie dachte, es würde sie erblinden lassen. Ihr Oberkörper schoss in die Höhe und sie erbrach sich, ehe sie überhaupt etwas sehen konnte.
Während die Krämpfe ihren Körper zittern ließen und sie nach und nach die Pfütze erkannte, die ihr Magen auf der grünen Wiese hinterließ - wieso lag sie bitte auf einer Wiese- nahm sie außerdem wahr, dass es taghell war. Ein wunderschöner, sonniger, kühler Morgen schien es zu sein, was sie an dem leichten Raureif erkannte, auf den sie nun geradewegs kotzte. Als offenbar nichts mehr in ihrem Magen war, was sie hätte ausspucken können, wartete Vicky einige Sekunden und versuchte, das Stechen in ihrem Kopf zu unterdrücken, ehe sie diesen hob.
Die Wiese, auf der sie lag, war umgeben von hohen Bäumen und am klaren, blauen Himmel zogen leichte Wolken entlang. Ein sanfter Schauer lief ihr über den Rücken, als der kühle Wind sie berührte. Irgendetwas an dieser Situation war seltsam. Sie blickte an sich hinunter und stellte verwirrt fest, dass sie eine Art hellbraunen Kittel aus rauem, kratzigen Stoff trug, der lediglich mit einem braunen Band an ihrem Bauch zusammengehalten wurde und unter dem sie ein langes Kleid mit weiten, ausladenden Ärmel in demselben dunklen Braun trug, welche ihr um die Schultern herum schlabberten. Sie rappelte sich, immer noch leicht benommen, auf und unternahm ein paar erste, unsichere Schritte. Sie hatte keinerlei Erinnerungen an den Abend zuvor. Zuletzt hatte sie doch mit Annabelle und Jenny einen Kaffee getrunken! Und dann?
„Ich trinke nie, nie wieder!“ stöhnte Vicky. Was jetzt? Wohin sollte sie gehen? Und was, verdammt noch mal, war hier eigentlich los?!
Plötzlich meinte sie, aus einiger Entfernung Geräusche zu hören. Es klang nach einer großen Anzahl von Menschen, die sich lauthals unterhielten. Sie überquerte die große Wiese und ging geradewegs auf die hohen, dunklen Bäume zu. Langsam und vorsichtig betrat sie den Wald. Beinahe schlagartig war das Sonnenlicht verschwunden und lediglich ein leichtes Flimmern schien noch durch die dichten Baumkronen hindurch.
Wunderbar, so fangen entweder Märchen oder Horrorgeschichten an, dachte sie und zögerte, weiterzulaufen. Die Stimmen waren hier bereits deutlicher zu vernehmen, auch wenn sie immer noch nichts verstehen konnte. Außerdem hörte sie die typischen Geräusche des Waldes, die ihr immer schon gruselig vorgekommen waren. Vor fünf oder sechs Jahren hatte Annabelle zu ihrem Geburtstag eine Art Zeltlager im Wald veranstaltet, bei der es eigentlich hauptsächlich darum ging, sich möglichst schnell am Lagerfeuer zu betrinken und dann mit irgendwem in einem der Zelte zu verschwinden. Allerdings hatten sie auch eine Nachtwanderung mit Schnitzeljagd veranstaltet, bei der die Leute in zwei Gruppen aufgeteilt worden waren und diejenige gewonnen hatte, die zuerst den Kasten Bier fanden, welcher irgendwo im Wald versteckt worden war. Schon damals hatte sie sich vor Angst beinahe in die Hose gemacht.
Vicky versuchte, das Zirpen und Zischen aus dem dunklen Geäst um sich herum zu verdrängen und stapfte über den schlammigen Waldboden in die Richtung, aus der die Unterhaltung zu hören war. Sie war vielleicht zwanzig, dreißig Meter gelaufen, als es begann heller zu werden. Die Bäume lichteten sich, offenbar lag vor ihr eine Art Waldweg. Sie spähte durch die Sträucher und blickte geradewegs auf eine Lichtung, auf der sich dem Mädchen ein seltsamer Anblick bot.
Mitten auf dem staubigen Weg standen zwei große Planwagen, wie Vicky sie zuletzt bei einem Museumsbesuch in der Mittelstufe gesehen hatte. Vor dieses fassartige Konstrukt, das von weißem Stoff umspannt wurde, waren jeweils zwei vollkommen abgemagerte Pferde gespannt. Sofort bekam Vicky Mitleid mit den armen Tieren, obwohl sie eigentlich gehörigen Respekt und eine leichte Abneigung Pferden gegenüber hatte, seit eines sie in hohem Bogen abgeworfen hatte, als sie acht Jahre alt gewesen war. Noch abstruser waren allerdings die acht oder zehn Männer, die um die Fuhrwagen herumstanden und sich gegenseitig anbrüllten.
Sie trugen plattgedrückte Hüte auf dem Kopf, an denen teilweise noch Federn befestigt waren und bunte Hemden mit engen Westen darüber, sowie hohen, weißen Krägen um den Hals. Dazu… Stiefel? Wow.
„Erzähle noch einmal herum, dass ich dein Geld gestohlen habe und ich mach' dir Beine, du Hund!“ brüllte der Dickste von ihnen, dessen zugeknöpfte Weste jeden Moment über seinem dicken Bauch zu platzen drohte.
„Dann erklär's doch, Dietrich! Nur du wusstest, wo ich den Beutel verstecke und alle haben geschlafen, alle außer dir! Jetzt is' er weg! Fast alle Einnahmen vom Markt, so gut wie alle Stoffe hab' ich gestern verkauft! Was soll ich jetzt machen, was? Mir fehlt das Geld für Wochen!“
„Das kümmert mich einen feuchten Furz! Ich lass mich nicht als 'Lügner' oder 'Dieb' schimpfen, nicht von dir, du Schnapsnase! Von niemandem!“ Die Antwort des Anklägers ging in allgemeiner Streiterei unter, wobei die restlichen Männer, offenbar ebenfalls Händler, versuchten, die beiden Streithähne zu trennen. Plötzlich aber griff der Dicke, der selbst am Lallen war, blitzschnell in das Innere seines umgehängten Sackes, zog ein Messer und stieß es seinem Gegenüber wütend und mit voller Wucht in den Bauch, worauf dieser schreiend in sich zusammensackte.
Geschockt wollte Vicky losbrüllen, doch in diesem Moment legte sich von hinten eine warme Hand mit Druck auf ihren Mund und zog sie zurück ins Gebüsch.
Während ein „Pssssst“ neben ihrem Ohr ertönte, geriet sie in Panik, strampelte und versuchte, nach hinten zu treten. Sie bekam etwas links von sich zu packen, zerrte es zu sich und hob reflexartig mit aller Kraft ihr Knie, welches sein Ziel auch traf.
„Aaaaaaah, dieses Miststück!“ zischte jemand, als er vor ihr auf den Boden stolperte.
„Hey, hey, hey!“ flüsterte ihr eine zweite Stimme direkt ins Ohr. „Beruhige dich, okay? Ich tue dir nichts, ich schwöre. Aber wir dürfen uns hier nicht erwischen lassen. Also bitte, ich flehe dich an, tu uns allen den Gefallen und hör auf zu zappeln, dann lasse ich dich los. Einverstanden?“
Mit der schweren Hand auf ihrem Mund begann Vicky, kräftig zu nicken und als diese sich langsam entfernte, blickte sie nach unten. Zuerst sah sie die braungebrannten Arme, die noch immer um ihren Oberkörper gepresst waren, sich aber langsam begonnen, von ihr zu lösen.
Wie in Zeitlupe drehte sie sich langsam um und blickte geradewegs in die grünsten Augen, die sie jemals gesehen hatte. Sie gehörten einem jungen Mann, der sofort einen Schritt zurück machte, als hätte er nicht bereits jede Regel höflichen Abstandes über Bord geworfen. Seine Haare waren sehr kurz, an den Seiten sogar kürzer als kurz, doch die Stoppeln ließen dunkelbraun als Haarfarbe vermuten.
Sein markantes Kinn war nicht sonderlich gut rasiert und auch sonst wirkte er nicht so, als käme er frisch aus einem Badezimmer. Zwar wirkte er nicht abstoßend, doch dreckig war er definitiv. Seine helle Hose -oh nein, er trug genau solche Plunderhosen wie die Männer auf der Lichtung!- war übersät von Flecken und auch sein graues, mit einem dicken Gürtel gebundenes Hemd hatte schon bessere Zeiten erlebt. Der Typ war definitiv oft draußen, sonst wäre er niemals im Leben so braungebrannt. Man konnte ihn sich sofort als sexy Moderator irgendeiner Survival-Show im Fernsehen vorstellen, dachte Vicky und schüttelte insgeheim den Kopf über sich selbst, während sie sich zur Ordnung rief.
„Hey, willst du ihn nur anglotzen oder dich vielleicht auch mal bei mir entschuldigen?“ krächzte es neben ihr und fast wäre sie erschrocken, da sie den zweiten Typen bereits aus ihrem Gedächtnis gestrichen hatte.
Während der Dunkelhaarige ihnen andeutete, still zu sein und ein paar Schritte an ihr vorbei machte, um durch die Bäume spähen zu können, richtete sich Waldmensch Nr. Zwei auf und fuhr sich mit der Hand durch seine blonden Haare. Definitiv Typ Surferboy, arroganter, dreckiger Surferboy, dachte Vicky.
„Also,“ sagte Blondie, zupfte sich an seiner empfindlichsten Stelle herum, die Vicky offenbar perfekt getroffen hatte und motzte: „Ich bin Nick und komme aus Irland. Sei bloß froh, dass du kein Mann bist, sonst hätte ich auf die Vorstellungsrunde verzichtet und dir stattdessen gezeigt, wie man bei uns auf so etwas antwortet.“
„Ihr habt mich von hinten angegriffen“, begann Vicky, doch er unterbrach sie sofort.
„Jedenfalls bin ich hier mit meinem guten Freund Robin,“ er wies auf Mr. Survival, der sich umdrehte und endlich anstatt Blondie das Reden übernahm.
„Freut mich, dich kennenzulernen,“ sagte er und streckte ihr seine Hand entgegen. „Tut mir wirklich leid, dass wir dich so erschreckt haben, aber ich habe erst vor Kurzem gehört, dass du kommst und man darf sich hier wirklich keinen Fehler erlauben. Deshalb mussten wir dich von der Lichtung wegholen,“ erklärte er entschuldigend und aufgrund seines Blickes hätte Vicky sich am liebsten selbst dafür entschuldigt, überhaupt dort gewesen zu sein.
„I-Ich bin Vicky,“ sagte sie, blickte sich dann um und fragte: „Wo zur Hölle sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, was in den letzten paar Stunden passiert ist, aber ich scheine den größten Absturz meines Lebens gehabt zu haben und irgendwie von der Innenstadt aus hier gelandet zu sein. Wir sind doch noch in der Nähe von Frankfurt, oder?“ blinzelte sie plötzlich erschrocken.
Während der junge Mann namens Robin den Mund öffnete und nach einer geeigneten Antwort zu suchen schien, lachte Nick auf und sagte: „Das sind wir. Es sind zwar ein paar Kilometer, aber wir sind noch in der Nähe von Frankfurt.“ Er machte eine theatralische Pause. „Das wird dir allerdings nicht allzu viel bringen,“ prustete er los.
„Nick! Er will dir nur Angst machen, Vicky,“ versuchte Robin sie zu beruhigen und machte einen Schritt auf sie zu, doch sie wich ein Stück zurück.
„Was soll das heißen, es wird mir nicht viel bringen? Hört mal, wenn das hier irgendein verdammter Witz von Roman, Annabelle oder sonst wem sein soll, dann hört mit diesem Mist jetzt auf, sofort! Ich habe





























