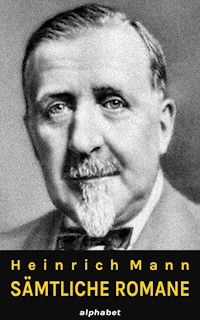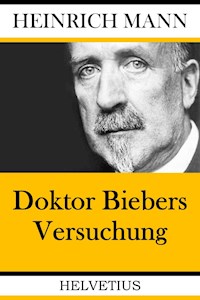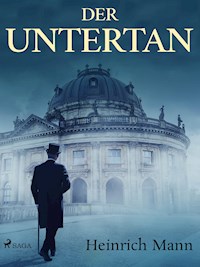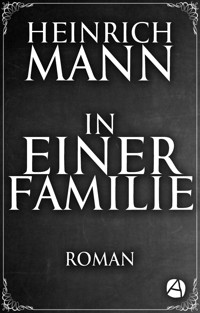0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band von "Novellen und Erzählungen" versammelt elf Werke von Heinrich Mann. Luiz Heinrich Mann (geboren 27. März 1871 in Lübeck; gestorben 11. März 1950 in Santa Monica, Kalifornien) war ein deutscher Schriftsteller aus der Familie Mann. Er war der ältere Bruder von Thomas Mann, dessen Popularität seit den 1920er Jahren weiter zunahm und Heinrichs frühere Erfolge noch heute überstrahlt. Ab 1930 war Mann Präsident der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, aus der er 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ausgeschlossen wurde. Mann, der bis dahin meist in München gelebt hatte, emigrierte zunächst nach Frankreich, dann in die USA. Im Exil verfasste er zahlreiche Arbeiten, darunter viele antifaschistische Texte. Seine Erzählkunst war vom französischen Roman des 19. Jahrhunderts geprägt. Seine Werke hatten oft gesellschaftskritische Intentionen; die Frühwerke sind oft beißende Satiren auf bürgerliche Scheinmoral, der Mann - inspiriert von Friedrich Nietzsche und Gabriele D'Annunzio - eine Welt der Schönheit und Kunst entgegensetzte. Mann analysierte in den folgenden Werken die autoritären Strukturen des Deutschen Kaiserreichs im Zeitalter des Wilhelminismus. Resultat waren zunächst u.a. die Gesellschaftssatire "Professor Unrat", aber auch drei Romane, die heute als die Kaiserreich-Trilogie bekannt sind, deren erster Teil "Der Untertan" künstlerisch am meisten überzeugt. Im Exil verfasste er sein Hauptwerk, die Romane "Die Jugend des Königs Henri Quatre" und "Die Vollendung des Königs Henri Quatre". Sein erzählerisches Werk steht neben einer reichen Betätigung als Essayist und Publizist. Er tendierte schon sehr früh zur Demokratie, stellte sich von Beginn dem Ersten Weltkrieg und frühzeitig dem Nationalsozialismus entgegen, dessen Anhänger Manns Werke öffentlich verbrannten. Inhaltsverzeichnis: - Ein Verbrechen - Ist sie's? - Das gestohlene Dokument - Drei-Minuten-Roman - Fulvia - Ginevra degli Amieri - Schauspielerin - Jungfrauen - Heldin - Abdankung - Der Unbekannte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ein Verbrechen
Ist sie's?
Das gestohlene Dokument
Drei-Minuten-Roman
Fulvia
Ginevra degli Amieri
I
II
III
Schauspielerin
I
II
III
IV
V
Jungfrauen
Heldin
Abdankung
Der Unbekannte
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Ein Verbrechen
»Glaubt mir, ihr jungen Leute, und begnügt euch in der Liebe mit Kleinigkeiten! Nehmt von den Frauen das Gute an, das sie euch zu geben vermögen, aber im übrigen –.«
Der Rittmeister a.D. von Hecht machte die seinen Gästen bekannte Handbewegung: »Reden wir nicht davon.« Er nahm einen Schluck Punsch und fuhr fort:
»Was die große Leidenschaft anbetrifft, so liegt das Übel darin, daß sie sich niemals auf beiden Seiten gleich groß findet. Ist sie nun auf eurer Seite größer, so ist das ein Unglück, aber hier kann man sagen: gegen Leiden hilft Tätigkeit, manchmal wenigstens. Wächst euch dagegen die Leidenschaft der Frau über den Kopf, so ruht ihr am Fuß eines Vulkans aus, der Schwefelregen wird euch begraben. Ich werde vielleicht zu tief, das wäre schade; also will ich euch lieber gleich die Geschichte erzählen, der ich meine Philosophie verdanke.
Als ich im Jahre 82 nach M. versetzt wurde, war ich an eine großstädtische Lebensweise gewöhnt und fand das Dasein in dem Neste etwas kärglich. Die Leute aßen recht gut, aber in ihren Sitten waren es Kleinbürger. Das einzige Haus, wo man sich mitunter gut unterhielt, war das eines reichen Kaufmannes Namens Starke, der mit Fellen, Pelzen oder so etwas Ähnlichem handelte. Er hatte eine Frau, die ich, als ein Kamerad mich ihr vorstellte, wiedererkannte; ich hatte sie auf der Straße zwar nur von hinten gesehen, aber sie übertrieb beim Gehen das Wiegen ihrer Hüften. Sie hatte eine zu kurze, doch vollkommen runde Taille und auffallend schweres braunes Haar. Außerdem war ihre Nase von entzückender Feinheit, mit leicht beweglichen Flügeln. Wenn sie lächelte, biß sie mit den spitzen weißen Zähnen in ihre blutroten Lippen wie in einen Pfirsich, und ihre grauen Augen blickten dazu voll träumerisch versteckter Neugierde. Später habe ich in großen Momenten silberne Schlangen darin aufzüngeln gesehen.
Um Frau Starke und mich legte sich vom ersten Tage an eine eigene Atmosphäre. Sie wollte nicht zu dem Kreise gehören, in dem sie lebte, sie sprach von Berlin, wo sie nie mehr als vier Wochen im Jahre zugebracht hatte, als sei sie dort zu Hause. Sie kannte dem Namen nach ein paar meiner Freunde, und von meinem zweiten Besuche an behandelte sie mich wie einen intimen Bekannten von früher, den sie endlich wiedergefunden hätte. Am Ende war sie ja nicht zu verachten in ihrer dreißigjährigen Schönheit, in ihrer Toilette, die sorgfältig auf der Höhe des Berliner Geschmacks erhalten wurde, und inmitten ihrer häufig erneuerten Einrichtung, die, etwas in M. Unerhörtes, ganz und gar als Umrahmung ihrer eigenen Erscheinung gedacht schien und nichts stickluftig Familienmäßiges hatte. Wenn aber ich, der ich immerhin dem Familienglück anderer ein paarmal im Leben zu nahe getreten bin, in diesem Falle mein Gewissen befrage, so darf ich sagen, es hat mir nur wenig vorzuwerfen. Alles kam scheinbar von selbst, und es war mir übrigens bekannt, daß ich Vorgänger gehabt hatte. Frau Annemarie hatte ihren Mann niemals leiden mögen. Starke, der sie ohne einen Pfennig Mitgift geheiratet hatte, betete sie an. Der arme Mensch mit dem runden Allerweltsgesicht, dem breiten Bürgerbauch unter seiner weißen Weste und den großen roten Händen erschöpfte sich im Dienst ihrer Schönheit, ihres Luxusbedürfnisses, ihrer Launen, aber er erntete nichts als Haß und Abscheu. In der Stadt flüsterte man sich in die Ohren, Annemarie habe ihm niemals seine ehelichen Rechte eingeräumt. Die Kameraden, von denen ich diesen Zug erfuhr, fanden, daß er für eine Bürgersfrau großartig sei und von Rasse zeuge.
Starke schien sich um den Klatsch nicht zu kümmern, er arbeitete. Man sah ihn immer nur von draußen, wie er am Fenster auf seinem Kontorbock saß. Obwohl er einer altangesehenen Firma vorstand, benahm er sich, als gälte es das trockne Brot zu verdienen. Er hatte wohl die Kosten der Villa einzubringen, die er draußen vor der Stadt, auf Wunsch seiner Frau, in durchaus echtem Material erbaut hatte; die Kosten der zum dritten Mal in seiner zehnjährigen Ehe erneuerten Stilmöbel sowie der Equipage seiner Frau. Annemarie war außer der Frau des Obersten die einzige in der Stadt, die eigenes Fuhrwerk besaß. Sie empfing alle Welt in ihrem Hause, auf ihren zahlreichen Festen sah man nur sie; ihr Mann stand in einer Ecke und blickte ihr mit einem vor Bewunderung fast idiotischen Lächeln durch die Flucht der Säle nach. Wenn er sprach, so kamen die Töne so gemäßigt aus seiner breiten Brust, daß es schüchtern klang. Er fürchtete den verachtungsvollen Blick, der ihn treffen mußte, wenn er seine grobe Stimme erhob. Geachtet wurde er trotzdem, wie ein solider Kaufmann aus altem Hause in der Provinz geachtet wird, wo man, wie es scheint, die geschäftlichen Verhältnisse den gesellschaftlichen voranstellt. Wenn man ihm Komplimente über sein elegantes Heim und seine schöne Frau machte, wiederholte er mit einer abwehrenden Handbewegung seine Lieblingsredensart: ›Ich brauche zwei Millionen, damit meine Frau in Berlin auftreten kann.‹
Ich hatte mich wahrhaftig nicht darüber zu beklagen, daß die schönste und gesuchteste Frau der Stadt mich bevorzugte. Aber ihre Gunst brachte auch Sorgen mit sich. Morgens um drei konnte ich einen geheimnisvollen Besuch erhalten. Annemarie hatte im letzten Augenblick erfahren, daß ihr Gatte mit dem Nachtzuge eine Geschäftsreise antrete, und da war sie. Befand sich Starke jedoch zu Hause, so beanspruchte sie, daß ich zu ihr komme. Ich eilte in Dunkelheit und einen Räubermantel gehüllt, vom entgegengesetzten Tore, wo meine Wohnung lag, herbei, ich hatte eine Gartenmauer zu erklettern und wurde von Annemarie selbst, die mich im Finstern bei der Hand ergriff, hinaufgeleitet. Nun, ich war schon sechsunddreißig und über die Romantik hinaus. Wenn dann die Geliebte mich etwas lau fand, so verdoppelte sich ihr Feuer. Ihre Schultern, und sie hatte prachtvolle Schultern, zuckten in fesselloser Leidenschaft und sie flüsterte, doch so laut wie die Leidenschaft flüstert, lauter jedenfalls als nötig gewesen wäre, selbst wenn nicht Starke zwei Zimmer entfernt geschlafen hätte. Mir war es peinlich zumute, dann sagte sie, während in ihren Augen der kalte Silberglanz flimmerte: ›Ich möchte ihn töten, damit du dich in meinen Armen sicherfühlen kannst.‹
Das war noch nicht alles. Wenn eine Frau, deren rechtmäßiges Los sie zur bürgerlichen Familienmutter bestimmt hätte, einmal auf den falschen Weg geraten ist, so vollführt sie tollere Sprünge als jede andere. Annemarie wollte jeden Morgen ihren Liebesbrief erhalten, und das ließ sich nur auf den kompliziertesten Umwegen besorgen. Es fiel ihr ein, mir zur belebtesten Tagesstunde ein Stelldichein anzusagen, und ich mußte den Dienst und alles übrige im Stich lassen, um in einem zwei Meilen entfernten Landwirtshaus ein Frühstück zu bestellen, während sie im Schlitten nachkam. Sie gehörte zu den Frauen, die auch das bescheidenste Stückchen Privatleben ihres Geliebten mit Beschlag belegen, sie wollen alles haben. Sie besaß die Herrschsucht, die kindische Neugier, die Eitelkeit und die ein bißchen einfältige Romantik der Bürgersfrau, die den großen Entschluß durchgeführt hat, über ihre natürlichen Schranken hinwegzusetzen. Aus Versehen nannte ich sie manchmal Emma; ein Glück, daß sie von der Bovary nichts wußte. Am unangenehmsten berührte es mich, daß sie fast täglich ihres Gatten erwähnte. Wenn sie, ihr Gesicht ganz dicht an meinem, langsam wiederholte: ›Wir müssen ihn loswerden, ich will, daß wir frei werden‹, so hielt ich sie nahezu eines Verbrechens fähig, und es überkam mich eine abscheuliche Furcht. Nachdem ich euch dies gesagt habe, mögt ihr mich feige nennen, aber wer mich verurteilen wollte, müßte, glaube ich, selbst etwas Ähnliches erlebt haben. Ich war durch meine Leichtfertigkeit in ein Abenteuer hineingeraten, in dem mich nun eine Leidenschaft festhielt, die zu teilen ich weit entfernt war. Wenn ich übrigens Annemarie nicht liebte, so kam es mir doch vor, als sei ihre Leidenschaft von der Art, die ebenfalls recht wohl ohne wirkliche Liebe bestehen kann.
Je größer meine Bedenken wurden, desto häufiger erinnerte ich mich des Gatten. Ich empfand aufrichtiges Mitleid mit dem Ärmsten, ganz besonders infolge eines Gespräches, dessen Zeuge ich während eines der Feste in Annemaries Hause ward. Es war ein neuer, ungeheuer kostspieliger Wintergarten eingeweiht worden, ich stand hinter einer Pflanzengruppe und hörte, da gerade die Tanzmusik schwieg, was nebenan am Kartentisch ein paar ältere Bürger sich halblaut erzählten.
›Ein schönes Fest‹, sagte der eine ›und kostet auch gar kein Geld.‹
›Wenn Starke sich ruiniert‹, bemerkte ein anderer, ›so weiß man wenigstens warum. Vorige Woche hat seine Frau ihn wieder die neuen Wagenpferde gekostet, prachtvolle Rappen, ich weiß zufällig, was er bezahlt hat.‹
Nach einer Pause wandte ein Dritter ein:
›Oh, Starke ist nicht so leicht umzubringen. Ein solider Kaufmann und ein altes Geschäft.‹
Die andern stimmten bei.
›Das ist sicher. Bei Starke hat man immer gewußt, woran man ist. Sein alter Freund Kasch, der neulich in P. gestorben ist, hat ihn zu seinem Testamentsvollstrecker ernannt. Starke verwaltet das Vermögen der Kinder.‹
›Wieviel beträgt es?‹
›Eine runde Million, sagt man.‹
Ich teilte dies Gespräch Annemarie ziemlich wörtlich mit.
›Du hast Mitleid mit dem häßlichen Narren!‹ rief sie mit einer Heftigkeit, die ihr ganzes bewegliches Gesicht ins Zucken brachte. ›Du liebst mich nicht!‹
Ich mußte sie besänftigen. Sie sagte, immer noch vor Zorn mit dem Fuße stampfend:
›Wie ich den Menschen hasse! Aber du sollst sehen, daß wir ihn loswerden, und bald!‹
Dabei bewirkte die kalte Leidenschaft in ihren grauen Augen abermals, daß mir ein Schauer über den Rücken lief.
Obwohl der Winter zu Ende ging, ließ Annemarie sich drei neue Gesellschaftskleider von unerhörtem Reichtum aus Paris kommen. Sie zeigte mir einen prachtvollen Brillantschmuck. Ich erschrak, ohne recht zu wissen worüber.
›Du ruinierst deinen Mann!‹ rief ich unwillkürlich.
›Hast du schon wieder Mitleid mit ihm?‹ fragte sie, aber diesmal blieb sie ganz fröhlich dabei.
Einige Tage später beschied sie mich abends gegen neun zu sich. Im Vorzimmer zögerte ich, da ich jemand bei ihr bemerkte, einen semmelblonden Menschen, der wie ein Kontorist aussah.
›Sind Sie ganz sicher, daß es so ist?‹ fragte Annemarie.
›Ganz sicher, gnädige Frau‹, erwiderte der Jüngling.
›Dann ist es gut. Gehen Sie über die Nebentreppe hinunter und durch die Gartentür hinaus, damit man Sie vorne nicht sieht.‹
Annemarie war an jenem Abend verlockend wie nie. Als ich Abschied nahm, lehnte sie den Kopf mit dem schweren Haar, das sich gelöst hatte und duftete, gegen meine Schulter.
›Ich habe einen Auftrag für dich‹, sagte sie.
Sie eilte an ihren Schreibtisch, zog einen Brief hervor und legte die adressierte Seite gegen ihre Lippen.
›Du wirst mir versprechen, diesen Brief am andern Ende der Stadt unbesehen in den Kasten zu werfen. Hörst du, unbesehen. Ich hätte ihn auch dem Menschen mitgeben können, der vorhin hier war. Aber –‹
Sie rümpfte ihre feine Nase.
›– diese Leute sind nicht verpflichtet, Männer von Ehre zu sein.‹
Ich steckte den Brief ein, und unterwegs vergaß ich ihn fast, müde und ein Dichter würde irrtümlich sagen liebestrunken, wie ich nach Hause ging. Aber am jenseitigen Tor fühlte ich plötzlich ein ungewohntes Gewicht in meiner Brusttasche. Glaubt ihr's mir nun oder nicht, aber es gibt einen Lebensinstinkt, der die Rolle des Hundes spielt, der nachts im Walde den Jäger vor einem Moraste warnt. Ich war gewarnt und zog den Brief hervor. Mit der Schilderung meiner Seelenkämpfe will ich euch verschonen, es genügt zu wissen, daß ich mit zusammengebissenen Zähnen und ohne hinzublicken den Umschlag aufriß. Erst als er ganz zerfetzt war, sah ich unter einer Gaslaterne die Aufschrift an. Der Brief war an den Staatsanwalt des Landgerichtes adressiert. Das Schreiben, das ich, ehe ich's noch wußte, gelesen hatte, enthielt anonyme Anzeige, daß der Kaufmann Starke die ihm anvertrauten Mündelgelder unterschlagen habe.
Im selben Augenblick fühlte ich mich von Blut übergossen. Ich lüge nicht, das Blut, das meine Stirn siedend heiß machte, schien nicht mein eigenes zu sein; ich meinte, man gösse es über mich. Und den Brief in der gekrampften Faust, fing ich zu laufen an, mit einem Gefühl, das ich in dem Augenblick, da ich euch die Geschichte erzähle, wiederfinde: es ist mir, als liefe ich noch. Ich stürmte die Treppe hinauf, zündete in meinem Zimmer eine Kerze an und hielt den Brief in die Flamme. Die verkohlten Papierfetzen zerdrückte ich zwischen meinen Fingern zu Asche, die ich teils unter die Möbel und teils aus dem Fenster streute. Es war mir, als habe ich die Spuren eines Verbrechens zu beseitigen. Dann weckte ich meinen Burschen, und während er meinen Koffer packte, setzte ich ein Urlaubsgesuch auf, durch dringliche Umstände begründet, die mich zwängen, mit dem Frühzuge abzureisen.
Den Rest der Nacht verbrachte ich in meinem Lehnstuhl und überlegte mir den Fall. Gewiß, der Mann war ja ein Schurke. Aber wenn er sein Vermögen, sein Haus und seinen Namen zugrunde richtete, so tat er es für die Frau, der er nichts abzuschlagen verstand. Wenn er schließlich zum Verbrecher wurde, so war nur sie sein Verbrechen, diese Frau, die ihn jetzt dem Gericht anzeigte. Warum tat sie es eigentlich? Sie mußte doch etwas für sich haben? Nun ja natürlich, ihre Leidenschaft!«
Der Rittmeister zuckte die Achseln. Er machte wieder die seinen Gästen bekannte Handbewegung: »Reden wir nicht davon.«
Ist sie's?
Warum gibt es Menschen, die sehr viel langsamer alt werden als alle anderen, und warum gehöre ich zu ihnen?
Ich denke mir, daß das Altern besonders dadurch fühlbar wird, daß wir unsere Umgebung älter werden sehen. Ein Mann, der seit vielen Jahren in der gleichen Häuslichkeit gelebt hat, wird von seinem ersten Hausrat im Laufe der Zeit ein Stück nach dem andern durch ein neues ersetzt haben, bis ihn an die Jugend kaum noch etwas, und nur das Verschlissene, Beschädigte erinnern kann. Wie die Gegenstände, so werden auch die Menschen seiner Umgebung nach und nach verändert oder ganz verschwunden sein.
Wenn man indessen, wie ich, seit früher Jugend ohne Familie, ja ohne eigentliche Heimat ist? Ich bin gewohnt, allein in der Welt umherzuziehen, und die Natur, die ich immer wieder in jedem Lande zu der Zeit aufsuche, wo sie mir ihre eigentümlichsten Reize bietet, bleibt jung, und so erhält sie mich jung. Zuweilen, wenn ich vor einer Landschaft in dem gleichen Zauber befangen stehe, wie schon so oft, will es mir unwahrscheinlich vorkommen, daß von dieser unvergänglichen Jugend ringsumher nur ich selbst ausgeschlossen sein sollte. Ich vergesse dann leicht, daß meine Schläfen schon recht grau geworden sind und daß meine lange Gestalt, obwohl von den fünfundvierzig Jahren noch nicht gebeugt, doch schon ein wenig zu hager ist.
Wie meine eigenen, so vergesse ich häufig genug auch die Jahre der andern. Es geschieht mir etwa, daß ich in einem Gesicht, von fern erblickt, das eines ehemaligen Reisekameraden zu erkennen meine. »Da ist er!« sage ich mir sogar ohne Überraschung, an die Zufälligkeiten des Findens und Verlierens auf Reisen gewöhnt. Bis ich dann, näher gekommen, mich erinnere, daß das Gesicht zwar dem ähnelt, das ich damals kannte – dessen jugendfrisches Lächeln nun aber längst durch Züge und Falten verunziert sein muß. Das sind meine traurigsten Stimmungen. Doch ist es anderer Art und mehr als solch eine törichte Verwechslung, das Abenteuer vom vorigen Frühjahr, dessen ich noch immer mit der gleichen ziellosen Unruhe, mit der gleichen gegenstandslosen Reue und Sehnsucht gedenke.
Gegen Abend in Montreux angekommen, saß ich, während es schon stark dämmerte, hinter dem Kursaal im Garten, der zum See hinabführt. Das Nachmittagskonzert war beendet, der Garten leer und still; ich glaubte allein zu sein, als ich plötzlich in einer der Lauben, die keine der spärlichen Gasflammen mit ihrem Licht erreichte, ein schattenhaftes Profil erblickte, das mich heftig zusammenschrecken machte. Halblaut entfuhr meinen Lippen der Name Jeanne. Dann faßte ich mich zwar, um mich zu erinnern, daß die Begegnung, die sich hier zu wiederholen schien, um zwanzig Jahre zurücklag.
Damals war ich in Montreux mit zwei jungen Ehepaaren dadurch in Verkehr gekommen, daß einer der Gatten zu meinen älteren Reisebekanntschaften gehörte. Seine Frau war eine Cousine Jeannes. Diese war an einen Mann in den Fünfzigern verheiratet, eine hohe vornehme Erscheinung, doch bereits stark verfallen. Man befand sich wegen seines Lungenleidens dort, allein es schien mir, daß auch die Frau ausdrücklicher Pflege bedurft hätte. Groß und schlank, in der Taille leicht nach vorn geneigt, trug sie auf schmalen Schultern und zartem Halse die überschwere Fülle ihres mattgoldnen Haares. Ihr Gesicht, mit der ganz leise aufgeworfenen Nase, den schmalen sanften Lippen und dem ungewissen, schimmernden Blick ihrer meerblauen Augen, war bleich. Man gewahrte die bläulichen Adern auf ihrer weißen Stirn neben dem gelben Mal, das dicht an der rechten Schläfe von einer vereinzelten Locke leicht verdeckt ward.
Die respektvolle Neigung ihres Gatten schien sie voll zu erwidern und nur für die Pflege zu leben, mit der sie den Kranken umgab. Sie führte ihn jeden Morgen die wenigen Schritte zu einer Bank am Strande, und während sie das Plaid um seine Schultern legte, sah man, wie sie ihn gleichzeitig mit ihrem sorglichen Blick einhüllte, der in solchem Augenblick seine gewöhnliche Vagheit verlor. Er wurde fester und stützte sich auf den Mann, der wirklich ihr Halt sein mußte und der ihr vielleicht den Glauben an das Leben und an alles Gute gegeben hatte. Denn sie war, eine Waise aus verarmter vornehmer Familie, in ihrer ersten Jugend mancher Unbill ausgesetzt gewesen und erst durch den Mann zu dem ihr gebührenden Range wieder erhoben worden. Eine unendliche Dankbarkeit beherrschte ihr ganzes Wesen.
Ich lebte gern in der Nähe der jungen Frau, ohne daß ich ihr zutraute, andere Gefühle zu erwecken als die eines wohltätigen, zarten Mitleids. Ich fand sie rührend in ihrer bescheidnen weißen Tracht, und da ich in romantischen Jahren stand, liebte ich es, sie mir als die Heldin eines alten Gobelin vorzustellen, die inmitten einer verblichenen Staffage ihren Gebieter erwartet. Die matten verwischten Farben, von denen ich ihre helle Gestalt umgeben dachte, hatte ich deutlich vor dem geistigen Auge. Und einmal fügte es sich, daß ich in der Wirklichkeit das Bild vollendet sah.
Es war im Schlosse Chillon, wo das befreundete Ehepaar, heiter die Säle durcheilend, uns einige Minuten in der Kemenate der Schloßherrin allein gelassen hatte. Jeanne saß auf der niedrigen Truhe, die einsam in der Fensternische des leeren Gemaches steht. Ein wenig müde gegen die dunkle Wandtäfelung gelehnt, blickte sie hinaus auf den See, der in abendlichen mattblauen Schleiern lag. Von drüben, wo man die Berge ahnte, rann ein bleiches, rotgelbes Licht herein, das um ihr Haar ein glanzloses Diadem wand. Sie hatte unwillkürlich durch die Macht der Umgebung die Haltung des Wartens angenommen. Da ward ich, zum erstenmal in ihrer Nähe, von einer nervösen Regung erfaßt. ›Sie wartet‹, flüsterte es in mir, ›und ich stehe hinter ihr. Ich stehe schon hinter ihr‹, wiederholte ich mit einer unbestimmten Frage.
Durch die Zufälligkeiten des täglichen Verkehrs wurden wir zuweilen allein aufeinander angewiesen. Ihr Gatte entfernte sich wenig vom Hause, die Freundin fürchtete das Wasser, das Jeanne leidenschaftlich liebte. So ruderte ich sie häufig, am liebsten der sinkenden Sonne entgegen, deren Widerschein in ihren großen stillen Augen ein Spiel mildgoldener Lichter hervorrief, indes ihre liebliche Gestalt von dem zarten Violett des jenseitigen Horizontes schmeichlerisch umgeben war.
Ein einziges Mal habe ich sie lustig, fast ausgelassen gesehen. Wir feierten das Geburtsfest ihres Gatten, abends in einem kleinen Gartensalon des Hotels. Der Mann ihrer Freundin erzählte drollige Geschichten, und Jeanne, die, in ihren Sessel zurückgelehnt, sich vor Lachen schüttelte, brachte ihn durch dazwischengeworfene Bemerkungen von einem aufs andere. Dann wieder suchte sie durch plötzliche Liebkosungen ihren Mann in ihrer Fröhlichkeit mit fortzureißen. Sie hatte nur zur Suppe ein wenig Sekt genippt, doch zeigten ihre blassen Wangen eine flüchtige Röte. Sie drückte das Spitzentuch kühlend darauf, dann sprang sie, mitten in der Unterhaltung, auf und trat auf die Terrasse hinaus.
Einen Augenblick später hörte ich sie hereinrufen:
»Seht, das ist ein Sternschnuppenregen!«
Da weiter niemand darauf achtete, erhob ich mich und trat zu ihr.
Die Lichtpunkte schossen über den Himmel, der auch noch in nächtlicher Färbung etwas von seiner weichen Schönheit bewahrt hatte, und sprühten drüben zwischen dem Gebüsch hernieder. Der Mond, in einer blauen Bucht schwimmend, milderte mit seinem Licht die grellbunten Reflexe, die zahlreiche Lampions, phantastisch an den Baumstämmen hangend, über das Laub warfen. Der silberne Strahl eines in der Weite plätschernden Brunnens schien im Stehen eingeschlafen.
Von der jungen Frau war die Lustigkeit abgefallen. Sie stand, gegen das Geländer gelehnt, doch so zart, als berührte sie es nicht, luftig wie eine Erscheinung, durch die der Mondstrahl hindurchfließen zu können schien. Das kleine Haupt war leicht rückwärts geneigt, wie von dem Gewicht des Haares hinübergezogen.
»Wie schön!« flüsterten ihre Lippen.
»Wie schön!« wiederholte ich, und aufatmend, fast ohne zu wollen, fügte ich hinzu: »Wie schön, dies in Ihrer Nähe zu genießen – Jeanne.«
Sie hatte sich aus ihrer träumerischen Haltung aufgerichtet, mit einer leichten doch bestimmten Wendung deutete sie ins Zimmer, wo ihr Gatte saß.
»Sie wissen, wem ich all dies Genießen danke«, sagte sie leise, so leise und doch so eindringlich, daß ich schweigend den Kopf senkte.
Es ward stille zwischen uns, und dann war ich froh, drinnen unsere Namen rufen zu hören.
Als wir hineinkamen, war von einer Bergpartie die Rede, die für den folgenden Tag geplant wurde. Sie war nur von uns beiden Männern beabsichtigt, aber mein Begleiter schlug vor, auch die Damen daran zu beteiligen.
»Sie sind nicht größere Dilettanten als wir im Steigen«, sagte er. »Warum wollen Sie uns allein lassen?«
Seine Gattin sagte für ihre Person zu, riet aber ihrer Freundin von der Teilnahme ab.
»Aber was hindert mich denn, mit euch zu gehen!« rief Jeanne, die auch diesmal ihrer Sorge nachgab, den pflegebedürftigen Gatten des Standes ihrer eigenen Gesundheit nicht gewahr werden zu lassen.
Wirklich fand am folgenden Tage die Partie statt, die ich mir zum voraus nicht als ganz ungefährlich vorstellen konnte. Denn wenn es auch keineswegs die Dent du Midi war, deren Ersteigung wir uns vorgenommen hatten, so konnte doch in dieser ersten Frühlingszeit auch auf dem Wege zu dem bescheideneren Gipfel, den wir erstrebten, der Schnee noch tief genug liegen. In der Tat befanden wir uns bald mitten darin, ohne unsere Unternehmungslust dadurch stören zu lassen. Nach einer Stunde munteren Aufstiegs bemerkte ich ein leichtes Gleiten unter meinem Fuß. Dadurch aufmerksam gemacht, hielt ich mich fortan im Nachtrab. Blieb ich doch so auch Jeanne am nächsten, die mir in der ungewohnten Tracht doppelt reizend erschien. Der Keckheit des fußfreien Kleides, des kühn auf das Hinterhaupt gedrückten grünen Lodenhutes widersprach auf das anmutigste die fast kindliche Zartheit ihrer Bewegungen.
Allmählich schien sie mir ein wenig teilnahmslos geworden, obwohl sie jede Müdigkeit leugnete. Glücklich am Ziel angelangt, verzehrten wir in Eile das mitgebrachte Frühstück, indes wir uns mittels Kognaks warm hielten. Dann ging es in gehobener Stimmung an den Abstieg, den ich eröffnete. Eine Strecke hinter mir hörte ich die Cousine, deren Lustigkeit durch das Gelingen des Unternehmens ganz entfesselt war, Jodler anstimmen, und hier und da eine kleine Galoppade wagen. Plötzlich vernahm ich zwei Schreie. Mich umwendend, sah ich die Freundinnen aneinander geklammert den Abhang herablaufen. Erst geschah es unter Lachen, dann folgten krampfhafte Versuche, den Schritt anzuhalten, und gleich darauf, als dies nicht gelang, von neuem kleine Schreie.
Alles ging in zwei Augenblicken vor sich. Ich hatte mich noch einmal kurz umgewandt. Der Weg war weder sehr steil, noch mit Hindernissen bedeckt, aber wenige Schritte unterhalb meines Standpunktes, auf den sie zuliefen, wandte er sich scharf nach links, gradaus gab es nichts als die noch immer beträchtliche Tiefe der senkrechten Wand. Ich rammte die Spitze meines Stockes in den Boden und stützte einen meiner ausgebreiteten Arme darauf, ganz mechanisch, und doch muß ich sagen, daß es die linke Seite, an der ich die Ankunft Jeannes erwartete, war, die ich so stützte. Es hätte sein können, daß ich nur eine von ihnen aufzuhalten vermocht hätte.
Doch der Anprall der beiden jungen Frauen war so leicht, es war kein Kunststück, ihm standzuhalten. Einen Augenblick fühlte ich sie beide gleich Bewußtlosen an meiner Brust ruhen. Dann richtete die Stärkere von ihnen sich mit Hilfe ihres herbeigeeilten Mannes auf. Ich blickte unwillkürlich um mich: Nein, es war niemand für Jeanne da als ich selbst, und so sah ich wieder auf ihr liebes, gegen meine Schulter gelehntes Haupt. Sie hob es halb empor, und mit Entzücken bemerkte ich ihren Blick, der anfänglich unbestimmt schimmerte, allgemach Festigkeit erlangte, wie er sich auf den meinen stützte. Nein, nicht nur ihr Gatte, auch ich konnte ihr Halt sein. Dann schien sie sich zu besinnen; reute sie der zu ausdrucksvolle Dank, den sie mir geschenkt hatte? Ich erschrak und löste meinen Arm von dem ihren. Allein, sie sank an ihren Platz zurück, und es war wie ein »Gleichviel!« Wieder fand ich ihren Blick, und was nun darin lag, war viel mehr als Halt suchende Dankbarkeit, war ganz etwas anderes als alles, was ihr Auge je dem Gatten auszudrücken vermocht hatte. Ich hielt den Atem an, dann, während ich es heiß in mir aufsteigen fühlte, flüsterte ich zum zweitenmal ihren Namen: »Jeanne.«
Daß solche Augenblicke, in denen wir die Unendlichkeit durchkosten, vorübergehen müssen wie andere! Dennoch war dieser kaum kürzer als alles, was folgte; Heimkehr und Abschied nach zwei Tagen, als die befreundeten Familien vorzeitig abreisten. Aber so kurz er war, jener Augenblick, so enthielt er noch immer Stoff genug für die endlosen Träumereien, denen ich mich nun wieder einmal hingab in diesem selben Montreux, im Kurgarten, in tiefer Dämmerung.
Plötzlich blitzte das Licht einer der Bogenlampen vor dem Kursaalgebäude auf. Emporgeschreckt gradaus starrend, ward ich an jenes schattenhafte Profil erinnert, das all meine Träumereien eigentlich veranlaßt und an dessen Gegenwart ich kaum noch gedacht hatte. Aber was sah ich? Das war ja sie, das war Jeanne!
Sie hatte, gleichfalls vom Lichte überrascht, den Kopf gewandt, so daß ich ihr gerade in das im weißen grellen Schein liegende Gesicht blickte. Das war das zarte Oval, dessen Konturen, mit den feinen Senkungen, die die Grübchen andeuteten, sich mir so oft, in mancher Nacht vor den geschlossenen Augen abgezeichnet hatte, das waren die sanften Linien des Mundes, der Nase, der Stirn, das waren auch ihre Augen, zu denen sie nun, mit dieser unvergeßlichen Bewegung, das langgestielte Lorgnon erhob.
Ich stand auf und ging langsamen Schrittes der Dame entgegen. Sie hatte einen Arm auf die Rückenlehne des Sessels gestützt, so daß ihre zarten Formen, daß die leichte Neigung ihrer Taille deutlich hervortrat. Weiß wie ihr Kleid umrahmte ein breiter Spitzenhut die Fülle des schlicht aufgenommenen mattgoldenen Haares, wovon eine vereinzelte Locke, o nun sah ich es, über das gelbe Mal nahe der rechten Schläfe fiel.
Wie unter dem Bann ihres Blickes ging ich auf sie zu, als sich ihr im Rücken aus dem Schatten der Laube eine kleine schwarzgekleidete Dame loslöste, um mir beweglich entgegenzukommen.
»Sie sind es also doch!« rief sie mir zu. »Und Sie Schlimmer geben sich erst jetzt zu erkennen!«
Es war die Cousine, und sie wenigstens fand ich verändert. Ihre rundliche kleine Erscheinung, die mich daran erinnerte, daß zwanzig Jahre vergangen seien, rief mich in die Wirklichkeit zurück. Ich begrüßte die Dame, die mich der Laube näher zu kommen hinderte. Mich einige Schritte fortziehend, erklärte sie mit gemäßigter Stimme:
»Das ist Jeanne's Tochter. Sprechen Sie ihr nicht von der Mutter, sie ist so namenlos empfindlich. Ach, Sie wissen wohl gar nicht, daß unsere arme Jeanne tot ist. Unser Erlebnis hat damals doch schlimmen Einfluß geübt. Bald darauf kam das Kind zur Welt, und es hat der Mutter das Leben gekostet. Sie haben auch nicht das Ableben meines Mannes erfahren. Wohin sollten wir die Mitteilung richten? Welch Glück, daß wir nun doch einmal wieder zusammentreffen!«
Halb betäubt hörte ich sie an und wartete ab, daß sie geendet hatte und mich dem jungen Mädchen zuführte.
So förmlich die Worte waren, die ich an dieses richtete und die sie mir erwiderte, so waren, was ich sah, dennoch dieselben Bewegungen, die mir aus den Stunden der holdesten Vergessenheit, der trautesten Träume im Gedächtnis geblieben waren; das machte mich unfähig, auf die Unterhaltung der Tante einzugehen. Nur zum Schlusse ward ich wieder aufmerksam.
»Wie schade«, rief sie aus, »daß Sie erst heute abend anlangen mußten. Wir beide, Jeanne und ich, wären froh gewesen, hier einen so guten Bekannten in der Nähe zu haben. Aber wir müssen morgen früh abreisen. Wenn es nur nicht so dringliche Abmachungen wären, die uns zwingen!«
Ich versprach, am nächsten Morgen zur Stelle zu sein und geleitete die Damen in ihr Hotel.
Gegen morgen erwachte ich aus fühllosem Schlaf, um allsogleich halbwachen Einbildungen zu verfallen, die mir bald Jeanne in meiner Nähe am gleichen Platze gegenwärtig zeigten, mich bald mit ihr in ein uferloses Traumland entführten, an das ich keine Erinnerung bewahrte. Mit dumpfen Gedanken erhob ich mich und eilte, die Damen abzuholen.
Sie waren bereit und bestanden darauf, in der Morgenfrische den Weg an den Bahnhof zu Fuß zu machen.
Unter kargem Gespräch waren wir bis an den steil zur Bahn aufsteigenden Weg gekommen, der See und Berge in weiter Aussicht beherrscht. Die Tante war, trotz meiner Versicherung, daß ihre Sorge um das Gepäck unnötig sei, einige Schritte zurückgeblieben. Mein Blick suchte heimlich das Profil des jungen Mädchens, das sich gegen den lichtweißen Himmel abzeichnete, und erspähte ihre Augen. Ja, das waren die Augen der Mutter, in ihrer unweltlichen, rätselhaften Vagheit gemacht, in den schimmernden, webenden Sonnendunst dieses Sees zu blicken. Das war, wovon ich nun mein Leben lang geträumt zu haben meinte. Ich fühlte es heiß in mir aufsteigen, und wenn ich nicht in Tränen ausbrechen wollte, so mußte ich sprechen, mußte aussprechen, was geheimnisvoll und unverstanden vielleicht von den Phantasien dieses Morgens in mir zurückgeblieben war? Zum drittenmal ließ mich ein bedeutsamer Augenblick den einzigen Namen nennen.
»Jeanne!« begann ich flüsternd, und als sie keine Miene bewegte: »Jeanne!« wiederholte ich, »gedenken Sie jenes Augenblicks?«
Atemlos wartete ich, bis ich ihre Lippen sich bewegen sah. Sie bewegten sich, aber die Worte, die sie sprach, schienen dennoch nicht aus ihrem Munde zu kommen. Es war wie wenn sie sich aus einer geisterhaften Luft, die um ihr Gesicht spielte, eines nach dem andern, gleich unsichtbaren Perlen lösten.
Sie sprach aber diese Worte:
»Ja, ich denke daran.«
Mir ward es darauf, als verdichtete sich der frische Wind zu einem eiskalten Mantel, der sich auf meine Schultern legte. Ich wunderte mich, daß ich unter seinem drückenden Gewicht weiterschritt. Wir gelangten aber ruhig an den Bahnhof, mechanisch besorgte ich die Angelegenheiten der Damen und drückte meine Lippen auf die dargebotenen Hände.
Erst auf dem Heimwege, langsam und unsicher, begannen Fragen sich in meinem Geiste zu ordnen.
Waren jene bedeutungsvollen Worte von dem jungen Mädchen, das mir das erste Mal im Leben begegnete, unter dem Einflusse meines eigenen Willens gesprochen, der den dieses zarten, empfindlichen Geschöpfes gebeugt hatte? Waren sie durch eine jener seltsamen »Wirkungen in die Ferne« vorbereitet, indem sich meine morgendlichen Phantasien auf ihren Geist erstreckt hatten? So wäre sie innerlich ohne Anteil an dem gewesen, was sie sagte. Ich fühle mich mehr zu der andern Frage hingezogen.
Hat Jeanne, in deren Seele eine so große Dankbarkeit lebte, in ihrer schweren Stunde meiner als dessen gedacht, der, wenn er ihr eigenes Leben nicht mehr retten konnte, dennoch das ihres Kindes bewahrt hatte? Hat sie, bevor ihr letzter Atem von ihr ging, diese Dankbarkeit, die in ihrer edlen Seele das vornehmste war, dem Kinde zugleich mit ihrem Leben vererbt und ihm so eine geheimnisvolle, verborgene Ahnung und wie eine Erinnerung an jenen einzigen Augenblick hinterlassen? Ist, was aus ihrer Tochter gesprochen hat, Jeannes Seele? Ist sie's?
Das gestohlene Dokument
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Das plötzliche und für uns schmerzliche Hinscheiden des Herrn Geheimrat Glumkow, vortragenden Rats im Ministerium des Innern, gibt noch immer Anlaß zu den verschiedensten Kommentaren. Wir verstehen sehr wohl, daß das gewissermaßen auffällige Betragen, das unser Verwandter kurz vor seinem Tode an den Tag legte, einen Verdacht in weitere Kreise dringen ließ, der ihn mit jenem, damals die öffentliche Meinung in hohem Grade beunruhigenden Vorfall in dem Ministerium, dem er als Beamter angehörte, in Verbindung brachte. Inzwischen ist, wie Sie wissen, der Täter ermittelt worden, und zwar in einer ganz anderen Person, als der jenes Agenten, als dessen Mitschuldigen sich unser Verwandter in seiner unglückseligen Verwirrung betrachtete. Aber »Semper aliquid haeret«.
Um das Andenken eines in jeder Beziehung untadeligen Beamten von gegenstandslosem Verdachte zu reinigen, halten wir, seine Familie, es nunmehr für angemessen, den Tatbestand jener Angelegenheit, soweit er den Verstorbenen angeht, in seinen eigenen täglichen Aufzeichnungen der Öffentlichkeit zu übergeben. Wir stellen Ihnen dabei anheim, die etwa kompromittierenden Personalien, die darin zur Sprache gelangen, nach Gutdünken unkenntlich zu machen.
Für die Familie des Geheimen Rats Glumkow
in vollkommener Hochachtung ergebenst
Dr. Albert Glumkow
Gymnasial-Professor
Donnerstag, 2.
Diesmal muß ich es als eine wirkliche Zurücksetzung auffassen. Obwohl ich an der Ausarbeitung der neuen Umsturzvorlage den Hauptanteil habe, ist die Vertretung des Ministers im Reichstage nicht mir, sondern dem Geheimrat v. Ehwald übertragen worden. Mit dem Gesetz wird zwar auch diesmal nicht viel zu machen sein, so gut wir die öffentliche Meinung fortdauernd bearbeiten mögen. Die Roten haben zuviel heimliche Bundesgenossen im Reichstage. Alles was »sozial« angekränkelt ist, fühlt sich durch unsere Vorlage betroffen. Also im Grunde ein undankbares Geschäft sie zu vertreten. Aber es bringt einen doch in Sicht. Man empfiehlt sich, je unwahrscheinlicher ein Erfolg ist, desto mehr durch Überzeugungstreue. Auf alle Fälle ist es ein Affront, nach dem es eigentlich nur noch den Abschied gibt. Der ist aber unmöglich aus den bewußten Gründen – ich möchte das Gesicht meiner 1. Frau bei der Nachricht sehen –, oder aber dem Ehwald ist ein Stein hinzuwerfen. Er ist eine Null, nur dekorativ und sich Sr. Exzellenz empfehlend. Man muß die Amendements abwarten, die der nächste Ministerrat bringen wird. Ehwald, den ich unter irgendeinem Vorwand im Stich lassen kann, wird zu ihrer Abfassung unfähig sein.
Sonnabend, 4.
Wieder ein Dokumentendiebstahl im Ministerium. Es ist unerhört. Ich sehe noch den unglücklichen Kanzleidirektor Brummer vor mir, wie er unter dem Blick des Ministers zusammenknickte. Ich erkannte unsere gutmütige Exzellenz gar nicht wieder. Aber es ist wahr, daß der Spaß aufhört, wenn die geheimsten Falten unserer Aktenmappen nicht mehr vor den Helfershelfern der Roten sicher sind. Wir könnten schließlich unsere Kanzleien gleich mit den Büros des »Vorwärts« vereinigen, das würde das Budget nicht unwesentlich entlasten. Hätte ich nur nicht der ganzen Szene zwischen Sr. Exzellenz und Brummer beiwohnen müssen! Es war kein Abgang tunlich. Zwanzig Beamte standen herum, wie zu einer fürchterlichen Musterung. Ich bin noch ganz überwältigt. Dem Mann sind die stillen Freuden des a.-D.-Standes sicher. Und wäre es nicht vorsichtiger, ich möchte sagen staatsmännischer, ihm gleich nachzufolgen, anstatt einen ähnlichen Anlaß abzuwarten – der alle Tage eintreten kann? Aber der Ministerrat steht noch bevor; er kann Ehwald teuer zu stehen kommen. Wir werden ja sehen.
Mittwoch, 8.
Schlimme Tage. Ich bin seit der Brummerschen Sache noch immer fieberhaft erregt und trage so etwas wie die Vorahnung eines Unglücks mit mir herum. Unsinn. Als ob es hieran nicht gerade genug wäre. Beßhardt erfüllt mich auch mit den gemischtesten Gefühlen, sooft ich genötigt bin, seinen Rapport entgegenzunehmen. Er hat von seinen mannigfachen früheren Berufsarten – Wechselagent und Reisender in Glanzwichse, glaube ich – eine biedermännische Kraft der Überzeugung von der Güte der Sache, die er vertritt. Als Agent provocateur ist er vollkommen oller ehrlicher Seemann. Es wirkt ja ganz komisch, wenn er sich über die Treulosigkeit eines von ihm angeworbenen Roten entrüstet, der auf dem Wege war, ihn den Genossen zu verraten. Kaum habe er ihn noch kaltstellen können. Er erzählt lauter solche Geschichten, die höchstens ins Polizeipräsidium gehören, bei uns aber dem Orte keineswegs angemessen sind. Und wenn der Mensch seine laute Biedermannsstimme mäßigen könnte. Unmöglich; in meinem Vorzimmer wäre alles zu hören gewesen. Ich mußte mit ihm in Ehwalds (der gerade abwesend war) Kabinett eintreten, wo man sicher ist. Aber sich mit Beßhardt allein zu befinden, ist auch kein Vergnügen. Es kompromittiert einen gewissermaßen. Jedermann fühlt, daß der Mensch, wie er die Genossen an uns verrät, geradesogut auch imstande wäre, uns an die Genossen zu verkaufen. Man kann in diesen Zeitläuften, wo, natürlich abgesehen von Sr. Exzellenz, niemand hoch genug steht, um ganz außer Verdacht zu bleiben, gar nicht vorsichtig genug sein. Der Mensch hat ein gewisses Augenzwinkern, womit er einen, ich möchte fast sagen, zu seinem Komplicen macht. Na, er tritt morgen seine Provinztour an, um die Stimmung zugunsten unserer Pläne zu bearbeiten. Ich werde einige Zeit von ihm befreit sein.
Sonnabend, 11.
Die Sache ist schief gegangen. Ehwald hat Glück gehabt, wie alle diese repräsentativen Strohköpfe. Die Minister machen dem Entwurf weiter keine Schwierigkeiten. Ehwald ist der Blamage entgangen. Als ich den Minister heute behutsam sondierte, übrigens ohne nennenswerte Hoffnung, winkte er mir deutlich ab. »Mein lieber G., Sie sind ehrgeizig. Wir müssen alle ehrgeizig sein. Aber Sie sind zu ehrgeizig.« Er sah mich bei dem letzten Wort schief an und wand sich hin und her, als hätte er