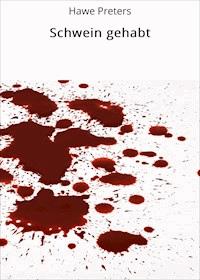4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ehemalige Journalistin Petra trifft in Lübeck zufällig einen Mann namens Henry, der ihr nach und nach seine Lebens- und Leidensgeschichte erzählt und einen Mord an zwei Neonazis gesteht. Im Mittelpunkt seiner Geschichte steht der 1996 von ihm erlebte Brand einer Asylbewerber-Unterkunft mit vielen Toten und Verletzten. Aufgrund dieses Ereignisses erleidet er Jahre später eine posttraumatische Störung. Die Suche nach den Verantwortlichen des Brandes be-stimmt zunehmend Henrys Leben. Petra ist skeptisch, ob sie Henrys Geständnis glauben soll. Sie will die Wahrheit herausfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hawe Preters
"Nur Gott kennt die Wahrheit"
Ein Roman mit realen Bezügen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Erklärungen
Impressum neobooks
Kapitel I
„Warum hatte er mir erzählt, dass er zwei Menschen getötet hat und weitere umbringen will? Warum gerade mir? Er kannte mich doch kaum. Glaubte er, ich verrate ihn nicht? Wollte er sich entlasten, auf diese blöde Weise entlasten ausgerechnet bei mir? Was fang ich jetzt an mit dieser Last?“
Petra saß aufrecht im Bett des Hotelzimmers, schüttelte den Kopf und sprach leise vor sich hin. Es war noch recht früh an diesem Sonntagmorgen. Der beginnende Tag warf sanftes Licht durch die Vorhänge, doch in der Nacht hatte Petra mehr gegrübelt als geschlafen.
Petra fragte sich, ob sie den Aussagen des Mannes tatsächlich glauben konnte. Vielleicht habe er sie auch nur verarscht, dachte sie, ihr einen Bären aufgebunden, sich wichtig gemacht. „Ich könnte mich lächerlich machen, glaubte ich ihm unbenommen.“
Die beiden letzten Abende einfach auf sich beruhen zu lassen, das kam ihr nicht in den Sinn. Ihre Neugierde war geweckt worden. „Entspricht das Geständnis dieses kleinen bärtigen Mannes der Wahrheit?“ Sie musste unbedingt noch einmal mit dem Mann sprechen. Nein nein, noch konnte sie ihn nicht an Polizei oder Staatsanwaltschaft verraten, noch wollte sie seinen vollständigen Namen niemandem nennen.
Petra traf den Mann – oder traf er sie? – am Freitagabend in Lübeck. Sie hatte sich eine kurze Auszeit von Freitag auf Sonntag genommen, um mal wieder die Stimmung auf den dortigen Weihnachtsmärkten einzufangen, und war am Freitagnachmittag mit dem Zug aus Hamburg angereist. Trotz der Pandemie war die Breite Straße voll mit Besuchern, und um so manchen Stand mit Allerwelts-Handwerkskunst bildeten sich Menschentrauben – wie das eben so ist: Die Neugierde oder das Gefühl, man könnte etwas verpassen, zieht die Menschen fast magisch dorthin, wo sich schon mehrere andere aufhalten.
Aber ansonsten wiederholten sich die Angebote der Stände, sogar Kunst- und Haushaltsprodukte aus Olivenholz wurden an mindestens drei unterschiedlichen Stellen angeboten. Darüber wunderte sich Petra, denn sie wollte vor Wochen ihren zerschlissenen Kunststoff-Pfannenwender gegen ein natürliches Produkt aus Olivenholz austauschen, der aber in keinem Geschäft mehr zu finden war. Offenbar werden die speziell für Weihnachtsmärkte produziert, dachte sie, denn hier hätte sie dutzende kaufen können.
Herzallerliebst waren die beiden etwa Zehnjährigen, vermutlich Geschwister, die mit Blockflöte und immerhin kleiner Schüler-Geige gegen das Gebrabbel der Ziehenden ihr „Oh du fröhliche“ wagten und über Petras 50-Cent-Münze in wahre Begeisterung ausbrachen. Das ist wohl etwas übertrieben, aber immer wieder besonders ist das nicht Erwartete oder Außergewöhnliche oder Exotische. So auch dieses dunkelhäutige, fast schwarze Gesicht, das am nächsten Stand die „echten Dresdner Christstollen“ der Feinbäckerei Walther anpries. Dieser dunkelhäutige Mann, verkleidet als heimatverbundener sächsischer Trachtenträger, nannte mit sächsischem Akzent die Kaufpreise des Gebäcks, indem er zwei verschiedene Stollen weißbehandschuht in die Höhe hob, wobei die goldenen Jackenknöpfe im Licht der Lampions glänzten. Der Mann war sicherlich froh, dass er mal das dunkle Sachsen verlassen konnte.
Eine Ecke weiter erklangen schräge Töne aus einer kleinen Nebenstraße. Dort hatte sich, einige Meter entfernt vom Menschenstrom der Breiten Straße, ein gebeugter Mann mit wuscheligem Haar und auf die Nasenspitze gerutschter Brille postiert, um mit völlig unmelodischem Gesang, sich selbst begleitend durch Zupfen der jeweils falschen Saite seiner Gitarre, einige Cent oder Euros zu erbetteln. Petra gab nichts. Auch der Drehorgelspieler vom ‚Travemünder Leierkasten Duo‘ – den Kopf mit bayrischem Filzhut bedeckt –, der, den rechten Arm immerfort kreisend, in rasanter Abfolge zwischen ‚Ave Maria‘ und Rock’n‘Roll alles aus seinem Kasten herausholte, bekam nichts.
Von der Breiten Straße ging Petra durch die Arkaden auf den umschlossenen Marktplatz, der mit Buden und Ständen bestückt war wie jedes Jahr. Funkelnde Lichtergirlanden erleuchteten die frühe Dämmerung. Mit dem Prager Schinken im aufgeweichten Brötchen ging sie zum Getränkestand auf der Nordseite des Platzes, vor den Laubengang und direkt unterhalb der aus Sandstein gestalteten Renaissance-Fassade des Rathauses, die von Granit-Säulen getragen wird und deren Entstehungszeit von zwei vergoldeten Löwen schräg unterhalb des linken Giebels gerahmt ist.
An diesem Getränkestand war es, jedenfalls in den Vorjahren, immer etwas ruhiger.
Mit einem Becher voll Glühwein und Schuss und mit dem aufgeweichten Brötchen ging sie über den großflächig mit Mulch aus gehäckseltem Holz bedeckten Boden zu einem der im erlaubten Abstand aufgestellten Steh-Tische. Der Mulch-Boden diente wohl dem Zweck, heruntergefallene Essensreste oder Erbrochenes zu verbergen.
Kaum hatte Petra den ersten Bissen vom Brötchen heruntergeschluckt, gesellte sich ein mindestens einen halben Kopf kleinerer Mann mit gefülltem Becher und unter die Nase gerutschter oder geschobener Mund-Nasen-Maske wortlos zu ihr, obwohl es noch einige freie andere Tische gab.. Er hob den Becher zum Trinken an und stoppte auf halbem Weg zum Mund, denn Petra überraschte ihn mit dem Ausruf „Maske!“. Er hatte doch tatsächlich seine Maske noch vor dem Mund – hatte wohl schlichtweg vergessen und weiter nicht gemerkt, dass er sie trug, so wie der Armbanduhr-Träger die Uhr erst dann spürt, wenn er sie nicht mehr trägt. Mit einem „Oh ja“ und – nach dem Abnehmen der Maske – verschmitztem Grinsen hinter dem zauseligen Vollbart bedankte er sich und mit „Ja dann Prost“ hoben beide gemeinsam ihre Becher.
Dieses eigentlich fürchterlich süße Getränk lobte der Mann mit „Das schmeckt ja teuflisch gut!“ So eröffnete er und suchte das Gespräch mit Petra, fragte, ob der Prager Schinken lecker sei, bei welchem Stand es ihn gebe, ob sie denn schon auf dem historischen Weihnachtsmarkt bei St. Marien gewesen sei, dass ihn wegen Höhenangst nichts und gar nichts auf das Riesenrad am Koberg bringen könne, ob sie Lübeckerin sei oder nur zu Besuch, dass die Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen zwar ärgerlich, aber wohl notwendig seien, er nicht so viel trinken wolle, da er am Folgetag wieder früh zum Dienst als Briefzusteller erscheinen müsse.
Zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs, das überwiegend von ihm bestimmt wurde, hatte er bereits vier Becher Glühwein intus. Mehr aus Gründen der Geselligkeit beteiligte sich Petra mit einem Glas Rotwein, immerhin trocken, aber trotz des Preises sicherlich von billigster Sorte.
Hin und wieder schweiften ihre Gedanken zur Frage, was dieser Mann von ihr wolle. Kleiner Mann und größere Frau – gibt es da nicht die Klischees: ‚Er steht drauf‘; oder: ‚Das Gefühl von Minderwertigkeit wird kompensiert durch rhetorische Charme-Offensive‘?
Nun denn, der Mann war nicht Petras Typ. Aber zunehmend bewunderte sie seine Standfestigkeit – ja, beide standen sich tatsächlich die ganze Zeit, immerhin schon über zwei Stunden, stehend an dem Steh-Tisch gegenüber – und sie bewunderte seine Gesprächigkeit, zumal sie eher als wortkarg bekannt ist. Wobei: „Bewunderung“ nicht der passende Ausdruck ist, besser wäre vielleicht Verwunderung. Eigentlich wollte Petra sich irgendwo warm und gemütlich hinsetzen, ohne von Geschwätzigkeit zugedröhnt zu werden. Aber irgendwie ergab sich die Situation nicht oder der Redeschwall des Mannes ließ es nicht zu oder er hatte doch eine kleine Neugierde in Petra ausgelöst, jedenfalls zog er sie zunehmend in seinen Bann.
Geradezu freiwillig offenbarte sie ihm ihre Hotel-Adresse und nannte ihren Namen und duzte ihn, nachdem er sowieso schon ins Du gefallen war und ihr seinen Vornamen verraten hatte. „Ich bin der Henry“, hatte er gesagt. Nicht einfach „Henry“, sondern „der Henry“.
„Dann bist du also der Henry Maske“, warf Petra ein. Das war ihr spontan eingefallen, vielleicht weil er vorhin auf ihren „Maske!“-Ausruf reagiert hatte und – das klingt jetzt vielleicht albern – sie bei „Maske“ immerzu an diesen Boxer denkt. Natürlich bestand kein Vergleich mit dem echten Henry Maske, diesem sogenannten Gentleman-Boxer mit kantigem Gesicht und mit aufrechter Haltung, der bestimmt zwanzig Zentimeter größer ist als Petras Gesprächspartner. Ja, die Blödheit dieser Namensgebung war ihr durchaus bewusst, aber sie gab zu, dass sie sich der Faszination eines guten Boxkampfes nicht entziehen kann. Selbst eine ausufernde Schlägerei löst bei ihr neben der mitleidenden Angst auch erregte Spannung aus.
Der Henry ihr gegenüber schien es nicht blöd zu finden, so genannt zu werden. Er kicherte. Trotz der aufkommenden Neugierde versuchte Petra jedoch gleichzeitig, Worte einer Verabschiedung zu finden, die ihn nicht vor den Kopf stoßen würden.
Bevor Petra sie aussprechen konnte, kam er ihr zuvor: „Du weißt, dass ich morgen wieder früh raus muss, aber einen kleinen Abschiedstrunk in gemütlicher Atmosphäre schaffen wir doch noch, oder? Ich kenn, nicht weit entfernt, eine kleine nette Kneipe. Hast Lust?“
Überrumpelt fiel ihr nur „Aber nur kurz“ ein und schon verließen beide den Markt und schlenderten durch diese hässliche Straße namens ‚Schüsselbuden‘ – ein merkwürdiger Name, es müsste mal der Namensursprung ermittelt werden -, in der die mächtige Westfront der Marienkirche fast erschlagend wirkt, am Polizeirevier links ab in die ‚Mengstraße‘, unterm Nasenschild des Schabbelhauses entlang, bogen rechts ab in die Kopfstein-gepflasterte ‚Siebente Querstraße‘ und querten plötzlich die ihr bekannte ‚Beckergrube‘. Diese Straße musste sie auch immer passieren, wenn sie zu ihrem Hotel in die ‚Fischergrube‘ wollte. Wollte der Henry jetzt etwa mit ihr in ihr Hotel, der Schlawiner?
Aber nein, beide kamen kurz darauf in die ‚Clemensstraße‘. Hier also sollte die kleine Kneipe sein, die Henry ihr auf ihrem kurzen, vielleicht zehnminütigen Spaziergang durch den kalten Dezember-Abend beschrieben hatte. Eine Kneipe mitten im ehemaligen Rotlichtviertel, in dem es mal vierzehn Bordelle gegeben haben soll. Oh Gott, müssen die Lübecker Männer bedürftig gewesen sein!
Einige Fassaden der dortigen Häuser mit den bunten Kacheln und kleinen Fensterluken sahen trotz des schmuddeligen Eindrucks dieser kurzen Straße interessant aus, soweit dies zu erkennen war, denn es gab dort keine weihnachtlichen Lichterketten, die die Dunkelheit erhellten. Die wenigen Passanten schienen eher einem studentischen Milieu zu entstammen. Die Häuser machten den Eindruck, dass man hier noch bei einigermaßen günstiger Miete wohnen könnte.
Dann erreichten beide das Lokal, ‚schickSAAL‘ hatten es die Pächter oder Besitzer genannt. Nun denn, richtig schick war es nicht, und unter einem ‚Saal‘ wäre etwas Größeres zu erwarten. Schnell fanden beide zwei Sitzplätze - wie denn auch sonst, waren doch noch nicht einmal die Hälfte der Tische besetzt. Aber Henry wollte unbedingt etwas entfernt von anderen sitzen. Das war Petra auch recht. Er legte die Pudelmütze – schütteres Haar kam zum Vorschein – und den Parker – ein kleiner Schwabbelbauch quoll über den Gürtel – auf den Nachbar-Stuhl. Sein Bio-Bier und ihr Mate-Tee kamen gleichzeitig, so dass beide sich hätten zuprosten können, wäre ihr der Tee nicht zu heiß gewesen.
„Ich trink dann schon mal“, sagte er und leerte das Glas in einem Zug.
„Oh Mann“, staunte sie, „du musst ja mächtig Durst haben“.
Statt darauf einzugehen erzählte er weiter über sich und warum er diese Kneipe vorgeschlagen hatte. In diesem Haus sei früher eine andere Kneipe gewesen, ‚Clemens‘ genannt, mit anderer Orientierung, die habe er früher hin und wieder besucht. Die jetzige Kneipe, die tagsüber als Café geführt werde, habe er erst vor wenigen Monaten wiederentdeckt, obwohl er ganz in der Nähe wohnen würde. Aber so häufig komme er nun mal nicht durch die Clemensstraße. Außerdem sei Petras Hotel nicht weit entfernt, so habe sie es nach dem Abschiedstrunk nicht mehr weit.
Insgeheim schmunzelte Petra, denn so altruistisch schätzte sie Henry nicht ein. „Der will bestimmt was von mir, gleich kommt er mit der Sprache raus“, dachte sie. Fragte aber stattdessen: „Wieso ‚schickSAAL‘? Weißt du, was die Leute sich dabei gedacht haben? Ist es mehr als ein Wortspiel?“
„Nein, keine Ahnung“, antwortete Henry, „vielleicht weil die Eröffnung vor einigen Jahren ein Wagnis war in dieser Gegend. Hier kommen ja nur selten die Touristengruppen durch, und allein von den Studenten und Linken und Alternativen kann der Laden schließlich wohl nicht leben.“
Er sprach jetzt viel leiser als vorher, als draußen auf dem Markt und beim Spaziergang. Petra musste sich ein wenig anstrengen, um sein Geflüster zu hören, und schob ihren Kopf näher in die Tischmitte, so dass sie seine Alkoholfahne erreichte.
„Hat denn das auch mit dir zu tun, mit deinem persönlichen Schicksal, dass du dieses Lokal gewählt hast?“, fragte sie.
Er schaute sie mit großen Augen an, wie ein Kind, das bei einer Lüge erwischt wird. Erwischt, betroffen, gar angstvoll ob befürchteter Sanktionierung? Oder einfach nur mit offenem, klarem Blick trotz Alkoholpegel? Jedenfalls antwortete er nicht, nicht gleich, als müsse er mit Bedacht die Worte suchen.
Der Mate-Tee war abgekühlt genug für Petras Gaumen. Und Henry lenkte nicht ab, sondern verzichtete auf die Bestellung eines weiteren Getränks.
Nach einer gefühlten Ewigkeit – Quatsch, ‚Ewigkeit‘ ist ja wohl was anderes, oder? Nach einer kurzen Weile des Schweigens bemerkte sie Feuchtigkeit in Henrys Augen. Und mit den ersten folgenden Worten bildete sich eine Träne in der Lidspalte auf der linken Schläfenseite, die langsam die Wange herab in den Vollbart rutschte.
„Hier gingen mal Neonazis ein und aus, in den Vorgänger dieser Kneipe, ins ‚Clemens‘“, flüsterte er mit unterdrückter Stimme und sich räuspernd. Petra musste sich noch näher an ihn ran schieben, um ihn zu verstehen. Hinter der Alkoholfahne schob sich ein fauliger Atem aus den Tiefen seines Schlundes in ihre Nase. „Die Leute hier, die jetzigen, haben sie vertrieben, die Faschos.“
Was ist los, wunderte sich Petra. Wieso die Träne, das ist doch großartig, die Neonazis vertrieben zu haben! „Hast du dabei geholfen?“, wollte sie mit einem Lächeln von ihm wissen. Er saß da, zusammengesackt, noch kleiner, ein Häufchen Elend. Er lächelte nicht zurück, stattdessen kullerten weitere Tränen in den Vollbart und von da auf die Tischplatte. Er ließ es zu, wischte die Tränen nicht weg und presste Worte hinaus, die Petra die nächsten Monate beschäftigen würden: „Ich habe sie getötet.“
Kapitel II
Kann man nach dieser Aussage auseinandergehen? Petra war fassungslos und zunächst sprachlos. Natürlich hätte sie nachfragen wollen: „Was sagst du da?“, „Wen hast du getötet?“, „Was soll das?“, „Wie meinst du das?“ – aber Henry entzog sich Petras noch nicht gestellten Fragen, stand einfach auf, irgendwie schwerfällig, aber abrupt, was sich wie ein Widerspruch anhört, aber so hatte sie es empfunden. Ein „Bleib doch!“ war jetzt sicherlich fehl am Platze, aber die rasch erbetene Telefonnummer kritzelte er noch schnell auf den Bierdeckel. Mit einem leisen „Tut mir leid“ und unter Tränen ging er, verließ er das ‚schickSAAL‘.
Ein wenig blöd kam Petra sich schon vor, in „aller Öffentlichkeit“ allein am Tisch zurückgelassen worden zu sein. Das war aber nur ein kleiner Anflug eines negativen Gefühls, denn sie war und ist intelligent und selbstbewusst genug, um hier nicht in eine Mischung aus Verärgerung und Selbstmitleid zu verfallen. Als Jugendliche hätte sie solch eine Situation weniger leicht verkraftet, denn insbesondere aufgrund ihrer äußeren Erscheinung und des Verhaltens ihrer damaligen Umwelt fühlte sie sich wenig beachtet und minderwertig.
Ihre – zu damaliger Zeit für ein junges Mädchen noch außergewöhnliche und auffällige – Körpergröße von 1,80 Metern verharmloste sie gerne und antwortete auf die häufige Frage „Wie groß bist du denn jetzt?“ mit „kurz über einsfünfundsiebzig“.
Mitschüler und Nachbarskinder nannten sie dennoch „Bohnenstange“, zumal sie auch überaus schlank war. Sogar im Tanzkurs mit siebzehn Jahren trug sie immer die flachsten Schuhe, dennoch war ihr Tanzpartner beim Abtanzball kaum größer als sie. Der mochte sie irgendwie trotz ihres kleinen Mundes und trotz ihrer spitzen, etwas zu langen Nase, die unter der dunkel umrandeten Brille hervorlugte und von zweiundzwanzig Sommersprossen umringt war.
Das Foto mit ihrem Tanzpartner bekam damals einen Ehrenplatz in ihrem Fotoalbum. Sie schaut es sich gerne auch heute noch hin und wieder an. Und denkt dabei, dass sie wirklich keine Schönheit war und ist, aber dass ihre spitze Nase doch nur ihre allgemeine Neugierde betont!
Diese Neugierde musste und konnte Petra im Beruf als Journalistin entwickeln, als Lokal-Reporterin einer Provinzzeitung. Lang ist es her, jetzt mit knapp fünfzig Jahren war sie unabhängig, auch unabhängig neugierig, und jetzt neugierig auf diesen Henry, auf sein Verhalten in der Kneipe, auf seine Geschichte. Was steckte hinter seinem „Geständnis“, war das nur dem Alkohol geschuldet?
Sie musste die Zeche zahlen, war nicht teuer, der Tee und das Bier, und der Weg zu ihrem Hotel in der ‚Fischergrube‘ war kurz, so kurz, dass sie die Kälte der Nacht kaum spüren musste. Sie ging hoch, nahm die Treppe in ihr Doppelzimmer, das Erich Mühsam gewidmet war. Die Einzelzimmer waren leider alle vergeben gewesen, und was sollte sie mit der Luxus-Suite namens Günter Grass? Für zwei Nächte? Und das noch freie Doppelzimmer namens Thomas Mann gefiel ihr nicht so sehr. Aber im Mühsam-Zimmer konnte sie jetzt nicht sofort einschlafen. Am Erich Mühsam lag’s wohl nicht. Es war ja auch noch viel zu früh, noch nicht zehn Uhr. Was macht man um 22 Uhr im Hotel, runter in die Bar? Oder doch Fernsehen?
Nein, grübeln, die letzten Stunden durch den Kopf gehen lassen und dann doch irgendwann einschlafen und mit Träumen wieder aufwachen und bemerken, dass die Lampe in der Zimmerecke noch leuchtet und das Gemälde an der Wand (vermutlich Öl) nicht in der eigenen Wohnung aufgehängt ist und nie aufgehängt werden wird, und die Frage, ob die Lampe gelöscht werden sollte, keinerlei körperliche Spannung erzeugt, sondern zunehmend durch Müdigkeit in den Hintergrund gedrängt wird, und sich dann nach erneutem Aufwachen gar nicht mehr stellt, weil das durch das Fenster scheinende angebrochene Tageslicht den matten Schein der Lampe überhellt.
Henrys Verhalten hatte sie schon geärgert, das konnte sie so nicht stehen lassen. Wie konnte der Mann sie um den Schlaf bringen! Er war ihr Antworten schuldig, Antworten, die nicht nur ihre Neugier stillten, sondern ihr keine Lügengeschichten erzählten. Sie wollte das klären, noch mal Kontakt aufnehmen.