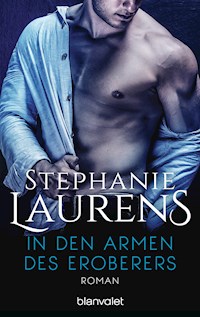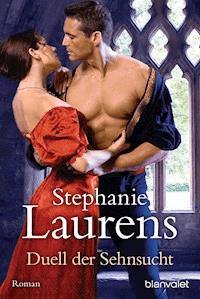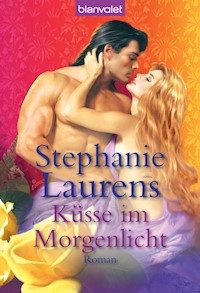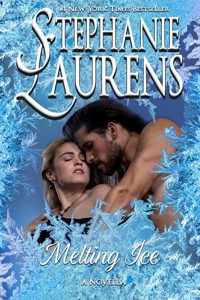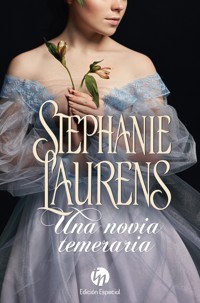Inhaltsverzeichnis
Buch
Kapitel 1 – DEVON, JUNI 1820
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Copyright
Buch
Alasdair ist der letzte Mann aus dem Cynster-Clan, der noch nicht verheiratet ist. Um dem Schicksal seiner Cousins und den Fängen der heiratswilligen Frauen zu entgehen, hat er sich entschlossen, London zu verlassen. Sein Ziel ist sein ehemaliger Mentor Horatio Welham in Devon. Doch als er dort ankommt, entdeckt er, dass Horatio ermordet wurde. Und bevor er irgendetwas tun kann, wird er von der temperamentvollen Tochter des Friedensrichters, Phyllida Tallent, k.o. geschlagen. Mit ihrer Hilfe will er nun den Mörder finden. Doch bei den Ermittlungen gerät die freiheitsliebende Schöne ins Visier des Täters. Denn sie ist die Einzige, die sein Gesicht kennt. Obwohl Alasdair geschworen hat, sich niemals zu binden, verliebt er sich unsterblich in Phyllida. Und auch Phyllida fühlt sich magisch von dem attraktiven und sinnlichen Alasdair angezogen …
Autorin
Stephanie Laurens begann zu schreiben, um etwas Farbe in ihren trockenen wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Romane wurden bald so beliebt, dass sie aus ihrem Hobby den Beruf machte. Heute gehört sie weltweit zu den meistgelesenen und populärsten Autorinnen historischer Liebesromane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne/Australien.
Als Blanvalet Taschenbuch außerdem lieferbar:
Ein verheißungsvoller Kuss (35806) – In den Armen des Eroberers (35838) – Der Liebesschwur (35839) – Gezähmt von sanfter Hand (36085) – In den Fesseln der Liebe (36098) – Ein unmoralischer Handel (36009)
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »All About Love« bei Avon Books, New York.
1
DEVON, JUNI 1820
Abstinenz.
Dieses Wort klang nicht einmal angenehm.
Alasdair Reginald Cynster, allgemein bekannt, und das aus gutem Grund, als Lucifer, schob diesen Gedanken mit einem verächtlichen Schnauben weit von sich und konzentrierte sich stattdessen auf seine beiden hochgezüchteten Schwarzen, die er über die schmale Straße lenkte. Die Straße führte nach Süden auf die Küste zu, Colyton, sein Ziel, lag ein Stück weiter an dieser Straße.
Um ihn herum hüllte der Frühsommer das Land in seine herrlichen Farben. Eine leichte Brise fuhr durch das Korn, Schwalben flogen im Wind hoch über ihm wie schwarze Pfeile vor dem blauen Himmel. Dichte Hecken rahmten die Straße ein, vom Sitz seines zweirädrigen Zweispänners aus konnte Lucifer gerade darüber hinwegsehen. Viel gab es in dieser ruhigen, ländlichen Gegend allerdings nicht zu sehen.
Also gab er sich ganz seinen Gedanken hin. Er lenkte die beiden Schwarzen in einem gemächlichen Tempo auf der kurvenreichen Straße und dachte über die wenig verlockende Möglichkeit nach, ohne die weibliche Gesellschaft auskommen zu müssen, an die er sich so gewöhnt hatte. Es war kein angenehmer Gedanke, aber er würde lieber diese Qualen erdulden, als das Risiko einzugehen, sich dem Fluch der Cynsters unterwerfen zu müssen.
Das war kein Fluch, den man leichtfertig abtun konnte – fünf seiner nächsten männlichen Verwandten waren ihm bereits erlegen, das waren schlicht alle außer ihm. Die Bar Cynsters hatten bei den Damen Londons Eindruck gemacht, die schmachteten und sich nach ihnen verzehrten. Wagemutig, teuflisch und unbesiegbar schienen die Bar Cynsters, bis der Fluch einen nach dem anderen ereilt hatte. Jetzt war er der Letzte von ihnen, der frei war – ungebunden, unverheiratet und unverbesserlich. Er hatte nichts gegen eine Ehe, aber leider war die Krux des Fluches, dass ein Cynster nicht einfach heiratete. Er heiratete nur eine Dame, die er liebte.
Allein dieser Gedanke ließ ihm einen Schauer über den Rücken laufen. Der Verletzlichkeit, die damit einherging, würde er sich niemals willentlich unterwerfen.
Gestern hatte sein Bruder Gabriel genau das getan.
Und das war einer von zwei Gründen, warum er jetzt hier war und sich in die Einsamkeit von Devon begab.
Er und Gabriel hatten einander das ganze Leben lang sehr nahe gestanden, immerhin betrug der Altersunterschied zwischen ihnen nur elf Monate. Der einzige Mensch, den er auf dieser Welt besser kannte als Gabriel, war seine Spielgefährtin Alathea Morwellan. Jetzt war sie Alathea Cynster. Gabriel hatte sie gestern geheiratet und hatte damit Lucifer die Augen dafür geöffnet, wie unausweichlich der Fluch war. Er hatte sein Werk ohne Rücksicht vollendet und hatte gegen jede Übermacht und Wahrscheinlichkeit gesiegt.
Er wünschte Gabriel und Alathea von Herzen Glück, aber er hatte nicht die Absicht, sich die beiden zum Vorbild zu nehmen.
Jetzt nicht. Und sehr wahrscheinlich niemals.
Wozu brauchte er eine Ehe? Was würde er damit gewinnen, was er nicht bereits besaß? Frauen waren ja ganz nett, er liebte es, mit ihnen zu tändeln, er genoss die unterschwellige Herausforderung, auch die Widerspenstigste von ihnen zu erobern und sie in sein Bett zu bekommen. Er genoss es, ihnen beizubringen, gewisse Freuden miteinander zu teilen. Doch weiter ging sein Interesse nicht. Er lebte in anderen Sphären und liebte seine Freiheit, er wollte niemandem Rechenschaft schuldig sein. Er liebte sein Leben so, wie es war, und hatte nicht die Absicht, es zu ändern.
Er war entschlossen, diesem Fluch zu entgehen, er kam recht gut ohne Liebe aus.
Also war er heute Morgen heimlich vom Hochzeitsfrühstück von Gabriel und Alathea verschwunden und hatte London verlassen. Jetzt, wo auch Gabriel verheiratet war, wäre er, Lucifer, das Hauptziel aller Mütter mit unverheirateten Töchtern in der gehobenen Gesellschaft, daher hatte er alle Einladungen zu den sommerlichen Hauspartys ausgeschlagen. Er war nach Quiverstone Manor gefahren, dem Landsitz seiner Eltern in Somerset. Dort hatte er seinen Kammerdiener Dodswell zurückgelassen, der aus dieser Gegend stammte und seine Schwester besuchen wollte. Heute Morgen hatte er Quiverstone schon früh verlassen und war in Richtung Süden gefahren.
Auf der linken Seite der Straße entdeckte er drei Häuser, sie standen an der Einmündung eines schmaleren Weges, der von einer Anhöhe herunterführte. Langsam fuhr er an den Bauernhäusern vorüber und über die Bergkuppe – das Dorf Colyton lag vor ihm. Er zog die Zügel an und sah sich um.
Innerlich verzog er das Gesicht. Er hatte richtig vermutet. So, wie Colyton aussah, standen seine Aussichten, hier eine Frau zu finden, mit der er sich die Zeit vertreiben konnte – eine verheiratete Frau, die seinen Ansprüchen genügte und mit der er das drängende Verlangen stillen konnte, das allen Cynsters eigen war -, gleich null.
Also würde es wirkliche Abstinenz bedeuten.
Das Dorf, das im Schein der Sonne hübsch und ordentlich vor ihm lag, sah aus, als hätte ein Künstler seine Vorstellung einer ländlichen Idylle gemalt, voller Frieden und Harmonie. Rechts vor ihm lag auf einem kleinen Hang der Gemeindeanger, oben stand eine Kirche, ein solider normannischer Bau, neben dem er einen gepflegten Friedhof entdeckte. Hinter dem Friedhof verlief ein weiterer Weg nach unten, wahrscheinlich mündete er ein Stück weiter in die Straße. Die Hauptstraße selbst machte einen Bogen nach links, gegenüber dem Gemeindeanger standen einige Bauernhäuser, an einem davon hing ein Wirtshausschild. Ein Stück davor zierte ein Ententeich den Gemeindeanger, seine Schwarzen stampften mit den Hufen und schüttelten beim lauten Quaken der Enten die Köpfe.
Lucifer beruhigte seine Pferde, dann sah er nach links zum ersten Haus, das in einem Garten stand. Ein Name war über dem Eingang eingraviert. Er kniff die Augen zusammen. Colyton Manor, las er. Sein Ziel.
Es war ein hübsches Haus aus hellem Sandstein, zwei Etagen hoch, und das Dachgeschoss war zu beiden Seiten des Eingangs im gregorianischen Stil mit einer Reihe von Giebelfenstern verziert. Das Haus lag an der Straße hinter einer hüfthohen Mauer, ein großer Garten voller Blumen und blühender Rosen umgab es. Mitten im Garten stand ein runder Brunnen, von dort aus führte der Weg zur Haustür und zu einem Tor zur Straße. Nach hinten wurde der Garten begrenzt durch eine Reihe von Bäumen, die das Haus vom übrigen Dorf trennten.
Ein Kiesweg führte am Haus vorbei zu den Ställen, die in der Nähe der Bäume lagen. Den Weg säumten einige Büsche, ab und zu warf ein Baum seinen Schatten. Ein wenig verwildert reichten die Büsche beinahe bis zu der Stelle, an der der Zweispänner stand, das Blitzen von Wasser zeugte von einem hübschen See.
Colyton Manor sah genauso aus, wie das Haus eines reichen Gentleman sein sollte. Es war das Haus von Horatio Welham, deshalb hatte Lucifer Colyton es als Versteck gewählt.
Horatios Brief hatte ihn vor drei Tagen erreicht. Er war ein alter Freund und sein Lehrmeister. Horatio hatte ihn eingeladen, ihn in Colyton so bald wie möglich zu besuchen. Und da im Augenblick alle Damen der Gesellschaft ihre Blicke auf ihn gerichtet hatten, war für Lucifer dieser Zeitpunkt sofort gekommen – er hatte diesen Brief als Entschuldigung genommen, sich aus dem gesellschaftlichen Durcheinander zurückzuziehen.
Früher war er ein steter Gast in Horatios Haus im Lake Distrikt gewesen, doch dies war sein erster Besuch in Colyton.
Die Schwarzen schüttelten die Köpfe, das Zaumzeug klirrte. Lucifer reckte sich, er griff nach den Zügeln und konnte kaum seine Ungeduld unterdrücken, Horatio wiederzusehen, ihm die Hand zu schütteln und seine Zeit mit diesem belesenen Mann zu verbringen. Was seine Ungeduld noch verstärkte, war Horatios Grund für seine Einladung – er wollte Lucifers Meinung über einen Gegenstand hören, der Lucifer vielleicht dazu bringen könnte, seine Silber- und Edelsteinsammlung auf andere Stücke auszudehnen. Den ganzen Weg von Somerset hatte er darüber nachgedacht, um was für einen Gegenstand es sich dabei wohl handeln könnte, war aber zu keinem Schluss gekommen.
Doch bald würde er es erfahren. Er schlug leicht mit den Zügeln, und die Schwarzen setzten sich in Bewegung. Geschickt lenkte er sie durch das Tor, dann hielt er den Zweispänner neben dem Haus an.
Obwohl die Pferde schnaubten und mit den Hufen scharrten, kam niemand aus dem Haus, um ihn zu begrüßen.
Er lauschte, doch er hörte nichts außer dem Zwitschern der Vögel und dem Summen der Insekten.
Dann erinnerte er sich daran, dass Sonntag war, Horatio und der ganze übrige Haushalt wäre in der Kirche. Er blickte zum Gemeindeanger und bemerkte, dass die Kirchentür ein wenig offen stand. Noch einmal blickte er zur Haustür – auch sie stand offen. Scheinbar war jemand zu Hause.
Er band die Zügel fest, sprang vom Wagen und ging über den Kiesweg zum Tor. Sein Blick fiel auf den blühenden Garten. Der Anblick weckte eine längst vergessene Erinnerung. Vor dem Tor blieb er stehen, dann überlegte er, woran ihn der Garten erinnerte.
Es war der Garten von Martha.
Martha war Horatios verstorbene Frau, sie war der Mittelpunkt gewesen, um den sich der ganze Haushalt im Lake Distrikt gedreht hatte. Martha hatte die Gartenarbeit geliebt, bei jedem Wetter war sie bemüht gewesen, einen herrlichen Anblick zu schaffen – genau wie diesen hier. Lucifer betrachtete die Pflanzen. Der Garten war jenem Garten ähnlich, den Horatio und Martha im Lake Distrikt gehabt hatten. Doch Martha war schon seit drei Jahren tot.
Abgesehen von seiner Mutter und seinen Tanten hatte sich Lucifer enger zu Martha hingezogen gefühlt als zu jeder anderen Frau ihres Alters – sie hatte in seinem Leben einen ganz besonderen Platz eingenommen. Oft hatte er ihren Ratschlägen gelauscht, sich den Worten seiner Mutter hingegen immer taub gestellt. Martha war nicht mit ihm verwandt – es war ihm leichter gefallen, sich von ihren Lippen die Wahrheit anzuhören. Marthas Tod hatte seine Begeisterung, Horatio zu besuchen, ein wenig gedämpft. Zu viele Erinnerungen stiegen dabei wieder auf, das Gefühl ihres gemeinsamen Verlustes war heftig.
Es war eigenartig, jetzt hier Marthas Garten zu sehen, es war beinahe so, als hätte jemand die Hand auf seinen Arm gelegt, und doch war niemand hier. Er runzelte die Stirn – beinahe konnte er Marthas flüsternde Stimme hören.
Heftig wandte er sich ab und trat durch das Tor. Die Haustür stand halb offen, er stieß sie noch weiter auf. Der Flur war leer.
»Hallo! Ist hier jemand?«
Keine Antwort. Er hörte nur das Summen der Insekten von draußen. Er trat über die Schwelle und blieb dann stehen. Es war kühl im Haus und still … als warte alles. Die tiefe Falte auf seiner Stirn wurde noch tiefer, dann ging er weiter, dabei machten seine Stiefel auf dem schwarz-weiß gefliesten Boden ein lautes Geräusch. Er wandte sich gleich zur ersten Tür auf der rechten Seite. Sie stand offen, und er stieß sie noch weiter auf.
Er roch das Blut, noch ehe er durch die Tür trat. Nach Waterloo trogen ihn seine Sinne nicht mehr. Die Haare in seinem Nacken sträubten sich, seine Schritte wurden langsamer.
Hinter ihm strahlte die Sonne hell und warm – doch die Kälte im Haus schien immer stärker zu werden. Sie zog ihn an.
Auf der Schwelle blieb er stehen, sein Blick fiel auf den Körper, der nur wenige Schritte von der Tür entfernt lag.
Ihm wurde ganz kalt. Nur einen kurzen Augenblick zögerte er, dann zwang er sich dazu, den Blick auf das alte, von Falten gezeichnete Gesicht zu richten, auf das schüttere weiße Haar, das von einer Kappe mit einer Troddel bedeckt war. In einem langen weißen Nachthemd, mit einem gestrickten Tuch um die Schultern, das ihm auf den Rücken gerutscht war, sah der tote Mann, dessen einer Arm ausgestreckt lag und dessen nackte Füße zur Tür hin lagen, aus, als würde er schlafen, hier in seinem Wohnzimmer, umgeben von all seinen antiken Büchern.
Aber er schlief nicht – er war auch nicht nur zusammengebrochen. Blut rann aus einem kleinen Schnitt an seiner linken Seite, gleich unter seinem Herzen.
Lucifer zog scharf den Atem ein. »Horatio!«
Er fiel auf die Knie und suchte nach dem Puls am Handgelenk und am Hals, doch er fand ihn nicht. Als er die Hand auf Horatios Brust legte, fühlte er noch einen Anflug von Wärme, ein wenig Farbe lag noch auf den Wangen des alten Mannes. In Lucifers Kopf wirbelten die Gedanken.
Horatio war umgebracht worden – vor wenigen Minuten erst.
Er fühlte sich benommen, abwesend, ein Teil seines Verstandes arbeitete noch, katalogisierte alle Tatsachen, er war ganz der erfahrene Kavallerieoffizier, der er früher einmal gewesen war.
Der einzige tödliche Stoß war ein Stoß nach aufwärts gewesen, direkt ins Herz – wie eine Wunde von einem Bajonett. Sie hatte nicht sehr stark geblutet … eigenartig wenig Blut war geflossen. Mit gerunzelter Stirn sah er noch einmal nach. Unter dem Körper entdeckte er mehr Blut. Horatio war später auf den Rücken gerollt worden – ursprünglich war er mit dem Gesicht nach unten zu Boden gefallen. Lucifer sah etwas Goldenes unter dem Umhang aufblitzen, mit zitternden Fingern suchte er danach – und zog einen langen, schmalen Brieföffner hervor.
Seine Finger schlossen sich um den geschnitzten Griff. Er suchte in der unmittelbaren Umgebung nach Anzeichen eines Kampfes. Der Teppich war nicht verschoben, der Tisch, der zwischen dem Körper und dem Teppich stand, schien sich noch am gleichen Platz zu befinden.
Langsam wich seine Benommenheit. Gefühle stiegen in ihm auf, Lucifer kam allmählich zu sich.
Er fluchte leise vor sich hin, weil er das Gefühl hatte, jemand hätte ihm einen Schlag in den Magen versetzt. Nach der scheinbaren Idylle draußen schien es obszön, Horatio so hier zu finden – ein Albtraum, aus dem er nie wieder aufwachen würde. Das entsetzliche Gefühl des Verlustes überkam ihn, seine Vorfreude lag ihm wie ein bitterer Geschmack in seinem Mund. Fest presste er die Lippen zusammen und holte tief Luft...
Er war nicht allein.
Im gleichen Augenblick, in dem er dieses Gefühl hatte, hörte er auch schon das Geräusch. Dann klirrte etwas hinter ihm und polterte.
Er sprang auf die Füße und umklammerte den Brieföffner …
Etwas Schweres traf ihn auf den Hinterkopf.
Es war ein höllischer Schmerz.
Zusammengesunken lag er auf dem Boden. Wie ein Sack Sand musste er zu Boden gegangen sein, aber er konnte sich an den Schlag gar nicht erinnern. Er hatte keine Ahnung, ob er das Bewusstsein verloren und es erst gerade wiedererlangt hatte oder ob er erst in diesem Augenblick auf dem Boden aufgeschlagen war. Mit seiner letzten Willenskraft gelang es ihm, die Augen einen Spaltweit zu öffnen. Horatios Gesicht verschwamm vor seinen Augen. Er schloss die Augen wieder und unterdrückte ein Aufstöhnen. Mit ein wenig Glück würde der Mörder glauben, er sei bewusstlos, was er auch beinahe war. Die schwarze Dunkelheit der Bewusstlosigkeit drohte ihn einzuhüllen, ihn nach unten zu ziehen. Entschlossen widerstand er.
Den Brieföffner hielt er noch immer in der Faust, doch sein rechter Arm lag unter seinem Körper. Er konnte sich nicht bewegen. Sein Körper fühlte sich an, als sei er bleischwer, er konnte sich nicht verteidigen. Er hätte sich zuerst in dem Zimmer umsehen müssen, doch der Anblick von Horatio, der blutend vor ihm lag … verdammt!
Eigenartig benommen wartete er und fragte sich, ob der Mörder sich wohl noch die Zeit nehmen würde, auch ihn umzubringen, oder ob er einfach nur fliehen würde. Er hatte keine Schritte gehört, die sich entfernten, doch war er gar nicht sicher, dass er überhaupt noch hören konnte.
Wie lange lag er jetzt schon hier?
Von ihrem Platz hinter der Tür starrte Phyllida Tallent mit großen Augen auf den Mann, der leblos neben der Leiche von Horatio Welham lag. Ein leiser entsetzter Aufschrei kam aus ihrem Mund – dieser lächerliche Ton riss sie aus ihrer Benommenheit und ließ sie handeln. Sie holte tief Luft, dann trat sie einen Schritt vor, bückte sich und schloss beide Hände um den Griff der Hellebarde, die jetzt über dem auf dem Boden liegenden Mann lag.
Sie nahm all ihre Kraft zusammen, zählte bis drei und zog dann. Sie stolperte, ihre Stiefel scharrten über den Boden, während sie versuchte, die unhandliche Waffe beiseite zu zerren.
Sie wollte sie gar nicht umstoßen.
Gerade erst hatte sie das Zimmer betreten und Horatios Leiche entdeckt, sie konnte noch gar nicht klar denken, als sie draußen auf dem Kies die Schritte des Fremden gehört hatte. Sie war in Panik geraten, hatte geglaubt, dass er der Mörder war, der zurückgekehrt war, um die Leiche beiseite zu schaffen. Weil das ganze Dorf in der Kirche war, konnte sie sich nicht vorstellen, wer er sonst sein könnte.
Er hatte zwar »Hallo« gerufen, aber das hätte der Mörder vielleicht auch getan, um sich zu versichern, ob jemand seine Tat bereits entdeckt hatte. Verzweifelt hatte sie nach einem Versteck gesucht, aber an den Wänden des langen Wohnzimmers standen so viele Bücherregale – der einzige Ort, an dem sie sich hätte verstecken können, war zu weit weg, um ihn noch rechtzeitig zu erreichen. Verzweifelt hatte sie sich an der einzig möglichen Stelle verborgen – im Schatten gleich hinter der geöffneten Tür, zwischen dem Türrahmen und dem letzten Bücherregal hatte sie sich neben die Hellebarde gezwängt.
Das Versteck hatte seinen Zweck erfüllt, aber als sie erst einmal an seinem Benehmen und seinem gemurmelten Entsetzen festgestellt hatte, dass dieser Mann kein Mörder war, und nachdem sie überlegt hatte, ob es wohl weise wäre, sich bemerkbar zu machen – immerhin war sie die Tochter des örtlichen Friedensrichters und außerdem alt genug, um zu wissen, dass man nicht so einfach in Hosen in die Häuser anderer Menschen schleichen durfte, um dort nach Dingen zu suchen, die andere Leute verloren hatten – als ihr all das klar geworden war und sie festgestellt hatte, dass er kein Mörder war, und sie einen Schritt nach vorn gemacht hatte, um sich bemerkbar zu machen, hatte sie mit der Schulter die Hellebarde umgestoßen.
Sie konnte den Fall nicht mehr aufhalten.
Sie hatte danach gegriffen und vergebens versucht, sie zu halten oder sie zur Seite zu stoßen, doch am Ende war es ihr nur gelungen, sie so weit zu drehen, dass die schwere Klinge den Mann nicht am Kopf traf. Wäre das passiert, dann wäre er wohl gestorben. Doch so war die eiserne Waffe mit einem entsetzlichen Geräusch seitlich gegen seinen Kopf geschlagen.
Als sie die Hellebarde endlich zur Seite gezerrt hatte, legte sie sie auf den Boden. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie leise immer wieder die gleichen Worte vor sich hin geflüstert hatte: Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!
Sie wischte sich die Hände an der Hose ab, ihr war ganz übel, dann schaute sie sich ihr unschuldiges Opfer an. Das Geräusch, mit dem die Hellebarde gegen seinen Kopf geschlagen war, klang noch immer in ihren Ohren. Dass er gerade in diesem Augenblick aufgesprungen war, hatte den Schlag auch nicht abgemildert. Wie eine Feder war er hochgeschnellt, doch die Hellebarde hatte ihn trotzdem getroffen.
Mit einem entsetzlichen Geräusch war er zu Boden gegangen. Und seither hatte er sich nicht mehr bewegt.
Sie machte sich auf das Schlimmste gefasst und trat über den Griff der Hellebarde. »Oh Gott – bitte gib, dass ich ihn nicht umgebracht habe!« Horatio war umgebracht worden, und jetzt hatte sie einen Fremden ermordet. Was geschah nur mit ihrer Welt?
Panik hatte sie ergriffen, als sie auf die Knie sank. Der Mann lag zusammengesunken vor ihr, mit dem Gesicht zu Horatio gewandt …
Lucifer fühlte, dass sich ihm jemand näherte. Er konnte nicht hören und auch nicht sehen, aber er wusste, dass jemand hinter ihm kniete. Der Mörder. Das musste er wenigstens annehmen. Hätte er doch nur genügend Kraft, wenigstens die Augen zu öffnen. Er versuchte es, aber nichts geschah. Die Bewusstlosigkeit drohte ihn zu überwältigen – er weigerte sich, ihr nachzugeben. In seinem Kopf dröhnte es. Gleichzeitig fühlte er, dass der Mörder die Hand ausstreckte. Das Dröhnen in seinem Kopf wurde noch stärker …
Finger – zierliche Finger – strichen sanft und zögernd über seine Wange.
Bei dieser Berührung explodierte der Schmerz in seinem Kopf.
Nicht der Mörder. Erleichterung durchflutete ihn, dann versank er gnadenlos in der schwarzen Tiefe der Ohnmacht.
Phyllida strich dem Mann über die Wange, die Schönheit seines Gesichts machte sie ganz benommen. Er sah aus wie ein gefallener Engel – die reinen, klassischen Linien seines Gesichts konnte es bei einem sterblichen Menschen gar nicht geben. Seine Stirn war breit, seine Nase klassisch, das dichte Haar war ganz dunkel, pechschwarz. Unter den breiten, gebogenen Augenbrauen waren seine Augen sehr groß. Seine Augenlider bewegten sich nicht, und ihr Magen zog sich zusammen. Dann entdeckte sie seine Lippen, schmal und sanft, sie bewegten sich, als würde er atmen.
»Bitte, bitte, stirb nicht!«
Verzweifelt suchte sie an seinem Hals nach einem Puls, dabei verschob sie seine Krawatte. Sie wäre vor Erleichterung beinahe ohnmächtig geworden, als sie den leisen Herzschlag schließlich entdeckte, kräftig und stetig. »Gott sei Dank!« Sie sank in sich zusammen. Ohne nachzudenken rückte sie vorsichtig seine Krawatte wieder zurecht, strich sie glatt – er war so wunderschön, und sie hatte ihn nicht umgebracht.
Draußen auf dem Kiesweg hörte sie das Knirschen von Rädern.
Phyllida sprang auf. Weit riss sie die Augen auf. War das der Mörder?
Ihre Panik legte sich so weit, dass sie die Stimmen erkennen konnte, als der Wagen am Haus vorüberfuhr. Es war nicht der Mörder – es waren die Angestellten des Hauses. Sie warf noch einen Blick auf den bewusstlosen Fremden.
Zum ersten Mal in ihrem Leben fiel es ihr schwer nachzudenken. Ihr Herz hämmerte noch immer wie wild, ihr war ganz schwindlig. Sie holte tief Luft und bemühte sich, sich zu konzentrieren. Horatio war tot, daran konnte sie nichts mehr ändern. In der Tat fiel ihr nichts ein, was jetzt wichtig wäre. Sein Freund war bewusstlos, und das würde er wohl auch noch einige Zeit bleiben – sie musste sich darum kümmern, dass er gut versorgt wurde.
Sie stand in Hosen in Horatios Wohnzimmer, anstatt in der Farm mit Kopfschmerzen im Bett zu liegen. Eine Erklärung konnte sie dafür auch nicht geben, nicht ohne den Grund zu verraten, weswegen sie hier war – diese verlorenen persönlichen Gegenstände. Noch schlimmer war, dass die Gegenstände nicht einmal ihr gehörten. Sie wusste gar nicht, warum sie überhaupt so wichtig waren, warum mit allen Mitteln verhindert werden musste, dass sie entdeckt wurden, deshalb musste sie ganz entschieden ihre Existenz verbergen. Neben all den anderen Dingen hatte sie geschworen, die ganze Sache geheim zu halten.
Verdammt! Jeden Augenblick würde sie entdeckt werden. Mrs Hemmings, die Haushälterin, wäre sicher jetzt schon in der Küche.
Denk nach!
Und wenn sie jetzt einfach heimlich verschwand, anstatt hier zu warten und sich in Erklärungen zu verstricken, wenn sie jetzt einfach weglief, durch den Wald nach Hause schlich, sich umzog und dann zurückkam? Eine Erklärung würde ihr dafür leicht einfallen. In zehn Minuten konnte sie zurück sein. Dann würde sie dafür sorgen, dass man Horatios Leiche entdeckte, und sie könnte sich um die Versorgung des Fremden kümmern.
Das war ein vernünftiger Plan.
Phyllida kam wieder auf die Beine. Ihre Knie zitterten, noch immer fühlte sie sich benommen. Sie wollte sich gerade abwenden, als ihr Blick auf den Hut fiel, der auf dem Tisch hinter Horatios Körper lag.
Hatte der Fremde einen Hut getragen, als er das Zimmer betreten hatte? Das war ihr gar nicht aufgefallen, aber er war so groß, er hätte die Hand ausstrecken und ihn auf den Tisch legen können, ohne dass sie das überhaupt bemerkt hatte.
In den Hüten der Männer war auf dem Hutband oft der Name eingraviert. Sie machte ein paar Schritte um Horatios Körper herum und streckte die Hand nach dem braunen Hut aus.
»Ich gehe nur eben schnell nach oben und sehe nach dem Herrn. Pass auf den Topf auf, bitte.«
Phyllida vergaß den Hut. Sie floh durch den Flur aus der Haustür hinaus, dann rannte sie über die Wiese an der Seite des Hauses in die Büsche.
»Juggs, mach die Tür auf.«
Die leise gesprochenen Worte in einem Ton, den Lucifer sonst nur von seiner Mutter kannte, holten ihn aus seiner Bewusstlosigkeit zurück.
»Nee – das kann ich nicht«, antwortete eine breite Männerstimme. »Das wäre nicht klug.«
»Klug?« Die Stimme der Frau wurde ein wenig lauter. Nach einer kleinen Pause, in der Lucifer förmlich hören konnte, wie sie ihr Temperament zügelte, fragte sie: »Hat er überhaupt schon das Bewusstsein wiedererlangt, seit du ihn aus dem Herrenhaus geholt hast?«
Also war er nicht länger in Horatios Haus. Wo zum Teufel war er nur?
»Nee! Er ist vollkommen weggetreten.«
Das stimmte zwar nicht ganz, aber wenigstens beinahe. Außer dem Gehör funktionierten seine Sinne nicht richtig – außer dem fürchterlichen Schmerz in seinem Kopf fühlte er nicht sehr viel. Er lag auf der Seite, auf einem sehr harten Untergrund. Die Luft war kühl und ein wenig staubig. Er konnte die Augen nicht öffnen – nicht einmal diese Bewegung gelang ihm.
Er war hilflos.
»Woher willst du wissen, ob er überhaupt noch lebt?« Die herrische Stimme der Frau ließ keinen Zweifel daran, dass es sich bei ihr um eine Lady handelte.
»Lebt? Natürlich lebt er noch – warum auch nicht? Er war lediglich besoffen und ist dann ohnmächtig geworden, das ist alles.«
»Besoffen? Juggs, du bist Wirt. Wie lange bleibt ein besoffener Mann wohl ohnmächtig, wenn man ihn an die frische Luft bringt?«
Juggs schnaufte verächtlich. »Er ist ein feiner Herr – wer weiß, wie lange die ohnmächtig bleiben? Sie sind alle ziemlich mies.«
»Man hat ihn zusammengesunken neben der Leiche von Mr Welham gefunden. Was ist denn, wenn er nicht einfach nur ohnmächtig geworden ist, sondern eine Verletzung hat?«
»Woher sollte er die denn haben?«
»Vielleicht hat er ja mit dem Mörder gekämpft und hat versucht, Mr Welham zu retten.«
»Nee! Wenn das so wäre, dann wäre ja der feine Herr hier gar nicht der Mörder – das würde bedeuten, dass zwei verschiedene Leute an einem Tag hier gewesen wären und keiner von uns sie gesehen hätte. Und so etwas passiert hier einfach nicht.«
Die Lady verlor die Geduld. »Juggs – mach jetzt diese Tür auf! Was ist, wenn dieser Gentleman hier stirbt, weil du entschieden hast, dass er nur ohnmächtig ist, und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Wir müssen zumindest nachsehen.«
»Er ist wirklich ohnmächtig, das sage ich doch – er hat keinerlei Verletzung, Thompson und ich haben nachgesehen und nichts gefunden.«
Lucifer nahm all seine Kraft zusammen. Wenn er Hilfe wollte, dann musste er die Lady unterstützen. Er wollte nicht, dass sie sich geschlagen gab und ihn mit diesem gefühllosen Wirt allein ließ. Er hob eine Hand – sein Arm zitterte -, dann legte er die Hand an seinen Kopf. Er hörte ein Aufstöhnen, dann begriff er, dass er es war, der diesen Ton ausgestoßen hatte.
»Da! Siehst du?« Die Stimme der Lady klang triumphierend. »Sein Kopf schmerzt – sein Hinterkopf. Warum wohl, wenn er doch offensichtlich nur ohnmächtig ist? Schnell, Juggs – mach diese verdammte Tür auf. Natürlich stimmt da etwas nicht, der Mörder hat ihn zusammengeschlagen. Was um alles in der Welt habt ihr euch denn nur gedacht?«
»Vielleicht hat er sich ja den Kopf angeschlagen, als er gefallen ist«, grollte Juggs.
Warum um alles auf der Welt glaubte der Mann nur, er sei gefallen? Endlich hörte er, wie Schlüssel klirrten. Die Lady hatte gewonnen, sie kam ihm zu Hilfe. Ein Schloss knarrte, dann hörte er, wie eine schwere Tür geöffnet wurde. Schnelle Schritte näherten sich über einen Steinboden.
Eine schmale Hand legte sich auf seine Schulter. Er fühlte eine warme, weibliche Berührung.
»Bald ist alles wieder in Ordnung.« Ihre Stimme klang leise und beruhigend. »Ich will nur einmal nach Ihrem Kopf sehen.«
Sie beugte sich über ihn, seine Sinne waren soweit zurückgekehrt, dass er begriff, sie war nicht so alt, wie er geglaubt hatte. Diese Erkenntnis gab ihm die Kraft, seine Augen zu öffnen, wenn auch nur ein wenig.
Sie sah es und lächelte ihn aufmunternd an, dann strich sie ihm das Haar aus der Stirn.
Der Schmerz in seinem Kopf schien zu verschwinden. Er öffnete die Augen ein wenig weiter und betrachtete ihr Gesicht. Sie war kein Mädchen mehr, doch noch immer eine junge Lady. Sie musste ungefähr Anfang zwanzig sein, doch ihr Gesicht war ausdrucksstärker, kräftiger und entschlossener als das anderer Mädchen in ihrem Alter. Das entging ihm nicht, doch das war es nicht, was seine Aufmerksamkeit so fesselte, dass er den lähmenden Schmerz in seinem Kopf beinahe vergaß.
Ihre braunen Augen waren groß und weit aufgerissen, voller Mitgefühl – einem Mitgefühl, das so ehrlich war, dass es seinen Zynismus überwand und ihn rührte. Diese hübschen Augen lagen unter einer breiten Stirn und sanft geschwungenen Augenbrauen, dunkles Haar umgab das Gesicht, es war beinahe so dunkel wie sein eigenes, kurz geschnitten rahmte es ihr Gesicht ein, beinahe wie ein Helm. Ihre Nase war gerade, ihr Kinn spitz, ihre Lippen …
Der plötzliche Ansturm sinnlicher Gefühle war fehl am Platz, Horatio war tot. Er schloss die Augen.
»Sie werden sich schon bald besser fühlen«, versprach sie ihm. »Wenn wir Sie erst einmal in ein bequemes Bett gelegt haben.«
Juggs stand hinter ihr und schnaubte verächtlich. »Aye – ich wette, so einer ist er. Und außerdem ist er auch noch ein Mörder.«
Lucifer ignorierte Juggs. Die Lady wusste, dass er kein Mörder war, und sie hatte hier das Sagen. Ihre Finger fuhren leicht durch sein Haar und suchten vorsichtig nach seiner Wunde. Er spannte seinen Körper an, dann biss er die Zähne zusammen, als sie über seine Wunde strich.
»Siehst du?« Sie schob sein Haar zur Seite und berührte die Wunde. »Man hat ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, mit irgendeiner Waffe.«
Noch einmal schnaubte Juggs. »Vielleicht hat er sich ja den Kopf an dem Tisch im Haus aufgeschlagen, als er ohnmächtig geworden ist.«
»Juggs! Du weißt genauso gut wie ich, dass diese Wunde dafür viel zu groß ist.«
Mit geschlossenen Augen atmete Lucifer flach. Der Schmerz übermannte ihn, ihm wurde ganz übel. Verzweifelt versuchte er, sich das Gesicht der Lady wieder ins Gedächtnis zu rufen, er bemühte sich, sich auf irgendetwas zu konzentrieren, um den Schmerz in Grenzen zu halten. Ihr Hals war anmutig. Und das ließ auf den Rest ihres Körpers schließen. Sie hatte ein Bett erwähnt. Bei diesem Gedanken hielt er inne, wieder einmal verwirrten ihn seine Gedanken.
»Lassen Sie mich mal sehen«, brummte Juggs.
Eine schwere Hand legte sich auf Lucifers Kopf – der Schmerz darin schien zu explodieren.
»Papa, dieser Mann ist ernsthaft verwundet.«
Die Stimme seines Schutzengels rief Lucifer in die Wirklichkeit zurück. Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, seit sie das letzte Mal bei ihm gewesen war.
»Er hat einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Juggs hat die Wunde auch gesehen.«
»Hmm.« Schritte näherten sich. »Stimmt das, Juggs?«
Es war eine neue Stimme, tief und kultiviert, mit dem Akzent der Gegend. Lucifer fragte sich, wer »Papa« wohl sein mochte.
»Aye. Es sieht ganz so aus, als hätte er einen Schlag abbekommen, und zwar einen heftigen Schlag.« Juggs – dieser Trottel – war immer noch da.
»Und du sagst, er hat diese Wunde am Hinterkopf?«
»Ja – hier.« Lucifer fühlte, wie die Finger der Lady ihm das Haar zur Seite strichen. »Aber du darfst sie nicht anfassen.« Glücklicherweise tat »Papa« das auch nicht. »Sie scheint sehr empfindlich zu sein – er hat für einen Augenblick das Bewusstsein wiedererlangt, aber als Juggs seinen Kopf angefasst hat, ist er wieder ohnmächtig geworden.«
»Das ist wohl kaum verwunderlich. Er hat einen ziemlichen Schlag abbekommen. Und zwar sehr wahrscheinlich mit dieser Hellebarde von Horatio, wie es aussieht. Hemmings sagt, er hat die Hellebarde neben diesem Gentleman hier gefunden. Wenn man bedenkt, wie schwer das Ding ist, ist es ein Wunder, dass er nicht tot ist.«
Die Lady ließ das Haar wieder zurückfallen. »Also ist es doch wohl offensichtlich, dass er nicht der Mörder sein kann«, meinte sie.
»Nicht mit dieser Wunde und der Hellebarde, die neben ihm gelegen hat. Es sieht so aus, als hätte sich der Mörder hinter der Tür versteckt und wäre auf ihn losgegangen, als dieser Mann hier die Leiche entdeckt hat. Mrs Hemmings schwört, dass das Ding nicht von selbst umgefallen sein kann. Und das scheint auch offensichtlich zu sein. Also müssen wir einfach nur warten und sehen, was dieser Gentleman uns erzählen kann, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt.
Herzlich wenig, meinte Lucifer insgeheim.
»Nun, es wird ihm auf keinen Fall besser gehen, solange er in dieser Zelle hier liegt.« Die Stimme der Lady hatte einen entschiedenen Klang angenommen.
»In der Tat nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was Bristleford sich gedacht hat, wie er auf den Gedanken kommen konnte, dass dieser Kerl hier der Mörder ist, der bei dem Anblick von Blut ohnmächtig wurde.«
Ohnmächtig beim Anblick von Blut? Wäre es ihm möglich gewesen, hätte Lucifer verächtlich geschnaubt, aber er konnte noch immer nicht sprechen. Der Schmerz in seinem Kopf schien nur darauf zu warten, ihn wieder in die Bewusstlosigkeit zu treiben. Er konnte nichts anderes tun, als einfach nur still dazuliegen und alles zu erfahren, was möglich war. Solange die Lady das Kommando übernahm, war er in Sicherheit – es schien so, als handele sie in seinem Interesse.
»Ich dachte, Bristleford hätte gesagt, er hätte ein Messer in der Hand gehabt.«
Diese Worte kamen natürlich von Juggs.
»Papa« schnaubte verächtlich. »Selbstverteidigung. Er hat wohl gespürt, dass der Mörder hinter ihm war, und hat dann nach der einzigen Waffe gegriffen, die in der Nähe war. Auch wenn er sich damit leider nicht gegen eine Hellebarde verteidigen konnte. Nein – es ist wohl offensichtlich, dass jemand die Leiche gefunden und sie umgedreht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Mörder diese Mühe gemacht haben sollte – Horatio hatte ja nichts Wertvolles in seinem Nachthemd versteckt.«
»Also ist dieser Mann hier unschuldig«, schloss die Lady. »Wir sollten ihn wirklich auf die Farm bringen.«
»Ich reite zurück und schicke euch einen Wagen«, antwortete »Papa.«
»Ich werde hier warten. Und sage Gladys, sie soll so viele Kissen mitschicken wie sie nur kann und …«
Die Worte der Lady entfernten sich. Lucifer lauschte nicht länger. Sie hatte gesagt, sie würde hier bei ihm bleiben. Es hatte sich so angehört, als sei die Farm »Papas« Haus, also würde sie sehr wahrscheinlich auch dort leben. Hoffentlich. Er wollte mehr von ihr sehen, wenn seine Schmerzen erst einmal nachgelassen hatten. Der Schmerz in seinem Kopf und auch der Schmerz in seinem Herzen.
Horatio war ein sehr lieber Freund gewesen – wie nah er ihm gestanden hatte, bemerkte er erst jetzt, als er nicht mehr da war. Er dachte über seine Trauer nach, doch er war viel zu schwach, um sie verarbeiten zu können. Er versuchte, seine Gedanken abzulenken, versuchte, nicht länger an den Schmerz zu denken, doch das gelang ihm nicht.
Also lag er einfach nur da und wartete.
Er hörte, wie die Lady zurückkam, es waren noch andere Menschen in ihrer Begleitung. Was dann folgte, war nicht angenehm. Glücklicherweise war er der Ohnmacht noch viel zu nahe, nur vage bemerkte er, dass er hochgehoben wurde. Er hatte erwartet, das Rumpeln des Wagens zu fühlen, doch der Schmerz in seinem Kopf war größer.
Dann lag er auf einem Bett und wurde ausgekleidet. Seine Sinne regten sich schwach, er bemerkte, dass zwei Frauen um ihn herum waren, ihren Händen und ihren Stimmen nach waren beide älter als sein Schutzengel. Er hätte ihnen geholfen, wenn es ihm möglich gewesen wäre, doch selbst dazu war er nicht in der Lage. Sie umsorgten ihn, bestanden darauf, dass er ein Nachthemd übergezogen bekam, und waren äußerst bedacht, seinen Kopf dabei nicht zu berühren.
Sie machten es ihm in weichen Kissen und duftenden Laken bequem, dann ließen sie ihn in Frieden.
Phyllida sah nach ihrem Patienten, sobald Gladys, ihre Haushälterin, ihr versichert hatte, dass er versorgt war.
Miss Sweet, ihre alte Gouvernante, saß auf einem Sessel und häkelte eine Spitze. »Er ruht sich aus«, flüsterte ihr Sweetie leise zu.
Phyllida nickte und ging dann zu dem Bett hinüber. Sie hatten ihn auf den Bauch gelegt, damit die Wunde an seinem Hinterkopf geschont wurde. Er war viel größer, als sie gedacht hatte – seine breiten Schultern und seine Brust, der lange Rücken und seine noch längeren Beine – sein Körper schien das Bett auszufüllen. Er war vielleicht nicht der größte Mann, den sie je gesehen hatte, aber sie nahm an, dass er ein sehr vitaler Mann war. Doch jetzt schien eine unpassende Schwere in seinen Gliedern zu liegen, eine Anspannung. Sie sah in sein Gesicht, es war sehr blass, doch sah er sehr gut aus, auch wenn sein Gesicht irgendwie versteinert schien, vollkommen leblos. Die Lippen, die eigentlich den Anflug eines spöttischen Lächelns hätten zeigen sollen, waren fest zusammengepresst.
Sweetie irrte sich – er war bewusstlos, ganz sicher ruhte er nicht.
Phyllida richtete sich wieder auf. Ein Schuldgefühl hielt sie gefangen. Es war ihr Fehler gewesen, dass er den Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Sie ging zurück zu Sweetie. »Ich gehe zu Horatios Haus. In einer Stunde bin ich wieder da.«
Sweetie lächelte und nickte nur. Mit einem letzten Blick auf das Bett verließ Phyllida das Zimmer.
»Das weiß ich wirklich nicht, Sir.«
Phyllida betrat den Flur des Hauses und entdeckte Bristleford, Horatios Butler, der vor der geschlossenen Tür des Wohnzimmers von Mr Lucius Appleby ausgefragt wurde. Beide wandten sich zu Phyllida um, Appleby verbeugte sich vor ihr. »Miss Tallent.«
Phyllida nickte ihm zu. »Guten Tag, Sir.« Viele der Damen des Ortes fanden, dass Appleby mit seinem hellen Haar attraktiv aussah, doch für ihren Geschmack war er viel zu kalt.
»Sir Cedric hat mich gebeten, mich um die Einzelheiten von Mr Welhams Tod zu kümmern«, erklärte ihr Appleby sein Eindringen in dieses Haus. Er war der Sekretär von Sir Cedric Fortemain, einem Landbesitzer des Ortes, das Interesse Sir Cedrics erstaunte niemanden. »Bristleford hat mir gerade erklärt, dass Sir Jasper davon überzeugt ist, dass der Gentleman, den man neben der Leiche entdeckt hat, nicht der Mörder ist.«
»Das ist richtig. Man weiß noch nicht, wer der Mörder ist.« Phyllida hatte keine Lust, sich auf weitere Diskussionen mit ihm einzulassen, stattdessen wandte sie sich an Bristleford. »Ich habe John Ostler gebeten, sich um die Pferde des Gentleman zu kümmern.« Um seine herrlichen Pferde – selbst für ihren ungeübten Blick waren die beiden Pferde Schönheiten und sicher auch sehr wertvoll. Ihr Zwillingsbruder Jonas würde sie sich sehr wahrscheinlich sofort ansehen, wenn er erst einmal davon erfuhr. »Wir werden sie hier in den Stall stellen – die Ställe auf der Farm sind voll, weil meine Tante Huddlesford und meine Cousins angekommen sind.«
Sie waren erst an diesem Nachmittag gekommen, gerade als sie losgelaufen war, um den unbekannten Gentleman zu retten, ihre nutzlosen Cousins waren auch schuld daran, dass sie zu spät gekommen war, um ihn vor Juggs zu retten.
Bristleford runzelte die Stirn. »Wenn Sie glauben, dass es besser ist …«
»Ja, das ist es. Es scheint offensichtlich zu sein, dass der Gentleman zu einem Besuch hierher gekommen ist – offensichtlich war er ein Freund von Mr Welham.«
»Das weiß ich nicht, Miss. Die Hemmings und ich sind noch nicht lange genug in den Diensten unseres Herrn, um all seine Freunde zu kennen.«
»Sicher. Zweifellos wird Covey Bescheid wissen.« Covey war Horatios Kammerdiener, er hatte schon viele Jahre lang bei ihm gearbeitet. »Ich nehme an, er ist noch nicht zurück?«
»Nein, Miss. Er wird am Boden zerstört sein.«
Phyllida nickte. »Ich bin nur schnell gekommen, um den Hut des Gentleman zu holen.«
»Seinen Hut?« Bristleford starrte sie erstaunt an. »Da war kein Hut, Miss.«
Phyllida blinzelte. »Sind Sie sicher?«
»Es lag kein Hut im Wohnzimmer.« Bristleford sah sich um. »Vielleicht liegt er ja in seinem Wagen.«
Phyllida gelang ein Lächeln. »Nein, nein – ich hatte nur angenommen, dass er vielleicht einen Hut mitgebracht hat. Haben Sie auch keinen Stock gefunden?«
Bristleford schüttelte den Kopf.
»Nun, dann verschwinde ich wieder. Phyllida nickte Appleby noch einmal zu, der sich in ihre Richtung verbeugte, dann verließ sie das Haus.
Unter dem Portikus blieb sie noch einmal stehen und blickte über Horatios wunderschönen Garten. Ein Schauer rann über ihren Rücken …
Phyllida hob den Kopf und sah sich um, dann ging sie schnell zum Tor und eilte nach Hause.
Der Schmerz in seinem Kopf wurde größer.
Lucifer warf sich unruhig auf dem Bett hin und her, er bemühte sich, dem messerscharfen Schmerz in seinem Kopf zu entkommen. Hände versuchten, ihn festzuhalten, sanfte Stimmen wollten ihn beruhigen. Er begriff, dass man von ihm verlangte, still liegen zu bleiben – er versuchte es, doch der Schmerz ließ es nicht zu.
Dann kehrte sein Schutzengel zurück. Er hörte ihre Stimme am Rande seines Bewusstseins, sie war der Grund dafür, dass er die Kraft fand, still liegen zu bleiben. Sie wusch ihm das Gesicht, den Hals und seine Schultern mit Lavendelwasser, dann legte sie ein kühles Tuch auf seine Wunde. Der Schmerz ließ nach, und er seufzte auf.
Sie ging, und er wurde wieder ruhelos. Doch noch ehe der Schmerz ihn übermannte, kehrte sie zurück und tauschte das kühle Tuch aus, dann setzte sie sich neben sein Bett und legte ihre kühle Hand auf sein Handgelenk.
Er entspannte sich. Und endlich schlief er ein.
Als er aufwachte, war sie weg.
Es war dunkel, im Haus war es still, alles schlief. Lucifer hob den Kopf – doch der Schmerz ließ ihn innehalten. Er biss die Zähne zusammen, dann drehte er sich auf die Seite und hob den Kopf ein wenig, um sich umzusehen. Eine ältere Frau mit einer Morgenhaube saß zusammengesunken in einem Lehnsessel am Fenster. Er strengte seine Ohren an und hörte ein leises Schnarchen.
Die Tatsache, dass er hören konnte, beruhigte ihn ein wenig. Er legte den Kopf in die Kissen zurück und dachte nach. Auch wenn sein Kopf noch immer sehr schmerzte, wenn er ihn bewegte, so ging es ihm doch wesentlich besser. Er konnte nachdenken, ohne größere Schmerzen zu haben. Er reckte sich, bewegte seine Arme und Beine, sorgsam darauf bedacht, den Kopf ruhig zu halten. Dann entspannte er sich wieder und strengte seine Sinne an, alles schien einwandfrei zu funktionieren. Er war vielleicht noch nicht gesund, doch war er unversehrt.
Nachdem er das festgestellt hatte, konzentrierte er sich auf seine Umgebung. Ganz langsam kehrte auch die Erinnerung an das zurück, was geschehen war, und seine Gedanken ordneten sich wieder. Er war in einem Zimmer, das auf eine Art gemütlich eingerichtet war, die ihm verriet, dass es sich um das Zimmer eines Mannes handeln musste. Er erinnerte sich daran, dass sein Schutzengel »Papa« gerufen hatte und dass der sein Urteil über Lucifers Verwicklung beim Mord an Horatio abgegeben hatte. »Papa« war sehr wahrscheinlich der örtliche Friedensrichter. Wenn das so war, dann hatte er mit ihm genau den richtigen Mann kennen gelernt. So bald es ihm wieder gut genug ging, um seinen Kopf zu bewegen, hatte Lucifer nämlich die Absicht, den Mörder von Horatio zu finden.
Er hielt in seinen Gedanken inne … dann lenkte er sie in eine andere Richtung. Sein Schutzengel war nicht da – zweifellos lag sie schlafend in ihrem Bett.
Nein, nicht diese Richtung.
Innerlich seufzte er auf. Dann schloss er die Augen, schmiegte sich in die Kissen und gab sich ganz seiner Trauer hin.
Er ließ sich von seinem Kummer um Horatio, mit dem er keine schönen Zeiten mehr teilen würde, übermannen – von dem Kummer um den Tod eines Mannes, der wie ein Vater für ihn gewesen war. Es würde keine gemeinsame Freude über eine Entdeckung mehr geben, keine eifrigen Bitten um Informationen mehr, keine gemeinsame Jagd mehr danach, die Herkunft neu entdeckter Schätze herauszufinden.
Die Erinnerungen waren lebendig, doch Horatio war tot. Ein Kapitel seines Lebens war beendet. Es fiel ihm schwer zu akzeptieren, dass er das letzte Kapitel des Buches erreicht hatte und dass er das Buch jetzt schließen müsste.
Der Kummer ließ langsam nach, er hinterließ ein leeres Gefühl in seinem Inneren. Zu oft schon hatte er dem Tod ins Auge geblickt, als dass der Schock darüber lange hätte dauern können. Er kam aus einer Familie von Kriegern, der ungerechte Tod war der Auslöser einer seiner primitivsten Reaktionen. Rache – nicht aus persönlicher Befriedigung, sondern im Namen der Gerechtigkeit.
Horatios Tod würde nicht ungerächt bleiben.
Er lag in den weichen Laken, und sein Kummer verwandelte sich in Zorn und schließlich in eiskalte Entschlossenheit. Seine Gefühle verhärteten sich, in Gedanken kehrte er zu der Szene zurück, die er erlebt hatte, jeden einzelnen Schritt erlebte er noch einmal, erinnerte sich an alles, bis er wieder zu der Berührung kam …
Finger so zierlich, dass sie einem Kind oder einer Frau gehören konnten. Wenn man die Faszination hinter der Berührung bedachte – eine Faszination, die er sofort wiedererkannte -, dann würde er wetten, dass eine Frau dabei gewesen war. Eine Frau, die nicht der Mörder war. Horatio war vielleicht alt gewesen, aber er war nicht so wehrlos, dass eine Frau ihm ein Messer ins Herz stechen konnte. Nur wenige Frauen besaßen diese Kraft oder diese Erfahrung.
Also – Horatio war umgebracht worden. Dann hatte er, Lucifer, den Raum betreten, und der Mörder hatte ihm die Hellebarde auf den Kopf geschlagen. Danach war die Frau gekommen und hatte ihn gefunden.
Nein – so konnte es nicht gewesen sein. Horatios Leiche war umgedreht worden, ehe Lucifer den Raum betreten hatte, er war mit »Papa« einer Meinung – das konnte der Mörder nicht getan haben. Die Frau musste es gewesen sein, und als Lucifer dann erschien, musste sie sich versteckt haben.
Sie musste gesehen haben, wie der Mörder ihm die Hellebarde auf den Kopf geschlagen hatte und dann verschwunden war. Warum hatte sie nicht um Hilfe gerufen? Das hatte ein Mann mit dem Namen Hemmings getan.
Etwas stimmte hier offensichtlich nicht. Noch einmal ging er alle Tatsachen durch, doch das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte, konnte er nicht beiseite schieben.
Eine Diele auf dem Flur knarrte. Lucifer lauschte. Einen Augenblick später wurde die Tür zu seinem Zimmer geöffnet.
Er blieb ruhig auf der Seite liegen, die Augen hatte er halb geschlossen, damit es so schien, als würde er schlafen, doch er konnte noch etwas sehen. Er hörte das leise Klicken, als sich die Tür schloss, dann kamen Schritte näher, und der Schein einer Kerze erhellte das Zimmer.
Sein Schutzengel erschien. Sie trug ein Nachthemd.
Ein paar Schritte vor dem Bett blieb sie stehen und betrachtete sein Gesicht. In einer Hand trug sie den Kerzenhalter, die andere lag zwischen ihren Brüsten und hielt dort einen Umhang fest. Zum ersten Mal sah er sie ganz, und er konnte nicht aufhören, sie zu betrachten, sie abzuschätzen. Ihr Gesicht war genauso wie in seiner Erinnerung, die großen Augen, das spitze Kinn und das glatte dunkle Haar gaben ihr das Aussehen von Intelligenz und weiblicher Entschlossenheit. Sie war mittelgroß, schlank, aber nicht dünn, ihre Brüste waren hoch und fest, unter dem Rand des Umhanges konnte er die rosigen Spitzen entdecken. Ihre Taille unter dem Nachthemd konnte er nicht abschätzen, doch ihre Hüften waren sanft gerundet, ihre Oberschenkel schlank.
Sie hatte nackte Füße. Sein Blick blieb daran hängen, sie lockten ihn. Es waren kleine, nackte, durchaus weibliche Füße. Ganz langsam ging sein Blick zurück zu ihrem Gesicht.
Während er sie betrachtete, hatte auch sie ihn gemustert. Ihre dunklen Augen lagen auf seinem Gesicht, es schien, als wolle sie sich jede einzelne Linie einprägen. Dann wandte sie sich ab.
Lucifer unterdrückte den Wunsch, sie anzusprechen. Er wollte sich bei ihr bedanken – sie war so voller Freundlichkeit und Mitgefühl -, aber wenn er jetzt ein Geräusch machte, würde er sie erschrecken. Er sah, wie sie bei der schlafenden Frau stehen blieb, sie stellte den Kerzenhalter ab, dann griff sie nach einer Decke, faltete sie auseinander und legte sie um die schlafende Frau. Als sie sich wieder abwandte und nach der Kerze griff, lag ein Lächeln um ihren Mund.
Sie ging zur Tür, aber beinahe schien es, als hätte sie seine stille Bitte gehört, denn ehe sie an dem Bett vorüberging, blieb sie noch einmal stehen. Sie sah zu ihm hin, dann trat sie zögernd näher.
Sie hielt die Kerze ein wenig zur Seite, so dass ihr Licht durch ihren Körper abgeschirmt wurde, dann blieb sie noch einmal neben dem Bett stehen und betrachtete sein Gesicht. Er zwang sich, die Augen halb geschlossen zu halten, daher konnte er auch nur noch ihr Gesicht sehen. Ihre Augen waren abgrundtief, der Ausdruck auf ihrem Gesicht unergründlich.
Dann ließ sie ihren Umhang los. Langsam streckte sie die Hand aus. Mit den Fingerspitzen strich sie sanft über sein Gesicht.
Lucifer hatte das Gefühl, als hätte sie ihn gebrandmarkt. Er stützte sich auf einen Ellbogen, umfasste ihr Handgelenk und starrte sie an.
Sie keuchte auf, das Geräusch war laut in dem stillen Zimmer. Der Kerzenhalter schwankte heftig, dann beruhigte er sich wieder. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie ihn an.
Er umfasste ihr Handgelenk noch fester, seine Blicke hielten die ihren gefangen. »Sie waren das.«
2
Phyllida starrte in seine Augen, die von einem so lebhaften dunklen Blau waren, dass sie beinahe schwarz aussahen. Sie hatte diese Augen schon zuvor gesehen, doch auch wenn sie schon da beeindruckend gewesen waren, so waren sie doch leblos gewesen vor Schmerz. Jetzt, wo sich ihr Blick gnadenlos auf sie richtete, strahlten sie wie dunkle Saphire und raubten ihr den Atem.
Phyllida hatte das Gefühl, als sei sie diejenige, die von der Hellebarde getroffen worden war.
»Sie waren da.« Sein Blick hielt den ihren gefangen. »Sie waren die Erste, die bei mir war, nachdem mich der Mörder zu Boden geschlagen hatte. Sie haben mein Gesicht berührt, genau wie jetzt auch.«
Phyllida war bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Gedanken wirbelten durch ihren Kopf. Seine Finger hielten noch immer ihr Handgelenk umfangen, es erschreckte sie. Sie versuchte, ihm den Arm zu entziehen, versuchte, sich aus seiner Umklammerung zu befreien, doch sein Griff wurde noch fester, sie fühlte seine Kraft und begriff, dass es nutzlos war, sich gegen ihn zu wehren.
Ihr war ganz schwindlig. Sie hatte vergessen zu atmen.
Sie riss ihre Blicke von ihm los, dann starrte sie auf seine Lippen und fragte sich, was sie jetzt sagen sollte. Wie konnte er das nur wissen? Er musste es erraten haben.
Im Schatten sah sein Gesicht noch beeindruckender aus, als sie es in Erinnerung hatte. Seine Wirkung – seine Körperlichkeit – war überwältigend. Er schien mehr als nur gefährlich zu sein. Er trug ein Nachthemd ihres Vaters. Der Kragen stand offen und enthüllte dunkles, krauses Haar auf seiner Brust.
Die Erkenntnis, dass sie mitten in der Nacht am Bett eines Mannes stand und auf seine Brust starrte, noch dazu im Nachthemd, machte sie ganz benommen. Eine heiße Röte stieg ihr in die Wangen. Gladys war zwar in der Nähe, aber …
Sie sah sich in dem Zimmer um. Als hätte er ihre Hoffnung gefühlt, dass Gladys aufwachen würde, drehte er sich auf den Rücken und zog sie auf sich.
Phyllida unterdrückte ein Aufkeuchen. »Passen Sie auf Ihren Kopf auf«, zischte sie leise.
Seine Augen blitzten. »Ich passe schon auf.«
Seine Stimme war tief, beinahe schnurrte sie. Er streckte den Arm aus, mit dem er ihr Handgelenk festhielt. Sie musste sich über ihn beugen, immerhin hielt sie noch immer den Kerzenhalter in der anderen Hand. Unvermeidlich zog er sie immer weiter über sich.
Sie schluckte, als sich ihre Brüste seinem Oberkörper näherten. Ihr Herz schlug laut, und sie kletterte auf das Bett.
Er lächelte triumphierend. »Und jetzt können Sie mir erzählen, was Sie heimlich in Horatios Wohnzimmer zu suchen hatten.«
Sein Befehl war ganz direkt. Phyllida hob das Kinn. Im Alter von vierundzwanzig Jahren ließ sie sich nicht mehr so leicht einschüchtern. »Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden.« Noch einmal versuchte sie, ihre Hand aus seiner Umklammerung zu lösen, doch sie hatte keinen Erfolg damit. Sie kniete neben ihm auf dem Bett, eine ihrer Hände hielt er fest, in der anderen hatte sie den Kerzenhalter, nicht gerade eine Position der Macht. Sie kam sich vor wie ein Bittsteller.
Sein Gesichtsausdruck verhärtete sich. »Sie waren da. Sagen Sie mir, warum.«
Sie sah ihn hochmütig an. »Ich fürchte, Sie befinden sich noch immer im Delirium.«
»Ich war auch nicht im Delirium, als Sie mich berührt haben.«
»Sie haben ständig vom Teufel geredet. Und als wir Ihnen dann versichert haben, dass Sie nicht sterben würden, haben Sie nach dem Erzengel verlangt.«
Seine Lippen wurden ganz schmal. »Mein Bruder heißt Gabriel, und mein ältester Cousin ist Devil.«
Sie starrte ihn an. Devil. Gabriel. Wie war dann wohl sein Name? »Na gut, aber dieser Gedanke, den Sie da gerade geäußert haben, ist Unsinn. Ich weiß nichts über den Mord an Horatio.«
Endlich konnte sie ihm auch in die Augen sehen und versank ganz in den blauen Tiefen. Es war ein äußerst eigenartiges Gefühl, ihr ganzer Körper prickelte, eine angenehme Wärme breitete sich in ihrem Inneren aus. Das Gefühl, seine Gefangene zu sein, wurde noch stärker. Den seltsamen Gedanken, dass ihr Nachthemd durchsichtig war, schob sie schnell beiseite.
»Sie waren nicht in Horatios Wohnzimmer, als ich dort auf dem Boden lag?«
Seine Stimme war leise, ein wenig herausfordernd, und das Gefühl der Gefahr beschlich sie. Gefangen von seinen Blicken, von seiner Hand um ihr Handgelenk, presste Phyllida fest die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Sie konnte es ihm nicht sagen – noch nicht. Zuerst musste sie mit Mary Anne sprechen, die sie von ihrem Eid erlösen musste.
»Und diese Finger« – sein Griff um ihr Handgelenk veränderte sich ein wenig – »waren es also nicht, die über meine Wange gestrichen haben, als ich neben Horatio lag?«
Er hob ihre Hand und sah sie sich an, und auch sie sah darauf. Lange, gebräunte Finger umschlossen die ihren. In seiner großen Hand verschwand ihre kleine Hand vollkommen. Der Druck seiner Hand nahm zu, als er ihre Finger an sein Gesicht hob. »So.« Er strich mit ihren Fingerspitzen über seine Wange, dann ließ er ihre Hand wieder sinken.
Sein Bart war gewachsen, er kratzte an ihren Fingern, und dieses Gefühl verstärkte noch den Eindruck, dass er kein Stein, sondern eine lebendige Kreatur war. Aufs Neue sah Phyllida fasziniert zu, wie ihre Finger über seine Wange strichen, immer tiefer, bis hin zu dem verlockenden Schwung seiner Lippen … erst dann wurde sie sich bewusst, dass er seinen Griff gelockert hatte. Ihre Finger hatten sich selbständig gemacht.
Sie riss die Hand zurück, doch er war schneller. Wieder legten sich seine Finger um ihr Handgelenk.
»Sie waren da.« Sein Ton klang grimmig entschlossen, er war vollkommen überzeugt.
Phyllida sah in seine tiefen blauen Augen, all ihre Instinkte rieten ihr wegzulaufen. Sie zog an der Hand. »Lassen Sie mich los.«
Er zog eine Augenbraue hoch, schien nachzudenken – mit laut klopfendem Herzen überlegte sie, welche Alternativen er wohl erwog. Dann entspannte sich sein Mund, doch nicht sein eindringlicher Blick. »Also gut – für den Augenblick.«
Sie versuchte, ihm ihre Hand zu entziehen, doch er gab sie nicht frei. Stattdessen hob er ihre Hand noch einmal – diesmal an seine Lippen. Dabei hielt sein Blick den ihren fest gefangen. Sie hoffte, dass er ihr die Aufregung – Panik, gemischt mit versteckter Erregung – nicht ansehen konnte.
Seine Lippen glitten über ihre Fingerknöchel, und ihr stockte der Atem. Seine Lippen waren kühl, doch ihre Haut brannte dort, wo er sie berührt hatte. Mit weit aufgerissenen Augen fühlte sie, wie ihr die Sinne schwanden. Ehe sie noch tief Luft holen konnte, drehte er ihre Hand um und drückte einen brennenden Kuss in die Handfläche.
Sie riss die Hand zurück – er gab sie frei, doch nur zögernd. Sie rutschte vom Bett herunter, und ihr Nachthemd fiel wieder über ihre Beine. Zuvor konnte sie kaum noch atmen, doch jetzt ging ihr Atem viel zu schnell.
Seine Augen blitzten zufrieden auf.
Phyllida hob den Kopf, nahm den Umhang über ihrer Brust zusammen, zögerte noch einen Augenblick und nickte dann hochmütig. »Ich werde später am Morgen noch einmal nach Ihnen sehen.«
Sie wandte sich zur Tür. Eine eigenartige Wärme stieg in ihr auf. Ohne noch einen Blick zurück zu riskieren, floh sie aus dem Zimmer.
Lucifer sah, wie sich die Tür hinter ihr schloss. Er hatte sie gehen lassen, auch wenn er das eigentlich gar nicht wollte. Aber es gab keinen Grund zur Eile, und die Dinge hätten sich vielleicht viel schneller entwickelt, als es ratsam war, wenn sie weiter auf seinem Bett gekniet hätte.
Er holte tief Luft, noch immer hatte er ihren Duft in seiner Nase, süße, weibliche Haut, noch warm vom Schlaf. Ihr Nachthemd war vollkommen undurchsichtig gewesen, doch hatte es sich jeder Rundung ihres Körpers angeschmiegt. Und als sie erst einmal die Enden ihres Umhanges losgelassen hatte, war er vollkommen abgelenkt gewesen.
Wenn die ältere Frau nicht in dem Zimmer gewesen wäre …
Eine Minute verging, dann schob er diese Gedanken schnell beiseite. Es war nicht klug, seine Absicht so deutlich zu machen. Glücklicherweise schien sein Schutzengel entschlossen, sich um ihn zu kümmern, trotz der Bedrohung, die sie jetzt offensichtlich begriffen hatte.
Ihre letzten Worte waren mehr eine Erklärung gewesen als nur eine Bemerkung. Wenn sie ihn wirklich gefunden hatte, als er in Horatios Wohnzimmer gelegen hatte, und aus irgendeinem Grund gezwungen gewesen war, ihn dort zurückzulassen, dann war ihre Reaktion verständlich. Sie fühlte sich schuldig. Ganz gleich, wie schwer er ihr das Leben auch machen würde, sie würde versuchen, das Richtige zu tun.
In dieser Hinsicht war er sich ziemlich sicher – sie war eine Frau, die sich bemühen würde, das zu tun, was richtig war.
Er reckte sich und dehnte seine angespannten Muskeln, dann legte er sich auf die Seite, um seinen Kopf zu schonen. Er schmerzte noch immer, doch die ganze Zeit, als sie im Zimmer gewesen war, hatte er nicht mehr an die Schmerzen gedacht.
Er hatte an nichts anderes mehr denken können als an sie. Die Gewissheit, dass sie es gewesen war, die in Horatios Wohnzimmer neben ihm gekniet und ihm so zögernd und voller Verwunderung über die Wange gestrichen hatte, hatte die Anziehungskraft noch verstärkt, auch wenn er mit aller Macht versucht hatte, sie zu ignorieren. Diese Erkenntnis bedeutete, dass er nicht länger so tun musste, als sei er sich dessen nicht bewusst, seine Anziehungskraft, ihre Faszination und ihre daraus folgende Nervosität würden sich als äußerst hilfreich erweisen.