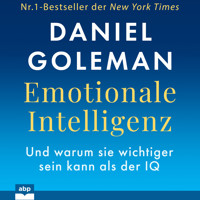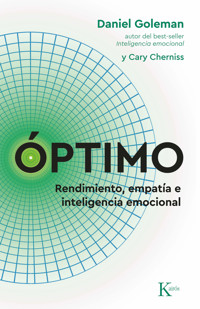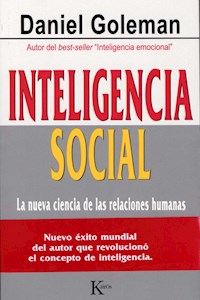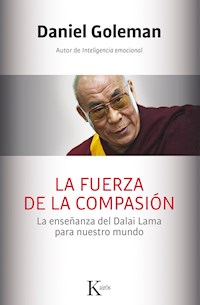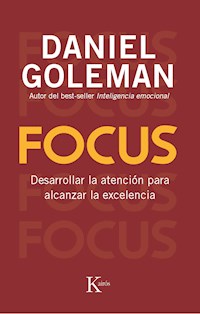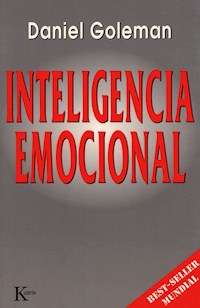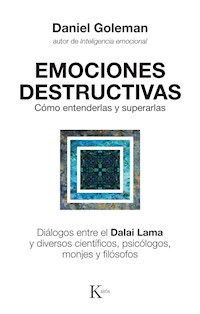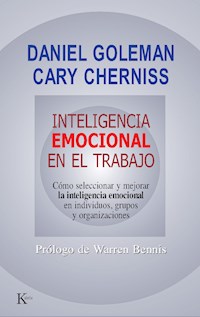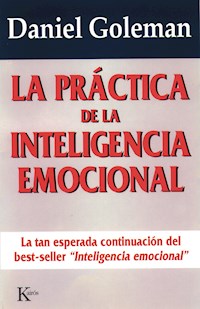9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Umweltgerecht leben ist möglich, sagt Daniel Goleman. Und wir können unseren Wohlstand wahren – doch nur mit ökologischer Intelligenz. Der Schlüssel zu einer lebenswerten Zukunft liegt in unserer Hand. Wir dürfen kaufen, was die Umwelt schont, und müssen boykottieren, was sie belastet. So verändern wir die Wirtschaft und retten unseren Planeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Daniel Goleman
Ökologische Intelligenz
Wer umdenkt, lebt besser
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Gockel und Maria Zybak
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für alle Enkel dieser Welt
und die Enkel ihrer Enkel
1
Der versteckte Preis unserer Einkäufe
Vor einiger Zeit erwarb ich spontan einen kleinen, knallgelben Rennwagen aus Holz mit einer grünen Kugel als Kopf des Fahrers und vier schwarzen angeklebten Scheiben für die Räder. Das Spielzeug kostete nur 99 Cent. Ich kaufte es für meinen achtzehn Monate alten Enkel, weil ich glaubte, es würde ihm gefallen.
Nachdem ich mit diesem kleinen Holzauto nach Hause gekommen war, las ich zufällig, dass Farben (insbesondere Gelb und Rot) durch Blei mehr Strahlkraft erhalten, länger halten und es nicht so teuer ist wie andere Zusätze. Daher sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Farben dieses Metall enthalten, bei billigem Spielzeug besonders hoch.[1] Dann stieß ich auf einen weiteren Artikel. Eine Analyse von 1200 Spielzeugen, hieß es darin, die man aus den Regalen verschiedener Geschäfte entnommen hatte – darunter auch die Ladenkette, in der ich jenes Holzauto gekauft hatte –, habe ergeben, dass ein großer Prozentsatz davon Blei in unterschiedlichen Mengen enthielt.[2]
Ich habe keine Ahnung, ob die glänzende gelbe Farbe an dem besagten Spielzeugauto Blei enthält, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mein Enkel es, sobald er es in die Hände bekäme, sofort in den Mund stecken würde. Heute, Monate später, steht dieses Spielzeugauto immer noch auf meinem Schreibtisch. Ich habe darauf verzichtet, es meinem Enkel zu schenken.
An unendlich vielen materiellen Gütern unserer Welt befindet sich ein unsichtbares Preisschild. Wir können nicht sehen, in welchem Ausmaß die Dinge, die wir täglich kaufen und benutzen, über die Produktion hinaus weitere Kosten verursachen – Kosten für unseren Planeten, für unsere Gesundheit, für die Menschen, deren Mühsal unsere Bedürfnisse befriedigt und uns all diese Annehmlichkeiten verschafft. Unser Alltagsleben spielt sich inmitten einer Flut von Gegenständen ab, die wir kaufen, benutzen, wegwerfen, achtlos herumliegen lassen oder aufbewahren. Jeder dieser Gegenstände hat seine eigene Geschichte und Zukunft, seine eigene Herkunft und sein eigenes Ende, und all das bleibt unserem Blick verborgen: ein ganzes Gewebe von Folgen und Auswirkungen am Rande seines langen Weges, angefangen bei der Gewinnung der Rohmaterialien über die Herstellung und den Transport, seinen Gebrauch im Haushalt oder am Arbeitsplatz bis zu dem Tag, an dem wir uns seiner wieder entledigen. Und doch sind diese unsichtbaren Auswirkungen womöglich der wichtigste Aspekt.
Unsere Produktionstechniken und die dabei eingesetzten Chemikalien stammen weitgehend aus einer unschuldigeren Zeit, in der sich sowohl Käufer als auch Wirtschaftsingenieure noch den Luxus leisten konnten, die negativen Auswirkungen der Produkte mehr oder weniger zu ignorieren. Vielmehr genossen sie ihren Nutzen: Strom aus Kohle, die noch Jahrhunderte reichte; billige und leicht formbare Kunststoffe, gewonnen aus einem scheinbar unendlichen Meer von Erdöl; eine Schatztruhe voller synthetisch hergestellter chemischer Verbindungen; billiges Bleipulver, das Farben strahlender und haltbarer machte. Sie sahen nur das Positive daran und dachten nicht an die Kosten für unseren Planeten und seine Bewohner.
Die Zusammensetzung und die Auswirkungen all der Dinge, die wir täglich kaufen und benutzen, sind zwar zum größten Teil das Ergebnis von Entscheidungen, die vor langer Zeit getroffen wurden, aber sie bestimmen immer noch die Produktentwicklung und -fertigung und die industrielle Chemie – und damit letztlich auch das Inventar unserer Haushalte, Schulen, Krankenhäuser und an unserem Arbeitsplatz. Das materielle Erbe der einst Staunen hervorrufenden Erfindungen des Industriezeitalters bis Ende des 20. Jahrhunderts hat unser Leben im Vergleich zu dem unserer Urgroßeltern unermesslich viel angenehmer gemacht. Raffinierte Molekülzusammensetzungen, ohne Beispiel in der Natur, sorgen tagtäglich für einen wahren Strom von Wundern. An den bis heute verwendeten künstlich hergestellten chemischen Stoffen und Verfahren, die gestern in der Wirtschaftswelt höchst sinnvoll waren, weiterhin festzuhalten, ist jedoch kaum vernünftig. Weder Konsumenten noch Unternehmen können es sich noch länger leisten, die Entscheidungen von damals – und ihre ökologischen Folgen – ungeprüft zu lassen.
In meinen früheren Arbeiten habe ich untersucht, was es bedeutet, mit unseren Emotionen und – in jüngerer Zeit – mit unseren sozialen Beziehungen intelligent umzugehen. In diesem Buch beschäftige ich mich mit der Frage, inwiefern wir als Gemeinschaft unsere Intelligenz in Bezug auf die ökologischen Folgen unserer Lebensweise weiterentwickeln können – und wie diese ökologische Intelligenz im Zusammenwirken mit Markttransparenz zu positiven Veränderungen führen kann.
Um es gleich offen zu sagen: Was ökologische Intelligenz betrifft, war ich zunächst so unbedarft wie die meisten von uns.[3] Doch bei meinen Recherchen hatte ich das Glück, auf ein virtuelles Netzwerk von Personen – von Führungskräften der Wirtschaft und Wissenschaftlern gleichermaßen – zu stoßen, die Hervorragendes in dem einen oder anderen Teilbereich jener Fertigkeiten leisten, die wir dringend benötigen, um gemeinsam eine ökologische Intelligenz zu entwickeln und mit dem so erworbenen Wissen bessere Entscheidungen zu treffen. Beim Skizzieren der Möglichkeiten für die Realisierung einer solchen Vision habe ich auf meine Erfahrungen als Psychologe und Wissenschaftsjournalist zurückgegriffen, um in der Welt des Handels und der Produktion nachzuforschen und Ausschau zu halten nach den allerneuesten Ideen auf Gebieten wie der Neuroökonomie und der Informationswissenschaft und vor allem in einer erst im Entstehen begriffenen Disziplin, der Industrieökologie.
Die Reise, auf die ich mich begeben habe, schließt nahtlos an eine andere an, die ich vor über zwanzig Jahren antrat, als ich in einem Buch über Selbsttäuschung schrieb, dass unsere Konsumgewohnheiten weltweit zu ökologischen Schäden in einem nie da gewesenen Ausmaß führen, »einfach«, so meinte ich damals, »weil wir die Zusammenhänge nicht kennen«.[4]
Damals dachte ich, wir würden eines Tages in der Lage sein, den ökologischen Schaden genau zu ermitteln, den die Herstellung und die Verpackung, der Transport und die Entsorgung eines Produkts anrichten, und alles in einem Messwert zusammenzufassen. Die Kenntnis dieses Werts etwa für einen Fernseher oder eine Rolle Alufolie, so meine Überlegung, würde uns ermöglichen, mehr Verantwortung für die Auswirkungen unserer persönlichen Entscheidungen auf den Planeten Erde zu übernehmen. Doch dann ging mir die Luft aus und ich musste eingestehen, dass »solche Informationen nicht zur Verfügung stehen und selbst die ökologisch Bewusstesten unter uns das Nettoergebnis unserer Lebensweise für unseren Planeten nicht kennen. Und so unterliegen wir aufgrund unserer Ignoranz einer ungeheuren Selbsttäuschung und glauben, unsere Entscheidungen in materiellen Dingen – großen wie kleinen – hätten keine bedeutenden Folgen.«
Vor all den Jahren wusste ich noch nichts von Industrieökologie, jener Disziplin, die routinemäßig genau die Analysen vornimmt, von denen ich träumte. Sie ist dort angesiedelt, wo sich Chemie, Physik und Ingenieurswissenschaften mit der Ökologie treffen, und führt diese zusammen, um die Auswirkungen der menschlichen Produktion auf die Natur zu bemessen. Als ich mir damals wünschte, es gäbe bereits eine solche Disziplin, war sie erst im Entstehen begriffen und noch konturlos. Sie wurde in den 1990er Jahren von einer Arbeitsgruppe der National Academy of Engineering entwickelt, und die allererste Ausgabe des Journal of Industrial Ecology erschien 1997, mehr als zehn Jahre später, als ich mir eine solche Zeitschrift gewünscht hatte.
Die Industrieökologie entstand aus der Einsicht, dass Industriesysteme den natürlichen Systemen in vielerlei Hinsicht gleichen: Die Ströme bearbeiteter Stoffe – der Erde entnommen und in neuen Kombinationen in Umlauf gebracht –, die zwischen den Unternehmen fließen, können als Inputs und Outputs gemessen werden, die eine Art Stoffwechsel reguliert. In diesem Sinne kann man auch die Industrie als ein Ökosystem betrachten, und zwar als eins, das tiefgreifende Auswirkungen auf alle anderen Ökosysteme hat. Die neue Wissenschaft umfasst so verschiedene Gebiete wie die Schätzung des CO2-Ausstoßes einzelner industrieller Prozesse oder die Analyse des weltweiten Phosphorflusses bis hin zu der Frage, wie durch elektronische Kennzeichnung die Wiederaufbereitung von Müll rationalisiert werden könnte oder welche ökologischen Auswirkungen ein Boom bei Badezimmermodernisierungen in Dänemark hat.
In meinen Augen sind Industrieökologen – neben jenen, die auf dem neuesten Stand von Disziplinen wie der Umweltmedizin sind – die Speerspitze eines aufkommenden Bewusstseins, das ein entscheidendes Mosaiksteinchen bei unseren kollektiven Bemühungen um den Schutz unseres Planeten und seiner Bewohner sein könnte. Man stelle sich nur einmal vor, welche Wirkung es hätte, wenn das Wissen, das gegenwärtig Spezialisten wie etwa Industrieökologen vorbehalten ist, uns allen zur Verfügung stünde: wenn es den Kindern in der Schule vermittelt würde, im Internet leicht zugänglich wäre, heruntergebrochen würde auf eine Bewertung der Dinge, die wir kaufen und tun, und in Kurzfassung vorhanden wäre, wenn wir unmittelbar vor der Kaufentscheidung stehen.[5]
Egal ob als einzelner Konsument, als Einkäufer bei einer Organisation oder als Produktmanager – wenn wir die versteckten Auswirkungen dessen, was wir kaufen, verkaufen oder herstellen, so genau kennen würden wie ein Industrieökologe, könnten wir die Zukunft positiver gestalten, indem wir unsere Entscheidungen mehr mit unseren Werten in Einklang bringen. Methoden, uns solche Daten zur Kenntnis zu bringen, werden bereits entwickelt. Sobald uns dieses entscheidende Wissen einmal zur Verfügung steht, werden wir in eine Ära eintreten, die ich das Zeitalter der radikalen Transparenz nennen möchte.
Durch eine radikale Transparenz wird die Kette der vielfältigen Auswirkungen jedes einzelnen Produkts – die CO2-Bilanz, bedenkliche chemische Stoffe, die Behandlung der Arbeiter und vieles mehr – zu einem Faktor, der beim Verkauf ins Gewicht fällt. Radikale Transparenz wird von einer zukünftigen Generation technischer Anwendungen profitieren, zum Beispiel einer Software, die das Sammeln großer Datenmengen ermöglicht und diese in einfacher Form darstellt. Wenn wir die wahren Auswirkungen unserer Kaufentscheidungen kennen, können wir diese Informationen dazu nutzen, schneller positive Veränderungen herbeizuführen.
Sicher gibt es bereits verschiedene Öko-Kennzeichnungen auf der Grundlage hervorragenden Datenmaterials zur Bewertung bestimmter Produktgruppen. Aber die nächste Welle ökologischer Transparenz wird weitaus radikaler ausfallen – die Daten werden umfassender und detaillierter sein – und uns überschwemmen. Um die Informationsflut nutzbar zu machen, muss in viel weiter gehender und systematischerer Weise, als es heute bei den manchmal wahllosen Produktauszeichnungen der Fall ist, all das transparent gemacht werden, was uns bisher verheimlicht wurde. Ausgestattet mit den richtigen, zielführenden Daten werden die Konsumenten die Welt der Wirtschaft kontinuierlich verändern – angefangen bei den fernsten Fabriken bis hin zum Kraftwerk in ihrer nächsten Umgebung – und damit eine neue Front im Kampf um Marktanteile eröffnen.
Radikale Transparenz wird ein derartiges Bewusstsein für die Auswirkungen der Dinge schaffen, die wir herstellen, verkaufen, kaufen und wegwerfen, dass die Wirtschaft auch mit unangenehmen Wahrheiten wird herausrücken müssen. Sie wird das Marketing dahingehend revolutionieren, dass die enorme Vielfalt grüner, sauberer Technologien und Produkte, die heute entwickelt werden, mehr in den Vordergrund tritt, und somit einen weitaus stärkeren Anreiz für alle schaffen, auf diese Technologien und Produkte umzusteigen.
Eine derartig umfassende ökologische Aufklärung stellt einen bislang nicht beschrittenen ökonomischen Weg dar: die Anwendung der strengen Transparenzkriterien, wie sie etwa auf den Finanzmärkten verlangt werden, auf die ökologischen Auswirkungen der Dinge, die wir kaufen. Sie würde den Käufern Informationen als Grundlage ihrer Entscheidungen an die Hand geben, die ähnlich geartet sind wie jene, derer sich die Börsenanalysten bei der Abwägung der Gewinne und Verluste von Unternehmen bedienen. Und sie würde dem leitenden Management größere Klarheit verschaffen, um die Aufgabe ihres Unternehmens, sozial verantwortlicher und nachhaltiger zu operieren, zu erfüllen. Gleichzeitig würde sie ihm Hinweise darauf geben, in welche Richtung sich die Märkte entwickeln.
Dieses Buch folgt den Spuren meiner persönlichen Reise in diese Welt. Sie beginnt bei meinen Gesprächen mit Industrieökologen über die ungeheure Komplexität selbst der Herstellung des einfachsten Produkts und über diese neue Wissenschaft, die den ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen auf jeder Stufe nachgeht. Anschließend frage ich nach den Gründen, warum diese Informationen uns weitgehend vorenthalten werden und warum die Abhilfe dafür in der Förderung unserer ökologischen Intelligenz, einem allgemeinen Wissen über die unsichtbaren ökologischen Auswirkungen und der Entschlossenheit besteht, beides zu verbessern.
Ich werde zeigen, wie wir unsere ökologische Intelligenz fördern können, indem wir diese Informationen den Käufern zugänglich machen – und die Erfinder einer Technologie aufsuchen, die im Begriff ist, eine derart radikale Transparenz Wirklichkeit werden zu lassen. Anschließend werde ich Ausschau halten nach Hinweisen auf eine Verschiebung der Marktanteile in einem Maße, das den Unternehmen die Wettbewerbsvorteile durch ökologische Verbesserungen klarmacht, die weitaus tiefer gehen als gegenwärtig üblich. Dabei werde ich einen konkreten Fall untersuchen: Die Kontroversen über Industriechemikalien zeigen aus Sicht der Gehirnforschung, warum die emotionale Reaktion der Konsumenten auf die Umweltbelastungen durch bestimmte Produkte für den Verkäufer eine wichtige Rolle spielt.
Schließlich beschäftige ich mich mit den Strategien von Unternehmen und fasse meine Gespräche mit einem sich ständig vergrößernden Kreis von Geschäftsleuten zusammen, die diese Entwicklung vorweggenommen und in der Wertschöpfungskette ihres Unternehmens bereits Verbesserungen eingeleitet haben, die darauf abzielen, die ökologischen Belastungen zu verringern und ihrem Unternehmen in einem radikal transparenten Markt eine gute Position zu verschaffen. Diese Führungskräfte haben begriffen, dass gute Geschäfte eng mit guten Beziehungen verbunden sind und die Zufriedenheit ihrer Kunden steigt, wenn sie sehen, dass das Unternehmen Rücksicht auf ökologische Belange nimmt. An dieser Stelle sehe ich meine Aufgabe darin, auf eine bevorstehende Welle aufmerksam zu machen, die kein Unternehmen verschonen wird.
Es ist viel die Rede davon, dass wir etwas für unseren Planeten tun, wenn wir uns anders verhalten: mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren, die neuen energiesparenden Glühbirnen verwenden, unsere Flaschen recyceln und dergleichen mehr. All das ist löblich, und wenn mehr Menschen in diesem Sinne handeln würden, wäre dies sicher ein großer Segen.
Aber wir können noch mehr tun. Bei den meisten Dingen werden die wirklichen Umweltbelastungen bislang ignoriert. Wenn erst die unzähligen versteckten ökologischen Folgen im Lebenszyklus eines Produkts – von der Herstellung bis zur Entsorgung der Fahrräder, Glühbirnen und Flaschen sowie aller anderen Materialien, die wir verwenden – ans Licht gebracht werden, öffnet sich eine Schleuse für effektives Handeln. Mit einem tiefer greifenden Wissen um die ökologischen Belastungen durch die Dinge, die wir kaufen, steigt unser Einfluss auf die Welt von Handel und Industrie enorm.
Dieses Wissen eröffnet uns ein breites Spektrum von Möglichkeiten, etwas Gutes für die Zukunft zu tun. Auf der Ebene des Käufers wird der kollektive Wille gestärkt, unseren Planeten und seine Bewohner vor den unbeabsichtigten Schäden durch die Wirtschaft zu schützen. Auf der Seite der Unternehmen wird der Umstand, dass die Verbraucher ihre Kaufentscheidungen stärker an ihren Werten ausrichten, eine heiß umkämpfte Arena für Wettbewerbsvorteile schaffen – eine Gelegenheit, Gewinn zu machen, die solider und vielversprechender ist als mit unserem gegenwärtigen »Öko«-Marketing. Auch wenn wir uns nicht aus der heutigen Krise herausshoppen können, so bietet radikale Transparenz doch einen zusätzlichen Weg hin zu einem grundlegenden Wandel.
Wir werden überhäuft mit bedrohlichen Szenarien zur Erderwärmung und zu den Giften in unseren Gebrauchsgegenständen sowie mit Forderungen, dass wir etwas ändern müssen, bevor es zu spät ist. Besonders eine Variante dieser Litanei ist uns nur allzu vertraut: immer höhere Temperaturen, immer schlimmere Hurrikane, schreckliche Dürren und eine ausgreifende Wüstenbildung hier, unablässige Regenfälle dort. Manche sagen für die nächsten zehn Jahre eine weltweit sprunghaft zunehmende Nahrungsmittel- und Wasserknappheit oder Umweltkatastrophen voraus – für sie ist Hurrikan Katrina in New Orleans ein Vorbote dafür –, in deren Folge weitere Städte auf der ganzen Welt evakuiert werden müssen.
Andere Stimmen, die von Tag zu Tag lauter werden, warnen, dass bestimmte chemische Stoffe in Gebrauchsgegenständen uns und unsere Kinder langsam vergiften. Diese schleichende Vergiftung geht bei weitem nicht nur vom Blei in Spielzeugen aus. Karzinogene Kunststoffhärter oder -weichmacher, so die Warner, finden sich nahezu überall in unserem Alltag, sei es in Infusionsbeuteln in Krankenhäusern oder in Schwimmflügeln für Kinder. Chemische Weichmacher in Lippenstiften sind ebenfalls, wenn auch auf andere Weise, gesundheitsschädlich. Unseren Computern entweicht ein Gift, Druckern ein anderes. Die Welt der vom Menschen gemachten Produkte, so scheint es, bringt eine chemische Suppe hervor, die allmählich das Ökosystem vergiftet, das unser Körper darstellt.
Und die Missetäter sind immer dieselben: Sie und ich. Was der Mensch tut, ist zum Hauptmotor dieser um sich greifenden Krise geworden, einer Krise, die eine schwere Bedrohung darstellt für, tja, Sie und mich.
Wir sind kollektiv in Aktivitäten verstrickt, die unweigerlich die ökologische Nische gefährden, in der menschliches Leben möglich ist. Die Dynamik, die auf unserem Handeln in der Vergangenheit beruht, wird noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte weiterwirken; giftige Stoffe, die in unser Wasser und unsere Böden dringen, und die Zunahme der Treibhausgase werden noch viele Jahre ihren Tribut fordern.
Dieses Katastrophenszenario kann leicht zu einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, ja der Verzweiflung führen. Denn wie, so fragt man sich schließlich, soll jemand den Tsunami menschlicher Aktivitäten, der alles mit sich reißt, aufhalten?
Je eher es uns gelingt, der Flutwelle Einhalt zu gebieten, umso weniger drastisch werden die Schäden sein. Und wenn wir uns unseren Beitrag zur Verschmutzung unseres Lebensraums genauer anschauen, finden wir sicher Angriffspunkte, wo wir durch einfache, allmähliche Veränderungen die weitere Verschärfung dieser Katastrophe verhindern oder ihr sogar entgegenwirken können.
Als einzelne Verbraucher sind wir gezwungen, aus einem Spektrum von Produkten auszuwählen, das durch Entscheidungen von Industrieingenieuren, Chemikern und Erfindern jeglicher Couleur irgendwann vor ferner Zeit oder an einem fernen Ort bestimmt wurde. Wir bilden uns zwar ein, frei wählen zu können, doch geschieht dies nur unter den Bedingungen, die von jenen unsichtbaren Kräften diktiert werden.
Wenn wir aber unsere Wahl auf der Grundlage umfassender Informationen treffen können, verschiebt sich die Macht von jenen, die verkaufen, zu jenen, die kaufen – egal, ob es sich um eine Mutter im Supermarkt um die Ecke, einen Einkäufer für den Einzelhandel beziehungsweise für eine Institution oder um einen Produktmanager handelt. Dann gestalten wir unser Schicksal, anstatt nur passives Opfer zu sein. Indem wir in einen Laden gehen, stimmen wir mit unserem Geld ab.
Damit werden wir jenen Unternehmen einen völlig neuen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die die für unsere gemeinsame Zukunft notwendigen Produkte anbieten. Die bewussten, auf soliden Informationen beruhenden Entscheidungen werden die heutigen Ingenieure, Chemiker und Erfinder vor neue Aufgaben stellen. Ich möchte behaupten, dass diese Marktkraft die Nachfrage für eine Welle von Neuerungen schaffen wird, die allesamt unternehmerische Chancen darstellen. Unsere gesteigerte ökologische Intelligenz dürfte einen Aufschwung fördern, der die industriellen Verfahren zur Herstellung all dessen, was wir kaufen, zum Positiven verändert. Zudem wird die Suche nach ökologischeren Produktionsweisen gefördert durch den weltweiten Schock angesichts der sprunghaft steigenden Ölpreise, die die Kostenrechnungen grundlegend verändern und in verstärktem Maße dazu zwingen, nach Alternativen Ausschau zu halten.
Die Unternehmen täten gut daran, sich auf den tiefgreifenden Wandel vorzubereiten, den die Verschiebung der Informationskontrolle vom Anbieter zum Käufer mit sich bringt. Die ökonomische Faustregel der letzten hundert Jahre – je billiger, desto besser – wird zunehmend ersetzt werden durch ein neues Erfolgsrezept: je nachhaltiger, gesünder und auch menschlicher, desto besser. Inzwischen wissen wir schon genauer, wie sich dieses Erfolgsrezept konkret umsetzen lässt.
2
»Grün« ist eine Illusion
Im Visuddhimagga, einem indischen Text aus dem 5. Jahrhundert[6], fordert ein weiser Mönch König Menandros auf, ihm zu erklären, was ein Wagen sei: Die Achsen, die Räder, der Wagenkasten? Die beiden Stangen, zwischen die das Pferd gespannt ist?
Die Antwort lautet: nichts von alledem. Was wir mit dem Wort »Wagen« benennen, bezieht sich auf die zeitweilige Verbindung seiner Bestandteile. Es ist eine Illusion.
Mit dieser Erkenntnis veranschaulicht der uralte Text die flüchtige Natur des Selbst, das weder in unseren Erinnerungen noch in unseren Gedanken beheimatet ist, weder in unseren Wahrnehmungen noch Empfindungen oder Handlungen (eine Analyse, die bereits vor 1500 Jahren die Dekonstruktion des Selbst in der modernen Philosophie vorwegnahm). Doch diese Erkenntnis gilt ebenso für einen Gameboy, einen Mixer und jedes andere vom Menschen hergestellte Objekt. Alle derartigen Gegenstände lassen sich in die Vielzahl ihrer Bestandteile und die einzelnen Produktionsschritte aufgliedern.
Für den Industrieingenieur entspricht diese Dekonstruktion von Objekten der Ökobilanzierung (life cycle analysis, kurz LCA), eine Methode, mit deren Hilfe wir jedes Produkt systematisch in seine Bestandteile und die industriellen Fertigungsprozesse zerlegen und mit nahezu chirurgischer Präzision messen können, welche Auswirkungen auf die Natur das Produkt vom Produktionsbeginn bis zur Entsorgung hat.
Die LCA hatte einen recht prosaischen Start. Eine der allerersten Studien wurde in den 1960er Jahren von Coca-Cola in Auftrag gegeben, um die jeweiligen Vorteile von Plastik- und Glasflaschen und den quantitativen Nutzen ihrer Wiederverwertung zu ermitteln. Mit der Zeit wandte man die Ökobilanzierung auch auf andere industrielle Produkte an, und inzwischen setzen immer mehr nationale und internationale Markenhersteller diese Methode in irgendeiner Phase des Produktionsprozesses ein, wenn Entscheidungen zur Produktentwicklung oder -herstellung anstehen – und viele Regierungen nutzen LCAs zur Regulierung dieser Wirtschaftsbereiche.
Entwickelt wurde die LCA oder Ökobilanzierung von einem lockeren Zusammenschluss von Physikern sowie Chemie- und Industrieingenieuren mit dem Ziel, Herstellungsprozesse in allen Einzelheiten zu dokumentieren – welche Materialien und wie viel Energie eingesetzt, welche Art von Umweltverschmutzung verursacht und welche Giftstoffe in welchen Mengen abgegeben werden –, und zwar bei jeder einzelnen Grundeinheit in einer sehr langen Kette. Der erwähnte alte Text zählt im Fall des Königswagens eine Handvoll Bestandteile auf; die Ökobilanzierung für einen Mini-Cooper hingegen umfasst Tausende von Komponenten wie beispielsweise die Module, die die elektronischen Teile in dem Auto steuern. Diese elektronischen Module wiederum lassen sich herunterbrechen – wie der Königswagen auf seine Hauptbestandteile – auf Leiterplatte, verschiedene Kabel, Plastik- und Metallteile; an der zu jedem dieser einzelnen Teile führenden Kette hängt wiederum ein ganzer Rattenschwanz wie die Materialgewinnung, die Herstellung, der Transport und so weiter. Die Module steuern die Armaturen, den Kühlerlüfter, die Scheibenwischer, die Scheinwerfer, die Zündung und den Motor – und bei jedem dieser Teile können es wiederum tausend oder mehr einzelne Produktionsschritte sein, die analysiert werden müssen. Die Ökobilanzierung für dieses Mini-Auto enthält also unter Umständen Hunderttausende unterschiedlicher Einheiten.
Mein sachkundiger Führer auf diesem Gebiet ist Gregory Norris, Industrieökologe an der Harvard School of Public Health. Mit einem Abschluss in Maschinenbau am MIT (Massachusetts Institute of Technology), in Luft- und Raumfahrttechnik an der Purdue University sowie mehreren Jahren Erfahrung als Raumfahrtingenieur im Bereich Konstruktion bei der Luftwaffe verfügt Norris über untadelige Referenzen. Doch er räumt sogleich ein: »Um eine Ökobilanzierung vorzunehmen, braucht man kein Raketentechniker zu sein – ich weiß es, denn ich war einer. Es geht hauptsächlich um Datenermittlung.«
Eine solche minutiöse Analyse liefert Werte zu den Umweltbelastungen durch ein Automobil über seine gesamte Lebensdauer von der Herstellung bis zur Verschrottung – über die verwendeten Rohmaterialien, den Energie- und Wasserverbrauch, das durch photochemische Reaktion entstehende Ozon, den Beitrag zur Erderwärmung, die Schadstoffbelastung von Luft und Wasser sowie die anfallende Menge an Sondermüll – um nur einige Punkte herauszugreifen.[7] Bei der Ökobilanzierung eines Automobils zeigt sich, dass hinsichtlich des Beitrags zur Erderwärmung alles andere von der Herstellung bis zur Verschrottung verblasst im Vergleich zu den Emissionen während des Fahrbetriebs.
Eine weitere treffende Metapher für den Charakter industrieller Prozesse findet sich in einer chinesischen Abhandlung aus dem 8. Jahrhundert über den Gott Indra.[8] In dem Himmel, in dem Indra wohnt, ist in alle Richtungen ein wundersames Netz gespannt, bei dem an jedem Knotenpunkt ein herrlicher Edelstein glitzert. Dieser ist so raffiniert geschliffen, dass seine Facetten alle anderen Edelsteine in diesem Netz widerspiegeln, so dass eine unendliche Rückkoppelung entsteht. Jeder einzelne Edelstein trägt ein Bild aller anderen in sich.
Das Netz des Gottes Indra liefert uns ein passendes Bild für die unermesslichen Zusammenhänge innerhalb und zwischen den Systemen in der Natur genauso wie in den vom Menschen gemachten Systemen, etwa der Prozesskette eines Produkts. Als Norris mit mir die Ökobilanz für ein Verpackungsglas durchging, wie es für Marmelade oder Nudelsaucen verwendet wird, fanden wir uns am Ende in einem Labyrinth von Mehrfachverknüpfungen wieder, die eine anscheinend unendliche Kette von Material-, Transport- und Energiebedarf bilden. Für die Herstellung von Marmeladengläsern (und jedes andere Verpackungsglas) müssen Material – darunter Quarzsand, Natron, Kalk und verschiedene anorganische Chemikalien – von Dutzenden Lieferanten sowie Energie in Form von Erdgas oder Strom eingekauft werden, um nur einige wenige zu nennen. Und jeder Lieferant tätigt wiederum Einkäufe bei Dutzenden Lieferanten oder nimmt diese sonstwie in Anspruch.
Am Herstellungsprozess von Glas hat sich seit römischer Zeit wenig geändert. Heutzutage brennen mit Erdgas betriebene Öfen mit einer Temperatur von weit über 1000 °C rund um die Uhr, um Quarzsand zu Glas zu schmelzen, sei es für Fenster, Konserven oder das Display auf Ihrem Handy. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Ein Diagramm der dreizehn wichtigsten Schritte bei der Glasherstellung zeigt die Zusammenführung von 1959 verschiedenen »Prozesseinheiten«, von denen wiederum jede einzelne für unzählige vorausgegangene Prozesse steht, die ihrerseits das Ergebnis Hunderter anderer sind – ein anscheinend unüberschaubares System endloser Ketten.
Ich bat Norris um ein konkretes Beispiel aus diesem System. »Nehmen wir einmal die Herstellung von Natron«, meinte er. »Dazu braucht man Natriumchlorid, Kalk, flüssiges Ammoniak, verschiedene Brennstoffe und Strom, und all das muss zur Produktionsstätte transportiert werden. Für Natriumchlorid wiederum muss beispielsweise Steinsalz unter Einsatz von Wasser bergmännisch abgebaut werden, wozu verschiedene Materialien, Maschinen und Energie notwendig sind, und hinzu kommt noch der Transport.«
Da »alles mit allem zusammenhängt«, sagte Norris, »müssen wir ein ganz neues Denken entwickeln.«
Eine weitere Erkenntnis: Die Prozesskette für ein Glasbehältnis mag scheinbar unendliche Verknüpfungen aufweisen – aber irgendwann trifft die Kette dieser Verknüpfungen wieder auf frühere Glieder. Norris erklärte es folgendermaßen: »Wenn man bei der Prozesskette für ein Glasbehältnis die insgesamt 1959 Glieder weiterverfolgt, gelangt man zu Schleifen, die zurückführen – die Kette setzt sich ins Unendliche fort, aber asymptotisch.«
Norris veranschaulichte mir solche Schleifen an einem einfachen Beispiel. »Man braucht elektrische Energie, um Stahl herzustellen, und man braucht Stahl, um ein Elektrizitätswerk zu errichten und instand zu halten«, erklärte er. »Man kann also wirklich sagen, dass sich die Kette ins Unendliche fortsetzt – aber genauso trifft zu, dass die zusätzlichen Auswirkungen der vorgeschalteten Prozesse immer geringer werden, je weiter man sie zurückverfolgt.«
Das industrielle Pendant zu Indras Himmelsnetz gelangt also in ähnlicher Weise an seine Grenzen wie die mythische Schlange Ouroboros, die sich in den Schwanz beißt und daher als Symbol für sich wiederholende Kreisläufe oder für die Erneuerung gilt – insofern, als sich etwas ständig wiederholt und neu gestaltet.[9]
Bei industriellen Prozessen kann Ouroboros auch ein Ideal symbolisieren, das sich mit dem Begriff cradle to cradle (von der Wiege zur Wiege) umschreiben lässt, und das bedeutet, dass alles für ein Produkt Verwendete so geartet sein soll, dass es bei dessen Entsorgung komplett biologisch abbaubar ist oder mittels Recycling als Rohstoff für andere Produkte wiederverwendet werden kann. Im Gegensatz dazu steht die heutige Verfahrensweise des cradle to grave (von der Wiege bis zum Grab), bei der ein Produkt, das ausgedient hat, schlichtweg auf der Mülldeponie landet und dort Giftstoffe abgibt oder – etwa auf molekularer Ebene – andere Alptraumszenarien verursacht.
An den Wagen des Königs Menandros, an Indras Himmelsnetz und die Schlange Ouroboros musste ich wieder denken, als Gregory Norris und ich uns bei einer Telefonkonferenz unterhielten, während wir beide – ich in Massachusetts, er in Maine – an unseren Computerbildschirmen dasselbe sahen: In der Ökobilanz eröffnet jedes einzelne der annähernd zweitausend Glieder in der Prozesskette eines Verpackungsglases einen Blick auf die Auswirkungen für die menschliche Gesundheit, die Ökosysteme, das Klima und den Ressourcenbestand auf der Erde.
Für die Herstellung eines Glasbehälters müssen im Verlauf des Prozesses Hunderte von Stoffen eingesetzt werden, von denen jeder seine ganz spezifischen Auswirkungen hat. Es werden dabei rund 100 Substanzen ins Wasser abgegeben und etwa 50 in den Boden. Von den 220 in die Luft emittierten Stoffen ist beispielsweise das in einer Glasfabrik verwendete Natron für 3 Prozent der potenziellen gesundheitsschädlichen Folgen und für 6 Prozent der Gefahren für die Ökosysteme verantwortlich (bezogen auf die Auswirkungen des Produkts insgesamt).
Eine weitere Bedrohung für die Ökosysteme – 16 Prozent der negativen Auswirkungen bei der Glasherstellung – ergibt sich aus der für den Schmelzofen verbrauchten Energie; 20 Prozent der insbesondere für das Klima schädlichen Folgen sind auf die Erzeugung der Energie für die Fabrik zurückzuführen, die das Glas herstellt. Insgesamt fällt die Hälfte der Emissionen, die zur Erderwärmung beitragen, in der Glasfabrik selbst an, die andere Hälfte an anderen Punkten der Produktionskette. Diese Emissionen reichen von Kohlendioxid und Stickstoffoxiden in relativ hoher Konzentration bis zu Spuren von Schwermetallen wie Kadmium und Blei.
Nimmt man die zur Herstellung von einem Kilogramm Verpackungsglas eingesetzten Materialien unter die Lupe, kommt man im Verlauf der Produktion auf ganze 659 verschiedene Inhaltsstoffe – von Chrom, Silber und Gold bis zu exotischen Chemikalien wie Krypton und Isocyansäure und acht in ihrer Molekularstruktur unterschiedlichen Varianten von Äthan.
Eine schier unüberschaubare Menge an Informationen. »Deshalb nutzen wir die Folgenabschätzung, mit deren Hilfe wir alles zu einer Handvoll aussagekräftiger Indikatoren bündeln können«, so Norris. Will man beispielsweise wissen, welche Karzinogene bei der Glasfabrikation anfallen, dann sagt einem die Ökobilanz, dass die größten Übeltäter aromatische Kohlenwasserstoffe sind – am bekanntesten sind die flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), die sich im Geruch frisch aufgetragener Wandfarbe oder eines Duschvorhangs aus Vinyl bemerkbar machen, was Anlass zur Sorge geben kann. Bei der Glasherstellung machen diese Verbindungen etwa 70 Prozent der karzinogenen Wirkung aus.
Allerdings wird keine dieser Verbindungen direkt bei der Glasherstellung in der Fabrik freigesetzt; sie entstehen alle an irgendeinem anderen Punkt in der Prozesskette. Jede Einheit in der Ökobilanz des Glasbehälters liefert einen Ansatzpunkt zur Untersuchung der Folgen. Geht man bei der Analyse in die Tiefe, dann stellt sich heraus, dass 8 Prozent der karzinogenen Wirkung aus der Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen resultieren, die mit der Errichtung und dem Betrieb der Fabrik in Zusammenhang stehen; 16 Prozent kommen aus der Gewinnung des Erdgases, mit dem die Fabrik ihre Schmelzöfen beheizt; und 31 Prozent aus der Herstellung von Polyethylen hoher Dichte (HDPE) für die Plastikfolie, mit der die Gläser für den Versand verpackt werden.
Heißt das, dass wir überhaupt keine Glasverpackungen für Nahrungsmittel mehr verwenden sollten? Nein, keineswegs. Glas bietet gegenüber Materialien wie Plastik entscheidende Vorteile. Anders als manche Kunststoffe gibt es keine zweifelhaften Chemikalien in Flüssigkeiten ab, und es lässt sich unendlich oft wiederverwerten.
Doch während mir Norris die interessantesten Punkte der Ökobilanzierung eines Glasbehälters erläuterte, ging mir plötzlich ein Licht auf: Das alles galt für einen Glasbehälter, der zu 60 Prozent aus recyceltem Material besteht.
Was genau, fragte ich Norris, gewinnt man durch diese 60 Prozent Recycling? Zum einen, antwortete er, spart man durch die Verwendung von Altglas anstelle von neuem in etwa denselben Anteil an Rohmaterialien ein, das heißt an deren Gewinnung, Verarbeitung und Transport. »Natürlich muss auch das Altglas noch verarbeitet und transportiert werden, aber unter dem Strich bringt das Glasrecycling immer noch Vorteile. Ein konkretes Beispiel: Bei einem Anteil von 28 Prozent recyceltem Material pro Tonne Glas spart man 1900 Liter Wasser und 9 Kilogramm an CO2-Emission in die Luft.«
Doch trotz Recycling bleiben immer noch all die anderen Auswirkungen. Damit wandelt sich unsere Vorstellung von einem Entweder-Oder – entweder »grün« oder nicht – zu einem wesentlich differenzierteren Bild mit feinen Abstufungen, die je nach Kriterien die verschiedensten Grade ökologischer Belastung zeigen. Erstmals steht uns eine Methodik zur Verfügung, um die komplexen Wechselbeziehungen zwischen jedem einzelnen Schritt von der Rohstoffgewinnung und Herstellung von Produkten über ihren Gebrauch bis zu ihrer Entsorgung zu verfolgen, systematisch zu erfassen und darzustellen. Und um daraus ein Fazit zu ziehen, was jeder einzelne Schritt für die Ökosysteme – sei es die Umwelt oder der menschliche Körper – bedeutet.
Betrachten wir unter diesem Aspekt einmal die Einkaufstaschen, die die britische Designerin Anya Hindmarch in einer limitierten Auflage von 20000 Stück herausbrachte. Die Idee dazu kam ihr, als die ethisch-ökologische Organisation We Are What We Do an sie herantrat. Hindmarch nutzte ihre Bekanntheit in der Modewelt, um das Bewusstsein der Verbraucher dahingehend zu schärfen, dass sie in Geschäften auf Plastiktüten verzichteten.[10] Und es funktionierte.
Die Taschen wurden für 15 Dollar angeboten und in Supermärkten verkauft statt wie Hindmarchs übrige Produkte in teuren Boutiquen. Schon um zwei Uhr morgens bildeten sich vor den ausgewählten Läden in ganz England Schlangen – und um neun Uhr vormittags war nicht eine Tasche mehr zu haben.[11] Als die gleichen Taschen später im Hauptgeschäft von Whole Foods am Columbus Circle in Manhattan angeboten wurden, waren sie innerhalb von dreißig Minuten restlos ausverkauft. In Hongkong und Taiwan gab es einen derartigen Ansturm auf die Taschen, dass Menschen dabei zu Schaden kamen – weshalb darauf verzichtet wurde, sie auch in Peking und anderen asiatischen Großstädten anzubieten. Und als man in Großbritannien über höhere Standards für Recyclingprodukte diskutierte, wurde wiederholt auf dieses Beispiel hingewiesen.
Hindmarch zeigt mit ihrem Öko-Chic einen Weg auf, wie geschicktes Vorgehen und intelligente Produkte der Veränderung unserer Gewohnheiten ein wenig nachhelfen können. Und ändern müssen wir uns. Die kleinen und großen Plastiktüten, in denen wir unsere Einkäufe nach Hause tragen, sind ökologisch eine Katastrophe. Allein in den USA gehen jedes Jahr 88 Milliarden Stück über die Ladentheke; ihre im Überfluss vorhandenen Verwandten von São Paulo bis Neu-Delhi treibt der Wind durch die Straßen, sie bleiben im Buschwerk hängen, verstopfen die Rinnsteine und kosten Tiere, die sie fressen oder sich in ihnen verfangen, das Leben. Und das Schlimmste ist: Es dauert schätzungsweise fünfhundert bis tausend Jahre, ehe eine Plastiktüte verrottet ist.
Doch Papiertüten sind nicht unbedingt besser. Nach Schätzungen der US-Umweltbehörde EPA wird bei der Herstellung von Papiertüten mehr Energie verbraucht und mehr Wasser verschmutzt als bei Plastiktüten. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Beispielsweise lassen sich Letztere zu 100 Prozent recyceln – tatsächlich wird in den USA aber nur eine von hundert Plastiktüten wiederverwertet.
In einer bahnbrechenden, 1999 in Science veröffentlichten Studie wurden mittels Ökobilanzierung die Vorteile von Papier gegenüber Kunststoff als Material für Kaffeebecher verglichen, und sie machte die vielfältigen Schwierigkeiten eines solchen Vergleichs deutlich.[12] Für einen Pappbecher werden 33 Gramm Holz verbraucht, für einen Styroporbecher rund 4 Gramm Öl oder Erdgas als Brennstoff; beide erfordern den Einsatz einer Menge Chemikalien (deren gesundheitliche Auswirkungen die Analyse nicht berücksichtigt); bei der Herstellung des Pappbechers wird 36-mal so viel Strom verbraucht und 580-mal so viel Abwasser – mit einem gewissen Maß an Belastungen durch Giftstoffe wie etwa Chlor – erzeugt wie bei einem Styroporbecher. Andererseits entsteht bei der Herstellung von Styroporbechern Pentan, ein Gas, das die Ozonschicht schädigt und den Treibhauseffekt verstärkt. Beim Verrotten eines Pappbechers wiederum wird Methan freigesetzt. Und noch komplizierter wird die Rechnung, wenn man nicht nur die Folgen für die Umwelt, sondern auch die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit einbezieht.
Die intelligente Antwort auf die Frage »Papier- oder Plastiktüte?« lautet immer noch: »Weder, noch. Ich habe eine Tasche dabei.« In vielen Ländern, in denen die Kunden für eine Einkaufstüte bezahlen müssen, ist es bereits gängige Praxis, selbst eine Tasche mitzubringen; auch in amerikanischen Geschäften ist dies zunehmend zu beobachten. Doch bei einer Ökobilanzierung stellt sich auch hier die Frage: Welche Auswirkungen hat diese ökologisch korrekte Tasche?
Hindmarchs Firma gab sich alle Mühe, ihre Taschen ökologisch korrekt herzustellen: Sie wurden in zertifizierten Fabriken produziert, die faire Löhne zahlen und keine Kinder beschäftigen; die Folgen von Herstellung und Transport wurden durch den Erwerb von Kohlenstoffemissionsrechten ausgeglichen; und die Taschen wurden zum Selbstkostenpreis verkauft. Hindmarch wollte sogar fair gehandelte, direkt von kleinen Pflanzern gekaufte Baumwolle verwenden, konnte aber nicht genug davon auftreiben und griff deshalb immerhin auf organisch angebaute Baumwolle zurück.
Und doch muss man sich fragen, was eine Ökobilanz dieser beispielhaften Tasche an Umweltschäden ergeben würde – und damit auch, in welcher Weise sie noch verbessert werden könnte.
Oft trügt der »grüne« Schein
Auf Hindmarchs leinener Einkaufstasche prangte der Slogan: »Ich bin KEINE Plastiktasche«, ein wortspielerischer Bezug zu einem Bild des belgischen Surrealisten René Magritte von 1929, auf dem eine Pfeife dargestellt ist, unter der steht: Ceci n’est pas une pipe – Dies ist keine Pfeife. Der Titel des Bildes, La trahison des images (wörtlich: Der Verrat der Bilder) unterstreicht Magrittes Aussage, dass das Bild nicht das Ding selbst ist und die Dinge nicht das sind, als was sie erscheinen.
Neulich habe ich ein T-Shirt erworben, das in einem Kaufhaus besonders augenfällig plaziert war. Auf dem Etikett heißt es stolz: »100% organische Baumwolle – tausendmal besser für alle.«
Diese Aussage stimmt und stimmt auch wieder nicht.
Zuerst das, was stimmt: die Vorteile des Verzichts auf Pestizide beim Baumwollanbau.[13] Weltweit werden rund 10 Prozent aller Pestizide auf Baumwollfeldern ausgebracht. Zur Vorbereitung des Bodens, damit die zarten jungen Baumwollpflanzen gedeihen, besprüht man ihn mit einem Gift, sogenannten Organophosphaten (sie führen beim Menschen zur Schädigung des zentralen Nervensystems), die alle mit der Baumwolle möglicherweise konkurrierenden Gewächse abtöten und ebenso alle Insekten, die sich an den jungen Pflanzen gütlich tun könnten.
Nach einer solchen Bodenbehandlung dauert es – vorausgesetzt, es werden keine Pestizide mehr eingesetzt – bis zu fünf Jahre, ehe auch nur Regenwürmer wiederkommen, ein entscheidender Schritt bei der Gesundung des Bodens. Kurz vor der Ernte werden die Felder maschinell mit Paraquat besprüht. In der Regel landet dabei etwa die Hälfte dieses Unkrautbekämpfungsmittels in nahe gelegenen Gewässern und auf Äckern. Angesichts der von Pestiziden verursachten Schäden steht wohl außer Frage, dass organische Baumwolle die umweltfreundlichere Variante ist – so weit, so gut.
Aber nun zu den Schattenseiten. Zum Beispiel sind Baumwollpflanzen ungeheuer durstig. Für ein einziges T-Shirt werden rund 10000 Liter Wasser verbraucht. Der Aralsee ist vor allem wegen des hohen Wasserbedarfs von Baumwollplantagen in weiten Teilen verlandet. Zum anderen wirkt sich allein schon das Umpflügen des Bodens auf das Ökosystem aus und setzt CO2 frei.
Das T-Shirt aus organischer Baumwolle, das ich kaufte, war dunkelblau. Baumwolle wird zuerst gebleicht, dann gefärbt und schließlich mit Hilfe von Industriechemikalien – unter anderem Chrom, Chlor und Formaldehyd – veredelt, von denen jede Substanz auf ihre Weise giftig ist. Was das Ganze noch schlimmer macht: Baumwolle lässt sich schwer färben, deshalb landen große Mengen Färbemittel im Abwasser der Fabrik und später womöglich in nahen Flüssen und im Grundwasser. Manche häufig verwendeten Textilfarben enthalten Karzinogene; Mediziner wissen seit langem, dass Arbeiter in Färbereien auffällig oft an Leukämie erkranken.
Das Etikett meines T-Shirts ist ein gutes Beispiel für »Greenwashing«, das selektive Hervorheben von einem oder zwei ökologisch gesehen positiven Merkmalen eines Produkts, um ihm insgesamt den Anstrich besonderer Umweltfreundlichkeit zu geben. Eine umfassendere Analyse der versteckten Auswirkungen bringt zahlreiche Aspekte an den Tag, warum das T-Shirt letztlich vielleicht doch nicht so »grün« ist. Wenn auch ein organisches T-Shirt durchaus seine Vorteile hat: Bleiben die negativen Auswirkungen eines Produkts im Dunkeln, dann stellt der »organische« Anteil bestenfalls den ersten Schritt zu einer sozial verantwortungsbewussteren oder nachhaltigeren Produktionsweise dar; schlimmstenfalls ist es lediglich ein Marketingtrick.
Als die Fastfoodkette Dunkin’ Donuts ankündigte, dass ihre Doughnuts, Croissants, Muffins und Munchkins zukünftig »transfettfrei« sein würden, folgte das Unternehmen anderen Großkonzernen in der Branche, die ihre Produkte bereits ein bisschen gesünder gemacht hatten. Aber entscheidend sind die zwei Wörter ein bisschen: Trotz »null Transfett« bleiben alle diese Backwaren eine ungesunde Mischung aus Fett, Zucker und Weißmehl. Bei der Untersuchung Zehntausender in Supermärkten angebotener Produkte stellten Ernährungswissenschaftler – keineswegs überraschend – fest, dass ein Großteil der als »gesund« vermarkteten Artikel es in Wirklichkeit gar nicht waren.[14]
Die Tatsache herauszustellen, dass ein T-Shirt aus organischer Baumwolle gefertigt oder ein Doughnut frei von Transfetten ist, lässt dieses Produkt aus Sicht des Marketing im Glanz ökologischer Korrektheit erstrahlen. Werbefachleute heben natürlich immer eine oder zwei positive Eigenschaften eines Produkts hervor, um es für den Verbraucher möglichst reizvoll erscheinen zu lassen. An erster Stelle stand schon immer der appetitliche Bratenduft, nicht das Steak selbst.
Doch dieser bewusste Taschenspielertrick lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers von allen negativen Aspekten ab, die ein bestimmtes Produkt vielleicht dennoch besitzt. Die Farbstoffe im T-Shirt sind gefährlich wie eh und je, ebenso enthält ein »Null Transfett«-Doughnut immer noch so viel Fett und Zucker, dass der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellt. Solange wir aber nur auf den winzigen Anteil ökologischer Vorzüge schauen, können wir uns bei unserer Kaufentscheidung einigermaßen gut fühlen.
Greenwashing schafft also lediglich die Illusion, dass wir ein ökologisch vorbildliches Produkt kaufen; es ist sozusagen grün getüncht.
Jeder kleine Schritt in Richtung Grün hilft, keine Frage. Unsere Fixierung auf Dinge, die das Etikett »grün« tragen, zeigt aber lediglich, dass wir uns in einem Übergangsstadium befinden und erst allmählich ein Bewusstsein für ökologische Auswirkungen entwickeln. Bis jetzt fehlt es hier noch an Präzision, an tieferem Verständnis oder Klarheit.
Mein pseudo-grünes T-Shirt ist kein Einzelfall. In einer Studie wurden für über tausend verschiedene, bei Discountern wahllos aus den Regalen gegriffene Produkte 1753 positive ökologische Kennzeichnungen gezählt.[15] So gibt es beispielsweise Markenhersteller von Papier, die einige wenige Merkmale hervorheben – zum Beispiel, dass ihr Papier einen bestimmten Anteil an Recyclingmaterial enthält oder chlorfrei gebleicht wurde –, jedoch andere wichtige umweltrelevante Punkte unberücksichtigt lassen, etwa ob die Holzpulpe für die Papiermühle aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt oder ob die bei der Produktion eingesetzten enormen Wassermengen ordnungsgemäß gereinigt werden, ehe das Wasser wieder in einen Fluss geleitet wird. Oder denken wir an den Drucker im Büro, dessen geringen Energieverbrauch der Hersteller betont, jedoch nicht erwähnt, dass das Gerät bei Betrieb die Raumluft belastet oder dass dafür weder recycelte Druckerpatronen noch Recyclingpapier verwendet werden können. Mit anderen Worten: Dieser Drucker ist nicht »von der Wiege bis zum Grab« grün, sondern lediglich so weit technisch verändert, dass ein einziges Problem behoben wird.
Natürlich gibt es relativ umweltfreundliche Produkte, Baumaterialien und Energiequellen. Wir können phosphatfreie Waschmittel kaufen; einen Teppichboden verlegen, der weniger Giftstoffe ausdünstet, oder Bambusdielen aus nachhaltiger Forstwirtschaft; oder uns einen Stromversorger suchen, der überwiegend Wind-, Sonnen- oder andere erneuerbare Energie liefert. All das kann uns das Gefühl geben, eine umweltfreundliche Entscheidung getroffen zu haben.
Doch solche Entscheidungen zugunsten der Umwelt, so hilfreich sie auch sind, lassen uns nur allzu oft und umso eher vergessen, dass das, was wir heute als »grün« betrachten, lediglich ein Anfang ist, ein kleines bisschen ökologische Korrektheit unter Abertausenden von schlimmen Auswirkungen aller vom Menschen gemachten Dinge. Was heute als Maßstab für Umweltfreundlichkeit gilt, wird morgen als ökologisch kurzsichtig gelten.