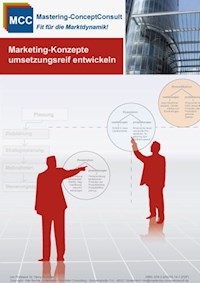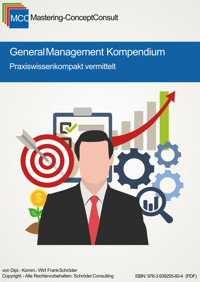49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schröder Consulting
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: MCC Ökonomie
- Sprache: Deutsch
Das MCC Ökonomie Kompendium befasst sich mit allen relevanten Themen der Volkswirtschaftslehre. Ein hoher Praxisbezug verhilft schnell die komplexen Sacherhalte und Auswirkungen zu erfassen und zu verstehen. Erhalten Sie alle wesentlichen Elemente der Mikroökonomie und der Makroökonomie sowie der Phasen innerhalb der Konjunkur und Wachstum Phasen anschaulich und leicht verständlich dargestellt, um wirtschaftspolitische Entscheidungen besser nachvollziehen zu können. Hierbei verhilft Ihnen die Vermittlung des wirtschaftspolitischen Instramentariums schnell, wirtschaftspolitische Ziele und Zyklen zu erfassen. Viele praxisorientierte Beispiele und die leicht verständliche Ausdrucksweise des Autors verhelfen schnell dazu, komplexe, wirtschaftliche Zusammenhänge wie zum Beispiel die Staatsverschuldung bis hin zur Sparpolitik zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mikroökonomie Crashkurs für Manager
Wirtschaftliche Entscheidungen mikroökonomisch ableiten
von Professor Dr. Harry Schröder
Copyright – Alle Rechte vorbehalten Frank Schröder Consulting -
Inhaltsverzeichnis
1 GRUNDLAGEN DER MIKRKOÖKONOMIE 1.1 Der Ursprung der Mikroökonomie. 1.2 Grundtatbestände des Wirtschaftens. 1.2.1 Übungsfrage „Teilgebiete der Ökonomie“ 1.3 Der einfache Wirtschaftskreislauf 1.4 Die Produktionsfaktoren untereilen sich in: 1.4.1 Übungsfrage: 1.5 Haushalts- und Unternehmereinkommen 1.5.1 Übungsfrage: 1.6 Bedürfnisarten und Güterarten 1.7 Produktionsprozess und Produktionsmöglichkeitskurve 1.7.1 Übungsfrage: 1.8 Wirtschaften nach ökonomischem Prinzip 1.8.1 Übungsfrage „Input/Output“ 1.8.2 Repetitorium Mikroökonomie-Grundlagen II 1.9 Arbeitsteilung und Wirtschaftssysteme 1.9.1 Übungsfrage: 1.9.2 Repetitorium Mikroökonomie-Grundlagen III
2 FUNKTIONEN DER MIKROÖKONOMIE 2.0.1 Übungsfrage: 2.1 Die Nachfragefunktion der Haushalte 2.1.1 Übungsfrage: 2.2 Gesamt- und Grenznutzen eines Gutes. 2.2.1 Übungsfrage: 2.3 Die Preiselastizität der Nachfrage 2.3.1 Übungsfrage „Einkommenselastizität“ 2.4 Die Angebotsfunktion der Unternehmungen 2.5 Die mikroökonomische Kostenanalyse 2.5.1 Repetitorium Mikroökonomie-Funktionen 2.5.2 Grenzkosten und Opportunitätskosten 2.5.3 Übungsfrage „Kosten“ 2.6 Die Minimalkostenkombination 2.7 Die mikroökonomische Erlösanalyse 2.7.1 Übungsfrage: 2.7.2 Rentabilitätsberechnungen 2.7.3 Übungsfrage „Produktionseinstellung“ 2.7.4 Repetitorium Mikroökonomie-Funktionen II
3 KLASSIFIKATIONSELEMENTE IN DER MIKROÖKONOMIE 3.1 Klassifikation von Marktformen 3.1.1 Übungsfrage “Grenzerlös“ 3.2 Vollkommene und unvollkommene Märkte 3.2.1 Kriterien für vollkommene Märkte 3.2.2 Übungsfrage: 3.2.3 Repetitorium Mikroökonomie-Klassifikationselemente I 3.2.4 Kriterien für unvollkommene Märkte 3.2.5 Übungsfragen: 3.3 Kombinationen zum Marktgleichgewicht 3.3.1 Übungsfrage: 3.4 Preis-Mengen-Kombinationen zum Marktgleichgewicht 3.4.1 Das Marktgleichgewicht im Monopol 3.4.2 Repetitorium Mikroökonomie-Klassifikationselemente II 3.4.3 Das Marktgleichgewicht im Oligopol 3.4.4 Das Marktgleichgewicht im heterogenen Polypol 3.4.5 Repetitorium Mikroökonomie-Klassifikationselemente III
1 GRUNDLAGEN DER MIKRKOÖKONOMIE
1.1 Der Ursprung der Mikroökonomie
Der Ursprung der Mikroökonomie lässt sich mit dem Jahr 1776 genau datieren. In jenem Jahr bracht Adam Smith seinen Klassiker heraus (The Wealth of Nations).
In diesem Buch legte Smith die Grundprinzipien einer Marktwirtschaft dar.
Die Mikroökonomie beschäftigt sich grundsätzlich mit dem Verhalten von Haushalten, Märkten und Unternehmen. Da bei der Mikroökonomie die Beziehung der Haushalte zu den Märkten und Unternehmen stets gewahrt bleibt, ist die Mikroökonomie am treffendsten als „betriebsnahe Volkswirtschaftslehre“ zu bezeichnen.
Smith legte dar, wie einzelne Preise entstehen und er forschte nach den Stärken und Schwächen des Marktmechanismus. Er erkannte das Effizienzpotenzial der Märkte, „die unsichtbare Hand“, durch die das Eigeninteresse der Haushalte und der Unternehmen zum Vorteil für alle wird.
1.2 Grundtatbestände des Wirtschaftens
Wirtschaften bedeutet die rationale Disposition über knappe Güter.(d.h. planvolle Tätigkeit, um mit der Knappheit der Güter fertig zu werden)
Die Mikroökonomie ist dazu im Wesentlichen eine Entscheidungstheorie: „Sie untersucht die Entscheidungen von einzelnen Wirtschaftssubjekten in Knappheitssituationen".
1.2.1 Übungsfrage „Teilgebiete der Ökonomie“
1. Welches sind die beiden Teilgebiete der Ökonomie und beschreiben Sie die Aufgabenfelder!
Lösungen
Die Ökonomie wird in zwei große Teilgebiete gegliedert:
1) Die Mikroökonomik untersucht, wie Haushalte und Unternehmungen Einzelentscheidungen treffen und wie die Wirtschaftseinheiten auf den Märkten zusammentreffen bei den Fragen:
a)
welche Güter produziert werden
b)
wie diese Güter produziert werden
c)
für wen die Güter produziert werden
2)
Die Makroökonomik befasst sich mit der Gesamtleistung einer Wirtschaft und zwar mit den:
a)
Gütermärkten
b)
Geldmärkten
c)
Arbeitsmärkten
Merke: Da gesamtwirtschaftliche Entwicklungen durch eine Vielzahl von Entscheidungen entstehen, kann man makroökonomische Analysen nicht ohne die Mikroentscheidungen verstehen.
Die Wirtschaftssubjekte:
sind Träger wirtschaftlicher Entscheidungen
disponieren auf der Grundlage begrenzter Budgets
verfolgen individuell spezielle Ziele
Die planmäßigen Dispositionen beziehen sich auf:
a) den Konsum von Gütern b) die Produktion von Gütern
Arten und Ziele der Wirtschaftssubjekte:
Konsumierende Wirtschaftssubjekte nennt man „Haushalte" und diese untereilen sich in:
private Haushalte
öffentliche Haushalte
(Bund /Länder /Gemeinden /Kommunen)
Produzierende Wirtschaftssubjekte nennt man „Unternehmungen"
Private und öffentliche Unternehmungen gliedern sich auf in:
des primären Sektors
des sekundären Sektors
des tertiären Sektors
Die Zielorientierungen lauten in den:
Es wird in drei Sektoren selektiert:
1.3 Der einfache Wirtschaftskreislauf
Merke: Die Haushalte bieten Produktionsfaktoren an (Arbeit/Boden/Kapital) und erhalten dafür Leistungseinkommen. Weiterhin tätigen die Haushalte mit dem Einkommen Konsumausgaben.
Die Unternehmungen fragen Produktionsfaktoren nach und produzieren damit Konsumgüter. Weiterhin geben die Unternehmungen Konsumgüter an die Haushalte ab.
Der Produktionsprozess
1.4 Die Produktionsfaktoren untereilen sich in:
Arbeit
Boden
Kapital
technisches Wissen
Merke:Wobei die Produktionsfaktoren Arbeit und Boden als „originäre (ursprüngliche) Produktionsfaktoren bezeichnet werden und das Kapital als „derivativer (abgeleiteter) Produktionsfaktor gilt.
Der Produktionsfaktor Arbeit unterteilt sich in:
körperliche und geistige Arbeit
selbständige und nichtselbständige Arbeit
dispositive (anordnende) und exekutive Arbeit
gelernte, angelernte, ungelernte Arbeit
Der Produktionsfaktor Boden unterteilt sich in:
Anbauboden
(Land- u. forstwirtschaftliche Nutzung)
Abbauboden
(Bergbauliche Nutzung)
Standortboden
(Bauliche Nutzung / Verkehrsnutzung)
Der Produktionsfaktor Kapital unterteilt sich in:
Finanzkapital
(Geldkapital)
Sachkapital
(produzierte Produktionsmittel, die der Güterherstellung dienen wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, usw.)
1.4.1 Übungsfrage:
In welcher Hinsicht entspricht die Ausbildung einer Art von Kapital?
Lösung:
Ausbildung stellt einen wichtigen Bestandteil des Humankapitals dar.
Humankapital beschreibt u.a. die Summe aller Ausbildungsinvestitionen.
Ausbildung stellt damit den Einsatz von Ressourcen dar, mit dem Ziel, die Produktivität in der Zukunft zu erhöhen.
Die Ausbildung ist personengebunden und nicht übertragbar und diese Verbindung macht sie zum Humankapital.
Der Produktionsfaktor technisches Wissen ist der qualitative Produktionsfaktor, welcher die Höhe der Güterproduktion bestimmt. Dieser Produktionsfaktor hat direkten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum.
Er ist häufig wie folgt, eingebettet:
Innerhalb des Sachkapitals
(Sachinvestitionen mit Know how zu bedienen)
Innerhalb des Produktionsfaktor Arbeit
(Bildungsinvestitionen mit Zuwachs an Know how)
1.5 Haushalts- und Unternehmereinkommen
Die Leistungseinkommen der Haushalte teilen sich auf in:
Funktionelle Einkommen
(vertraglich vereinbarte Entgelte der Produktionsfaktoren)
Entgelte der Produktionsfaktoren
-
Arbeit - Lohn -
Boden - Grundrente -
Kapital - Zins
Entgelte der ProduktionsfaktorenVerteilungsprozess
Der Lohn wird wie folgt definiert:
Die folgenden Lohnformen gibt es:
Zeitlohn
Leistungslohn
(Akkordlohn, Prämienlohn, Leistungszulage)
Vor- und Nachteile des Zeitlohns
Vorteile:
berücksichtigt individuellen Arbeitsrhythmus
ermöglicht Qualitätsarbeit
Nachteile:
schafft keine Leistungsanreize
Leistungskontrollen notwendig
Grundrenten sind in der Ökonomik ganz allgemein Einkommen, welche durch die natürlichen Knappheitszustände zustande kommen.
Entscheidungstheorien zu den Unternehmereinkommen:
Das Allokationsproblem
In welcher Kombination sollen die Faktoren zur Produktion welcher Güter eingesetzt werden?
Das Distributionsproblem
Wie sollen die produzierten Güter auf die Haushalte verteilt werden?
Das Koordinationsproblem
Wie sind die Konsumtionspläne der Haushalte mit den Produktionsplänen der Unternehmungen in Übereinstimmung zu bringen?
Begriffe der Einkommensverteilung
1.5.1 Repetitorium Mikroökonomie-Grundlagen I
1.a) Definieren Sie den Begriff "Wirtschaften"!
b) Was sind Wirtschaftssubjekte und auf welcher Grundlage disponieren sie?
c) Welche spezifischen Zielorientierungen haben Wirtschaftssubjekte?
Lösungen:
zu a) rationale Disposition über knappe Güter, d.h. planvolle Tätigkeit, um mit der Knappheit der Güter fertig zu werden.
zu b) Wirtschaftssubjekte sind Träger wirtschaftlicher Entscheidungen und disponieren auf der Grundlage begrenzter Budgets.
zu c) Haushalte = Nutzenmaximierung Öffentl. Haushalte = Kostendeckung Unternehmungen = Gewinnmaximierung
2. Beschreiben Sie beim "einfachen Wirtschaftskreislauf" die Funktionen:
a) der Haushalte b) der Unternehmungen
Lösungen:
zu a) Haushalte bieten Produktionsfaktoren an (Arbeit, Boden, Kapital). Erhalten dafür Leistungseinkommen und tätigen mit dem Einkommen Konsumausgaben.
zu b) Unternehmungen fragen Produktionsfaktoren nach, produzieren damit Konsumgüter und geben Konsumgüter an die Haushalte ab.
3. Unternehmungen gliedern sich in unterschiedliche Sektoren.
a) Nennen Sie die Sektoren und deren wirtschaftlichen Haupttätigkeiten
b) Listen Sie zu jeder Haupttätigkeit jeweils zwei Beispiele auf
Lösungen:
Sekundär = z.B. Handwerk, Industrie
4.
a) Zählen Sie die Arten des Produktionsfaktors "Boden" auf und nennen Sie jeweils ein Nutzungsmerkmal!
b) Beschreiben Sie den derivativen Produktionsfaktor!
Lösungen:
zu b) Der derivative Produktionsfaktor umfasst Finanzkapital (Geldkapital) und Sachkapital (dient der Güterherstellung)
5.Beschreiben Sie im Rahmen der Entscheidungstheorien zu den Unternehmereinkommen
a) das Allokationsproblem
b) das Distributionsproblem
c) das Koordinationsproblem
Lösungen :
zu a) In welcher Kombination sollen die Faktoren zur Produktion welcher Güter eingesetzt werden?
zu b) Wie sollen die produzierten Güter auf die Haushalte verteilt werden?
zu c) Wie sind die Konsumtionspläne der Haushalte mit den Produktionsplänen der Unternehmungen in Übereinstimmung zu bringen?
Übungsfrage:
Was beschreibt der Begriff Effizienz?Lösung: Effizienz beschreibt die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre knappen Ressourcen bestmöglich auszunutzen.
Bezogen auf die Produktionsmöglichkeitskurve (PMK) bedeutet das, dass die Wirtschaft dann effizient arbeitet, wenn sie sich auf der PM-Kurve befindet, anstatt innerhalb der PMK. D.h. die Wirtschaft produziert dann effizient, wenn sie nicht mehr von einem Gut erzeugen kann, ohne zugleich bei einem anderen Gut Abstriche machen zu müssen.
Oder anders ausgedrückt: Produktionseffizienz ist dann gegeben, wenn eine Gesellschaft den Output eines Gutes nicht ohne Verzicht auf ein anders Gut erhöhen kann. Auf der PM-Kurve zu stehen bedeutet, dass Produktionssteigerungen bei einem Gut unweigerlich zum Verzicht auf andere Güter führen. Wenn eine Wirtschaft ineffizient ist, also ein Teil der Ressourcen nicht genutzt wird, befindet sie sich nicht auf ihrer PMK, sondern irgendwo dahinter innerhalb der Produktionsmöglichkeitskurve.
Merke: Eine Quelle der Ineffizienz sind Depressionsphasen im Konjunkturzyklus oder Störungen durch Streiks oder politische Veränderungen usw.
1.6 Bedürfnisarten und Güterarten
Bedürfnisse sind ein Grundtatbestand des Wirtschaftens und bilden die Existenz von Bedürfnissen
Merke:Bedürfnis ist das Empfinden eines Mangels mit dem Bestreben, diesen zu beheben.
Folgende Bedürfnisarten gibt es:
Existenz- oder Grundbedürfnisse
(z.B. essen, trinken, schlafen, etc.)
Kulturbedürfnisse
(abwechslungsreiche Nahrung, modische Kleidung,
geräumiges Wohnen, schnelle Verkehrsmittel)
Luxusbedürfnisse
(großzügige Villa, Privatjet, etc.)
Individualbedürfnisse
(Mangel, den ein Individuum empfindet)
Kollektivbedürfnisse
(entstehen aus dem Zusammenleben,
z.B. Rechtssicherheit, Polizeischutz, Verteidigung)
Offene Bedürfnisse
(alle bewussten Bedürfnisse)
Latente Bedürfnisse
(alle unbewussten Bedürfnisse, werden z.B. durch Werbung geweckt)
Die Entwicklung vom Bedürfnis zum Bedarf:
Bedürfnisse umreißen abstrakte Wünsche
(z.B. trinken)
Bedarf ist die Konkretisierung der Bedürfnisse
(z.B. Kaffee trinken)
Marktwirksame Nachfrage entsteht erst, wenn der Bedarf mit Kaufkraft ausgestattet ist
Vom Bedürfnis zur Nachfrage
Einkommen und Kaufkraft werden in der Mikroökonomie aufgeteilt in:
Güter sind Mittel der Bedürfnisbefriedigung
Die grundsätzliche Unterscheidung der Güterarten:
freie Güter
(haben keinen Preis)
wirtschaftliche Güter
(haben einen Preis)
a) Gebrauchsgüter (werden über eine längere Zeit genutzt)
b) Verbrauchsgüter (stiften nur einmal Nutzen)
2. immaterielle Güter werden unterteilt in:
Dienstleistungen
(persönliche und unpersönliche)
Rechte
(z.B. Lizenzen)
Produktivgüter
(dienen der Produktion anderer Güter)
Konsumgüter
(dienen dem Ge- und Verbrauch der Haushalte)
Komplementäre Güter
(sich ergänzende)
Substitutive Güter
(sich ersetzende)
Homogene Güter
(gleichartige)
Heterogene Güter
(ungleichartige)
Privates Gut
(in Besitz kommt, wer Preis bezahlt)
öffentliches Gut
(jeder kann kostenlos teilhaben z.B. öffentliche Sicherheit)
1.7 Produktionsprozess und Produktionsmöglichkeitskurve
Der Produktionsprozess hat folgende Merkmale:
die Güter sind nicht im konsumreifen Zustand vorhanden
der Umformungsprozesses zur Konsumreife ist notwendig
es erfolgt der Einsatz von Produktionsfaktoren, diese werden innerhalb der Produktion passend kombiniert
1.7.1 Übungsfrage:
Warum ist die Produktivität wichtig?
Lösung:
Die Produktivität misst die Menge der pro Arbeitsstunde produzierten Güter.
Unterschiede im Lebensstandard sind hauptsächlich nationalen der Produktivität zuzurechnen.
In Volkswirtschaften, die eine große Gütermenge pro Zeiteinheit herstellen, ist der Lebensstandard hoch.
In Volkswirtschaften mit weniger produktiven Arbeitskräften sind die Lebensbedingungen bescheidener.
Der Zusammenhang zwischen Produktivität und Lebensstandard hat Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik.
Ein Anstieg im Lebensstandard setzt wirtschaftspolitische Maßnahmen voraus, die die Produktivität erhöhen.
Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, zu sorgen für:
einen hohen Ausbildungsstand
eine gute Kapitalausstattung
den Zugang zu Spitzentechnologien
Die Produktionsmöglichkeitskurve (PMK) zeigt die maximalen Produktionsmengen, die eine Wirtschaft angesichts ihres technologischen Fachwissens und der verfügbaren Menge an Produktionsfaktoren erzielen kann.
Durch Knappheitssituationen bei den Produktionsfaktoren und der verfügbaren Technologie sind den Unternehmungen bei der Produktion Grenzen gesetzt.
Dazu folgendes Entscheidungsmodell in Knappheitssituationen:
Stellen wir uns eine Wirtschaft vor, die nur zwei Güter hervorbringt: Kanonen und Kühlschränke
Produktionsmöglichkeiten-Tabelle
Die bestehenden Möglichkeiten:
Punkt A: nur Kanonen- keine Kühlschränke
Punkt F: nur Kühlschränke - keine Kanonen
Punkt B,C,D,E: zugunsten der Kühlschränke wird auf immer mehr Kanonen verzichtet.
Produktionsmöglichkeiten-Diagramm
Eine fortlaufende Kurve verbindet die im Diagramm eingezeichneten Punkte der Produktionsmöglichkeiten.
Produktionsmöglichkeiten-Analyse
Punkt l Punkte, die außerhalb der Kurve liegen, sind erst mit einsetzendem Wachstum erreichbar.
Punkt U Jeder Punkt innerhalb der Kurve zeigt an, dass Ressourcen nicht bestmöglich genutzt werden.
Solche Analysen sind für jede Auswahl von Gütern einsetzbar:
Je mehr Autobahnen, desto weniger bleibt für den sozialen Wohnungsbau
Je mehr für Ernährung ausgegeben wird, desto weniger bleibt für Bekleidung
Je mehr konsumiert wird, desto weniger bleibt für Produktivgüter
1.8 Wirtschaften nach ökonomischem Prinzip
Das Wirtschaften nach dem ökonomischen Prinzip dient der Überbrückung des Spannungsverhältnisses zwischen Bedürfnissen und knappen Gütern.
Die „Planmäßige Disposition" beinhaltet:
eine Aufstellung der Rangreihung der zu befriedigenden Bedürfnisse
die Ablegung der Rechenschaft über die zur Verfügung stehenden Mittel
eine Zuordnung der Mittel zum jeweiligen Zweck im Wirtschaftsplan
Bei der Wirtschaftlichkeit des Planswird nach dem sogenannten „Ökonomischen Prinzip" verfahren:
a) Optimierung der Mittel nach dem:
Minimal Prinzip
gestecktem Ergebnis
geringsten Mitteleinsatz
b)Optimierung der Ergebnisse nach dem:
Maximal Prinzip
vorgegebenen Mitteleinsatz
bestmöglich erzielbarem Ergebnis
Ökonomisches Prinzip:
a) Minimal- oder Sparprinzip Gegebenes Ziel mit möglichst geringem Mitteleinsatz erstreben
b) Maximalprinzip Mit gegebenen Mitteln größtmöglichen Erfolg erstreben
Die ökonomische Ergebnisrechnung drückt sich in der Erhöhung von Produktivität und Rentabilität aus:
1.8.1 Übungsfrage „Input/Output“
Beschreiben sie die Begriffe Input / Output!
Lösung:
Jede Gesellschaft hat Entscheidungen über Input und Output ihrer Wirtschaft zu treffen. Input sind Güter oder Dienstleistungen, die von den Unternehmen in ihren Produktionsprozessen genutzt werden. Ein Synonym für Inputs ist der Begriff Produktionsfaktoren. Diese lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen: Arbeit, Boden und Kapital.
Eine Wirtschaft setzt die ihr zur Verfügung stehenden Inputs ein, um mit ihnen Outputs zu erzeugen. Outputs sind Güter und Dienstleistungen, die aus einer Produktion hervorgehen. Sie werden entweder konsumiert oder im weiteren Produktionsprozess verwendet.
Bei einem Computer based Training zählen der Zeitaufwand, die Trainings-Unterlagen und dergleichen zu den Inputs, während die Absolventen als Output zu betrachten sind.
Eine Gesellschaft muss folgende Entscheidungen treffen:
Welche Outputs sie produzieren soll und in welcher Menge?
Wie sie die Outputs produzieren soll
(mit welchem technischen Wissen)?
Für wen die Outputs zu produzieren sind und wie sie verteilt werden sollen?
Fazit: Das ergänzende „Extremumprinzip" wirft die Frage auf, ob ein begrenzter zusätzlicher Mitteleinsatz einen überproportionalen Erfolg nach sich zieht.
1.8.2 Repetitorium Mikroökonomie-Grundlagen II
1. Nennen und beschreiben Sie fünf Bedürfnisarten und nennen Sie die beiden Grund-Bedürfnistypen!
Lösungen:
Existenz- oder Grundbedürfnisse
(essen, trinken, schlafen, kleiden)
Kulturbedürfnisse
(abwechslungsreiche Nahrung, modische Kleidung usw.)
Luxusbedürfnisse
(Villa, Privatjet)
Individualbedürfnisse
(Mangel, den ein Individuum empfindet)
Kollektivbedürfnisse
(Rechtssicherheit, Polizeischutz, Verteidigung)
Offene Bedürfnisse
(alle bewussten Bedürfnisse)
Latente Bedürfnisse
(alle unbewussten Bedürfnisse)
2.
a) Wann wird ein Bedarf zur marktwirksamen Nachfrage?
b) Was ist das Realeinkommen und was das Nominaleinkommen?
c) Wie errechnet sich aus dem Nominaleinkommen die verfügbare Konsumsumme?
Lösungen:
zu a) marktwirksame Nachfrage entsteht erst, wenn der Bedarf mit Kaufkraft ausgestattet ist.
3. a) Was sind materielle und was sind immaterielle Güter? b) Beschreiben Sie Produktivgüter und Konsumgüter!
Lösungen:
zu a)Materielle Güter sind Sachgüter, d.h.:
Gebrauchsgüter
(werden über eine längere Zeit genutzt)
Verbrauchsgüter
(stiften nur einmal einen Nutzen)
Immaterielle Güter, d.h.:
Dienstleistungen
(persönliche und unpersönliche)
Rechte
(z.B. Lizenzen)
zu b)
Produktivgüter dienen der Produktion anderer Güter
Konsumgüter dienen dem Ge- und Verbrauch der Haushalte
4. a) Was zeigt die Produktionsmöglichkeitskurve an?
b) Welche Frage wirft das Extremumprinzip auf?
Lösungen:
zu a) die maximale Produktionsmenge, die eine Wirtschaft angesichts ihres technologischen Know-hows und der verfügbaren Menge an Produktionsfaktoren erzielen kann.
zu b) ob ein begrenzter zusätzlicher Mitteleinsatz einen überproportionalen Erfolg nach sich zieht
1.9 Arbeitsteilung und Wirtschaftssysteme
Die Arten der Arbeitsteilung teilen sich auf in:
Innerbetriebliche Arbeitsteilung
Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung
Internationale Arbeitsteilung
Die Vorteile der Arbeitsteilung sind:
Spezialisierung nach persönlichen Neigungen und Fähigkeiten
Reduzierung der körperlichen Arbeit
(durch Mehreinsatz von Maschinen)
Steigerung der Produktivität und Güterqualität
Die Nachteile der Arbeitsteilung sind:
Schnell aufkommende Arbeitsmonotonie
Fehlender Bezug zum Endprodukt
Die Maschine bestimmt das Arbeitstempo
Merke:
Die innerbetriebliche Arbeitsteilungdefiniert sich aus der Zerlegung eines Produktionsprozesses (z.B. Automobilproduktion) in sowohl nebeneinander gelagerte Teilprozesse (Motoren-/Getriebehersteller), als auch nacheinander gelagerte Teilprozesse (Bleche formen und lackieren).
Die internationale Arbeitsteilung, erstmalig vertreten durch Adam Smith (engl. Nationalökonom 1776), definiert sich als ökonomische Grundlage zur Wohlstandssteigerung der Nationen. Das Hauptproblem internationaler Arbeitsteilung liegt in der nicht vorhandenen Überschaubarkeit volkswirtschaftlicher Prozesse.
Die Wirtschaftsplanung in großen arbeitsteiligen Volkswirtschaften ist kompliziert, da diese nicht überschaubar in den folgenden Elementen ist:
a) der Rangordnung der Bedürfnisse
b) der verfügbaren Mittel
Wirtschaften in großen arbeitsteiligen Volkswirtschaften setzt einen Ordnungsrahmen voraus, welcher das Koordinationsproblem löst. Die Abstimmung der Pläne der Unternehmen erfolgt mit sowohl untereinander, als auch auf Grundlage der Haushaltspläne.
Die Wirtschaftssysteme können in zwei Grundformen unterteilt werden:
Zentralplanwirtschaft
Marktwirtschaft
1.9.1 Übungsfrage:
Was ist eine Marktwirtschaft?
Lösung:
Eine Marktwirtschaft ist eine Wirtschaft:
in der Haushalte und Unternehmen die wichtigsten Entscheidungen über Produktion und Konsum treffen.
ein System der Preise, Märkte, Gewinne und Verluste, Anreize und Belohnungen bestimmt, welche Güter produziert, wie die Güter produziert und für wen die Güter produziert werden.
Unternehmen produzieren die Güter, die den höchsten Gewinn erwarten lassen
(was),
mit den kostengünstigsten Produktionsmethoden
(wie),
und die Haushalte bestimmen darüber, wie sie ihr Einkommen aus Arbeit und Vermögen ausgeben
(für wen).
Abgrenzungsmerkmale bei den Wirtschaftssystemen
Anmerkungen:
Durch Mehrproduktion kommt es zur Preissenkung und Produktionsfaktoren werden aus der Produktion abgezogen.
Durch Minderproduktion kommt es zur Preissteigerung und Stabilisierung der Marktsituation.
Die Nachteile der reinen Zentralplanwirtschaft:
eingeschränkte ökonomische Freiheit
Motivationsverlust
mangelnde Beweglichkeit behördlicher Lenkungsmechanismen
(sogen. Staatsversagen)
Die Nachteile der reinen Marktwirtschaft:
weitgehende Kurzfristigkeit von Marktabläufen
mangelnde Versorgung von Kranken, Alten, Arbeitslosen
Gefahr der Wettbewerbsreduzierung
(durch wirtschaftliche Machtstellungen einzelner)
Die Realtypische Wirtschaftssysteme sind durchweg Mischsysteme, wobei Elemente der Zentralplanung oder der Marktwirtschaft dominieren. In der Bundesrepublik Deutschland wird zur Kompensierung marktwirtschaftlicher Nachteile das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft herausgestellt.
1.9.2 Repetitorium Mikroökonomie-Grundlagen III
1. Welches sinda) die Vorteile der Arbeitsteilung? b) die Nachteile der Arbeitsteilung?
Lösung:
zu a)
Spezialisierung nach persönlichen. Neigungen und Fähigkeiten
Reduzierung der körperlichen Arbeit durch Mehreinsatz von Maschinen
Steigerung der Produktivität und Güterqualität
zu b)
Arbeitsmonotonie
kein Bezug zum Endprodukt
die Maschine bestimmt das Arbeitstempo
2. a) Beschreiben Sie die Probleme der internationalen Arbeitsteilung!
b) Nennen Sie bitte einen passenden Lösungsansatz! Lösung:
zu a)
Nicht gegebene Überschaubarkeit volkswirtschaftlicher Prozesse
Keine Rangordnung der Bedürfnisse und der verfügbaren Mittel sind vorhanden
zu b)
Koordinationsmechanismus ist gefragt, welcher sicherstellt, dass die Pläne der Unternehmungen sowohl untereinander als auch auf die Pläne der Haushalte abgestimmt werden.
3. Beschreiben Sie a) die Nachteile der Zentralplanwirtschaft
b) das Koordinationsinstrument und das Lenkungssystem der Marktwirtschaft!
Lösung:
zu a)
eingeschränkte ökonomische Freiheit
Motivationsverlust
mangelnde Beweglichkeit behördlicher Lenkungsmechanismen
(sogen. Staatsversagen)
zu b)
Koordinationsinstrument ist der Markt
(auf den Märkten erfolgt Ausgleich von Angebot und Nachfrage
durch freie Preisbildung)
die jeweilige Preisentwicklung bewirkt, dass die Produktion umstrukturiert und die Produktionsfaktoren in die gewünschte Verwendung gelenkt werden.
2 FUNKTIONEN DER MIKROÖKONOMIE
Bedürfniswelt / Güterwelt
2.0.1 Übungsfrage: Wozu dient der Marktmechanismus
Antwort: Der Marktmechanismus dient der Koordinierung von Geschäftsbeziehungen durch ein System der Preise und Märkte. Mit Hilfe des Marktmechanismus ermitteln Käufer und Verkäufer die Preise und tauschen Waren und Dienstleistungen aus.
Ein Markt kann zentralisiert sein: z.B. Börse oder dezentralisiert sein: z.B. Immobilien- oder Arbeitsmarkt.
Er kann auch ausschließlich elektronisch existieren: z.B. für Finanzgeschäfte.
Definition: Ein Markt ist ein Mechanismus, mit dessen Hilfe Käufer und Verkäufer miteinander in Beziehung treten, um Preis und Menge einer Ware oder Dienstleistung zu ermitteln.
In einem Marktsystem hat alles seinen Preis, nämlich der Wert der Ware, ausgedrückt in Geld. Die Preise stellen dabei jene Bedingungen dar, zu welchen die Haushalte und Unternehmen bereit sind, bestimmte Waren auszutauschen.