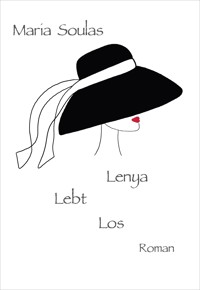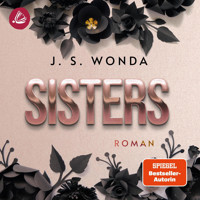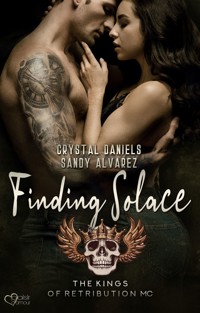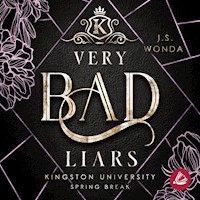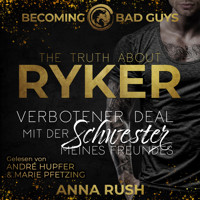3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Helen ist hin- und hergerissen zwischen den aufregenden Spielchen Alexanders und der verläßlich-langweiligen Liebe ihres Dauerlovers Bernhard. Eine spannende erotische Dreiecksgeschichte mit eiskalten Überraschungen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Ähnliche
Maria Soulas
On the Rocks
FISCHER E-Books
Inhalt
On the Rocks
»Ich hoffe, Sie gehören nicht zu den Frauen, die morgens die Telefonnummern austauschen wollen!« Die Stimme drang wie ein eiskalter Luftzug in das wohltemperierte, angenehm schläfrig machende Ambiente, ließ ein erregendes Prickeln auf Helens Haut zurück und verklang wie unwirklich in der vornehm-lautlosen Geräuschkulisse des »Chez Henry«.
Sie mußte sich verhört haben.
Ihr Blick löste sich von dem exotischen Blumenarrangement, senkte sich auf die blütenweiße Damastdecke, tastete sich an den funkelnden Gläsern wieder hoch und wanderte bis zur Stuhllehne gegenüber, auf der wie selbstverständlich seine Hand ruhte. Kräftig und feingliedrig.
Er öffnete, während er sich setzte, sein dunkelgraues Jackett. Als sie das kalte Begehren in seinen Augen sah, wußte Helen, daß er es wirklich gesagt hatte. Sie deutete eine leichte Handbewegung in Richtung Ober an, um diesen Menschen hinauskomplimentieren zu lassen. Mit der Verzweiflung, die sie früher hin und wieder an der Schultafel ereilt hatte, suchte sie nach einer entschiedenen, sarkastischen, unzweideutigen, rhetorisch gelungenen Entgegnung, die sein schiefes Lachen aus der Bahn werfen sollte.
Vor seinem geeisten Blick gab sie auf.
»Sie haben sich im Tisch geirrt – und«, sie lauschte fassungslos ihrer Kleinmädchenstimme nach, »vermutlich auch im Etablissement.«
»Aber nicht in Ihnen!« Sein Lächeln machte sich heimisch.
Endlich war der Ober zur Stelle. Geradezu untertänig begrüßte er ihn und nahm seine Bestellung entgegen.
»Martini – aber bitte mit Eis!«
Die dezent fragende Miene des Befrackten signalisierte, daß er jeden noch so absonderlichen Wunsch seiner Gäste hinzunehmen bereit war, ja mehr noch, ihn im Geiste bereits verewigte für künftige Besuche.
»Das ist gar nicht –«, setzte Helen an, doch der Ober war bereits strahlend davongedienert.
Der Herr mit dem Martini auf Eis. Bitte sehr. Das Übliche.
»Ich hasse Martini!« sagte Helen, um etwas zu sagen.
»Wie schade«, ungerührt sah er sie an. »Aber bei der Art unserer Bekanntschaft spielen Trinkgewohnheiten wohl kaum eine übergeordnete Rolle!«
Helen versuchte sich klarzuwerden, ob das, was so unbeirrbar in ihr hochkroch, Wut war oder ein hysterischer Lachanfall oder vielleicht eine Ohnmacht.
»Und ich glaube, daß ich Ihre Bekanntschaft gar nicht machen möchte.« Sie versuchte seinem Blick standzuhalten.
Die Vorstellung eines mit Riechsalz herbeieilenden Maître machte die Inszenierung ihrer ersten Ohnmacht perfekt.
Ihre Mundwinkel begannen zu zucken.
Vielleicht war Riechsalz aber gar nicht mehr üblich in solchen Fällen. Bernhard wußte bestimmt, was zu tun war.
Bernhard ist ein Meister aller Lebenslagen, dachte Helen mit einem Desinteresse, das sie erschreckte.
»Zwei Martini!« Mit der professionellen Freundlichkeit, die er seinen Gästen schuldig zu sein glaubte, servierte der Ober die ungewöhnlichen Aperitifs. »On the rocks!« Pflichtbeflissenes Lächeln. »Haben die Herrschaften schon gewählt?«
Mit einem unverhohlenen, wenn auch stummen Ja starrte ihr Gegenüber sie an.
Das war der Mann aus dem Zug, der Unbekannte, der Unsichtbare, das Phantom, der Namenlose, der Jetzt-oder-nie-Spion alter Mädchenphantasien. Zusammengeträumt und verlacht und erregt herbeigesehnt. Und geopfert für Bernhard.
Das war er. Dessen Existenz nicht einmal Omimi mit ihren sechsundachtzig Jahren schwärmerisch verleugnet hätte.
Das war er.
Und Helen wußte nicht, warum er sich nicht in Luft auflöste und die Wirklichkeit wieder Einzug halten ließ.
»Vielleicht möchten die Herrschaften noch einmal die Karte studieren.« Ebenso diskret wie verständnislos entfernte sich der Ober.
»Die machen hier sehr gutes Eis!« sagte er.
»Mein Verlobter wird jeden Moment eintreffen.« Helens Stimme klang in ihren Ohren nach, als sie ein leises Klirren hörte.
Er griff gerade mit zwei Fingern in ihr Glas und holte das Eis heraus.
Das ist ein schlechter Film, dachte Helen und folgte mit den Blicken seiner Hand, die, eine tropfende Spur hinter sich herziehend, unter der Tischdecke verschwand, die strahlend weiß war, gestärkt und bodenlang.
Ihre Großmutter hatte nie gesteigerten Wert auf edle Tischwäsche gelegt.
Helen versuchte sich davonzuerinnern, die verwirrende Gegenwart ihres Gegenübers einfach zu vergessen. Sie konzentrierte sich auf das Osterfest bei Tante Auguste. Ereignisse wie dieses hatten sie oft aus den Fängen einschläfernder Gesprächspartner oder erbarmungsloser Witzbolde gerettet.
Helen ignorierte seinen Blick und seine Hände und spürte der tief in ihre Erinnerung eingegrabenen Schrecksekunde nach, als die riesige Suppenterrine ihren großen Auftritt hatte. Jahrzehntelang hatte sie in der Vitrine auf diesen feierlichen Moment gewartet, da sie, endlich aus dem Requisitendasein befreit, die Szene ihres (Terrinen-) Lebens spielte – im Kreise aller Verwandten, die, in steifer Langeweile vereint, auf das große Festessen warteten, um danach sogleich die Flucht aus der Familienfeierei anzutreten. Niemand wußte, wie es geschehen war, aber plötzlich war das gute alte Erbstück mit der schweren Suppe im Porzellanleib ins Wanken geraten und mit einem ungehörigen Platschen auf dem Parkettboden in tausend suppenbekleisterte Stücke zersprungen, nicht ohne sich mit cremig-zarten Klecksen auf vielerlei Sonntagskleidung zu verewigen. Omimi hatte sich herrlich amüsiert, während Tante Auguste sich bedenklich nah an einen Infarkt herankeuchte.
Helen spürte seine Hand kühl über ihre Oberschenkel streichen. Sanft öffnete er ihre Beine und fuhr, feuchte Kälte verbreitend, an den Innenseiten ihrer Schenkel entlang.
›Das geschieht nicht wirklich‹, sagte sich Helen. Sie würde empört aufspringen, wenn es wirklich geschähe.
Seine Hand war triefend an dem Stück nackter Haut zwischen Strümpfen und Slip angelangt. Helen dachte krampfhaft daran, daß sich ganze Suppensturzbäche auf ihr Festtagskleid ergossen hatten. In Hemd und Höschen hatte sie in der Waschküche gekauert, während Omimi versuchte, die Flecken herauszuwaschen. Immer wieder hatte sie innegehalten und die Terrinenszene nachgespielt. Vor Lachen hatten beide Bauchschmerzen bekommen, erinnerte sich Helen, während ihr Atem hechelnd in kleinen Stößen zwischen ihren ausgetrockneten Lippen hervorbrach.
Sein Daumen begann, ihren Slip beseitezuschieben.
»Was tun Sie da?« hörte Helen sich überflüssigerweise fragen.
Vernebelt sah sie ein Paar ihr gegenüber wohlerzogen etwas auslöffeln, was in Farbe und Konsistenz Tante Augustes Pilzrahmsuppe in nichts nachstand.
Die Frau erinnerte sie an Bibs. Sehr entfernt, aber immerhin. Bibs wäre so etwas nie passiert, Helen unterdrückte das Zittern, das in leichten Schüben bis in die Finger- und Zehenspitzen fortbebte.
Bibs hätte ihn entweder aufgefordert zu tun, was er tat, oder ihn einfach abblitzen lassen. Wie leicht zauberte allein die Erinnerung an Bibs eine Antwort für ihn herbei. Ganz lässig hätte sie mit einem Bibs-Blick auf seine Frage gekontert: ›Vielleicht gehören Sie ja gar nicht zu den Männern, die ich eine ganze Nacht ertragen kann.‹
So etwas fiel Helen nie ein. Sie beschloß, sich die Antwort zu merken, für den Fall, daß er auf die Telefonnummer zurückkäme.
Als ihr Slip zerriß, zuckte sie leicht zusammen. Mit der Linken stieß sie ihr Glas um.
Wie aus dem Nichts stand der Ober sofort neben ihr.
»Ich bringe Ihnen gleich ein neues!« lächelte er und tupfte mit einer Serviette auf dem Damast herum.
»Mit viel Eis bitte«, fügte er mit völlig normaler Stimme hinzu, während seine Hand den fast geschmolzenen Eiswürfel gegen ihre wachsende Erregung preßte.
Sein Daumen beschrieb kleine, lockende Kreise. Helen biß sich auf die Unterlippe.
Sie erinnerte sich, wie froh sie gewesen war, daß ihr Vater sie Omimi anvertraut hatte und nicht etwa Tante Auguste, als seine Frau ihn verlassen hatte und er beschloß, keine väterlichen Pflichten bei Helen wahrnehmen zu wollen.
Befremdet dachte sie, daß Tante Auguste in Bernhards Augen das einzige normale Mitglied der Familie war. Eine Frau, die ihm bereits beim ersten Besuch die Vorzüge der Ehe angepriesen, ihm zu Weihnachten häßliche braune Socken gestrickt und ihnen ständig selbstgebackene Plätzchen geschickt hatte.
Seine Hand lustwandelte über sie hinweg, durch sie hindurch und in sie hinein.
Den ersten Heiratsantrag hatte Bernhard ihr tatsächlich auf der Rückfahrt von einem Tante-Auguste-Besuch gemacht. So verlegen an einer roten Ampel hüstelnd, daß Helen ihn am liebsten geküßt hätte. Statt dessen hatte sie ihm die Geschichte mit der Ostersuppe erzählt, die sich vortrefflich als Ablenkungsmanöver in allen Lebenslagen eignete.
Bernhard hatte sich ein bißchen um ein Lächeln bemüht und sich ohne einen neuerlichen Versuch konzentriert in den Wochenendverkehr eingefädelt.
Dann entglitten Helen alle Strohhalme, durch die sie in Vergangenes, Gegenwärtiges oder einfach nur Reales schlüpfen konnte. Sie rutschte ihm auf dem Stuhl entgegen. Seine eiskalten Finger entfachten eine Hitze, die ihr weh tat.
»Ein Martini mit extra viel Eis, für die Dame!« Wieder tupfte der Ober auf der in dicken Damastlagen versickerten Martinilache herum. »Ich lasse Ihnen gleich ein neues Tischtuch bringen!« Er winkte bereits einem Kollegen.
»Nein!« entfuhr es Helen. »Nein«, wiederholte sie ruhiger. »Danke – das ist wirklich«, sie spürte ihn eindringen, »nicht nötig«, brachte sie noch hervor.
»Wie Sie wünschen, Madame!« Endlich wandte er sich zum Gehen. Helen sah den Befrackt-Beflissenen schemenhaft verschwinden.
Dann war er nur noch in ihr.
Mit der anderen Hand hob er sein Glas an die Lippen. Er lächelte. Während er unter dem Tisch sein Spiel fortsetzte.
»Ein Schluck Martini?«
Helen versuchte möglichst sicher nach ihrem Glas zu greifen.
»Nicht das Eis anknabbern!« Er lächelte. »Das brauchen wir noch!«
Sie stürzte die brennende Flüssigkeit gierig hinunter, stellte das Glas hart auf den Tisch und beschloß zu gehen.
Sie würde ihn einfach sitzenlassen. Mit seinen Martinis.
Staunend sah sie, wie ihre Hand das Glas leicht zu ihm hinüberschob.
Er griff hinein und holte die Eiswürfel heraus, jonglierte sie unter den Tisch, und während er mit der Linken wieder kaltes Eis an sie preßte, zog er die Rechte langsam zurück. Führte sie an die Oberfläche und dann an den Mund. Genießerisch strich seine Zunge an den Fingerkuppen entlang. Helen griff nach seinem Glas und leerte es in einem Zug.
Um sie herum dinierte ein erlesenes Publikum. Die Menüs und gedämpften Konversationen wirkten ebenso echt wie die Kostüme und die leisen Klavierklänge im Hintergrund.
Und doch war es nicht wirklich. Helen spürte das Pochen tief in sich und wußte, daß nichts anderes wirklich war außer diesem Pochen.
Das Eis troff mit ihrer Nässe vermengt in ihr Kleid, auf den Stuhl und an ihren zitternden Beinen entlang zu Boden. Sie würde diesen Raum nicht verlassen können, bis alle Gäste gegangen waren.
Helens Hände krampften sich um ihren Stuhl.
Kalt. Kalt. Kalt. War er in ihr.
Zuckend prallten Hitze und Kälte aufeinander, glühten und vereisten und ließen keine Empfindung zurück, verödeten alles mit Feuer und Eis.
Und in der einsamen Leere in ihr konnte nur Lust überleben.
Nur Lust.
Die wuchs und sich teilte und neue Lust hervorbrachte und alles erfüllte und zuckend an alle Grenzen ihres Innersten stieß.
Schweiß trat aus ihrer Haut, kühlte sie mit einem feuchten Schleier und heftete die cremefarbene Seide ihres Kleides wie eine zweite Haut an ihren Körper. Ein kleiner Schutzschild.
Helen bemühte sich, ruhig zu atmen, nicht zu schreien, nicht zu keuchen.
Die kühle Beherrschung in seinem Gesicht ließ sie erschrecken und vermochte dennoch nicht, ihre Erregung zu mindern.
Sie schloß die Augen und stellte sich vor, daß er auf ihr lag, unter ihr, neben ihr.
Mit einem anderen Gesicht.
Ohne Kälte. Ohne diese Distanz, die keine Nähe zulassen konnte. Nicht einmal körperliche.
Er hatte kein Gesicht. Kein Gesicht. Nur Hände.
Die Hand unter dem Tisch.
»Dürfte ich um die Rechnung bitten«, hörte sie seine Stimme, durchtränkt von einer unverbindlichen Höflichkeit, während seine Hand die andere Wirklichkeit schuf.
Jetzt geht er. Dachte sie mit einer zufriedenen Enttäuschung. Er geht zurück in die Welt der Phantasie. Er springt auf den fahrenden Zug. Er schwingt sich in die Luft. Er tanzt zurück ins traumlose Nichts.
Und sie wußte, sie würde widerspruchslos mit ihm gehen. Das Schattenreich entdecken und erobern, das alle Märchen stets ein unerwähntes Dasein fristen ließen. Das nur die Neugier weckte und die Sehnsucht.
Diese Sehnsucht, die sich pochend aus der Kinderzeit zurückmeldete. Und nicht einmal Bernhard gegenüber irgendeine Verpflichtung spüren ließ.
Sie wußte sich nichts zu sagen, das sie zum Bleiben bewegen könnte.
»Haben die Herrschaften beschlossen, nicht zu dinieren?«
»Die Dame fühlt sich nicht wohl!« erwiderte der fremde Pirat, der tollkühne Bösewicht, der verwunschene Prinz, der furchtlose Ritter, der unbekannte Eroberer – im Plauderton banaler Höflichkeiten. »Würden Sie uns bitte ein Taxi rufen!«
Mit einem bedauernden Blick auf Helen zog sich der Ober zurück.
Seine feuchte, heiße Hand strich an der Innenseite ihres Schenkels entlang. Aufreizend langsam, eine Gänsehaut nach der anderen hinter sich herlockend, während der Ober die Rechnung brachte.
»Ich kann nicht aufstehen.« Der Gedanke an die Flecken in ihrem hellen Kleid zog eine heftige Röte über ihr Gesicht.
Mit besorgt-unbeteiligter Miene brachte der Ober zum Ausdruck, daß Unwohlsein nicht zu den üblichen Meinungsäußerungen seiner Gäste gehörte.
Bevor er Helen mit der im »Chez Henry« gebotenen lautlosen und niemals hastigen Beflissenheit zu Hilfe eilen konnte, war ihr Gegenüber bereits aufgestanden und legte ihr fürsorglich sein Jackett um die Schultern.
»Ich hoffe, es ist lang genug«, raunte er ihr zu, als sie an ihn gelehnt das Restaurant verließ.
Vorbei an kulinarischen Ereignissen von bedeutendem Rang, erstarrten Tante-Auguste-Suppen, sternchen- und kochmützenübersäten Kompositionen und behutsam-neugierigen Blicken, die Bruchteile von Sekunden aus der kunstvoll arrangierten Kulisse auftauchten und wieder zurückkehrten zur friedlichen Beobachtung des vornehmen Gemetzels, das gepflegte Hände mit blitzendem Besteck auf polierten Tellern anrichteten.
Helen fragte sich, ob die diskreten Gäste des »Chez Henry« tatsächlich nicht bemerkt hatten, was unter dem züchtigen Damastvorhang geschehen war, oder ob sie, einem Gesetz des Anstands folgend, es einfach ignorierten.
Wie sie auch einen Mord vor ihren Augen durch die hohe Kunst des unbefleckten Speisens ganz einfach ungeschehen machen würden. Solche Blicke – wie jetzt unter lila Lidern und jetzt umrahmt von edel schimmerndem Brillendesign und jetzt wie zufällig aus grauen, erkennenden Augen: »Guten Abend, Frau Doromme!« – würden sie der Leiche zuteil werden lassen, während sie aus dem Interieur entfernt würde.
Helen grüßte flüchtig zurück. Ihre Schenkel glitten klebrig aneinander vorbei.
Freundlich-dezent lächelte sie von einem Tisch zum anderen. Ein halbes Dutzend erkennende Blicke hatten registriert, wie sie an einen Mann gelehnt, der nicht ihr Verlobter war, zum Ausgang strebte.
Niemand würde Bernhard direkt fragen.
Dessen war sich Helen sicher.
Und jeder würde auf eine Gelegenheit lauern, sein Wissen dennoch preiszugeben.
Dessen war sich Helen sicher.
Und wer nicht selbst Zeuge gewesen war, konnte derlei Ereignisse sicherlich im Gästebuch nachlesen. In der gleichen, schön geschwungenen Schrift wie die Menüs in der Speisekarte würden sie dastehen – unter der Rubrik »Was wir nicht empfehlen können«. Durch die altertümlich anmutende Schrift auf dem schweren Papier erst wurde alles wirklich.
Der Wunsch, dieses ausgeklügelte Regelwerk zwischen Aperitif und Dessert ein wenig zu stören, regte sich immer stärker in Helen. So wie sie als Kind oft von sich aus unentdeckte Streiche preisgab, weil sie es nicht ertrug, unertappt zu bleiben und ihren Triumph ganz allein auszukosten.
So wie sie damals von schulischen Schandtaten berichtete, angetrieben von diesem inneren Zwang, spürte sie, daß sie das »Chez Henry« nicht so einfach diskret verlassen konnte in der Hoffnung auf einen Klassenbucheintrag in Schönschrift von irgendeiner Hand, die von Woche zu Woche zur Feder griff.
Früher war es leicht gewesen, sich zu bezichtigen, zumal Omimi meist entzückt war von Helens Tun, wie sie in den häufigen Gesprächen mit Helens Lehrern zum Audruck brachte, indem sie betonte, wie wichtig Phantasie und Zivilcourage im Leben seien und daß sie ihrer Enkelin diese erfreulichen Eigenschaften ganz gewiß nicht mit Strafen verleiden würde.
Jeder Gedanke an Omimi wärmte Helen stets ein wenig Kälte davon. Irgendwohin, wo sie ihr nichts mehr anhaben konnte.
Da war der letzte Tisch.
Die letzte Gelegenheit. Dachte Helen und ergab sich der Vorfreude.
Geschickt stolperte sie am Stuhl einer magersüchtigen Martininipperin vorbei, brachte dabei die Tizianmähne in haarsprayverklebte Wallung und, so lächelte Helen verzückt, auch den Martini, der sich über den Schoß der Schönen ergoß.
»Pardon, Madame«, schloß Helen ihre kleine Inszenierung ab. Sie verneigte sich in die erstaunte Runde, die ihr sprachlos nachsah, während sie an seinem Arm zur Tür schritt.
Sie hätte für alle Damen Martinis bestellen sollen, überlegte Helen und sonnte sich in seinem fragenden Blick, den sie an ihrem Lächeln umhertasten spürte.
Martini mit viel Eis.
Und sie hätte sie alle auf Bernhards Rechnung setzen lassen sollen.
Immerhin hatte seine Unpünktlichkeit den Verlauf dieses Abends bestimmt.
Helen stellte sich vor, wie sie lustlos und harmonisch gespeist hätten. In Bernhards Gegenwart hätte sie es nicht gewagt, von der Karte oder den Empfehlungen des Obers auch nur geringfügig abzuweichen. Bernhard schätzte es nicht, wenn sie den kulinarischen Pfad vorbestimmter Genüsse verließ.Weder zu Hause bei Frau Grüger noch außerhalb der heimischen Eßzimmerwände.
Es wäre gerecht gewesen, fand Helen, wenn Bernhard die Drinks hätte zahlen müssen. Mutig schmiegte sie sich in den Arm dieses Fremden, der wohlig um ihre Taille spielte.
Als sie nach draußen traten, sah sie Bernhard seinen Wagen abschließen.
Er kontrollierte die Tür zweimal. Das tat er immer. Er kam über eine halbe Stunde zu spät – und hatte dennoch die Muße, seinen Gewohnheiten zu folgen. Er kontrollierte zweimal, ob die Tür auch richtig zu war.
Ihre Hüfte erbebte in leisen Lustschauern, jedesmal wenn sein Becken sanft an ihres stieß.
Rasch stieg sie in das wartende Taxi und lehnte sich tief in die Polster.
Während er dem Fahrer Anweisungen gab, schlug sie die Beine übereinander. Er lachte heiser an ihrem Ohr, als er sich zurücklehnte. Ihre Körper berührten sich kaum, aber Helen spürte, wie ihre Erregung wieder über sie herfiel. Jeden Zentimeter ihrer Haut eroberte und ihm fiebrig entgegenzitterte.
»Das war Bernhard«, sagte sie, als das Taxi sich in Bewegung setzte. »Mein Verlobter.«
»Dann sind Sie ja gerade rechtzeitig gekommen.«
Sie hörte ihn wieder lachen und verspürte den Wunsch, ihn irgendwie zu treffen.
Bernhard war der Mann, mit dem sie seit fünf Jahren lebte.
Der sie liebte. Auf seine Art.
Ebenso wie sie ihn liebte. Auf ihre Art.
Er war der Mann, mit dem sie Kinder haben würde. Mit dem sie alle Treueschwüre hatte zelebrieren wollen. Der Mann, der ihr nicht mißtrauen würde.
Der Mann, der sie nicht verlassen würde.
»Ich seh Sie gern an, wenn's Ihnen kommt.« Sagte er so laut, daß Helen überzeugt war, der Taxifahrer müßte jedes Wort gehört haben. Sie drückte sich tiefer in den Sitz.
Jetzt würde Bernhard im »Chez Henry« suchend nach ihr Ausschau halten. Er würde die Stirn leicht runzeln und dann mit der Linken die Brille zurechtrücken.
Er würde seine Gäste an den Tisch führen, sich erkundigen, ob eine Nachricht für ihn hinterlassen worden sei, und ihr, äußerlich völlig gelassen, insgeheim grollen.
Helen dachte an ihre kleine Abschiedsvorstellung und fühlte plötzlich eine beklemmende Röte über ihr Gesicht huschen.
»Und ich seh Sie gern an, wenn Sie rot werden.« Hörte sie seine Stimme so nah an ihrem Ohr, daß sein Atem brennend heiß schien. Es freute sie auf eine unbefriedigende Art, daß er glaubte, ihre Röte sei sein Verdienst.
Doch das war nicht genug. Sie würde ihn viel unerwarteter treffen, beschloß sie, als sein Schenkel leicht an ihren stieß.
Das Bernhard-Bild erschien in einem bunten Rahmen vor ihr. Sie kannte jede Geste und jedes Wort. Puppentheater in Lebensgröße.
Aber an Bernhard war nichts Kindisches. Nicht einmal die unsichtbaren Fäden an seinen Gliedmaßen, die jetzt bei einem leichten Kopfnicken die linke Hand anhoben, um dem Ober zu winken, waren belustigend. Helen hatte mit der Zeit gelernt, sie genau zu sehen. Sie schimmerten ganz leicht im Licht. Hauchzart waren sie und unzerreißbar. Ein übergeordnetes Ich zog je nach Anlaß und Situation, der Regieanweisung einer guten Erziehung entsprechend, den einen oder anderen Faden. So war stets sichergestellt, daß sein tadelloses Benehmen sich in jeder Geste, jedem Wort und der dazu einstudierten Mimik widerspiegelte.
Und niemals wußte jemand danach zu sagen, was er tatsächlich getan hatte, so perfekt fügte sich jegliches Tun in den Rahmen. Es war harmonisch und nicht austauschbar. Und nicht erinnerungswürdig.
Trauer und Nachsicht ließen das Bild von Bernhard gnädig sich verklären und verschwinden.
»Wohin fahren wir?« fragte sie, als seine Hand sacht an ihrem Hals entlangstrich.
Er antwortete nicht, und Helen fühlte die tiefe Gewißheit, daß es ihr völlig gleichgültig war.
Sie würde überall hinfahren mit ihm.
Wenn er nur – sie schluckte die quälende Erwartung hinunter.
Was sie tun würden, nannte man nicht Liebe machen.
Bernhard sagte es auf seine umständliche Art, die sie früher so an ihm geliebt hatte: ›Laß uns nach oben gehen, Kleines.‹
Helen erschrak darüber, daß sie ›geliebt hatte‹ dachte.
Sie verdrängte die Frage, ob sie seine Art noch immer liebte, und dachte an das, was im Schlafzimmer geschehen war, was ihrem Körper widerfuhr, jahrelang, ohne daß es eine andere Empfindung zurückgelassen hätte als die flüchtige Kenntnis einer Gewohnheit.
›Wenn du wirklich Glück hast – also richtig großes Glück, dann hat er drei Variationen auf Lager und fühlt sich dabei auch noch wie ein Bilderbuch-Liebhaber. Womöglich aus einem Erwachsenen-Bilderbuch!‹ Bibs' Lachen und die erklärenden Gesten hatten Helen mitgerissen, obwohl sie ein kleines schlechtes Gewissen für Bernhard immer tief in sich nährte und hegte.
Und doch hatte Bibs einfach recht.
Kaum war sie zu Bernhard gezogen, war das Schlafzimmer Nacht für Nacht zu einer perfekt nachgestellten Fellini-Szenerie geworden. Sie kannte die Dialoge, die Stichworte, die Kreidezeichen am Boden und auf dem Bett und jedes Kommando für Beleuchter, Ton- und Kameramann.
Sie konnte sogar das Scriptgirl in der Ecke auf dem kleinen, eisgrau gepolsterten Schemel sitzen sehen. Helen nahm sich vor, ihn zum Sperrmüll zu geben.
Sie schloß die Augen, spürte den Händen des anderen nach und versuchte, nicht an ihr Leben mit Bernhard zu denken. Das sich so in ihr verewigt hatte, daß jede Berührung es ein klein wenig heraufbeschwor.
So wie sie sich an die Abfahrtszeiten einer bestimmten Buslinie erinnern würde und an den Geruch regennasser, hustender Mitfahrer mit grauen Gesichtern, die nur Mitfahrer waren und sonst gar nichts. Sie würde sich erinnern, weil sie die Strecke täglich zurücklegte. Ohne daß ihr das Ziel etwas bedeutete.
Auf eine stille, ferne Weise, die sie nicht wirklich berührte, empfand sie Mitleid mit Bernhard, der eine kaum sichtbare Kontur am Horizont war, aus dem Busfenster heraus fotografiert.
Die Hand begann ihr Kleid zu öffnen.
›Das wird doch nichts! Da spiegelt sich die Kamera in der Busscheibe! ‹ Ihr Vater hatte wenig Geduld bewiesen, erinnerte sich Helen an einen der wenigen gemeinsamen Urlaube.
Irgendwo an irgendeiner spanischen Küste. Alles hatte sie festhalten, bewahren und für später beweisbar machen wollen. Wenn ihr Vater wieder in sein unbekanntes Leben zurückgekehrt sein würde und sie Omimi und Bibs erzählen konnte, was sie gemeinsam erlebt hatten. Unzählige Filmrollen waren in ihrer knallroten Tasche durcheinandergepurzelt, auf unzähligen Busreisen mit unzähligen anderen Touristen, die an den Lippen der drallen Reiseführerin hingen, die ihrerseits nur Augen für Helens Vater hatte.
Dann hatte Helen die Kamera im Hotel liegenlassen und überhaupt nicht mehr fotografiert. Bis sie selbst auch im Hotelzimmer geblieben war und sich nur hin und wieder mit einem Blick aus dem Fenster der Existenz ihres Vaters versichert hatte. Vor plätschernder Postkartenkulisse an der Seite irgendeiner Reiseleiterin oder irgendeiner anderen Frau, die in den Radius seines verschwenderischen Lächelns geriet.
Jede für sich ein Schnappschuß für einen dieser billigen kleinen Reiseprospekte, die niemanden wirklich an einen dieser Orte locken konnten. Die vermutlich nur gedruckt wurden, damit man die anderen Reisen schätzen lernte. An die anderen Orte. Ohne Kitschhimmel und Bonbonfarben.
Die Reisen, die sie mit Bernhard gemacht hatte, dachte Helen und genoß das Spiel seiner Finger zwischen ihren Brüsten.
Stilvoll, in beinah trauter Zweisamkeit war sie mit Bernhard gereist. Ohne Dias, die man jemandem würde zeigen müssen.
›Unsere Bilder sind im Kopf‹, pflegte Bernhard zu sagen und erlaubte Helen, nur auf den Reisen ihre Kameraausrüstung mitzunehmen, von denen sie berichten mußte. Aber diese dienstlichen Reisen hatte sie ohnehin meist allein unternommen. Ohne seine Umarmungen in die Hotelzimmer zu lassen.
Umarmungen, die nichts von denen zu Hause unterschied, bis auf einen leichten Sonnenbrand vielleicht, auf den es Rücksicht zu nehmen galt.
Auch im Urlaub liebten sie sich ausnahmslos im Bett. Das war am besten für Bernhards Rücken.
Ihr Atem beschleunigte sich unter seinen sanften Berührungen. Helens Blick war geradeaus auf den breiten Nacken des Taxifahrers gerichtet.
Bernhard. Bernhard.
In der Badewanne hatte er einmal einen Krampf bekommen, und andere Möbel und Örtlichkeiten lehnte er auf unmißverständliche Art und Weise ab.
Helen erinnerte sich beschämt an ihren Versuch, ihn im Keller zu verführen, während Frau Grüger nebenan Wäsche aufhängte, oder an die Episode auf dem Küchentisch.
Ein böses Lächeln huschte um ihre Lippen. Mit einiger Mühe kam das Taxi noch an einer roten Ampel zum Stehen.
Helen spürte die Erwartung ungeduldig klopfend zwischen ihren fest zusammengepreßten Schenkeln.
Der Fahrer brummte irgend etwas von zu kurzen Grünphasen, und die Hand des anderen umschloß ihre linke Brust. Helen spürte dem Prickeln nach, daß jede seiner Berührungen direkt zwischen ihre Beine schickte.
Sie versuchte ein wenig zur Seite zu rutschen, um nicht den Blicken des Fahrers im Rückspiegel ausgeliefert zu sein, doch der Arm, der um ihre Schultern lag, zog sie wieder in die Sitzmitte.
Ficken. Vögeln. Bumsen. Sagte sich Helen vor, wie sie als Kind verbotene oder unanständige Wörter vor dem Spiegel zelebriert hatte.
Die Vorstellung, daß sie genau das mit diesem Mann tun würde, steigerte Helens Erregung bis zu einer kaum mehr erträglichen Intensität.
»Da wären wir!« hörte sie den Taxifahrer zwischen ihren unkontrollierten Atemstößen.
Als er sein Portemonnaie aus dem Jackett zog, strich er wie im Vorübergehen über ihre entblößte Haut. Helen schlüpfte rasch in die Ärmel seines Sakkos und schloß es vor dem geöffneten Kleid, den Blick starr auf den gebräunten Nacken des Fahrers gerichtet.
Als Helen ihn neben dem Taxi stehen sah, wußte sie, daß sie nicht mehr zurückkehren könnte zu Bernhard, zu ihrem Leben, ihrer gemeinsamen Vergangenheit, der beruhigenden Gegenwart und der vorstellbaren Zukunft.
Wenn sie jetzt ausstieg.
Ihr Verlangen raste in einen dunklen Tunnel, und Bernhard wurde zu einem verschwommenen Plakat in einer U-Bahn-Station. Eine Socken- oder Zahnpastareklame.
Nicht mehr wahrnehmbar. Nicht mehr erinnerbar.
Sie würde die Hand verlieren, die ihren Nacken massierte, die Armbeuge, in der sie einschlafen konnte, und den ganzen Bilderreigen, der an ihr vorüberhuschte. Schüchtern und unaufdringlich.
Rasch beugte sie sich vor und bat den Breitnackigen loszufahren.
Das Taxi rollte wie in Zeitlupe an. Helen glaubte, er werde ihr nachlaufen, hinter ihr herrufen.
Nichts dergleichen geschah.
Er hatte nur mit ausdrucksloser Miene die Tür zugeworfen.
»Wohin wollen Sie denn?« fragte der Taxifahrer und drehte sich leicht zu ihr um. Helen sah eine tiefe Narbe unter dem rechten Auge. Sie zeichnete keine Verwegenheit in dieses Gesicht und kein Geheimnis. Nur eine kurze, entschlossene Zufriedenheit über Helens leises Erschrecken. Er war es gewohnt, daß die Menschen zurückzuckten vor dem rot aufgeworfenen wulstigen Fleisch.
Helen wollte irgend etwas sagen, was sie aus der Masse derer herausheben könnte, die ihn so ansahen, wie er es erwartete, peinlich berührt den Blick senkten, sich mit geweiteten Augen abwandten oder ihm mitleidig-aufmunternd zulächelten.
Irgend etwas. Aber da war nichts, was willig genug war, über ihre Lippen hinweg Normalität zu schaffen.
Sie nannte ihm ihre Adresse.
Eigentlich war es Bernhards Adresse.
Vielleicht auch die von Frau Grüger. Sie schlief zwar nicht im Haus, aber sie bewohnte es viel inniger, als Helen es je getan hatte.
Ihre Hand streichelte den rauhen Stoff seines Jacketts. Es vermittelte ihr ein wenig reale Erinnerung an seine Existenz.
Ihre Hand glitt unter die Jacke und tastete sich an den Spuren entlang, die seine Hand hinterlassen hatte.
Sie stellte sich vor, die Narbe des Taxifahrers zu berühren. Mit verbundenen Augen, ohne zu wissen, was unter ihren Fingerkuppen aus seinem Gesicht ragte. Weich und fleischig würde es sich anfühlen, und die Erstarrung würde unter ihrem Streicheln zurückweichen.
Ihre Hand erkundete die klebrige Spur zwischen ihren Schenkeln.
Zärtlichkeit würde sie glätten, dachte Helen. Alle Narben ließen sich von Zärtlichkeit heilen. Wenigstens ein bißchen. Bis die Zärtlichkeit verlorenging oder einfach vergessen wurde. Manchmal waren nur die Narben, die wieder aufrissen, das einzige unbestechliche Zeichen. Nichts sonst konnte so eindringlich beweisen, daß es zu Ende war.
Die immer wieder aufgerissenen Wunden waren für Helen stets das untrügliche Zeichen zum Aufbruch gewesen. Blutend und geschunden hatte sie nach neuer Zärtlichkeit gesucht.
Nur bei Bernhard war sie geblieben.
Ihre Hand drang tief ein.
Sie fragte sich, ob sie wirklich nicht aufgegangen waren, all die alten Narben in den Bernhard-Jahren, oder ob es eine Zeit der Gewöhnung gab, die nur noch gaukelte.
Alles, was man sich wünschte.
Dienerin meiner Glückseligkeit! dachte Helen und stöhnte verhalten. Und meiner Gefühllosigkeit.
Es ist nichts geschehen. Sagte sie sich. Gar nichts.
Sie würde Bernhard im Restaurant anrufen und ihm ausrichten lassen, daß sie nicht kommen könne. Und sie würde in Zukunft das »Chez Henry« meiden.
Ihre Hand glitt in dem Rhythmus, in dem der andere ihren Körper zum Vibrieren gebracht hatte, vor und zurück.
Sie überlegte fieberhaft, ob er sie kennen könnte. Ihren Namen oder gar ihre Anschrift. Vielleicht hatte er Bernhards Kennzeichen gesehen.
Wenn er sie finden wollte, würde es ihm gelingen. Helen genoß die Vorstellung seiner verzweifelten Suche nach der Unbekannten aus dem »Chez Henry«.
Er sollte sie suchen und begehren und begehren und begehren.
Sie spürte, wie sie zu zerfließen begann. In ihr Kleid, sein Jackett und die muffigen Taxisitze.
»Ist es hier?« Abrupt kam der Wagen zum Stehen. Helen zog erschrocken ihre Hand zurück. Sie glättete ihr Kleid und preßte beim Zahlen die Beine zusammen. Sie hoffte, er werde nichts merken. Und ahnte ganz dunkel, daß sie genau das wollte.