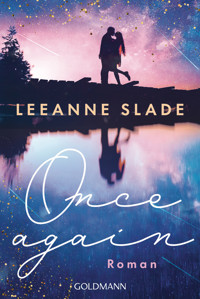
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du könntest die letzten fünf Jahre noch einmal erleben ...
Grace wünscht sich nichts sehnlicher, als die Zeit um fünf Jahre zurückzudrehen. Am Abend vor ihrem 30. Geburtstag ist sie am Tiefpunkt ihres Lebens angelangt: Ihr Restaurant ist bankrott, ihre Großmutter liegt nach einer Herzattacke im Krankenhaus, und ihr eigenes Herz leidet noch immer unter der Trennung von ihrer großen Liebe Henry. Als Grace am nächsten Morgen aufwacht, ist plötzlich alles anders. So unglaublich es auch klingt, ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen – sie ist tatsächlich wieder 25! Grace ist fest entschlossen, dieses Mal alles besser zu machen und sich unbedingt von Henry fernzuhalten. Wenn er nur nicht so unwiderstehlich wäre …
Eine großartige Rom-Com mit Charme, einem Hauch Magie und ganz viel Herzklopfen. Die perfekte Lektüre für alle Leser*innen von Sophie Kinsella und Mhairi McFarlane.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Graces Leben ist ein einziges Chaos: Ihr Restaurant ist bankrott, ihre geliebte Großmutter Dottie liegt im Krankenhaus, und von ihrer großen Liebe Henry hat sie seit vier Jahren nichts mehr gehört. Den Abend vor ihrem 30. Geburtstag verbringt Grace allein mit reichlich Wein in ihrer Wohnung. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder 25 zu sein, als alles noch gut war.
Als sie am nächsten Morgen die Augen aufschlägt, begreift Grace, dass ihr Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen ist: Heute ist ihr 25. Geburtstag, und sie wohnt zusammen mit ihrer besten Freundin in einer WG. Ihre Großmutter ist kerngesund, sie hat niemals ein Restaurant eröffnet, und Henry ist ihr noch nie begegnet. Grace beschließt, die Chance zu nutzen und dieses Mal alles besser zu machen. Vor allem darf sie sich auf gar keinen Fall erneut in Henry verlieben …
Weitere Informationen zu Leeanne Slade sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
LEEANNE SLADE
Once again
Roman
Aus dem Englischen von Marco Mewes
Dieser Roman basiert auf dem Hörbuch »The Glitch« von Leeanne Slade, deutsche Ausgabe mit dem Titel »Alles auf Anfang«, übersetzt von Marco Mewes, an Audible Original.
Hörbuch erhältlich unter: www.audible.de/
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Taschenbuchausgabe Dezember 2025
Copyright © 2024 by Leeanne Slade
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: FinePic®, München
LS · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32872-6V001
www.goldmann-verlag.de
Kapitel eins≈Grace
Heute
Mein Leben lang war ich mir sicher, dass es keinen Grund gibt, irgendetwas zu bereuen. Dass jeder Fehltritt, jede schlechte Entscheidung, jede schmerzhafte Verwundung der Seele uns genau dorthin bringt, wo wir im Leben sein sollen. Dass man aus jeder Erfahrung lernt, daran wächst und ein besserer Mensch wird.
Aber das hier.
Das hier bereue ich von ganzem Herzen.
»Und darum muss ich euch leider mitteilen, dass The Lucky One heute den letzten Abend geöffnet hat«, sage ich. »Morgen früh um neun gehört das alles hier der Bank.«
Ich blicke meinen treuen Angestellten ernst in die Augen und versuche, nicht in Tränen auszubrechen. Mir ist klar, dass ich mich jetzt professionell verhalten muss, trotzdem hoffe ich, dass man mir ansieht, wie sehr es mir das Herz bricht, hier zu stehen. Rhonda, seit dem allerersten Tag meine Souschefin, erwidert meinen Blick ausdruckslos. Patrick, mein charmanter und hochgeschätzter Oberkellner, funkelt mich an, als ob er mir am liebsten den Hals umdrehen würde. Annika, meine Küchenhilfe und der netteste Mensch, den ich kenne, sieht aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen.
»Bitte sag mir, dass du einen Scherz machst.« Patrick wirft einen kurzen Blick auf sein Kellnerteam, alles Teenager mit schwarzen Schürzen, die Stifte gezückt, um das heutige Tagesmenü zu notieren. Ursprünglich hatte ich die schlechte Nachricht am Ende der Schicht verkünden wollen, damit wir alle zusammen heulen und die Bar leertrinken können, doch als immer mehr Fragen über den kaum gefüllten Kühlraum und den gepackten Karton in meinem Büro gekommen waren, ist es einfach aus mir herausgeplatzt.
»Ich wünschte, es wäre nur ein Scherz«, antworte ich.
Patrick presst die Kiefer zusammen. »Ich hab Kinder, Grace. Und eine Hypothek. Was denkst du, was passiert, wenn du mich einfach rausschmeißt?«
»Ich werde jedem von euch ein absolut glänzendes Empfehlungsschreiben ausstellen und jeden anrufen, den ich kenne, damit ich euch irgendwo unterbringen kann.« Ich versuche, zuversichtlich zu klingen, doch meine Worte schlagen ein wie Bomben.
Rufe wie »Eine Vorwarnung wäre nett gewesen« schallen mir entgegen. Und sie haben recht. Ich hätte ihnen irgendwie sagen sollen, wie schlecht es um die Finanzen des Lucky One stand. Es ist pure Ironie, dass mein Restaurant den Namen des siegreichen Pferdes trägt, auf das ich nicht gesetzt habe – bei einem Pferderennen, das zu einem der wichtigsten Momente meines Lebens wurde –, denn die letzten vier Jahre waren ein mühsamer Kampf gegen den drohenden Ruin gewesen. Aber irgendwann in den letzten sechs Monaten bin ich ins Straucheln gekommen und seither über jedes Hindernis gestürzt, das mir in den Weg kam. Ich dachte, es für mich zu behalten, bis ich eine Lösung gefunden habe, würde allen unnötige Sorgen ersparen. All die schweren Bücher mit Tipps und Ratschlägen für Geschäftsgründer haben behauptet, dass die besten Geschäftsleute immer zuversichtlich auftreten, mit Würde, als hätten sie alles unter Kontrolle. Also habe ich über die Scherze meiner Angestellten gelacht, während ich Mahnungen öffnete. Wenn Schuldeneintreiber kamen, habe ich so getan, als wären es Gäste, die ihr Essen zum Mitnehmen wollten. Ich habe leere Behälter in braune Papiertüten gesteckt, sie ihnen in die Hand gedrückt und geflüstert: »Sie kriegen Ihr Geld.« Patrick hat vermutlich geglaubt, dass ich nebenbei einen Drogenring betreibe.
»Seit wann weißt du das schon?«, fragt Rhonda.
»Schon eine Weile. Ich habe versucht, von der Bank einen Überbrückungskredit zu bekommen, der uns bis zur Sommersaison über Wasser hält. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das hier zu verhindern, und ich habe wirklich geglaubt, dass der Kredit heute genehmigt wird. Aber es gibt kein neues Geld mehr.«
»Ich hab genug gehört«, sagt Annika von hinten. Sie nimmt ihre Schürze ab und legt sie auf den Tresen. »Ich werde bestimmt keine weitere Schicht hierbleiben, wenn du uns so im Stich lässt. Kannst du überhaupt die Löhne zahlen, die du uns schuldest?«
»Ich hab euer Trinkgeld von dieser Woche.« Ich halte ihnen die Umschläge hin, während sie mich bitterböse anfunkeln. »Den Rest bekommt ihr … so schnell wie möglich.«
Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ich sehe zu, wie sie einer nach dem anderen gehen und mir dabei kaum in die Augen schauen. Mit ihrem Schweigen sagen sie mir, was ich längst weiß: Du hast es richtig verbockt.
»Ich mach es wieder gut«, rufe ich ihnen hinterher. »Versprochen.«
Rhonda ist die Letzte, die geht. Sie ist dreißig Jahre älter als ich, und dies sollte ihr letzter Job vor dem Ruhestand sein. Sie ist ein Goldschatz. Eine sanftmütige Frau, die in Fast-Food-Ketten angefangen und es bis in die Küchen der Sterne-Restaurants geschafft hat. Sie hat mir mehr beigebracht als ich ihr, und als sie zugesagt hat, meine Souschefin zu werden, fühlte es sich wie ein Lottogewinn an. Mit ihr zusammenzuarbeiten, ist eine der besten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Das sage ich ihr, und sie nickt, aber ihr Blick ist voller Enttäuschung. Schließlich zeigt sie auf eine Kuchenschachtel auf dem Edelstahltresen.
»Wir haben dir eine Geburtstagstorte gebacken. Red Velvet. Die magst du doch am liebsten.«
Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss wie der Hammer des Richters, mit dem er sein Urteil fällt: Grace Monroe, schuldig, einen weiteren katastrophalen Fehler begangen zu haben.
Und die traurige Wahrheit dahinter: Es ist nicht mal annähernd mein schlimmster.
Ich stehe in der Küche, das einzige Geräusch ist das Brummen des Geschirrspülers. Auf einem Schneidebrett liegen halb geschälte Kartoffeln, auf dem Herd köchelt eine Erbsen-Minz-Suppe. Es gibt eine Million Dinge, die ich tun müsste, um die Schicht alleine zu schaffen. Stattdessen gehe ich zu der Schachtel auf dem Tresen und klappe den Deckel auf. Der Anblick reibt ordentlich Salz in die Wunde. In geschwungenen Lettern aus Zuckerguss steht auf der Torte: Alles Gute zum 30sten für unsere fantastische Chefin!!!
Ich habe nicht mal genug Zeit zu weinen, denn durch den Spalt in der Küchentür sehe ich die ersten beiden Gäste des Abends eintreffen. Sie bleiben am Pult neben dem Eingang stehen, wo Patrick sie eigentlich in Empfang nehmen sollte. Eine Frau im Designermantel und ihr Begleiter, der entweder ihr erwachsener Sohn oder ihr sehr junger Liebhaber ist.
Sie recken die Hälse auf der Suche nach irgendjemandem, der sie an ihren Tisch bringt, und der Schmerz in meiner Brust wird übermächtig. Ich kralle mich am Tresen fest, während mir ein Gedanke wieder und wieder durch den Kopf geht: Ich wünschte, ich hätte diesen Laden nie eröffnet. Mit nur fünfundzwanzig Jahren so ein Restaurant zu eröffnen, hatte sich damals angefühlt, als würde ich jedem den Mittelfinger zeigen, der mir erzählt hatte, dass ich zu jung sei. Dass mir die Erfahrung fehle. Jetzt schäme ich mich so sehr, dass ich mir den Finger am liebsten abbeißen und mit dem Rest meiner wohlverdienten Strafen zusammen runterschlucken würde.
Die Dame entdeckt mich und versucht, mit einem energischen Winken meine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Einen Augenblick«, rufe ich ihr zu.
Ich kann das nicht, auf keinen Fall. Ich schließe die Augen und atme tief ein, wappne mich innerlich für den unvermeidlichen Protest, wenn ich den beiden erkläre, dass wir sie heute Abend nicht bedienen können. Dass wir geschlossen haben. Für immer. Sie sieht wie jemand aus, der mir dafür eine ordentliche Standpauke halten wird.
Ich strecke mich und greife ans obere Ende meines handgeschnitzten Weinregals, wo ich mir eine besonders teure, staubige Flasche nehme. Dann greife ich mir noch eine zweite und stecke sie in meine Handtasche.
Hoffentlich reicht das, um die Enttäuschung etwas zu mildern.
Ihre und meine.
* * *
Ich mache nur oberflächlich sauber. Sobald jemand den Laden gekauft hat, reißt er sowieso alles raus, wofür ich so hart gearbeitet habe, und verwandelt es vermutlich in den zwölften Coffeeshop in der Innenstadt von Winley. Aber ich leere den Bürosafe und packe die restlichen Lebensmittel in einen Karton für die Essensspende. Als ich zum allerletzten Mal abschließe, schleppe ich einen vollen Rucksack mit mir herum und einen Pappkarton, auf dem ich die Kuchenschachtel balanciere. Ich weigere mich, daran zu denken, was für ein zutiefst deprimierender Augenblick dies ist.
Der Fußweg zum Bahnhof dauert fünf Minuten, und es regnet, als hätte der Himmel jeden Tropfen aufgehoben, um ihn genau in dem Moment fallenzulassen, wenn ich aus der Tür komme. Wie sonst hätte dieser perfekte Tag enden sollen? Meine dünnen blonden Haare kleben mir an den Wangen, dicke Regentropfen laufen mir in die Augen, und als das Handy in meiner Hosentasche vibriert, schaffe ich es nur mit Müh und Not, mir schnell genug einen Stöpsel ins Ohr zu stecken und das Gespräch anzunehmen.
»Happy Birthday-Abend to you!«, singt Sasha.
Damit entlockt sie mir ein Lächeln, was sich nach den letzten Stunden wie eine kleine Heldentat anfühlt.
»Hey, Sash.« Ich klinge noch elender, als ich mich fühle.
»Du hörst dich ja nicht sehr fröhlich an. Hattest du eine stressige Schicht? Hat Patrick wieder jemandem das Essen in den Schoß fallen lassen?«
Gegenüber meinen Angestellten hatte ich einen guten Grund, sie über die Lage des Restaurants im Unklaren zu lassen – aber dass ich es vor meiner besten Freundin verschwiegen habe, dafür gibt es keine Entschuldigung. Wir sehen uns jeden Monat. Es gab jede Menge Gelegenheiten, ihr davon zu erzählen, sie nach Rat zu fragen, mich an ihrer Schulter auszuheulen. Aber dann hätte ich zugeben müssen, wie schlecht ich meinen Laden geführt habe. Wie wenig ich noch immer darüber weiß, wie man ein Restaurant betreibt, während ihre Rechtsanwaltskanzlei einen Preis nach dem anderen gewinnt und sie ständig auf der Titelseite irgendeines Magazins prangt.
Auf keinen Fall würde ich ihren Erfolg mit meinen Pleiten beschmutzen.
»Ich hab heut früher Schluss gemacht und bin auf dem Weg nach Hause, um meinen letzten Abend als Twentysomething zu genießen.« Bei der Lüge zieht sich mir der Magen zusammen. In Wirklichkeit bin ich auf dem Weg nach Hause, um meinen Red Velvet Cake in einer Fressattacke hinunterzuschlingen, eine Flasche Wein zu trinken und heulend meine jämmerlichen Entscheidungen zu bedauern. Viel weiter kann man von Abend genießen nicht weg sein. »Aber mach dir keine Sorgen, morgen früh bin ich für dich frisch und ausgeruht.«
Schweigen.
»Was das betrifft«, sagt sie zögerlich.
Ich weiß instinktiv, was als Nächstes kommt, bleibe stehen und spüre, dass mir Wasser in die Schuhe gelaufen ist. »Bitte sag nicht, dass du unsere Geburtstagstradition absagst.«
Als wir noch zusammengewohnt haben, bevor die Sache zwischen Sasha und Roman ernst wurde und sie in ihr schickes Penthouse-Apartment gezogen sind, haben Sasha und ich den Morgen meines Geburtstags immer gemeinsam verbracht. Anfangs haben wir, meist verkatert, trockene Supermarkttörtchen verputzt, doch als wir etwas … nun, reifer wurden, gab es stattdessen pochierte Eier auf Toast, die wir tatsächlich mit Messer und Gabel aßen, wie in einem echten Restaurant. Hinterher haben wir uns aufs Sofa geworfen und meinen Lieblingsfilm geguckt, Liebe braucht keine Ferien, obwohl es schon Januar war.
»Es tut mir so leid …«, fängt sie an.
»Oh, Sasha«, unterbreche ich sie und habe einen Kloß im Hals. Ich schlucke ihn runter. Ist es traurig, dass das die einzige Sache in meinem Leben war, auf die ich mich noch hatte freuen können?
»Ich fühl mich schrecklich. Ich weiß, wir machen das immer zusammen, aber Dr. Gomez hat in allerletzter Minute noch eine Absage reinbekommen.«
Das braucht sie nicht näher zu erklären. Die größte Koryphäe für künstliche Befruchtungen im ganzen Land. Sasha und Roman warten schon ewig auf einen Termin. Zwei erfolglose Versuche haben sie bereits hinter sich, und ich bezweifle, dass einer von beiden mehr als drei Fehlschläge verkraften wird. Dr. Gomez und ihre überdurchschnittliche Erfolgsrate sind vermutlich ihre allerletzte Chance.
»Ist schon gut«, versichere ich ihr. »Das geht vor. Absolut.«
»Bist du sicher?«, fragt sie. »Ich meine, wenn ich rechtzeitig wieder zurück bin, kann ich …«
»Natürlich bin ich sicher. Konzentrier dich jetzt auf dich und Roman. Ich bin ja quasi schon dreißig. Kompetent und erwachsen. Ich komme schon zurecht.« Noch eine Lüge. Mist.
Mein Handy vibriert wieder. Noch jemand, der versucht, mich zu erreichen. Als ich den Namen auf dem Display lese, ächze ich. »Hör zu, ich muss auflegen, jemand ruft mich an. Melde dich morgen, ja? Lass mich wissen, wie es lief, sobald du kannst, okay?«
Sasha wünscht mir nochmal alles Gute zum Geburtstag, und ich sage ihr, dass ich sie lieb hab, dann wechsle ich auf das andere Gespräch.
»Grace.« Es ist meine Mutter. Die einzige Person, die ein Telefonat damit beginnt, den Namen ihres Gesprächspartners auszusprechen, als hätte die Person ihr eine Ohrfeige verpasst. Man sollte meinen, dass sie mich etwas herzlicher begrüßt, angesichts der Tatsache, dass wir uns seit einem Jahr nicht gesprochen haben.
»Hi.« Ich überquere die Straße, um die trockene Zuflucht des Bahnhofs zu erreichen. »Es passt grade nicht so gut.«
Sie ignoriert das. »Ich war die letzte Woche in Deutschland. Ich bin erst heute Nachmittag wieder gelandet, nur um zu erfahren, dass man Dottie ins Krankenhaus eingeliefert hat.«
Neben mir geht eine Autoalarmanlage los, und aus einer Kneipe, in der für einen Januarabend viel zu viel los ist, plärrt ohrenbetäubende Musik, aber nichts davon ist laut genug, um die Alarmglocken zu übertönen, die in meinem Kopf aufschrillen. Mein erster Gedanke ist, dass sie sich irren muss. Dass meine Großmutter niemals, nicht in einer Million Jahre, Mum als ihren Notfallkontakt nennen würde. Das wäre immer ich. Meine Nummer. Ich bin es, die im betreuten Wohnheim neben ihrem Bett sitzt und ihr vorliest, bis sie einschläft, genau wie sie es für mich getan hat, als ich ein kleines Kind war. Ich hole ihre Herzmedizin und bringe ihr dreimal die Woche etwas zu essen, um sicherzugehen, dass sie vernünftiges Essen bekommt. Ich wusste nicht mal, dass das Wohnheim Mums Kontaktdaten hat.
Ich schaue auf mein Handy, ob ich irgendwelche verpassten Anrufe oder Sprachnachrichten habe. Nichts.
»Ins Krankenhaus? Nein, davon wüsste ich.« Ich gehe schneller und balanciere den Karton auf meiner Hüfte, während ich mich zwischen den spitzen Regenschirmen der Pendler und Einkaufsbummler hindurchschlängele.
»Ich sage dir, es stimmt. Ich habe vor dreißig Minuten mit einer Schwester im Krankenhaus gesprochen.«
Mir wird bewusst, dass ich es diese Woche nicht geschafft habe, Dottie zu besuchen. Oder die Woche davor. Ich war so mit dem Restaurant beschäftigt, dass ich nicht dazu gekommen bin, nach ihr zu sehen. Was, wenn sie gestürzt ist? O Gott. Mir wird eiskalt. Was, wenn es ihr Herz ist? »Was ist passiert?«, frage ich.
»Ich werde mehr wissen, sobald ich dort bin.«
Das ist keine richtige Antwort. Inzwischen renne ich geradezu. Ich spüre einen Druck auf der Brust, und die kalte Luft brennt mir in der Lunge. »In welchem Krankenhaus ist sie? Winchester? Southampton? Basingstoke? Ich kann in …«
»Nein«, befiehlt Mum. »Lass mich rausfinden, was passiert ist. Dein Vater und ich sind schon fast da. Ich rufe an, sobald ich mehr weiß.«
Typisch Mum, dass sie selbst in einer solchen Situation ganz die Geschäftsfrau ist und die einzelnen Schritte wie einen Vertrag aushandelt.
Ich denke daran, wie ich Dottie das letzte Mal gesehen habe. Die zitterigen Hände, mit denen sie ihren Wackelpudding gegessen hat. Das stumpfe Licht in ihren Augen. Ohne Kraft. Ihr alter Kampfgeist nur noch ein schwacher Schatten seiner selbst. Das sieht nicht gut aus. Ganz und gar nicht.
Ich ringe Mum das Versprechen ab, mich sofort anzurufen, wenn sie erfährt, was passiert ist. Dass ich sofort in ein Taxi steigen und ins Krankenhaus kommen kann. Sie seufzt, als würde ich die Sache überdramatisieren. Das Gen für Mitgefühl und Fürsorge muss bei uns eine Generation übersprungen haben, denn Mum fehlt es komplett.
Nachdem sie das Gespräch beendet hat, lehne ich mich an eine Wand im Bahnhof. Schuhe quietschen auf dem nassen Boden, der Feierabendansturm ist noch in vollem Gange. Die Leute schubsen, seufzen genervt und ächzen, während sie sich durch die Schranken zwängen. Mir ist ganz schwindelig. Die Ränder meines Sichtfeldes werden unscharf, als hätte ich schon ein paar Kurze getrunken, und die Wirklichkeit entgleitet mir langsam. Es ist einfach alles zu viel. Mein Gesicht wird heiß, meine Kehle krampft sich zusammen. Das Bild, wie Dottie allein in einem Krankenhausflur liegt, blitzt vor meinem Auge auf.
Ich spüre eine heiße Träne auf meiner kalten Wange, als die Durchsage die baldige Einfahrt des sechs Uhr vierunddreißig Zugs nach Winchester ankündigt, und zwinge mich, in die wogende Menschenmasse zu treten, die langsam vorwärtsdrängt. Mit jedem Schritt nach vorn füllen zwei andere Personen die Stelle hinter mir. Hier ist kein Platz für Tränen.
Mein aufgeweichter Pappkarton verformt sich am Rücken der Frau vor mir, die Kuchenschachtel rutscht zur Seite. Ich komme an die Schranke. Die Leute hinter mir drängen vorwärts, und ich kann nicht mehr genau sagen, ob es die Menge oder meine Gefühle sind, die mir die Luft zum Atmen rauben. Ich kann jetzt nicht drüber nachdenken. Mein Portemonnaie steckt in meiner Manteltasche. Ich hole die Fahrkarte heraus, die natürlich nicht funktioniert. Ich ziehe sie einmal über das Lesegerät. Dann nochmal. Vor und zurück. Komm schoooon. Nicht jetzt. Brennende Tränen nehmen mir die Sicht, mit jedem Blinzeln halte ich eine Sturmflut zurück. Noch ein letzter Versuch. Das Plastik stößt gegen das Lesegerät. Nichts. Sie wird nicht akzeptiert.
»Sie dämliche Idiotin«, knurrt der Mann hinter mir.
Das war’s.
Das ist es, was mir den Rest gibt.
Der Stress der letzten sechs Monate stürzt auf mich ein, in meine Ohren, meine Augen, mein Gehirn. Ich sehe die enttäuschten Gesichter meiner Angestellten, die ich so hängengelassen habe. Ich höre Sasha, die mich bei meinem einzigen Geburtstagsplan alleine lässt. Ich spüre die kalte, mechanische Stimme meiner Mutter, die erzählt, dass die wichtigste Person in meinem Leben, aus deren Holz ich geschnitzt bin, hilflos und ohne mich in einem Krankenhaus liegt.
Das Schluchzen, das ich ausstoße, ist heftig. Ich bebe. Der große Mann zuckt zurück, als er meine laufende Nase sieht. »Haben Sie eine Vorstellung davon, was ich gerade durchmache?«, brülle ich ihn an. Die Leute schauen herüber, und plötzlich wird mir die Sache furchtbar peinlich. Ich verliere an Schwung. »Seien Sie nett«, flüstere ich und schniefe.
Es hat dieselbe Wirkung, als würde man eine Giftschlange bitten, Gnade zu zeigen.
»Das interessiert keine Sau«, brüllt der Mann zurück. »Suchen Sie sich einen anderen Platz für Ihre Midlife-Crisis.«
Er stößt mich zur Seite, und weil die Welt mich hasst, funktioniert seine Fahrkarte natürlich sofort. Ich fange noch heftiger zu schluchzen an. Die Leute stoßen mich beiseite wie ein Hindernis. Schließlich hat eine Dame mit einer Warnweste ein Herz und nutzt ihre Mitarbeiterkarte, um mich durch die Schranke zu lassen. Ich sammle mich und gehe zur Rolltreppe. Ich muss es nur bis nach unten schaffen und in den Zug steigen. Das sind höchstens noch fünfzig Meter.
Als ich auf die Rolltreppe trete, sehe ich mein Spiegelbild in einem Werbemonitor, der für einen Augenblick schwarz geworden ist. Ich sehe furchtbar aus. Aufgequollene Wangen, blutunterlaufene Augen, meine Nase ist rot wie eine Cocktailkirsche und tiefschwarzer Mascara ist mir über die Wangen gelaufen.
Am unteren Ende der Rolltreppe bemerke ich einen Mann. Groß. Dunkler Mantel. Zuerst denke ich, dass es der Kerl ist, der mich eine Idiotin genannt hat und Teil zwei von »Wie ich eine Fremde zum Heulen brachte« inszenieren will. Doch dann dreht er sich um, und mir wird klar, warum er mir so bekannt vorkam. Er streicht sich mit der behandschuhten Hand durch die dichten braunen Haare und tritt auf die Rolltreppe.
Mir klappt der Kiefer runter.
O mein Gott.
Henry Dunne.
Ich kralle mich in den Rand des Kartons und suche nach einem Fluchtweg. Ich fahre bereits auf der Rolltreppe nach unten, aber niemand geht, alle stehen. »Verzeihung«, bitte ich, und dann nochmal etwas verzweifelter. Dann erst sehe ich den Grund, warum sich niemand bewegt: Ein älterer Herr mit einem Koffer in Übergröße, der auf sein Handy glotzt. Ich schaue nach hinten. Ich habe bereits ein Drittel des Weges nach unten zurückgelegt und bin komplett eingekesselt. Entweder gelingt mir in den nächsten Sekunden das Kunststück, über zehn wütende Pendler hinweg die runterfahrende Rolltreppe hinaufzulaufen – und ich bin mir sicher, dass Menschen schon für weniger sportliche Herausforderungen Sponsoren gefunden haben –, oder ich rutsche den Handlauf hinab, rausche als unscharfer Fleck an ihm vorbei und breche mir unten die Hüfte … oder den Hals. Vermutlich beides.
Aber keine der beiden Möglichkeiten garantiert mir, dass ich nicht von dem Mann gesehen werde, der mir gezeigt hat, dass sich wahre Liebe anfühlt wie eine kunterbunte Märchenwelt … bevor er mich in die ewige Finsternis stieß.
Mein Herz rattert wie ein Presslufthammer, und ich versuche, mich stattdessen zu verstecken. Ich verberge mein Gesicht hinter dem von Schuppen bedeckten Kragen des Mannes vor mir und lege eine Hand über den Mund, bis ich kaum noch atmen kann. Von all den Menschen, denen ich hätte begegnen können. Jetzt. Hier. Während ich aussehe, wie ich aussehe, und mich zerbrechlicher fühle als der labberige Karton in meinem Arm.
Ich blicke auf meine Füße. Er hat mich gesehen. Ich weiß es. Ich spüre, wie er mich beobachtet.
Mir ist klar, dass ich nicht zurückschauen sollte. Ich sollte mich blind stellen. Ahnungslos.
Aber es ist Henry.
Also schaue ich auf, und wie ich es mir gedacht habe, treffen sich unsere Blicke.
Jadegrün. Die Farbe von Polarlichtern. Des Glücksklees, der uns immer verwehrt blieb. In einem winzigen Ausdruck von Schreck öffnet Henry leicht den Mund. Die Haare über seinen Ohren haben einen sanft silbrigen Schein, und er hat sich einen gepflegten Bart wachsen lassen, der seinen markanten Kiefer verbirgt, aber so gut aussieht, dass etwas in meinem Magen zu flattern beginnt.
Ich bin nie darüber hinweggekommen, wie gut er aussieht.
Wir blinzeln gleichzeitig. Zwischen uns sprühen Funken. Innen und außen. Am ganzen Körper. Ich spüre es in jedem Zentimeter, von meinen surrenden Fingerspitzen bis in meine klopfende Brust. Trauer, Verrat, Liebe und Lust. All die Gefühle, die verloren gingen, als wir uns getrennt haben, wirbeln nun in einer Endlosschleife durch mich hindurch. Ich weiß, dass er es auch spürt. Ich sehe es an seinem verletzten Blick, daran, wie er seinen Kiefer anspannt. Mit jedem Schlag rutscht mir das Herz höher in die Kehle.
Jetzt ist er so nah, dass ich ihn berühren könnte. Würde ich den Arm ausstrecken, könnte ich meine Hand auf ihn legen, könnte mich versichern, dass er echt ist und er wirklich hier ist. Sein Blick bohrt sich in meinen. Ein Blick, mit dem er die Zeit selbst durchbohren könnte, der einen auf ewig verfolgt.
Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen.
Ich halte den Atem an.
Und dann ist er vorbei.
Hinauf.
Hinauf.
Hinauf.
Hinauf.
Er fährt immer weiter, ohne mich. Genau wie vor vier Jahren.
Ich erreiche das untere Ende der Rolltreppe und stolpere. Als ich endlich den Mut aufbringe, mich umzudrehen und die Rolltreppen hinaufzuschauen, ist Henry verschwunden. Irgendwo im Bahnhof. Ich frage mich, ob ich mir alles nur eingebildet habe. Oder geträumt.
Die Realität holt mich wieder ein, als mich jemand schmerzhaft anstößt, dann noch jemand. Am Ende einer vollen Rolltreppe stehenzubleiben, ist ein Verstoß gegen die Regeln des öffentlichen Nahverkehrs, der mit dem Tode geahndet gehört. Aus den Lautsprechern kommt die Ansage, dass mein Zug gleich abfährt, und als ich loslaufe, um ihn noch zu kriegen, fliegt mir mein Karton aus der Hand. Er steigt hoch und höher, dreht sich, kippt, macht einen Salto wie ein Zirkusakrobat. Nur die Landung kriegt er nicht hin.
Alles knallt auf den Boden, der Karton birst in zwei Teile. Die Torte, mit der ich meinen dreißigsten Geburtstag feiern sollte, schlägt als Letztes auf, landet mit einem satten Klatschen und zerbröselt in etliche Teile, als Hunderte Menschen den weichen roten Kuchen zu Matsch treten.
Genau so fühlt sich mein Herz an.
Kapitel zwei≈Grace
Heute
Noch fünfunddreißig Minuten, dann bin ich dreißig. Ich dachte immer, wenn ich die dreißig erreiche, diesen Meilenstein des Erwachsenwerdens, dass ich das irgendwie spüren würde. Dass ich etwas geleistet hätte. Dass ich gereift wäre. Dass ich wüsste, wie ich mich im Angesicht eines Notfalls zu verhalten hätte. Stattdessen trinke ich allein. Ich habe die Flasche mit altem Wein geöffnet, die ich aus dem Restaurant mitgenommen habe. Nach einem Glas weiß ich, dass ich es morgen früh bereuen werde, mich zu betrinken, so wie ich die zwölf zunehmend aggressiven Sprachnachrichten bereue, in denen ich meine Mutter anflehe, mich auf den neuesten Stand zu bringen.
Ich habe jede Notaufnahme an der Südküste angerufen, aber keine davon kennt eine Dottie Monroe. Ich habe in ihrem Wohnheim angerufen und mit dem Nachtdienst gesprochen, der mir absolut nichts Hilfreiches mitteilen konnte, weil die Heimleiterin offenbar seit zwei Wochen zum Skifahren in den Alpen ist. Ausgehend von den Katastrophen, die es gab, als sie in die Flitterwochen gefahren ist, ist das gesamte Heim vermutlich schon im Verwaltungschaos versunken.
Ich sitze mit wippenden Knien im Dunkeln, kaue an meinen Nägeln, vor mir ein zweites Glas Wein, und weiß nicht, was ich tun soll, wenn Dottie irgendetwas zustößt. Wenn ich sie verliere …
Die Beziehung zu meinen Eltern ist ziemlich kompliziert, in dem Sinne, dass es quasi keine gibt. Kurz nach meiner Geburt haben sie eine Firma für Finanzdienstleistungen gegründet, die sie während des Dotcom-Booms in eine Vergleichswebseite umgewandelt haben. In England hatten sie damit nie großen Erfolg, aber der europäische Markt war ganz verrückt danach. Das bedeutete, dass sie öfter im Ausland als zu Hause waren. Obwohl sie ein echtes Kind hatten, wurde die Firma ihr umhegtes Baby. Das Zentrum ihres Universums.
Großgezogen hat mich Dottie. Sie hat mich in ihren neonfarbenen Hosenanzügen von der Schule abgeholt, hat mein aufgeschürftes Knie mit Jod und einem Klecks ihrer hausgemachten Kräutertinktur versorgt. Sie hat mich aufgeklärt und mir gezeigt, wie man Verhütungsmittel benutzt (dafür hat sie extra fünf unterschiedlich große Bananen gekauft). Sie hat mich über meinen ersten Liebeskummer hinweggetröstet und mit mir gefeiert, als ich meine Kochausbildung abgeschlossen habe.
Meine beste Freundin und engste Vertraute. Ich durfte sie nie »Großmutter« nennen – sie meinte, sie fühle sich jünger, wenn das nicht so klar angesprochen würde, und mir war es ohnehin nie wichtig. Der Begriff Großmutter wurde dem, was diese Frau für mich ist, nie gerecht. Sie ist alles für mich.
Ich leere das zweite Glas Wein und rufe nochmal meine Mutter an. Sie geht nicht ran. Ich rufe Dad an. Es klingelt nicht einmal. Ich weiß, dass mich jeder Schluck nach dem zweiten Glas Wein vermutlich viel zu emotional werden lässt. Als ich das letzte Mal allein getrunken habe, endete es damit, dass ich mich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und aus vollem Hals Powerballaden gesungen habe, bis ich ohnmächtig wurde, was jetzt, wo ich an der Schwelle zu meiner vierten Dekade stehe, weniger eine »witzige Anekdote« und sehr viel mehr ein Anlass für »Ich sollte vielleicht mal mit jemandem reden« ist.
Dreißig. Pleite. Arbeitslos. Die Beziehung zu meinen Eltern unwiederbringlich zerrüttet. Eine Großmutter, die vermutlich um ihr Leben ringt. Single …
Scheiß drauf. Ich schenke mir einfach das dritte Glas ein. Noch zwanzig Minuten bis Mitternacht, und die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mutter zurückruft, liegt quasi bei null. Vermutlich hat sie sich überzeugt, dass das Krankenhaus Dottie aufgenommen hat, ist nach Hause gefahren und ins Bett gegangen. Wäre nicht das erste Mal, dass sie vergessen hat, dass ich existiere.
Trotzdem rufe ich sie noch ein letztes Mal an, und während ihre Stimme von der Mailbox erklingt, bemerke ich das rote Leuchten in meiner weißen Küche. Das Licht des Mondes, das durchs Fenster scheint. Er ist größer und röter, als ich ihn je erlebt habe. Mein winziger, überwucherter Hintergarten sieht aus wie an Halloween. Ich erinnere mich an etwas, das geschah, als ich etwa zehn war. Dottie und ich in ihrem Bungalow, die Kristalle auf ihrer Fensterbank leuchteten in allen Tönen von Bordeauxrot. »Ein Blutmond ist sehr mächtig«, erzählte sie mir, während wir in den Nachthimmel schauten. »Das Ende eines Kapitels, der Beginn einer Veränderung.«
Mir kommt eine Idee, die so lächerlich ist, dass ich sie auf der Stelle verwerfe. Doch in dem stillen roten Leuchten in meiner Küche kriecht sie bald wieder zu mir zurück und wird mit jedem Schluck Wein stärker. Die Erinnerung an diese ersten paar Nächte bei Dottie, nachdem man mich mit einem kleinen Köfferchen, einem Stundenplan für die Schule und einem Abschiedskuss dort abgestellt hatte. Mein fünfjähriges Ich wusste noch nicht, dass für meine Eltern die Karriere immer an erster Stelle stand. Und auch nicht, dass es der Beginn einer langen Tradition sein würde, mich immer wieder wochenlang zu meiner Großmutter abzuschieben.
Irgendwann begann Dotties kleiner Bungalow sich für mich wie ein richtiges Zuhause anzufühlen, doch bis dahin hatte ich solche Sehnsucht nach meinen Eltern, dass ich stundenlang weinte. Dottie war immer voller Geduld und Güte, und sie wusste stets, wie sie mich trösten konnte.
Als wir ihre Kristalle das erste Mal benutzten, war ich noch so klein, dass es gar keine richtige Erinnerung ist, eher eine verschwommene Ansammlung von Bildern. Wir beide sitzen auf dem Bett und halten uns an den Händen. Die Kristalle zwischen uns bilden einen Kreis, und Dottie sagt, dass ich mir etwas wünschen soll, so doll ich nur kann. Ich schließe meine Augen, spanne jeden Muskel an und wünsche mir, dass meine Eltern wieder zurückkommen, bis ich ganz rot im Gesicht bin und bibbernd schluchze, bevor ich endlich einschlafe.
Manchmal kamen Mum und Dad am nächsten Tag nach Hause. Dann sah ich voller Staunen zu meiner Großmutter und wunderte mich, wie sie das geschafft hatte. Manchmal blieben sie noch länger weg – eine neue Gelegenheit, ein neuer Deal, den sie abschließen konnten, irgendwas gab es immer. Als Entschädigung schleppte Dottie ihr Bettzeug in mein kleines Zimmer, wo wir eine Übernachtungsparty veranstalteten, mit Popcorn und Zeichentrickfilmen, und sie sagte mir, dass ich vielleicht nicht immer das bekomme, was ich mir wünsche, sondern manchmal das, was ich stattdessen brauche. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich nach solchen Abenden jemals in den Schlaf geweint hätte.
Bis zum heutigen Tag besteht Dottie darauf, dass es Magie wirklich gibt. Dass Geister unter uns wandeln, dass wir die Stimmen unserer Ahnen im Wind hören können, dass ein Stück Kristall jedes Leid heilen kann. Ich lächle immer und sage ihr: »Ja, natürlich«, auch wenn ich weiß, dass die Macht der Suggestion und der Placeboeffekt sehr viel wahrscheinlicher die Verantwortung tragen als irgendeine mystische Macht.
Warum stehe ich also jetzt auf meinem Küchenstuhl und strecke den Arm zum obersten Regal, hinter die dicken, schweren Kochbücher, zu dem kleinen Haufen eingestaubter Kristalle, von denen ich fast vergessen hatte, dass ich sie habe?
Dottie hat mir immer einen Kristall geschenkt, wenn sie das Gefühl hatte, dass es mir nicht sonderlich gut geht. Einen Amethyst, als ich mit meinem ersten Restaurantjob zu kämpfen hatte. Rosenquarz, als Henry und ich uns getrennt haben. Einen spitzen orangefarbenen für die Wochen danach, als ich nicht aus dem Bett aufstehen oder etwas essen konnte und auch duschen eher etwas war, das man auf später verschob.
Mir ist wirklich peinlich, wie verzweifelt ich bin, als ich alle Kristalle in einen Kreis lege und mich frage, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt oder eine Farbkombination, die ich einhalten sollte.
Ich zünde eine Kerze an und stelle sie in die Mitte.
Und jetzt?
Ich schaue mich im Zimmer um, und mein suchender Blick kommt auf einem gerahmten Schwarz-Weiß-Foto zum Ruhen. Dottie und ich stehen am Eröffnungstag vor dem Lucky One. Die Lokalzeitung benutzte das Foto, als sie über die Eröffnung berichtete, was, darauf besteht Dottie bis heute, allein das Ergebnis ihres innigen Wünschens gewesen sei. Dabei weiß ich, dass sie die Redaktion drei Wochen lang terrorisiert hat, bis sich jemand einverstanden erklärte vorbeizukommen. Dottie sagt immer, dass man alles wahr machen kann, wenn man nur fest genug daran glaubt. Ihr Optimismus ist einer der Gründe dafür, dass ich mit fünfundzwanzig überhaupt den Mut aufgebracht hatte, ein Restaurant zu eröffnen.
Ich weiß, was zu tun ist.
Ich nehme das Foto aus dem Rahmen und falte es auseinander, damit man den Teil sieht, den ich die letzten vier Jahre versteckt gehalten habe: Neben mir steht Henry. Ich habe seit damals jeden Tag in Dotties stolzes Gesicht geschaut, mit all den Lachfältchen, die sie normalerweise niemals auf einem Foto erlaubt. Aber jetzt sehe ich auch Henry, der auf der vordersten Stufe steht, die Arme um meine Hüften gelegt, und mir die Haare küsst. Ich höre noch, wie der Reporter ihn versehentlich als meinen Mann bezeichnet, spüre noch die Freude, als Henry daraus keine unangenehme Szene gemacht, sondern einfach nur gelächelt hat, bevor er sagte: Irgendwann.
Das ist es, erinnere ich mich gedacht zu haben, als der Fotograf abgedrückt hat. Das ist Glück. So fühlt es sich an, wenn man alles hat, was man immer wollte.
Nur zwei Monate, nachdem das Foto aufgenommen wurde, war alles anders. An dem Abend, als wir uns getrennt haben, sagte ich Henry, dass ich mir wünschte, ich hätte ihn nie getroffen, doch als ich das Foto jetzt in meinen Kristallkreis lege, weiß ich, dass ich mir das nicht länger wünsche.
Ich lege den Kopf in den Nacken, trinke noch mehr Wein, dann schließe ich die Augen. Ich atme lang und langsam aus, spanne alle Muskeln an, bis ich zittere. Und spreche meinen Wunsch.
»Ich wünsche mir dieses Gefühl zurück«, flehe ich die Luft an. »Das Glück. Die Freude. Ich will von allen Fehlern befreit sein, von allem, was ich bereue. Ich wünsche, dass Dottie gesund und glücklich ist. Dass meine Angestellten das Ende erleben, das sie verdienen. Ich wünsche, dass alles, was schiefgelaufen ist, verschwindet – der Herzschmerz, die Angst, die Zweifel. Puff. Verschwunden. Für immer.«
Ich öffne ein Auge und schaue mich in der leuchtend roten Küche um … Nichts geschieht. Ich komme mir ein bisschen albern vor. Ich will es gerade nochmal versuchen, als mein Handy vibriert.
Ein Anruf von einer nicht gespeicherten Nummer. Ich lange quer über den Tisch nach dem Telefon, wobei ich meinen Wein umstoße und versehentlich den Anruf beende. Dotties Kristalle fliegen in alle Richtungen davon. Das Glas zerbirst, und funkelnde Scherben zieren den Boden. Wein saugt sich in meine Socken. »Ernsthaft?«, rufe ich der Zimmerdecke entgegen.
Ich will die Nummer gerade zurückrufen – vielleicht ist es jemand aus dem Krankenhaus oder aus Dotties Wohnheim – als eine Nachricht eintrifft. Von Mum.
Sehr müde. Melde mich morgen früh.
Das ist alles? Als ich sie anrufe, geht sie nicht ran. Ich stoße einen frustrierten Laut aus, bevor ich meine Antwort eintippe.
Wie geht’s Dottie? Wo ist sie? Kann ich sie besuchen? Könntest du MICHSOFORTANRUFEN?
Ich schicke noch eine Nachricht mit dem Wort Bitte und hoffe, dass ein bisschen Freundlichkeit ihre gleichgültige Persönlichkeit erweichen kann, als noch eine Nachricht aufploppt. Von der Nummer, die mich gerade angerufen hat.
Grace, steht da. Ich habe den ganzen Abend gebraucht, um deine neue Handynummer herauszufinden. Ich weiß, ich bin vermutlich der letzte Mensch, von dem du hören möchtest, aber es ist wichtig, dass ich mit dir spreche. Ich rufe in einer Minute nochmal an. Bitte geh ran.
Henry
Ich starre die Nachricht so lange an, dass ich nicht einmal bemerke, wie meine Hände zittern. Habe ich das ausgelöst? Mit meinem Wein und den Kristallen und dem Wünschen? Nein, das kann nur ein Zufall sein.
Henrys kleines Profilbild leuchtet wie ein Signalfeuer auf meinem Handy auf, und als ich es anklicke, füllt sein Gesicht den Bildschirm. Dunkle Haare, schicke Sonnenbrille. Irgendwo, wo es warm ist. Er lächelt, als wäre alles auf der Welt in Ordnung. Als wäre er genau da, wo er sein sollte.
Henry so glücklich zu sehen, löst eine Reihe von Gefühlen in mir aus: Eifersucht, Dankbarkeit, Stolz. Woher hat er meine Nummer? Ich habe sie zwei Wochen nach unserer Trennung geändert und all meinen Freunden die ausdrückliche Anweisung erteilt, sie ihm nicht zu geben, falls er danach fragt, was er, wie ich ihm zugutehalten muss, vermutlich nie getan hat. Ich hatte viel Trost darin gefunden, dass er keinen Kontakt zu mir aufnehmen konnte, weder über E-Mail noch telefonisch oder über soziale Medien. Das machte den Schmerz erträglich, dass er keinen Kontakt zu mir aufgenommen hatte.
Warum also jetzt? Vier Jahre später? Er hatte heute bereits die Gelegenheit, mit mir zu sprechen, und hat nichts gesagt. Hat mich nur angestarrt. Trotzdem bin ich neugierig. Was könnte er mir nur mitteilen wollen? Dass es ihm leidtut? Dass er mir vergeben hat? Diese Worte habe ich früher schon von ihm gehört, und es hat nie etwas geändert und nie mein gebrochenes Herz geheilt.
In der Sekunde, in der die Uhr auf Mitternacht springt, ruft Henry an.
In das Leuchten des blutroten Mondes getaucht, sehe ich den Anruf auf meinem Display. Mein Daumen schwebt zwischen dem grünen und dem roten Icon hin und her. Grün für eine zweite Chance. Rot für das endgültige Ende. Ich versuche, den Mut zusammenzuraffen, mich für eines davon zu entscheiden, als sich ein Warnfenster öffnet.
NIEDRIGERBATTERIESTAND.
Ich renne zu meinem Ladekabel, was völlig verrückt ist, weil ich bereits entschieden habe, nicht ranzugehen. Eilig wickle ich es auf, was so lachhaft ist, weil ich seinen Anruf gar nicht annehme … Ich drücke den Stecker in die Steckdose, und als mein Finger zum grünen Annehmen-Icon huscht, spüre ich einen spitzen Schmerz durch meinen Arm schießen. Meine Sicht wird trübe und fleckig. Ich muss auf den Boden geknallt sein, denn mein Rücken kracht gegen etwas Hartes, und ich rieche meinen verschütteten Wein, doch ich bin zu desorientiert, um mich umzuschauen. Der Klang meines schmerzerfüllten Stöhnens wird von etwas ersetzt, das, ich schwöre es, wie Dotties Stimme klingt, die meinen Namen ruft. »Grace, Süßes. Grace!«, säuselt sie sanft. Aber Grace ist gerade nicht hier.
Sie ist irgendwo anders. In einem nebeligen, traumartigen Zustand. Ich sehe mich selbst als Kind, das den St. Catherine’s Hill hinaufgeht, der Wind in meinen Haaren, weiches Gras zwischen meinen Fingerspitzen. Ich sehe mir selbst zu, wie ich vor Dotties Bungalow Fahrradfahren lerne, wie sie meinen Rahmen loslässt und mir klatschend hinterherjubelt, als ich über den Gehweg gleite. Dann stehe ich vor meiner gesamten Schulklasse, umgeben von Gelächter, an dem ich nicht teilhabe. Ich sehe meinen ersten Kuss. Einen Mathematiktest, der mit DURCHGEFALLEN markiert ist. Ein Kaleidoskop von Erinnerungen, die immerzu stoppen und starten. Die mit unscharfen Rändern in mein Sichtfeld treiben und es wieder verlassen. Ich sehe Henry auf der Rolltreppe, wie er mir näher kommt, und als er mir die Hand entgegenstreckt, um meine zu berühren, als er den Mund öffnet, um mir etwas zu sagen, springt mein Traum wie eine Schallplatte mit einem Kratzer. Ein krächzendes Geräusch. Wir sind nicht länger im Bahnhof. Ich stehe im strömenden Regen vor seinem Haus. Er weint. Ich auch. Sofort ist das Bild verschwunden und wird von der Nacht abgelöst, als wir uns kennenlernten. Eine ausgelassene Hausparty und wir mittendrin, eine Insel der Ruhe. Ich spüre die Wärme seines Mundes auf meiner Haut, seine Finger an meinen Rippen. Er sagt mir, dass er mich liebt, so sehr, dass er es kaum erträgt – die Worte habe ich nie von ihm gehört, darum weiß ich, dass das nicht real ist, aber dennoch schließe ich die Augen und gebe mich diesem neuen Ort hin. Der süßen Möglichkeit dessen, was hätte sein können. Ein Paralleluniversum. Ein anderes Leben, das mir mit starren Zeitmarken vorgespielt wird.
Dann, wie im echten Leben, ist alles weg … und ich bleibe mit absolut gar nichts zurück.
Kapitel drei≈Grace
Heute
Der nächste Morgen bringt frische, klare Luft mit. Eine Brise huscht unter meinen geschlossenen Vorhängen hindurch und weckt mich sanft.
Himmel. Mein Schlafzimmer sieht aus wie der Tatort eines Verbrechens. Eines brutalen Verbrechens. Einbruch oder Körperverletzung. Ich muss nach zu viel Wein in der Küche eingeschlafen und in den frühen Morgenstunden halb im Schlaf hier hochgewankt sein. Ich habe die meisten meiner Klamotten aus dem Schrank gerissen und in der Zimmermitte zu einem Haufen aufgetürmt. Auf meinem Nachttisch liegt eine halb aufgegessene trockene Toastscheibe. Und ich habe – ganz offensichtlich – das billige Deo mit Blumenduft, das ich nie benutze, großzügig im Raum versprüht. Der Geruch ist so schwer, dass ich ihn schmecken kann.
Ich habe mich gerade halbwegs aufgesetzt, als die Zimmertür auffliegt. »HAPPY …«, ruft Sasha und wird von dem gellenden Schrei unterbrochen, der mir aus der Lunge fährt. Ich trete und werfe meine Bettdecke gleichermaßen in die Luft, als könnte mich ein Knäuel aus Gänsedaunen vor einem Eindringling beschützen. Sie landet auf mir, aber nicht, bevor sie Sasha den Teller aus der Hand geschleudert hat und ein einsames Croissant mit einer – jetzt geknickten – Kerze auf den Teppich fällt.
Ich ringe nach Atem. »Sasha! Was zur Hölle tust du hier? Du hast mich zu Tode erschreckt.«
Sie lacht, während ein Ballon zur Decke schwebt. »… Birthday?«, beendet sie ihren Gruß.
Ich bemerke, dass sie einen Pyjama trägt und ihre Haare unter einer pinkfarbenen Seidenhaube stecken. O Gott. Hab ich sie angerufen? Hab ich ihr erzählt, was für eine Versagerin ich bin und dass mein Leben einen derartigen Tiefpunkt erreicht hat, dass ich versucht habe, es mit einer schrägen Kristallzeremonie wieder geradezubiegen? Mir fällt kein anderer Grund ein, weshalb sie hergefahren und die Nacht hier verbracht haben sollte. Ich werde nie wieder alleine trinken. Nie wieder.
Sasha hebt das Croissant auf und pustet einmal drüber, bevor sie herzhaft abbeißt. »Mach dir keine Sorgen, unten liegt eine ganze Tüte davon. Also, wie geht’s dir, alte Frau?«
Sie setzt sich aufs Fußende meines Betts, und ich bin so verwirrt, dass ich kurz überlege, ob ich noch träume. Ich reibe mir den Nasenrücken. Alles fühlt sich ein bisschen wackelig an. Als hätte ich eine ganze Woche durchgeschlafen. Ich dachte, ich hätte den Rest vom Wein verschüttet, aber mein Schädel pocht, als hätte ich eine halbe Weinkiste geleert.
Ich greife nach dem Handy auf dem Nachttisch, aber da liegt es nicht.
»Suchst du das hier?«, fragt Sasha und reicht es mir. »Du hast es in der Küche liegenlassen. In der übrigens pures Chaos herrscht. Keine Ahnung, was du gestern Abend gekocht hast, aber was auch immer unten an dem Topf klebt, sieht wie Erbrochenes aus. Oder Durchfall. Oder als hätte jemand Durchfall erbrochen.«
Ich öffne den Mund, aber mir fehlen die Worte. So derbe Ausdrücke passen gar nicht zu Sasha, der Frau, die vom Lawyer Magazine den Titel »Eine, die man im Auge behalten muss« verliehen bekam. Zumindest nicht mehr.
»Das räume ich noch auf«, sage ich. Ich erinnere mich nicht daran, gekocht zu haben, aber das ist im Augenblick eine meiner geringsten Sorgen. »Zuerst muss ich Dottie finden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.«
Sashas Lächeln erlischt, und sie zieht besorgt die Augenbrauen zusammen. »Wirklich?«
»Ja. Meine Mum war bei ihr, ist aber so nutzlos wie immer, und ich …«
»Ich meine nur, weil sie vor zwanzig Minuten angerufen hat. Ich bin rangegangen. Sie klang kerngesund.«
»Wirklich?«
»Ja.« Sasha steht auf und beginnt, den peinlichen Klamottenhaufen auf dem Boden ordentlich zusammenzulegen. »Ich hab ihr gesagt, dass du noch schläfst. Sie meldet sich später nochmal. Sie meinte, sie hat um zehn ihren Buchclub und anschließend einen Termin mit einer Aura-Reinigerin. Es könnte also später-später werden.«
Dottie hat seit Jahren nichts mehr unternommen, wenn man nicht mitzählt, wie sie im Aufenthaltsraum sitzt und eine Geisterjäger-Sendung guckt, während sie den anderen Bewohnern, die ihre Gase nicht halten können, giftige Blicke zuwirft. Vielleicht hat das Krankenhaus sie entlassen und sie ermutigt, wieder aktiver zu sein. Oder der neue Sozialaktivitätskalender, von dem das Wohnheim immer spricht, wurde endlich umgesetzt. Aber Gott sei Dank geht es ihr gut.
Ich steige aus dem Bett und suche den von Sasha sortierten Kleiderstapel nach etwas Passendem durch. Ich wähle eine Jeans und einen gestreiften Pullover aus, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Sie räumt weiter auf, steckt Deckel auf meine Parfüms und schiebt Schubladen zu. Als wir noch zusammengewohnt haben, hat meine Unordentlichkeit sie den letzten Nerv gekostet. »Ich dachte, du hast heute früh einen Termin bei der Ärztin«, sage ich.
Sie schaut mich ausdruckslos an.
»Dr. Gomez«, konkretisiere ich. Etwas derart Wichtiges kann sie unmöglich vergessen haben.
Sie dreht sich zu mir um, legt beide Hände an meinen Kopf, drückt ihn nach hinten und schiebt mir mit den Daumen die Augenlider nach oben, als würde sie nach Lebenszeichen suchen. »Geht es dir gut? Du hast weniger wirr gesprochen, als du diese besonderen Brownies hattest.«
Sie lacht, als hätten sich all ihre Sorgen über Nacht in Luft aufgelöst.
Vielleicht ist das ihre Art, mich wissen zu lassen, dass sie nicht darüber sprechen will. Dass sie und Roman es sich anders überlegt haben. Sie hat mir erzählt, wie teuer eine künstliche Befruchtung ist und welchen Tribut die ersten beiden Versuche von ihrem Körper gefordert haben. War das ein Hilferuf, den ich überhört habe? Ich möchte sie drängen, mit mir darüber zu sprechen, aber ihr Lächeln wirkt so aufrichtig, so strahlend und lebendig, dass ich zögere. Sie ist aus einem Grund hergekommen. Um zu fliehen. Ich darf ihr das nicht wegnehmen. »Tut mir leid, ich bin noch nicht ganz wach«, erkläre ich ihr.
»Zu deinem Glück hab ich auch Kaffee gemacht«, sagt sie auf dem Weg zur Schlafzimmertür. »Ich muss los, heute ist ein irrer Tag im Büro. Aber heute Abend lassen wir’s krachen.«
»Krachen?«, frage ich und reibe mir die Augen. Der einzige Plan, den ich habe, besteht aus meinem Sofa. Wow. So ist es also in den Dreißigern? Eine lange Nacht, und man ist eine Woche außer Gefecht?
»Sag mir nicht, dass du’s vergessen hast.«
»Nein …?«, antworte ich und klinge so überzeugend, wie ich gestern Abend nüchtern war.
»Ich hab dir den Catering-Job besorgt, für die Neue, die bei mir arbeitet, schon vergessen?«
Ich habe seit Jahren keine privaten Events mehr gecatert. Ich würde mich eindeutig erinnern, wenn ich so etwas zugestimmt hätte. Allerdings war ich so mit dem Untergang des Restaurants beschäftigt, dass alles möglich ist. »Erinnere mich nochmal an die Einzelheiten.«
Sasha verdreht die Augen. »Heute Abend. Ein paar Tabletts mit Essen. Dreihundert Pfund.«
»Dreihundert?«, wiederhole ich. Ich kann es mir nicht leisten, das abzulehnen. »Bar auf die Hand?«
»Natürlich«, sagt Sasha. »Und dann bleiben wir noch, trinken ein bisschen und feiern deinen Geburtstag.«
»Oder wir können einfach das Essen abstellen, nach Hause fahren und einen alten Film reinschmeißen«, erwidere ich.
»Wir bleiben nicht hier und gucken Liebe braucht keine Ferien. Weihnachtsfilme im Januar sollten verboten werden.« Sie seufzt. Ich bin ein ziemliches Gewohnheitstier. »Du wirst nur einmal fünfundzwanzig, also musst du das Beste daraus machen.« Sie zwinkert mir zu.
»Oh, haha«, gebe ich mit einer Prise Humor zurück. »Im Augenblick fühle ich mich eher wie fünfundfünfzig.«
Seltsamerweise beschließt Sasha, bei mir zu duschen. Währenddessen schaue ich auf mein Handy. Es gibt keinen Nachweis davon, dass ich Sasha gestern Abend angerufen habe. Aber auch nichts von Henry. Was sich seltsam anfühlt, bis sich ein vertrautes, Henry-bezogenes Gefühl in mir regt: totale Trostlosigkeit. Ich habe ihn nicht ohne Grund aus meinem Leben geworfen, nach allem, was passiert ist. Es war einfach zu schmerzhaft, ihn auch nur anzusehen, seinen Namen zu lesen. Daran zu denken, was ich getan habe … was er … Nein. Ich verbiete meinem Gehirn, sich zu erinnern. Das betrunkene Ich muss zum selben Schluss gekommen sein, denn es hat jede Spur von ihm gelöscht. Was eindeutig das Beste ist. Selbst wenn es bedeutet, dass ich niemals erfahren werde, was er mir sagen wollte.
Sasha kommt in einem schicken grauen Anzug aus dem Badezimmer. Hat sie den mitgebracht? Sie verhält sich, als wäre sie nie ausgezogen. Vielleicht hat sie immer noch das Gefühl, hier zu wohnen. Nachdem sie mit Roman zusammengezogen ist, habe ich mir nie eine neue Mitbewohnerin gesucht. Es hat sich falsch angefühlt. Und noch schlimmer, als ich gezwungen war, die Stromrechnung alleine zu bezahlen.
Sie verabschiedet sich und lässt den Vanilleduft ihres Parfüms zurück, nachdem sie mir noch einmal gesagt hat, wie sehr sie sich auf heute Abend freut. Ich nehme mir eines der Croissants, die sie besorgt hat, und esse es, während ich langsam in den Tag starte. Schluss mit Jammern. Schluss mit Trübsal blasen. Die Operation »Mein Leben in den Griff kriegen« startet hier und jetzt. Und hey, es sieht doch schon gar nicht so schlecht aus: Sasha ist hier, Dottie geht es gut, und ich habe ein Dreihundert-Pfund-Catering vor mir. Nicht genug, um alle meine Schulden bei meinen Angestellten zu bezahlen, aber ein Anfang.
Ich eile durch die Küche und suche meinen Tagesplaner. Darin steht alles, was ich für ein Catering brauche: Rezepte, Einkaufslisten, Kostenrechnungen. Sasha hat recht, der Laden ist ein kompletter Saustall. In der Spüle stapelt sich ungewaschenes Geschirr, feuchte Kleidung liegt in der Waschmaschine, und aus dem Mülleimer dringt ein eigenartiger Geruch. Ich bin zutiefst beschämt, dass sie das alles in diesem Zustand gesehen hat. Ich sehe das Chaos mit neuem Blick: Stehen die Dinge wirklich so schlimm für mich? Von Studenten und abgebrannten jungen Erwachsenen erwartet man, dass sie so durchs Leben schliddern, aber nicht von erwachsenen Frauen, die auf eigenen Füßen stehen.
Nachdem ich das halbe Haus vergeblich nach meinem Planer abgesucht habe, erinnere ich mich, wo ich ihn zuletzt gesehen habe: Neben meinem unglückseligen Geburtstagskuchen auf dem Küchentresen im The Lucky One. Mist.
Ich schaue auf die Uhr.
Fast acht.
Wird eng, dort zu sein, bevor die Bank den Laden offiziell übernimmt, aber ich glaube, ich kann es schaffen.
* * *
Ich durchquere die Schranke am Bahnhof und renne Winleys Hauptstraße entlang. Es ist ein wolkenloser, sonniger Tag, doch er hat jene Januarkälte, bei der meine Wangen leuchten und meine Fingerspitzen schmerzen. Ich bin dasselbe Stück Straße schon tausend Mal gegangen, seit ich das Restaurant eröffnet habe. Ich weiß, dass ich großzügig um das hinderlich aufgestellte »Willys Empfehlungen«-Schild von William, dem Gemüsehändler herumgehen muss, auf dem er immer nur die phallisch geformten Gemüse anpreist. Ich weiß, dass die Bushaltestelle mit Fäkalwörtern vollgeschmiert ist, die selbst Dottie mit ihrem Schandmaul die Schamesröte ins Gesicht treiben würden. Ich weiß, dass es einen Gullydeckel gibt, der, wenn man lange genug darauf stehenbleibt, den Fuß mit Regenwasser bedeckt … Zumindest tut jeder so, als wäre es Regenwasser.
Das Problem ist nur …
Williams Schild steht nicht da. Die Bushaltestelle sieht nagelneu aus. Der Gullydeckel ist eine Gehwegplatte.
Ich bleibe stehen und schaue die Hauptstraße entlang, ob ich vielleicht am falschen Bahnhof ausgestiegen bin. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Da ist die Apotheke. Ein Wohltätigkeitsladen. Ein Optiker. Ein Zeitungsstand. Aber alles dazwischen ist seltsam. Die glänzend neuen Poster für alte Filme. Die Titelseite am Zeitungsstand, die über einen Politiker klagt, von dem ich mir sehr sicher bin, dass er vor einigen Monaten gestorben ist …
Ein angespanntes Kribbeln läuft meinen Rücken hinauf, und das Gefühl, das ich schon den ganzen Morgen über nicht abschütteln konnte, kehrt zurück – dass irgendetwas nicht stimmt. Als wäre ich am rechten Ort zur völlig falschen Zeit.
Nein. Das sind nur wieder meine drolligen fünf Minuten, sonst nichts. Ich bin verkatert. Oder kriege eine Erkältung. Ich stütze mich auf meinen Knien ab und schaue zu Boden, während ich verzweifelt versuche, mich irgendwie zu orientieren.
In genau dieser Sekunde hebt einer von Williams vermehrungsfreudigen Labradors sein Bein an mir. Ich springe zur Seite und entkomme knapp der kleinen Bodendusche.
»Himmelherrgott«, knurrt William und zerrt an der Leine. »Jeremiah. Nein. Bäume, ja. Häuser, ja. Menschen, nein.« Er schaut mich an. »Tut mir leid, Miss, er ist noch ein Welpe und weiß noch nicht genau, was er anpinkeln darf und was nicht.«
»William?«
»Hi!«, antwortet er fröhlich.
»Ich bin’s.« Warum guckt er mich an, als hätte ich einen fetten Popel an der Nase? »Grace. Grace Monroe?«
Der Mund unter seinem wilden grauen Schnurrbart verzieht sich zu einem Lächeln. »Ach herrje, ich hab ein furchtbares Namensgedächtnis.«
Okay. Das ist schräg. Ich bestelle schon seit Jahren jede Menge Gemüse bei ihm. Hat er schon erfahren, dass ich schließen musste? Will er mir so zeigen, wie wütend er über die verlorene Kundin ist? Außerdem waren er und Patrick befreundet. Natürlich schlägt er sich auf seine Seite. »Hören Sie, Patrick hat Ihnen vermutlich schon erzählt, was mit The Lucky One passiert ist. Ich weiß, es klingt schlimm, aber ich habe wirklich alles getan und versucht, was mir einfallen wollte, um den Laden am Laufen zu halten.«
»Das Lucky was?«, antwortet er. »Und wer ist Patrick?«
Ich seufze. Das grenzt schon an Frechheit. »Ich verstehe ja, dass Sie ein Problem mit mir haben, aber ich dachte, wir wären Freunde, William. Ich weiß, dass mein Restaurant schließt, beeinflusst auch Ihr Geschäft, aber man weiß ja nie. Wenn Sie einen hippen Coffeeshop reinsetzen, dann bekommen Sie vielleicht mehr Laufkundschaft vom …« Ich deute mit dem Arm auf mein Restaurant in einiger Entfernung. Und da sehe ich sie.
Eine schmuddelige kleine Imbissstube dort, wo The Lucky One sein sollte.
Die Imbissstube, deren Pacht ich übernommen habe.
Vor fast fünf Jahren.
Jedes Zeitgefühl löst sich vor meinen Augen auf. Ich schlucke einen Schwall Galle hinunter, reibe meine klammen Hände an den Hosenbeinen ab, blinzele ein paar Mal und bete, dass die Welt um mich herum aufhört, sich zu drehen. Menschen versammeln sich um mich, eine gesichtslose Masse voll schriller Stimmen, die Sorge ausdrücken. Ich kann mich auf keine davon konzentrieren, denn ich stammele immer wieder vor mir her: »Welches Jahr haben wir?«, bis die Worte in ein unverständliches Rauschen übergehen.
»Es geht ihr offensichtlich nicht gut!«, ruft jemand.
»Sie könnte auf Drogen sein. Die Kinder heutzutage spritzen sich doch ständig was in die Augäpfel«, sagt jemand anderes.
»Man kann sich nichts in die Augäpfel spritzen, Philomena. Überprüft ihre Venen!«
Ein älterer Herr, der nach Knoblauch riecht, versucht, meine Ärmel hochzukrempeln, und ich wehre mich nicht. »Da, seht. Eine Einstichstelle«, ruft er.
»Das ist ein Muttermal!«
Philomena und Knoblauchmann tasten weiter an meinem Arm herum, während ich wie betäubt eine Taube anstarre, die an einem verrottenden Döner herumpickt.
William erscheint in meinem Sichtfeld und wedelt mit der Hand vor meiner Nase herum, bevor er mich vorsichtig zu der Bank in der Bushaltestelle führt.
Er spricht in sein Handy. »Nun, ich weiß nicht, was ich mit ihr tun soll. Sie hat behauptet, mich zu kennen, und jetzt starrt sie eine Taube an. Nein, sie ist keine Vogelkundlerin. Ja, ich bin mir sicher! Zum Beispiel, weil sie kein Fernglas dabeihat. Weißt du was, David, vergiss, dass ich angerufen habe. Danke für deine Hilfe.«
Während ich sitze, knurrt mein Magen, und welch bizarre Schockstarre auch immer mich in ihrem Griff hatte, löst sich allmählich. Hunger und ein Kater. Denen hab ich das alles hier zu verdanken. Doch anstatt dass ich versuche, das William zu erklären, der mit dem Fuß stampft, während er seinen Beziehungskrach mit seinem Mann hat, beschließe ich, die Beine in die Hand zu nehmen, solange er mir den Rücken zudreht.
Ich erreiche mein Restaurant – was mal mein Restaurant war – und verschwinde aus der Sicht der Leute, die glauben, ich wäre high. An der Tür hängt ein Schild: GESCHLOSSEN. Innen sieht es genau so aus wie an dem Tag, als die Maklerin mich und Henry herumgeführt hat. Holztische, Plastikdecken, das Menü mit Kreide auf einer Tafel, die über die ganze Länge der Wand geht.
Vielleicht ist die Bank früher in den Laden gekommen, und der neue Pächter hat ihn in seinen vorherigen Zustand zurückversetzt? Vielleicht wurde er für eine dieser Fernsehsendungen ausgewählt, in denen ein Geschäft in nur zwölf Stunden komplett renoviert wird? Ich schnuppere, ob ich frische Farbe rieche, aber da ist nur der durchdringende Duft von Frittenfett. Ich lege eine Hand aufs Fenster, um sicherzugehen, dass es sich nicht vor meinen Augen in Luft auflöst, und plötzlich sehe ich mein Spiegelbild. Ich habe dieselben straßenköterblonden Haare, die in geschwungenen Wellen auf meine Schultern fallen, und dieselben blauen Augen. Aber ich sehe immer wieder zu meiner Haut. Leuchtend. Elastisch. Die Ränder unter meinen Augen sind nahezu verschwunden. Das bin ich, aber in besser. So gut habe ich seit Jahren nicht ausgesehen. Verjüngt.
Und meine von der Schwerkraft noch völlig unberührten Brüste sind der letzte Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht richtig ist.
Aber es ist auch nichts wirklich falsch.
Ich erinnere mich an den kleinen Kreis aus Kristallen, den ich gestern Abend errichtet habe: Ein Wunsch, ein Gebet, eine Manifestation … ein Irgendwas, so viel steht fest.
Die Straße hinter mir ist ruhiger geworden. Kein William mehr, kein Passant, den ich mit meiner Durchgeknalltheit irritieren kann. Ich hole mein Handy raus und rufe Sasha an. Sie wird wissen, was zu tun ist.
»Du hast mich gerade vor der schlimmsten Besprechung aller Zeiten gerettet, dafür also schon mal danke«, meldet sie sich. Ich höre, wie sie eine Tür öffnet. »Was gibt’s?«
Ein paar Mal setze ich an und stoppe dann wieder. Wie soll ich meine beste Freundin fragen, ob ich fünf Jahre in der Vergangenheit aufgewacht bin, fünf Jahre jünger, aber mit allen Erinnerungen daran, was aus meiner Sicht in den nächsten fünf Jahren geschieht … ohne völlig verrückt zu klingen? Also frage ich stattdessen etwas Vernünftiges. Etwas, was mir in der Sekunde in den Sinn kam, als sie ans Handy ging.
»Sasha. Heute Abend. Diese Party. Für wen genau catere ich?«
»Allie Saunders. Sie ist frisch hierhergezogen und hat die halbe Firma bei sich für Drinks eingeladen. Das hab ich dir doch schon erzählt. Bitte sag mir nicht, dass du einen Rückzieher machst.«
»Nein« ist alles, was ich rauskriege, als mir der Schock unter die Haut fährt. Nein, ich mache keinen Rückzieher. Nein, das passiert nicht wirklich. Nein, es kann nicht Allie sein, denn die ist schon vor fünf Jahren hierhergezogen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der letzte Mensch auf der Welt wäre, den sie bitten würde, ihr Event zu catern …
»Hör zu«, sagt Sasha. »Die letzten Monate waren hart. Ich weiß, dass du im Augenblick neben dir stehst, aber Liebling, langsam machst du mir wirklich Angst.«
»Ich mache mir selbst Angst«, erwidere ich.
»Ich muss wieder rein. Ich weiß, du hast gesagt, dass du heute Abend mit dem Essen richtig auf die Kacke hauen willst, um damit ein paar Empfehlungen zu kriegen, aber vielleicht lässt du es locker angehen, okay? Ein paar Schnittchen reichen völlig. Halte dein Stressniveau unten. Heute ist dein fünfundzwanzigster Geburtstag. Versuch, den Tag zu genießen, und wir sehen uns nachher.«




























