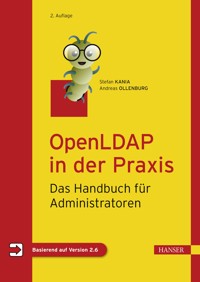
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Dieses Buch unterstützt Sie beim Einsatz von OpenLDAP in Ihrem Netzwerk – egal, ob Sie OpenLDAP das erste Mal einrichten oder von einer älteren Version migrieren. - Alle Kapitel bauen aufeinander auf, so dass Sie in der Lage sind, eine komplette OpenLDAP-Umgebung mit Kerberos einzurichten. Sie können aber auch einzelne Kapitel nutzen, um Ihre bestehende LDAP-Infrastruktur zu erweitern. - Besonders zu den Themen ACLs, Replikation und Kerberos finden Sie neben den Grundlagen auch Beispiele zu den Vorgehensweisen. - Neben der klassischen Installation wird auf die Einrichtung von OpenLDAP in Docker-Containern eingegangen. Zudem finden Sie einen Ausblick auf Kubernetes. - Mit allen Listings und Skripten zum Download. - basierend auf Version 2.6 - Ihr exklusiver Vorteil: E-Book inside beim Kauf des gedruckten Buches Dieses Buch bietet eine ausführliche Beschreibung von der Installation eines einzelnen OpenLDAP-Servers bis hin zu einer Multi-Provider-Replikation und der Einbindung von Kerberos, und Sie erfahren, wie Sie den Funktionsumfang Ihres LDAP-Servers durch Overlays erweitern und performanter gestalten können. Alle Schritte auf dem Weg zu einer redundanten OpenLDAP-Struktur werden genau beschrieben. Das Hauptaugenmerk bei der Verwaltung liegt auf der Kommandozeile. Zusätzlich wird der LDAP Account Manager (LAM) als grafisches Werkzeug vorgestellt. Das Buch unterstützt Sie auch bei der Umstellung von OpenLDAP 2.4 auf OpenLDAP 2.6. In einem eigenen Kapitel gehen wir auf das Thema Monitoring ein, denn ein Dienst wie LDAP sollte nie ohne Überwachung bleiben. In dieser Auflage wird nur noch die Konfiguration über cn=config beschrieben. Die folgenden Inhalte sind komplett neu in dieser Auflage: - Einrichtung von Referrals - Zwei Faktoren Authentifizierung - Das Overlay autoca zur automatischen Erstellung von Clientzertifikaten - Einrichtung des OpenLDAP via Ansible AUS DEM INHALT - Installation der benötigten Pakete - Verwaltung des OpenLDAP über cn=config - Erstellen eigener Schemata - Einstieg nach der Installation der Pakete - Erste Objekte im LDAP-Baum - Verschlüsselung der Verbindung über TLS und LDAPS - Einrichtung des sssd als LDAP-Client - Einsatz von Filtern - Absichern des Baums durch ACLs - Verwendung von Overlays zur Funktionserweiterung - Replikation des LDAP-Baums - Einsatz von Referrals - OpenLDAP mit Docker und Kubernetes - OpenLDAP als LDAP-Proxy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefan KaniaAndreas Ollenburg
OpenLDAP in der Praxis
Das Handbuch für Administratoren
2., aktualisierte Auflage
Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!
Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial.
Geben Sie auf plus.hanser-fachbuch.de einfach diesen Code ein:
plus-Kre7f-B34mb
Die Autoren:Stefan Kania, St. MichaelisdonnAndreas Ollenburg, Dörentrup
Alle in diesem Werk enthaltenen Informationen, Verfahren und Darstellungen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Werk enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autoren und Verlag übernehmen infolgedessen keine juristischeVerantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autoren und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt also auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.Die endgültige Entscheidung über die Eignung der Informationen für die vorgesehene Verwendung in einer bestimmten Anwendung liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2023 Carl Hanser Verlag München, http://www.hanser-fachbuch.deLektorat: Brigitte Bauer-SchiewekCopy editing: Jürgen Dubau, Freiburg/ElbeLayout: le-tex publishing services GmbHUmschlagdesign: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, MünchenUmschlagrealisation: Max KostopoulosTitelmotiv: © Max Kostopoulos
Print-ISBN: 978-3-446-47795-7E-Book-ISBN: 978-3-446-47835-0E-Pub-ISBN: 978-3-446-47965-4
Inhalt
Titelei
Impressum
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Formales
1.2 Schriftarten
1.2.1 Eingabe langer Befehle
1.2.2 Screenshots
1.2.3 Internetverweise
1.2.4 Icons
1.3 Linux-Distributionen.
1.4 Downloads zum Buch
1.5 OpenLDAP-Version
1.6 Konfigurationsarten
2 LDAP-Grundlagen
2.1 Grundlagen zum Protokoll
2.1.1 Der Einsatz von LDAP im Netzwerk
2.1.2 Das LDAP-Datenmodell
2.1.3 Attribute
2.1.4 Objektklassen
2.1.5 Objekte
2.1.6 Schema
2.1.7 Umwandeln eines Schemas in ein LDIF
2.1.8 Das LDIF-Format.
2.1.9 Aufbau einer Struktur
2.1.10 Namensfindung
3 Installation des ersten OpenLDAP
3.0.1 Die statische Konfiguration
3.0.2 Die dynamische Konfiguration.
3.1 Installation der Symas-Pakete
3.1.1 Die Datei ldap.conf
3.1.2 Erste Änderungen an der Konfiguration
3.2 Einspielen der ersten Objekte
4 Einrichten von TLS
4.1 Erstellen der Zertifikate am Beispiel von Debian.
4.2 TLS vs. LDAPS
5 Client-Anbindung mit sssd
5.1 Was bietet der sssd?.
5.2 Installation und Konfiguration.
5.3 Abfrage der Benutzer und Gruppen
5.3.1 SRV-Records im DNS
6 Erste Schritte in der Objektverwaltung
6.1 Anlegen neuer Objekte
6.1.1 Anlegen von Organizational Units (OUs)
6.1.2 Anlegen von Benutzern und Gruppen
6.2 Ändern von Attributen
6.3 Der neue Administrator
6.4 Änderungen direkt in der Datenbank
7 Grafische Werkzeuge
7.1 Webbasierte Werkzeuge.
7.1.1 Installation und Einrichtung des LAM
7.2 Lokale grafische Werkzeuge
7.2.1 Installation und Einrichtung des Apache Directory Studio
8 LDAP-Filter
8.1 Arten von Filtern
8.1.1 Beispiele zu einfachen Filtern
8.1.2 Beispiel zu erweiterten Filtern
8.2 Sonderzeichen in Attributen
9 Berechtigungen mit ACLs
9.1 Grundlegendes zu ACLs.
9.1.1 Aufbau einer ACL.
9.1.2 Die Berechtigungen
9.1.3 Die Privilegien
9.1.4 Erste Schritte mit ACLs
9.1.4.1 Neue Position für eine ACL
9.1.4.2 Löschen von ACLs
9.1.4.3 ACLs mit Filtern
9.1.5 ACL und grafische Werkzeuge
9.1.6 Rechte für den LDAP-Admin
9.2 ACLs in der Praxis
9.2.1 Rechte an der eigenen Abteilung.
9.2.2 Rechte für Gruppen
9.2.3 Rechte für ein simpleSecurityObject
9.2.4 ACLs mit regulären Ausdrücken.
9.2.5 ACLs mit Filtern in der Praxis.
9.2.6 Filtern aufgrund von Hostinformationen.
9.2.7 ACLs auf Grund von ssf
9.2.8 ACLs mit set
9.2.8.1 Alle ACLs
9.2.9 Prüfen von ACLs
10 Erweiterte Funktionen durch Overlays
10.1 Datenaufbereitung
10.1.1 translucent
10.1.2 valsort
10.1.3 deref
10.1.3.1 Einrichtung von deref
10.1.3.2 Verwenden von dereferenzierten Suchen
10.2 Datenmanipulation
10.2.1 memberOf.
10.2.2 dynlist
10.2.2.1 Dynamische Gruppen.
10.2.3 refint
10.2.4 unique
10.2.5 constraint
10.2.6 dds.
10.3 Zusatzfunktionen
10.3.1 Vorabbemerkungen zur Protokollierung.
10.3.2 accesslog
10.3.3 auditlog
10.3.4 ppolicy
10.3.4.1 Komplexere Kennwortrichtlinien.
10.3.5 autoca.
10.3.5.1 Einrichtung von autoca
10.3.5.2 Automatische Erzeugung von Schlüsselmaterial
10.3.6 homedir
10.3.6.1 Einrichten des Overlays homedir
10.3.7 otp
10.3.7.1 Serverseitige Einrichtung von otp
10.3.7.2 Definition der Vorgaben für die OTP-Authentifizierung
10.3.7.3 Einrichten von OTP für die Benutzer per Skript
10.3.7.4 Einrichten von OTP für die Benutzer über LAM SelfService
10.3.8 remoteauth.
10.3.8.1 Einrichtung von remoteauth
10.3.9 syncprov
10.3.10 variant
10.3.10.1 Einrichten mit einfachen Werten
10.3.10.2 Einrichtung mit regex
11 Dynamische Posix-Gruppen
11.1 Anpassungen am OpenLDAP-Verzeichnis
11.1.1 Einrichten der dynamischen Posix-Gruppen
11.2 Anpassung des Clients
12 Replikation des OpenLDAP-Baums
12.1 Grundlagen zur Replikation
12.1.1 Change Sequence Number
12.1.2 Zeitsynchronisation
12.1.3 Serverrollen
12.1.4 Replikationsumfang
12.2 Replikationsmethoden.
12.2.1 LDAP Synchronization Replication – Die vollständige Replikation
12.2.2 refreshOnly
12.2.3 refreshAndPersist
12.2.3.1 Einrichtung
12.2.4 Zwischenstopp
12.2.5 DeltaSync.
12.2.5.1 Einrichtung
12.2.6 Zusammenfassung und Ergänzung.
12.3 Schreiben auf dem Consumer
12.4 Replikationstopologien
12.4.1 Standby-Provider oder Mirror-Mode
12.4.2 Vorbereitung der Replikation
12.4.3 Einrichtung der Replikation cn=config
12.4.4 Einrichtung der Replikation der Objektdatenbank.
12.5 Consumer mit eingeschränkter Replikation
12.5.1 Einschränkungen über ACLs einrichten
12.5.2 Einschränkungen über Filter einrichten
12.5.3 Überprüfung der Replikation mit slapd-watcher
12.5.4 Troubleshooting mit CSN
13 Loadbalancer mit lloadd
13.1 Übersicht über lload.
13.1.1 Funktionsweise von lload
13.1.2 Voraussetzungen
13.2 Vorbereitungen für lload
13.2.1 Proxy-Authentifizierung.
13.2.2 Erstellen des Proxy-Benutzers
13.2.3 Rechte für den Proxy-Benutzer
13.3 Einrichten des Loadbalancers
13.3.1 Modul
13.3.2 Backend
13.3.3 Tier
13.3.4 Schreiboperationen.
14 OpenLDAP als Proxy
14.1 Einrichtung eines einfachen LDAP-Proxy
14.1.1 Einrichtung des LDAP-Proxy
14.1.1.1 Das Rewriting bestimmter Attribute
14.1.1.2 Das Caching bestimmter Suchanfragen
14.1.1.3 Testen des Caches.
14.2 Einrichtung eines meta-Proxyservers
15 OpenLDAP mit Kerberos
15.1 Funktionsweise von Kerberos
15.1.1 Einstufiges Kerberos-Verfahren
15.1.2 Zweistufiges Kerberos-Verfahren
15.2 Installation und Konfiguration des Kerberos-Servers
15.2.1 Konfiguration des ersten Kerberos-Servers.
15.2.2 Initialisierung und Testen des Kerberos-Servers.
15.2.3 Verwalten der Principals
15.3 Kerberos und PAM.
15.3.0.1 PAM-Konfiguration unter Redhat
15.3.1 Testen der Anmeldung
15.4 Hosts und Dienste
15.4.1 Entfernen von Einträgen
15.5 Konfiguration des Kerberos-Clients
15.5.1 PAM und Kerberos auf dem Client
15.6 Replikation des Kerberos-Servers
15.6.1 Bekanntmachung aller KDCs im Netz.
15.6.1.1 Bekanntmachung aller KDCs über die Datei krb5.conf
15.6.1.2 Bekanntmachung aller KDCs über SRV-Einträge im DNS
15.6.2 Konfiguration des KDC-Masters
15.6.3 Konfiguration des KDC-Slaves
15.6.4 Replikation des KDC-Masters auf den KDC-Slave
15.7 Kerberos Policies
15.8 Kerberos im LDAP einbinden
15.8.1 Vorbereitung des LDAP-Servers
15.8.2 Konfiguration des LDAP-Servers
15.8.3 Umstellung des Kerberos-Servers.
15.8.4 Zurücksichern der alten Datenbank.
15.8.5 Erstellung der Keys für den LDAP-Server
15.8.6 Bestehende LDAP-Benutzer um Kerberos-Principal erweitern
15.9 Neue Benutzer im LDAP
15.10 Authentifizierung am LDAP-Server über GSSAPI
15.10.1 Einrichtung der Authentifizierung.
15.10.2 Der sssd mit GSSAPI
15.10.3 Anbinden des zweiten KDCs an den LDAP
15.10.4 Replikation mit Kerberos absichern
15.10.5 Vorbereitung des zweiten LDAP-Servers
15.10.6 Einrichtung von k5start
15.10.7 Umstellung der Replikation auf GSSAPI
15.11 Konfiguration des LAM-Pro
15.11.1 Vorbereitung des Webservers
15.11.2 Konfiguration des LAM.
16 Einrichtung von Referrals
16.0.1 Namensauflösung.
16.0.2 Einrichtung
16.1 Einrichtung ohne Chaining
16.1.1 Konfiguration des Hauptnamensraums
16.1.2 Einrichten der untergeordneten Datenbank
16.1.3 Testen der Referrals
16.1.3.1 Was macht der sssd?
16.2 Einrichtung mit Chaining
16.2.1 Einrichtung der untergeordneten Datenbank
16.2.2 Konfiguration der Server
16.2.3 Erste Tests
16.2.4 Das Overlay chain
16.2.4.1 Auf dem Hauptnamensraum.
16.2.5 Der sssd Zugriff
16.2.5.1 Im Hauptnamensraum.
17 Monitoring mit Munin
17.1 Warum Monitoring?
17.2 cn=monitor
17.3 Munin
17.3.1 Munin-Server
17.3.2 Knoten
17.3.3 OpenLDAP-Daten
17.3.4 Überwachung des Loadbalancers
17.4 Andere Monitoring-Systeme
18 OpenLDAP im Container
18.1 Docker.
18.1.1 Einrichtung des Docker-Servers
18.1.2 Der erste Container
18.2 OpenLDAP
18.2.1 Netzwerken
18.2.2 Datenpersistenz
18.2.3 Compose
18.2.4 Ausblick.
18.3 Image im Eigenbau
18.3.1 Der Build-Prozess
18.3.2 Das Dockerfile
18.3.3 Testen des Images
18.3.4 Ausblick.
18.4 Kubernetes.
18.4.1 minikube
18.4.1.1 Einrichtung unter Debian
18.4.1.2 Die Kommandozeile
18.4.1.3 Das Dashboard
18.4.2 Registry
18.4.3 Namespace.
18.4.4 Volume.
18.4.5 Deployment
18.4.6 Ausblick.
19 OpenLDAP einrichten mit Ansible
19.1 Rolle zur Vorbereitung
19.2 Die Rolle zur Einrichtung von OpenLDAP
19.2.1 Vorbereitung für TLS.
19.2.2 Die Templates.
19.2.2.1 provider_main_config.j2
19.2.2.2 first-objects.j2
19.2.2.3 main_db_repl.j2
19.2.2.4 repl_config.j2
19.2.2.5 symas-openldap-default.j2
19.2.3 Die Tasks
19.2.4 Einspielen der Rolle
20 Beispiele aus der Praxis
20.1 Weitere Datenbanken einrichten
20.1.1 Zweite Datenbank einrichten
20.1.2 Anlegen der ersten Objekte
20.2 Ssh mit Kerberos und LDAP
20.3 Der sssd und Gruppen
20.4 Public Keys im LDAP
20.4.0.1 Anpassen des ssh-Servers
20.5 LDAP-Authentifizierung für den Apache-Webserver
Herzlich willkommen bei der zweiten Auflage unseres OpenLDAP-Buchs. Es ist endlich soweit, die lange erwartete neue Version von OpenLDAP ist erschienen. Okay, das war schon im Mai 2021, aber bis die Pakete verfügbar waren und die ersten Versionen ihre Kinderkrankheiten durchlaufen haben, wollten wir mit der neuen Auflage warten.
Was Sie hier in der Hand halten, ist eine komplett neu überarbeitete Auflage mit vielen Neuerungen und Erweiterungen. Wer von Ihnen die erste Auflage kennt, wird feststellen, dass gut 100 Seiten dazugekommen sind, und das, obwohl wir alles, was die statische Konfiguration betrifft, aus dem Buch entfernt haben. Wir haben uns ausschließlich auf die dynamische Konfiguration beschränkt. Warum? Einige Funktionen wie zum Beispiel die neu überarbeitete Replikation machen mit der statischen Konfiguration einfach keinen Sinn mehr – im Gegenteil: Sie schränkt dort an einigen Stellen sogar ein.
Es gibt auch neue Kapitel, die zwar von der Thematik her nicht unbedingt neu sind, aber doch überarbeitet wurden. Dazu gehören die Themen OpenLDAP-Proxy, Einrichtung von Referrals, Einrichtung von OpenLDAP über Ansible und last but not least das neue Modul lloadd, was aus einem OpenLDAP-Server einen Loadbalancer speziell für OpenLDAP bereitstellen kann.
Das Kapitel der ACLs wurde auch gründlich überarbeitet und um das Thema sets erweitert. Auch das Thema Sicherheit spielt wieder eine große Rolle. Wie schon in der ersten Auflage haben wir auch dieses Mal wieder ein ausführliches Kapitel zum Thema Kerberos im Buch, bei Kerberos selbst hat sich nicht so viel getan, aber wir haben die Konfiguration noch etwas genauer erklärt.
Wir verwenden im Buch ausschließlich den neuen Passwordhash ARGON2 und erklären auch, wie Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit OpenLDAP realisieren können.
Mit der neuen Version ist noch die Möglichkeit der automatischen Erstellung von Client-Zertifikaten für Benutzer und Hosts als neue Funktion vorhanden, auch das ist Thema dieser Auflage.
Wie bei anderen Fachbüchern auch lebt eine neue Auflage auch von konstruktivem Feedback der Leser. Auch wir haben davon profitiert.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem Buch helfen können, einen guten Einstieg zu bekommen oder eine bestehende alte Installation auf den aktuellen Stand zu bringen. Für uns war es wieder wichtig, dass Sie die einzelnen Beispiele auch praktisch nachvollziehen können.
Alle LDIF-Dateien und Konfigurationen erhalten Sie auf
https://www.kania-online.de/wp-content/uploads/2023/04/listings.zip
oder auf der Downloadseite des Verlages: Geben Sie dazu unter
https://plus.hanser-fachbuch.de
den Code plus-Kre7f-B34mb ein.
Vorwort von Stefan KaniaIch schreibe jetzt schon seit über zehn Jahren Fachbücher. Angefangen hat alles mit dem Linux-Server-Buch. In dem Buch habe ich auch die beiden Kapitel zum Thema OpenLDAP und Kerberos verfasst. Fast genauso lange habe ich immer wieder überlegt, ein Buch nur zum Thema OpenLDAP zu schreiben, in dem ich alle meine Erfahrungen zusammenfassen kann und genügend Platz habe, alle meine Ideen umzusetzen. Das habe ich dann, zusammen mit Andreas, 2020 auch umgesetzt. Uns war klar, dass es erst eine zweite Auflage geben kann, wenn eine neue OpenLDAP-Version erschienen und stabil ist. So war ich dann auch Feuer und Flamme und konnte auch Andreas wieder überreden, eine neue Auflage zu schreiben. Ich hätte gerne noch früher damit angefangen, aber dann habe ich doch etwas auf die Bremse getreten, um die neue Version etwas genauer zu testen.
Danksagungen
Danken möchte ich natürlich wieder Andreas, dass er sich hat breitschlagen lassen, noch einmal mit mir ein Buch zu veröffentlichen. Danke auch an den Hanser Verlag für das Vertrauen und die Unterstützung.
Vieles, was wir in diesem Buch erklären, habe ich bei einem langjährigen Kunden schon sehr früh geplant und umgesetzt und konnte so noch schneller damit beginnen, diese Auflage zu erstellen. Für das Vertrauen möchte ich auch meinen Dank in diese Richtung senden. Wenn ich jetzt „Danke, Andreas“ sage, ist damit nicht mein Co-Autor gemeint, sondern der Verantwortliche für die Umstellung beim Kunden.
Vorwort von Andreas OllenburgIch war lange Jahre als Trainer und Consulter für SUSE-, Novell- und Microsoft-Produkte auf Achse. Dadurch war das Thema „Verzeichnisdienst“ vor allem durch die Arbeit mit dem liebgewonnenen NDS/eDirectory, aber auch mit Active Directory, X.500- und eben auch OpenLDAP-Verzeichnissen immer präsent und entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem meiner Schwerpunkte. Auf meine Zertifizierung zum „Certified Directory Engineer“ von Novell (die Älteren unter uns werden sich erinnern) bin ich auch heute noch ein bisschen stolz.
Nach wie vor ist es hinsichtlich OpenLDAP nicht immer einfach, einheitliche Dokumentationen zu finden. Als wir uns 2019 in Berlin wieder einmal trafen und Stefan mir dieses Buchprojekt zum ersten Mal vorstellte, wurde ich daher schnell hellhörig. Bis er mich dann aber soweit hatte, dass ich mich mit ihm an ein Buch wagen wollte, bedurfte es dann tatsächlich noch etwas Überzeugungsarbeit – nebst dem gemeinsamen Genuss geistvoller Getränke. Aber ich war dann doch froh, mich von Stefan habe überreden zu lassen.
Und jetzt geht unser gemeinsames Erstlingswerk also in die zweite Runde. Als Stefan sich Ende 2022 bei mir meldete und mir eine neue Auflage des Buches schmackhaft machte, konnte ich nicht Nein sagen. Denn wer Stefan kennt, der weiß, wie charmant überzeugend er sein kann. Und was soll man auch sonst an langen und dunklen Winterabenden Besseres tun?
Danksagungen
Mein erster Dank geht natürlich an Stefan. Die Zusammenarbeit hat wieder mal hundertprozentig geklappt und wie immer Spaß gemacht. Darüber hinaus hatte er immer wieder wertvolle Tipps, und wir konnten gemeinsam viele gute Ideen entwickeln. Die Anzahl unserer grauen Haare hat sich wahrscheinlich wieder etwas vergrößert, aber das war es wieder wert.
Bezogen auf den Hanser Verlag kann ich mich Stefans Worten nur anschließen.
Der größte Dank geht aber auch dieses Mal wieder an die drei wertvollsten Menschen in meinem Leben: der besten Ehefrau von allen – auch wenn sie dabei wieder mit den Augen rollt – und unsere beiden großartigen, ebenfalls natürlich besten Kinder. Das Schreiben hat den Dreien wieder einiges an Geduld und Rücksicht abgefordert. Und wenn es mal wieder so gar nicht laufen wollte, wenn sich z.B. ein Fehler im Satzprogramm versteckt hatte oder ich das fehlende Leerzeichen in einer Konfiguration nicht finden konnte, haben sie wieder viel Geduld aufgebracht, mir den Rücken freigehalten oder mich motiviert. Daher also auch diesmal wieder: „Danke, ihr Drei, was wäre ich ohne Euch?“
An dieser Stelle möchten wir Ihnen die verschiedenen Formatierungsmöglichkeiten und Administrationsarten erklären. Hier finden Sie auch die Beschreibung zu den im Buch verwendeten Icons, Distributionen und OpenLDAP-Versionen.
1.1FormalesDamit Sie den größtmöglichen Nutzen aus diesem Buch ziehen können, sollen im Folgenden einige Konventionen erläutert werden.
Kommandozeile vs. grafische Administration
An den meisten Stellen im Buch verwenden wir die Kommandozeile, um die Dienste zu konfigurieren oder zu testen, aber auch die Maus kommt zum Einsatz, um Ihnen auch eine unterschiedliche Auswahl an grafischen Werkzeugen zu zeigen.
In diesem Buch geht es um OpenLDAP und die Verwaltung und Einrichtung des Dienstes, aber auch dem Thema Kerberos ist ein großes Kapitel gewidmet, denn LDAP erhöht zusammen mit Kerberos die Sicherheit Ihrer Umgebung.
1.2SchriftartenViele der Beispiele zu den Kommandos werden in Listings dargestellt. In den Listings werden Sie von der Befehlszeile bis zum Ergebnis alles nachvollziehen können, wie Sie hier im Beispiel sehen:
Listing 1.1 Ein Test-Listing
stefan@samba4~\$ ps PID TTY TIME CMD 4008 pts/2 00:00:00 bash 4025 pts/2 00:00:00 ps
Um Kommandos, Dateinamen und Konfigurationen im Text besser hervorzuheben, werden die folgenden Schriftarten verwendet:
Um bestimmte Begriffe hervorzuheben, werden sie schief geschrieben.
Für die Darstellung von Tastenkombinationen und Klicks auf bestimmte Symbole oder Karteireiter in der grafischen Oberfläche werden KAPITÄLCHEN verwendet.
Wenn im Text der Hinweis auf eine Datei gegeben wird, werden wir die Schriftart Sans Serif verwenden.
Im Fließtext werden Konsolenbefehle mit der Schrift Schreibmaschine geschrieben.
Parameter und Werte aus Listings werden durch die Verwendung von Kursivschrift gekennzeichnet.
1.2.1Eingabe langer BefehleEs gibt noch eine weitere wichtige, eher technische Konvention: Einige der vorgestellten Kommandozeilenbefehle oder Ausgaben von Ergebnissen erstrecken sich über mehrere Buchzeilen. Im Buch kennzeichnet am Ende der entsprechenden Zeilen ein „\“, dass der Befehl oder die Ausgabe in der nächsten Zeile weitergeht. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie Kommandos aus dem Buch abtippen.
1.2.2ScreenshotsDie Verwendung von Screenshots zur Erhellung von Sachverhalten werden wir im Laufe des Buches gezielt einsetzen. Oft geht es darum, Hierarchien besser darstellen zu können oder die Verwendung von grafischen Werkzeugen zu verdeutlichen.
1.2.3InternetverweiseAn einigen Stellen werden wir auf bestimmte URLs verweisen – sei es, um Ihnen Quellen für bestimmte Downloads zu geben, oder um Ihnen den Weg zu tiefer gehenden und weiterführenden Erklärungen zu geben, die den Rahmen dieses Buches sprengen würden. Verweise auf Internetadressen werden immer vollständig angegeben, zum Beispiel so: https://www.openldap.org.
1.2.4IconsSie werden in den einzelnen Kapiteln am Rand oft Icons finden, die Sie auf bestimmte Zusammenhänge oder Besonderheiten hinweisen sollen. Die Icons haben die folgenden Bedeutungen:
Wichtig: Wann immer Sie das nebenstehende Symbol sehen, ist Vorsicht angeraten: Hier weisen wir auf besonders kritische Einstellungen hin oder auf Fehler, die dazu führen können, dass das System nicht mehr stabil läuft. Damit sich die Warnungen mehr vom übrigen Text abheben, werden diese Textbereiche dann noch mit einem grauen Kasten hinterlegt.
Hinweis: Alle Textstellen mit diesem Icon sollten Sie unbedingt lesen! Hier handelt es sich oft um wichtige Hinweise, die Sie nicht außer Acht lassen sollten.
Tipp: Bei diesem Symbol finden Sie nützliche Tipps und Tricks zu bestimmten Aufgaben.
Für die Verwendung von OpenLDAP ist es nicht sehr relevant, welche Distribution Sie einsetzen. Da wir aber nicht die Pakete aus den Distributionen einsetzen (denn die basieren meist noch auf OpenLDAP 2.4), spielen auch unterschiedliche Pfade auf unterschiedlichen Distributionen keine Rolle mehr. Wir werden ausschließlich die Pakete der Firma Symas einsetzen, da nur diese Pakete immer aktuell sind. Warum die Pakete der Firma Symas? Die Entwickler vom OpenLDAP haben diese Firma gegründet und stellen somit auch immer die aktuellsten Pakete bereit. Egal welche Distribution Sie einsetzen, die Symas-Pakete installieren sich immer in das Verzeichnis /opt. Ein Unterschied besteht nur in der eigentlichen Installation der Pakete.
Beim Thema Kerberos werden wir Debian 11 einsetzen. Da sich zu den Redhat-basierten Distributionen der Pfad zu den Konfigurationsdateien ändert, werden wir an der Stelle auf die unterschiedlichen Pfade hinweisen. Aber auch die Funktionsweise von Kerberos ist bei allen Distributionen identisch, sodass die Wahl der Distribution hier auch keine Rolle spielt.
Im Buch werden wir auch auf die Einbindung von Kerberos in OpenLDAP eingehen. Um alle Beispiele für alle Distributionen einheitlich zu halten, werden wir ausschließlich den MIT-Kerberos einsetzen, da Sie diesen, im Gegensatz zum Heimdal-Kerberos, auf allen Distributionen finden.
Ein Hinweis zu Firewalls, SELinux und Apparmor: Wir werden vor der Installation diese Systeme immer deaktivieren, da es in diesem Buch nicht um das Thema Systemsicherheit geht.
1.4Downloads zum BuchAlle hier im Buch verwendeten Listings, LDIF-Dateien und Skripte stellen wir Ihnen unter der URL https://www.kania-online.de/wp-content/uploads/2023/04/listings.zip zur Verfügung.
1.5OpenLDAP-VersionMit der Einführung der neuen OpenLDAP-Version gibt es jetzt zwei verschiedene Zweige, die gepflegt werden. Zum einen ist da die Version 2.5, dabei handelt es sich um eine LTS-Version, die über einen längeren Zeitraum mit Updates versorgt wird, aber nicht alle neu entwickelten Funktionen erhalten wird. Zum anderen gibt es die Version 2.6, die auf der 2.5 aufsetzt, aber immer wieder neue Funktionen bereitstellt. Hier ist es Ihre Entscheidung, welchen Weg Sie gehen wollen. Wir werden hier die Version 2.6 einsetzen. Wir werden versuchen, Sie immer auf die Funktionen hinzuweisen, die nur in der Version 2.6 vorhanden sind. Die Unterschiede finden Sie aber auch immer in den Release Notes zu den Versionen.
1.6KonfigurationsartenOpenLDAP lässt sich auf zwei verschiedene Arten konfigurieren. Da wäre einmal die Möglichkeit über die statische Konfiguration mithilfe der Datei slapd.conf und die Möglichkeit der dynamischen Konfiguration über das eigene Backend cn=config. In der ersten Auflage des Buches haben wir immer beides gezeigt, aber auch schon erwähnt, dass die statische Konfiguration als deprecate gekennzeichnet ist. Aus diesem Grund werden wir hier nur noch auf die dynamische Konfiguration eingehen. Lediglich am Anfang werden wir die Grundkonfiguration über beide Wege erklären, um Ihnen zu zeigen, dass Sie alle Einträge aus der slapd.conf auch im Backend cn=config wiederfinden.
Suchen Sie die Schreibweise für bestimmte Parameter für die dynamische Konfiguration, dann finden Sie eine gute Tabelle, die beide Parameter (statisch) und (dynamisch) gegenüberstellt, unter https://tylersguides.com/guides/openldap-online-configuration-reference/.
Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß mit dem Buch zu wünschen und zu hoffen, dass Ihnen das Buch bei Ihrer täglichen Arbeit eine Hilfe sein wird.
Bevor wir mit der Einrichtung des ersten OpenLDAP-Servers beginnen, wollen wir Ihnen an dieser Stelle ein paar Grundlagen zum Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) vermitteln. Mithilfe dieser Grundlagen ist es für Sie später einfacher, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen, da Sie dann wissen, wie das Protokoll aufgebaut ist und was es bedeutet, wenn über Objects, Attribute und Schemata gesprochen wird.
LDAP ist ursprünglich kein Dienst, sondern wie es die Abkürzung schon sagt, ein Protokoll, das als Proxy zwischen den TCP/IP-Clients und den DAP-Datenbanken auf Großrechnern eingesetzt wurde. Da diese Großrechner nicht das OSI-Referenzmodell für ihre Protokolle verwendet haben, musste für den Zugriff von Clients aus dem TCP/IP-Netzwerk ein Übergang geschaffen werden, um die Zugriffe weiterleiten zu können. Dafür wurde LDAP entwickelt. Im Laufe der Zeit wurde dann ein eigenes Datenbank-Backend für diesen Proxy-Dienst entwickelt, und daraus ist dann der heutige Serverdienst LDAP entstanden.
LDAP ist ein hierarchisch gegliederter Verzeichnisdienst, und mit seiner Hilfe können Sie Ihre Unternehmensstruktur direkt abbilden. Sie können aber genauso eine Struktur erstellen, die verschiedene Ressourcen zusammenfasst. Sie müssen sich auf jeden Fall immer Gedanken über Ihre Struktur machen, denn eine allgemeingültige Struktur für einen LDAP-Baum gibt es nicht. Planen Sie gut, bevor Sie eine neue Struktur aufbauen. Eine genaue Planung kann Ihnen hinterher sehr viele nachträgliche Anpassungen und Änderungen ersparen. Gerade wenn es später darum geht, Berechtigungen für Zugriffe auf Objekte zu geben, ist die Planung der Struktur sehr wichtig. Ohne eine gute Planung kann es später schwer werden, die Berechtigungen mit wenigen einfachen Regeln zu setzen. Gruppieren Sie Ihre Ressourcen so, dass Sie später die einzelnen Bereiche des Baums gezielt mit Rechten für Gruppen und Benutzer vergeben können. Vergleichen können Sie die Struktur in etwa mit der Struktur Ihrer Dateisysteme auf Fileservern.
2.1Grundlagen zum ProtokollDie Entwicklung des Lightweight Directory Access Protocol stammt aus dem Jahr 1993. Es wurde benötigt, um den Zugriff auf DAP-Datenbanken über TCP/IP zu erleichtern. Der ursprüngliche X.500-Standard, der für DAP-Datenbanken verwendet wurde, umfasst alle sieben Ebenen des OSI-Referenzmodells. Das machte eine Implementation auf verschiedene Systeme aufwendig oder gar unmöglich. Aus diesem Grund wurde im Jahre 1993 das Protokoll LDAP entwickelt. Am Anfang wurde es nur verwendet, um auf DAP-Server zugreifen zu können. LDAP diente dabei mehr oder weniger als Proxy, um zwischen X.500 und den verschiedenen Systemen zu vermitteln. Der große Vorteil von LDAP gegenüber einer reinen DAP-Umgebung ist der, dass für LDAP nur ein funktionsfähiger TCP/IP-Protokollstack benötigt wird. Später wurde zu LDAP ein eigenes Datenbank-Backend hinzugefügt, um unabhängig von den DAP-Servern zu werden. Heute wird LDAP in verschiedenen Produkten als Verzeichnisdienst eingesetzt. Dazu gehören unter anderem Microsoft Active Directory, OpenLDAP oder der 389 Directory Server von Red Hat.
Wie schon erwähnt, handelt es sich bei LDAP um einen Verzeichnisdienst. Ein Verzeichnisdienst zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
Die Administration kann auf verschiedene Bereiche aufgeteilt werden.
Die gesamte Unternehmensstruktur kann 1:1 im Verzeichnis abgebildet werden.
Durch eine Partitionierung kann die Struktur auf mehrere Server verteilt werden.
Für die Suche nach bestimmten Objekten im Verzeichnis können Sie mehr oder weniger komplexe Filter einsetzen, die die Suche auf bestimmte Teilbereiche des Verzeichnisses einschränken und dadurch die Suche beschleunigen.
Da LDAP auf X.500 basiert, wird hier ein objektorientiertes Datenmodell verwendet. Dadurch ist eine Vererbung von Eigenschaften auf andere Objekte möglich.
Für alle Verzeichnisdienste existiert der X.500-Standard der ITU-T der internationalen Fernmeldeunion https://www.itu.int. Diese Standards beschreiben, wie Verzeichnisdaten zur Verfügung gestellt und abgerufen werden und wie die Verschlüsselung, Authentifizierung, Replikation und Verwaltung der Verzeichnisdaten gehandhabt werden. Die X.500-Standards liefern die Funktionsmodelle und Begriffsbestimmungen für die Verzeichnisdienste, die nicht voll auf dem X.500-Standard basieren, was bei LDAP der Fall ist.
Im Laufe seiner Entwicklung wurde LDAP immer weiterentwickelt, und die aktuelle Version von LDAP ist die Version 3. Verwechseln Sie die LDAP-Version nicht mit der Version der Produkte wie zum Beispiel OpenLDAP Version 2.6. Die Versionsnummer 2.6 bezieht sich hier auf die Version der Software und nicht auf die Version des Protokolls. Die aktuelle Version 3 von LDAP hat gegenüber der Version 2 die folgenden Vorteile:
Authentifizierung durch Verwendung von SASL für die Verschlüsselung der Passwörter. Hier wird heute hauptsächlich Kerberos eingesetzt. Im Buch wird es dazu ein eigenes Kapitel geben.
Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs im Netz durch TLS.
Möglichkeit der Verwendung von UTF-8 für Attribute.
Verweise auf andere LDAP-Server, die Referrals. Dadurch können Ressourcen in mehreren Bäumen gemeinsam genutzt, aber getrennt administriert werden.
Sollten Sie heute noch alte LDAPv2-Server im Netz finden, können Sie diese nicht mit LD-APv3-Servern replizieren, da die beiden Protokolle nicht kompatibel zueinander sind. Es ist aber immer noch möglich, ältere Software, die nur mit LDAPv2-Client-Software ausgestattet ist, mit einem LDAPv3-Server zu verbinden. Wie lange das noch möglich ist, bleibt aber fraglich. Sollten Sie noch Software nutzen, die einen alten LDAPv2-Client nutzt, sollten Sie diese möglichst bald aktualisieren.
2.1.1Der Einsatz von LDAP im NetzwerkSie können LDAP auf verschiedene Arten in Ihrem Netzwerk für die Verwaltung einsetzen. Aber erst zusammen mit Kerberos ist es auch möglich, ein Single Sign-on im Netzwerk zu realisieren. Ohne Kerberos können Sie lediglich eine zentrale Benutzerverwaltung aufbauen, die Ihre Anwender dann für die Anmeldung an verschiedenen Diensten nutzen können. Aber denken Sie daran: Sämtliche Datenübertragung zwischen einem LDAP-Server und einem LDAP-Client läuft immer erst einmal unverschlüsselt. Erst durch den Einsatz von TLS oder LDAPS werden die Daten sicher übertragen.
An ein LDAP-Verzeichnis können Sie die unterschiedlichsten Dienste anbinden und die Daten des LDAP für unterschiedliche Aufgaben nutzen. In der folgenden Aufzählung finden Sie eine kleine Übersicht der Möglichkeiten:
Verwaltung von Benutzern, Gruppen für Posix-Konten
Verwaltung von Weiterleitungen und Aliasen für den Postfix-Mailserver
Einrichtung der Benutzerauthentifizierung für einen IMAP-Server
Authentifizierung von Benutzern für die Anmeldung bei einem Proxy
Authentifizierung von Benutzern für die Anmeldung am Webserver
2.1.2Das LDAP-DatenmodellDas Datenmodell von LDAP ist objektorientiert, d. h. einzelne Objekte setzen sich aus Objektklassen und Attributen zusammen. Bei LDAP gelten dabei fast die gleichen Regeln wie bei der objektorientierten Programmierung. Auch im LDAP gibt es Vererbung und Polymorphie. Im Gegensatz zur objektorientierten Programmierung wird hier aber sehr viel Gebrauch von der Polymorphie gemacht, sprich ein Objekt besteht aus mehreren Objektklassen. In Bild 2.1 sehen Sie, wie sich ein Objekt aus verschiedenen Objektklassen und Attributen zusammensetzt.
Bild 2.1Aufbau eines Objekts
Die Aufgabe von LDAP ist es, die Objekte abzubilden und miteinander in Beziehung zu bringen. Ein Objekt wird im Verzeichnisbaum als Verzeichniseintrag bezeichnet. Jedes Objekt wird über seinen eindeutigen Namen, den Distinguished Name (dn), im Directory Information Tree (DIT) angelegt, der ähnlich wie der Name einer Datei im Dateisystem behandelt wird. Durch die verschiedenen Objekte entsteht so nach und nach eine Baumstruktur.
Im LDAP-Baum wird zwischen zwei verschiedenen Objektarten unterschieden. Zunächst gibt es die Organizational Unit (OU), bei der es sich um ein Containerobjekt handelt. In diesen Organizational Units können weitere Objekte erzeugt werden. Die OUs werden zum Aufbau der Struktur verwendet. Um noch einmal den Vergleich zum Dateisystem zu ziehen: Eine OU können Sie mit den Verzeichnissen im Dateisystem vergleichen, nur dass eine OU immer auch Attribute besitzt.
Die andere Objektart sind die Blattobjekte, die zum Beispiel mit der Kennzeichnung commonName (cn) oder users ID (uid) im Verzeichnisbaum Verwendung finden. Diese Objekte dienen zur Verwaltung der Ressourcen. Die Bezeichnungen werden aus den verschiedenen Objektklassen und Schemata abgeleitet, auf die wir im Verlauf dieses Kapitels noch weiter eingehen werden. Wie Sie gelesen haben, unterstützt die LDAP-Version 3 auch UTF-8-Zeichen. Sie können also für die Benennung von Objekten und Werten auch Umlaute und Leerzeichen nutzen, wenn Sie Attribute anlegen. Nur werden dann die Attribute BASE64-kodiert im LDAP abgelegt und bei einer Suche mit ldapsearch auch BASE64-kodiert angezeigt. Verwenden Sie anstelle des Attributes cn das Attribut uid für die Benennung Ihrer Benutzer, können Sie den Namen nur so abspeichern, wie es auch unter Unix möglich ist, nämlich ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen. Dann werden Ihnen die Namen der Benutzer auch immer im ASCII-Format angezeigt. Was aber, wenn ein Objekt kein uid-Attribut besitzt? Dann müssen Sie das cn-Attribut verwenden, sollten aber, besonders wenn Sie viel auf der Kommandozeile suchen, auf Leer- und Sonderzeichen verzichten.
Die meisten grafischen Werkzeuge können aber BASE64 direkt umsetzen und lesbar darstellen.
Hinweis: OpenLDAP weist eine Besonderheit auf gegenüber zum Beispiel dem Active Directory. Im OpenLDAP-Baum können Sie unterhalb des Blattobjekts weitere Objekte erzeugen. So ist es möglich, unterhalb eines Benutzers eine weitere OU zu erzeugen, in der dann zum Beispiel das persönliche Adressbuch des Benutzers gespeichert werden kann.
Attribute sind die Eigenschaften von Objekten. Ein Attribut besteht aus einem Namen, mit dem das Attribut innerhalb eines Objekts eindeutig referenziert werden kann, und einem eindeutigen Identifier. Attribute können eine unterschiedliche Anzahl von Werten besitzen. Es gibt Attribute, die nur genau einen Wert haben dürfen, und solche, die mehrere Werte haben können. Um die Wiederverwendbarkeit von Attributen in verschiedenen Objektklassen zu ermöglichen, werden Attribute getrennt von Objekten verwaltet, und zwar in Form von Attributtypen. Der attributetype enthält die Komponenten wie in Listing 2.1:
Listing 2.1 Beispiel für ein Attribut
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.4 NAME ’loginShell’ DESC ’The path to the login shell’ EQUALITY caseExactIA5Match SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )
In der ersten Zeile werden der Object Identifier (OID) und der Name des Attributs angegeben. Beide Werte müssen im gesamten DIT eindeutig sein.
Im Anschluss folgt eine Beschreibung, die frei formuliert werden kann. Danach gibt es die Möglichkeit, die Gleichheit EQUALITY für die Suche nach Attributen festzulegen. Ein Objekt mit dem Attribut loginShell würde nur angezeigt, wenn der Suchbegriff exakt, inklusive der Groß- und Kleinschreibung, übereinstimmt. Im Anschluss folgt noch eine Syntaxbeschreibung in Form eines OID. Alle möglichen OIDs können Sie im RFC 2252 nachlesen. Durch den OID wird festgelegt, um was für eine Art von Objekt es sich hier handelt, zum Beispiel um eine Zahl, eine Zeichenkette oder eine andere Syntax. Neben dem Namen, dem OID und der Beschreibung gibt es bei Attributen noch weitere Eigenschaften, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie die Verwendung planen. Im Beispiel sehen Sie die Zeile, die mit EQUALITY beginnt. Über diese Eigenschaft wird festgelegt, ob bei den zugeordneten Werten die Groß- und Kleinschreibung bei der Suche berücksichtigt wird. Diese Eigenschaft wird als Matching Rules bezeichnet. Alle Matching Rules finden Sie im RFC 4517.
Die nächste Zeile definiert die SYNTAX eines Attributs, dabei wird wieder ein OID verwendet. Die Beschreibung aller OIDs für die SYNTAX finden Sie ebenfalls im RFC 4517. Wenn Sie bei der SYNTAX nicht den zusätzlichen Parameter SINGLE-VALUE angeben, können Sie ein Attribut immer mit mehreren Werten belegen. Nicht bei jedem Attribut macht es Sinn, mehrere Werte zu speichern. Hinter der SYNTAX können Sie noch die maximale Länge des Attributs in geschweiften Klammern angeben. Bei der Länge legen Sie fest, wie viele Zeichen des Werts bei einer Suche geprüft und verglichen werden. Die maximale Länge eines Attributs beträgt 65535 Zeichen. Aber wozu dient die SYNTAX? Über die SYNTAX wird festgelegt, mit welcher Art von Werten die Attribute gefüllt werden können. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein Attribut kann so bestimmt werden, dass Sie nur Integer-Werte eintragen können oder aber Strings oder Bilder. Auch diese Werte sind wieder genau im RFC 4517 definiert.
2.1.4ObjektklassenEine Objektklasse im LDAP ist eine Sammlung von vorher definierten Attributen, die dann für die Zusammenstellung der Objekte verwendet wird. Ein Objekt kann sowohl ein Container, in dem weitere Objekte verwaltet werden, als auch ein Benutzer, eine Gruppe oder eine andere Ressource sein. Eines ist bei allen Objekten aber immer gleich: Alle Objekte bestehen aus einer oder mehreren Objektklassen, diese haben Eigenschaften, die Attribute. Die Attribute unterscheiden sich je nachdem, um welche Art von Objekt es sich handelt.
Es werden hauptsächlich zwei verschiedene Objektklassen verwendet:
STRUCTURAL ObjectClassBei der STRUCTURAL ObjectClass handelt es sich um die Objektklasse, die ein Objekt maßgeblich bestimmt. Man kann sie auch als übergeordnete Objektklasse bezeichnen. Einem Objekt muss immer genau eine STRUCTURAL ObjectClass zugeordnet sein. Ein Austauschen dieser Klasse ist nur sehr schwer möglich. Um einem Objekt eine neue STRUCTURAL ObjectClass geben zu können, werden Sie es im Normalfall neu anlegen.
AUXILIARY ObjectClassDie AUXILIARY ObjectClass können Sie zusätzlich zur STRUCTURAL ObjectClass zu einem Objekt hinzufügen. Sie können auch Objekte später um weitere AUXILIARY ObjectClasses erweitern oder die Klassen auch entfernen. Denken Sie nur daran, dass eine Klasse auch immer Attribute besitzt, die Sie bei einer späteren Änderung auch hinzufügen oder entfernen müssen, wenn Sie eine AUXILIARY ObjectClass von einem Objekt entfernen.
Um einen ersten Eindruck einer Objektklasse zu bekommen, sehen Sie in Listing 2.2 ein Beispiel für eine objectclass. Hier wird auch deutlich, dass bestimmte Attribute vergeben werden müssen, während andere vergeben werden können.
Listing 2.2 Beispiel für eine Objektklasse
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME ’posixAccount’ SUP top AUXILIARY DESC ’Abstraction of an account with POSIX attributes’ MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory ) MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ) )
Objekte bilden die Ressourcen in Ihrem Verzeichnisbaum ab. Alle Objekte in Ihrem Verzeichnisbaum benötigen einen eindeutigen Namen. Das Attribut, das zur eindeutigen Adressierung des Objekts verwendet wird, ist in den meisten Fällen der commonName eines Objekts. Über dieses Attribut wird das Objekt im Verzeichnisbaum verwaltet.
Ein Objekt kann für die Verwaltung der unterschiedlichsten Aufgaben verwendet werden. Für jede Aufgabe benötigt ein Objekt unterschiedliche Attribute, deshalb kann ein Objekt auch aus mehreren Objektklassen zusammengestellt werden. Wenn zum Beispiel für einen Benutzer ein Objekt erstellt werden soll, das für die Anmeldung an einem UNIX-System benötigt wird, muss dem Objekt die Objektklasse posixAccount zugeordnet werden, da diese die Attribute für eine erfolgreiche Anmeldung enthält.
Alle Attribute, die hier hinter MUST stehen, müssen Sie zwingend vergeben, wenn Sie ein Objekt mit dieser Objektklasse posixAccount erstellen wollen. Die Attribute, die in der Zeile MAY stehen, sind optional und können von Ihnen vergeben werden.
2.1.6SchemaDie Objektklassen werden jetzt nicht einzeln dem LDAP-Server zugeordnet, sondern in Gruppen zu einem Schema zusammengefasst. Für Schemata gilt das Gleiche wie für Objektklassen: Die Standardschemata sollten nicht erweitert werden, da es sonst bei einer eventuellen Zusammenführung zweier Bäume zu Konflikten kommt. Wenn Sie eigene Attribute benötigen, sollten Sie immer eine eigene Objektklasse in einem eigenen Schema erzeugen. Ein eigenes Schema können Sie auch gut in einen beliebigen LDAP-Baum integrieren. Ein wichtiger Punkt bei der Erstellung eines eigenen Schemas ist der OID für die Attribute und Objektklassen. Natürlich können Sie den OID selbst wählen. Was tun Sie, wenn der selbst gewählte OID schon vergeben ist und später eine Zusammenführung gerade mit diesem Baum stattfinden soll? Deshalb sollten Sie Ihren OID immer registrieren. Den eigenen OID können Sie kostenlos unter der URL http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page registrieren. Mit diesem Formular erhalten Sie einen OID vom Typ 1.3.6.1.4.1.*. Darunter können Sie nun die eigenen Attribute erstellen und nummerieren.
Neben einem eigenen OID sollten Sie für die Namen ein Präfix festlegen, mit dem alle Attributnamen und die Namen Ihrer eigenen Objektklassen im eigenen Schema beginnen. Wollen Sie zum Beispiel ein Schema für die Verwaltung Ihrer Kunden im Unternehmen erstellen, kann jedes Attribut mit dem Firmennamen als Präfix beginnen. Hier im Beispiel verwenden wir das Präfix stka-. Ein Beispiel für einen Attributnamen wäre dann NAME stka-Name. Listing 2.3 zeigt ein Beispiel für ein eigenes Schema:
Listing 2.3 Beispiel für ein eigenes Schema
# Schema for OpenLDAP-Book about Customers # # Last change: January 26, 2023 # # Created by: Stefan Kania <[email protected]> # # General guideline: # 1. The language in this file is english # 2. Every OID in this file must look like this: ns.a.b.c., where # ns - the official namespace of the Customer schema: # 1.3.6.1.4.1.12345 # a - Reserved, must always be 1 for the Customer schema. # b - Entry type (1:attribute, 2:object) # c - Serial number (increased with every new entry) # 3. Every entry in this file MUST have a "DESC" field, containing a # suitable description! # 4. Attributes are listed in front of objects. All entries must be # ordered by their serial number. # 5. All attributenames must start with ’stka-’ # # This schema is not depending on other schemas # Attribute type definitions attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.1 NAME ’stka-CustomerName’ DESC ’Name of the customer’ EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{100} SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.2 NAME ’stka-CustomerPhoto’ DESC ’JPEG photo of the Customer’ SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.28 SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.3 NAME ’stka-CustomerStreetName’ DESC ’streetname of the customer’ EQUALITY caseIgnoreListMatch SUBSTR caseIgnoreListSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.41 SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.4 NAME ’stka-CustomerZipCode’ DESC ’Zipcode of the customer’ EQUALITY caseIgnoreListMatch SUBSTR caseIgnoreListSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.41 SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.5 NAME ’stka-CustomerCity’ DESC ’Cityname of the customer’ EQUALITY caseIgnoreListMatch SUBSTR caseIgnoreListSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.41 SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.6 NAME ’stka-CustomerCountry’ DESC ’Countryname from the customer’ EQUALITY caseIgnoreListMatch SUBSTR caseIgnoreListSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.41 SINGLE-VALUE) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.7 NAME ’stka-CustomerPhonenumber’ DESC ’Official phonenumber from the customer’ EQUALITY telephoneNumberMatch SUBSTR telephoneNumberSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.50) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.8 NAME ’stka-CustomerHomepage’ DESC ’Official homepage of the customer’ EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255}) attributetype (1.3.6.1.4.1.12345.1.1.9 NAME ’stka-CustomerMail’ DESC ’Mailaddress from the customer’ EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{256} ) attributetype ( 1.3.6.1.4.1.12345.1.1.10 NAME ’stka-GoodCustomer’ DESC ’If set to true then the customer is good’ EQUALITY booleanMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 SINGLE-VALUE ) # Objectclass definitions objectclass ( 1.3.6.1.4.1.12345.1.2.1 NAME ’stka-Customer’ DESC ’Objectclass to manage all customers’ SUP top STRUCTURAL MUST (stka-CustomerName $ stka-CustomerCity) MAY (stka-CustomerPhoto $ stka-CustomerStreetName $ stka-CustomerZipCode $ stka-CustomerCity $ stka-CustomerCountry $ stka-CustomerPhonenumber $ stka-CustomerHomepage $ stka-CustomerMail $ stka-GoodCustomer))
Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Zeilen nach attributetype und objectclass eingerückt sind, sonst kommt es beim Start des LDAP-Servers zu Fehlern.
Jedes der hier verwendeten Attribute kann sowohl über den OID als auch über den Namen eindeutig referenziert werden. Durch die Verwendung eines eigenen Suffixes kann es auch nicht zu Verwechslungen mit Standardattributen kommen. Da hier der Typ SUP top STRUCTURAL für die Objektklasse genutzt wird und die Objektklasse von keiner anderen Objektklasse abhängig ist, können Sie ein Objekt erstellen, das nur aus dieser Objektklasse besteht. Wollen Sie eine Objektklasse erstellen, die Sie anschließend zusätzlich zu bestehenden Objekten hinzufügen wollen, dann müssen Sie an dieser Stelle SUP top AUXILIARY schreiben. Dadurch kann die Objektklasse auch im Nachhinein anderen Objekten zugeordnet werden. Sie sind dann aber nicht in der Lage, ein Objekt zu erstellen, das nur aus dieser einen Objektklasse besteht.
Sie haben in Ihrem eigenen Schema immer die Möglichkeit, aus den Attributen mehrere Objektklassen mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen ODIs, aber denselben Attributen zu bauen, und hätten dann beide Möglichkeiten.
Wenn Sie jetzt das Schema zu Ihrer LDAP-Konfiguration hinzufügen, können Sie die Objektklassen wie gewohnt nutzen.
Die komplette Beschreibung, wie Sie ein eigenes Schema aufbauen, finden Sie inklusive aller Syntaxbeschreibungen im RFC 2252.
Immer, wenn Sie ein eigenes Schema erstellen, müssen Sie es auch in die Konfiguration Ihres LDAP-Servers einbinden. Wichtig ist bei der Konfiguration die Reihenfolge der eingebundenen Schemata. Da eine Objektklasse auch Attribute einer anderen Objektklasse nutzen kann und es dabei nicht wichtig ist, in welchem Schema sich die Objektklasse befindet, müssen Sie immer auf die Reihenfolge der Einträge achten. In Kapitel 3, «Installation des ersten LDAP-Servers», werde ich noch genauer auf die Reihenfolge eingehen.
Im OpenLDAP gibt es einige Schemata, die fast immer eingebunden werden. In Tabelle 2.1 finden Sie eine Übersicht über diese Schemata.
Tabelle 2.1 Schemata des OpenLDAP
Name des Schemas
Funktion
core.schema
Standardschema, muss immer eingebunden sein
cosine.schema
Standardattribute der LDAP-Version 3
nis.schema
Hier befinden sich alle Attribute für POSIX-Konten
inetorgperson.schema
Enthält Attribute, die für die Benutzerverwaltung relevant sind
Wie schon in der Einleitung zum Buch beschrieben, werden wir in dieser Auflage nur noch auf die dynamische Konfiguration des OpenLDAP eingehen. Daher wollen wir Ihnen an dieser Stelle erklären, wie Sie eine eigene Schemadatei in eine LDIF-Datei umwandeln können, sodass Sie diese dann später auch in Ihren dynamisch verwalteten LDAP-Baum einbinden können. An dieser Stelle werden wir auf Kommandos zugreifen, die erst später erklärt werden. Aber wenn Sie die Umwandlung an dieser Stelle gleich testen möchten, können Sie das mithilfe der Listings realisieren.
Der Ausgangspunkt ist der, dass Sie bereits einen OpenLDAP installiert haben, da die benötigten Kommandos Bestandteil der Pakete sind. Der Server muss für die Umwandlung noch nicht konfiguriert sein und auch nicht laufen.
Kopieren Sie als Erstes Ihr Schema, zum Beispiel company.schema, nach /opt/symas/etc/openldap/schema/. Erzeugen Sie ein leeres Unterverzeichnis /root/schema. In diesem leeren Verzeichnis wird die umgewandelte Konfiguration abgelegt. Erstellen Sie eine Datei /root/schema-ldif.conf und tragen dort die Zeile aus Listing 2.4 ein:
Listing 2.4 Konfigurationsdatei zur Umwandlung
include /opt/symas/etc/openldap/schema/company.schema
Mit dem Kommando slaptest können Sie jetzt die Umwandlung durchführen. Sehen Sie dazu auch das Listing 2.5:
Listing 2.5 Umwandlung mit slaptest
root@provider01:~# slaptest -f schema-ldif.conf -F /root/schema config file testing succeeded
Wichtig: Das Verzeichnis, in dem die Dateien bei der Umwandlung abgelegt werden, muss unbedingt leer sein, sonst kommt es bei der Umwandlung zu einer Fehlermeldung, und der Vorgang wird abgebrochen.
Einspielen des Schemas
An dieser Stelle möchten wir Ihnen dann auch zeigen, wie Sie das neue Schema in den LDAP einbinden können. Bis zu diesem Punkt haben wir zwar noch keine Kommandos direkt erklärt und auch zu dem Aufbau der LDAP-Konfiguration noch nichts geschrieben, aber dieses ist die richtige Stelle, an der wir Ihnen den Vorgang erklären wollen.
Wenn Sie jetzt in das vorher angelegte Verzeichnis wechseln, finden Sie dort einen Eintrag cn=config/cn=schema/cn=0company.ldif. In der LDIF-Datei befindet sich das umgewandelte Schema. Nur können Sie das Schema so nicht einbinden, ein bisschen Handarbeit ist noch nötig.
Öffnen Sie die Datei mit einem Editor. Am Anfang der Datei entfernen Sie die ersten beiden mit einer # beginnenden Zeilen. Anschließend passen Sie die nächsten Zeilen wie in Listing 2.6 an:
Listing 2.6 Änderung am Anfang der Datei
<Original> dn: cn={0}company objectClass: olcSchemaConfig cn: {0}company <Änderung> dn: cn=company,cn=schema,cn=config objectClass: olcSchemaConfig cn: company
Am Ende der Datei entfernen Sie die Zeilen aus Listing 2.7:
Listing 2.7 Änderungen am Ende der Datei
structuralObjectClass: olcSchemaConfig entryUUID: 21b3d23a-460e-103d-8c56-6f21b1f0756f creatorsName: cn=config createTimestamp: 20230221083316Z entryCSN: 20230221083316.323337Z#000000#000#000000 modifiersName: cn=config modifyTimestamp: 20230221083316Z
Kopieren Sie die Datei nach /opt/symas/etc/openldap/schema/company.ldif. Im Anschluss können Sie Ihre Konfiguration mit dem Kommando ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:///-f /opt/symas/etc/openldap/schema/company.ldif um das Schema erweitern.
Erweiterung des Schemas
Wollen Sie später weitere Attribute zu Ihrem Schema hinzufügen, können Sie das im laufenden Betrieb des LDAP-Servers realisieren. Erstellen Sie eine LDIF-Datei mit dem neuen Attribut und der geänderten Objektklasse so wie das Beispiel in Listing 2.8:
Listing 2.8 Erweiterung des Schemas
dn: cn={4}my-schema,cn=schema,cn=config changetype: modify add: olcAttributeTypes olcAttributeTypes: {10}(1.3.6.1.4.1.12345.1.1.11 NAME ’stka-LuckyCustomer’ DESC ’If set to true then the customer is lucky’ EQUALITY booleanMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 SINGLE-VALUE) - delete: olcObjectClasses olcObjectClasses: {0} - add: olcObjectClasses olcObjectClasses: {0}( 1.3.6.1.4.1.12345.1.2.1 NAME ’stka-Customer’ DESC ’Objectclass to manage all customers’ SUP top STRUCTURAL MUST ( stka-CustomerName $ stka-CustomerCity ) MAY ( stka-CustomerPhoto $ stka-CustomerStreetName $ stka-CustomerZipCode $ stka-CustomerCity $ stka-CustomerCountry $ stka-CustomerPhonenumber $ stka-CustomerHomepage $ stka-CustomerMail $ stka-GoodCustomer $ stka-LuckyCustomer)
Wichtig: Die Nummer des Schemas in Ihrer Datei muss nicht mit dem DN aus dem Beispiel übereinstimmen. Schauen Sie in das Verzeichnis /opt/symas/etc/openldap/slapd.d/cn=config/cn=schema. Dort finden Sie alle Schemata mit der entsprechenden Nummer.
Anschließen können Sie die Änderung mit ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f mod-company.ldif einspielen.
Überlegen Sie genau, welche Attribute Sie in einem eigenen Schema benötigen, denn das Entfernen eines Schemas ist nicht so trivial wie das Einbinden. Denn es dürfen keine Objekte mit Attributen aus dem Schema mehr im LDAP vorhanden sein. Entfernen Sie ein Schema und es sind noch Objekte mit Attributen aus dem Schema vorhanden, ist Ihre Datenbank nicht mehr konsistent, und der LDAP-Server startet nicht mehr. Wenn Sie alle
Attribute und Objektklassen entfernt haben, stoppen Sie den LDAP-Server und löschen die Schemadatei aus dem Verzeichnis /opt/symas/etc/openldap/slapd.d/cn=config/cn=schema.
Anschließend starten Sie den LDAP wieder neu, und das Schema ist wieder entfernt.
2.1.8Das LDIF-FormatDamit Sie nach der Konfiguration des LDAP-Servers die ersten Objekte in dem Baum erstellen können, benötigen Sie Dateien im Lightweight Database Interchange Format (LDIF).
In diesen Dateien werden die Objektklassen und Attribute mit ihren Werten für das zu erstellende Objekt angelegt und anschließend mit dem Kommando ldapadd in den Verzeichnisbaumeingetragen. Listing 2.9 zeigt zwei Beispiele für LDIF-Einträge:
Listing 2.9 Beispiel für eine LDIF-Datei
dn: ou=users,dc=example,dc=net ou: users objectClass: organizationalUnit dn: uid=skania,ou=users,dc=example,dc=net uid: skania cn: Stefan sn: Kania userPassword:: e1NTSEF9OURIWjB4ZVVmekl5WHVhcC9lOHo5OWZvQkRrMFdqaFo= loginShell: /bin/bash uidNumber: 501 gidNumber: 100 homeDirectory: /home/skania shadowMin: -1 shadowMax: 999999 shadowWarning: 7 shadowInactive: -1 shadowExpire: -1 objectClass: inetOrgPerson objectClass: posixAccount objectClass: shadowAccount
Im ersten Teil wird eine neue Organisatorische Einheit (OU) erzeugt, in der später die Benutzer erstellt werden sollen. Als erste Zeile muss immer der DN des Objekts stehen. Das Objekt gehört zu den Objektklassen top und organizationalUnit. Nach dem letzten Attribut folgt eine Leerzeile. Diese Leerzeile dient als Trennung zwischen zwei Objekten und ist immer dann erforderlich, wenn mit einer LDIF-Datei mehrere Objekte erzeugt werden sollen. Wichtig ist, dass in der Leerzeile wirklich kein Zeichen steht, auch kein Tabulator oder Leerzeichen.
Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um einen Benutzer. Hier sehen Sie, wie das Objekt aus mehreren Objektklassen zusammengesetzt wird, aber auch, dass nicht alle Attribute aus den Objektklassen Verwendung finden.
Hier fällt auf, dass bei dem Attribut userPassword ein doppelter Doppelpunkt nach dem Attributname steht. Hier handelt es sich dann um einen BASE64-kodierten Wert. Immer, wenn Sie ein Attribut mit Sonderzeichen in den LDAP schreiben, wird der Wert im LDAP BASE64-kodiert abgelegt. Das ist auch der Fall, wenn Sie am Ende einer Zeile ein Leerzeichen setzen. Bei vielen Einträgen, vor allen Dingen später in der dynamischen Konfiguration, kann das auch zu Problemen führen. Wenn Sie einen Wert, der in BASE64 gespeichert ist, umwandeln wollen, können Sie das mit dem Kommando echo "BASE64-Wert" | base64 -d realisieren.
Tipp: Wenn Sie den vi für die Bearbeitung der LDIF-Dateien nutzen, können Sie im Kommando-Modus : set list eingeben, dann werden Ihnen alle Leerzeichen und Tab-Sprünge angezeigt. So können Sie dann die Leerzeichen am Ende einer Zeile einfach finden und entfernen.
Ein weiterer Punkt soll hier noch erwähnt werden: Laut RFC 2849 ist die maximale Zeilenlänge für einen im LDAP gespeicherten Eintrag 76 Zeichen, längere Zeilen werden umbrochen. Eine umbrochene Zeile können Sie an genau einem führenden Leerzeichen erkennen. In einem Editor würde diese Zeile aber als neue Zeile interpretiert. Wenn Sie sich Objekte aus dem LDAP auflisten lassen, die längere Zeilen haben, können Sie die Ausgabe durch die Kommandokette echo "Langezeile" | perl -p0e "s/\n //g" wieder zu einer Zeile zusammenfügen. Sie können auch die gesamte Ausgabe von ldapsearch durch die Weiterleitung ausgeben lassen. Alle Zeilen mit Umbrüchen werden dann zusammenhängend ausgegeben.
Mithilfe der LDIF-Dateien können Sie beliebig viele Objekte auf einmal erstellen oder verändern. Zusammen mit einem Shell-Skript wäre es auch möglich, die entsprechenden Werte für die Attribute aus einer anderen Datei auszulesen und damit komplexe Änderungen an vielen Objekten innerhalb des gesamten DITs durchzuführen.
2.1.9Aufbau einer StrukturImmer wieder werden wir gefragt: „Was ist denn nun die beste Struktur für einen Verzeichnisdienst?“ Leider kann niemand diese Frage universell beantworten, sondern das ist immer abhängig vom Einzelfall. Aber die Zusammensetzung eines Verzeichnisbaums kann erklärt werden.
Ein Verzeichnisbaum setzt sich grundlegend aus zwei verschiedenen Objektarten zusammen. Da sind zum einen die Organizational Units (OU), die eine Struktur aufbauen, und zum anderen die Blattobjekte, die die Ressourcen beschreiben und bereitstellen. Bei OUs gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Struktur aufbauen können. Die oberste Ebene eines Verzeichnisbaums ist immer der root Directory Service Entry (rootDSE). Diese Ebene ist eine unsichtbare Ebene, in der bestimmte Informationen über die Fähigkeiten in den optional attributes festgelegt werden. Erst unterhalb des rootDSE werden Sie Ihren eigenen Teil des Verzeichnisbaums erstellen. Die erste Ebene, die Sie dort erstellen, ist immer Ihr BaseDN, wobei DN für Distinguished Name steht, den eindeutigen Namen Ihres Verzeichnisdienstes. In Tabelle 2.2 sehen Sie eine Übersicht über die verschiedenen OU-Typen, die Sie verwenden können:
Tabelle 2.2 Organizational-Unit-Objekte
Abkürzung
Name
Beschreibung
Beispiel
C
Country
2-stelliger Ländercode
C=DE
O
Organization
Organisationsname
O=Firma
DC
domainComponent
DNS-Name
DC=firma,DC=de
OU
organizationalUnitName
Name für organisatorische Einheiten
OU=Abteilungen
Sie haben damit die Möglichkeit, eine Struktur Ihres Unternehmens so abzubilden, dass die Struktur die Gliederung Ihres Unternehmens weltweit widerspiegelt, oder Sie können den LDAP-Verzeichnisbaum an die DNS-Struktur Ihres Unternehmens anpassen. In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die Strukturen der beiden Verzeichnisdienste LDAP und DNS anzugleichen. Genau das macht Microsoft mit seinem Active Directory. Um Ihnen beide Möglichkeiten zu veranschaulichen, sehen Sie in Bild 2.2 eine Struktur, die mit einer Länderkennung beginnt.
Bild 2.2Struktur mit Länderkennung
In Bild 2.3 sehen Sie die Gliederung über das DC-Objekt. So können Sie dann Ihre Struktur passend zum DNS-Verzeichnisdienst aufbauen.
Bild 2.3Struktur mit einem DC-Objekt
Die weitere Planung über die untergeordneten OUs sollten Sie sehr genau vornehmen. Eine falsche oder schlechte Planung sorgt später dafür, dass es Ihnen schwerfallen kann, die Berechtigungen in Ihrem Verzeichnisdienst zu setzen.
2.1.10NamensfindungDamit ein Objekt im Verzeichnisbaum auch eindeutig adressiert werden kann, müssen Sie wissen, wie Sie ein Objekt eindeutig ansprechen können. Jedes Objekt im LDAP hat einen eindeutigen Namen, den Distinguished Name (DN). Dieser Name wird immer dann benötigt, wenn Sie ein neues Objekt anlegen oder ein bestehendes Objekt verändern wollen. Als Beispiel sehen Sie hier den DN der OU OU=Abt-1 aus Bild 2.3ou=Abt-1,O=Firma,DC=firma,dc=de. Wie Sie an dem Namen sehen, wird der Name immer vom eindeutigen zum abstrakten Element geschrieben, genau wie im DNS, bei dem es sich auch um einen Verzeichnisdienst handelt.
Neben dem DN gibt es noch den RDN, den Relative Distinguished Name. Dabei handelt es sich immer um den Namen, den ein Objekt relativ zum eigenen Standpunkt im Verzeichnisdienst hat. Sie können den RDN gut mit dem relativen Dateinamen im Dateisystemvergleichen; dieser Name ist auch immer abhängig von meinem aktuellen Standort im Dateisystem.
In der ersten Auflage dieses Buches haben wir die Installation noch für zwei Distributionen beschrieben, da bei den verschiedenen Distributionen ein paar Unterschiede bestanden. Dieses Mal greifen wir auf die Pakete der Firma Symas zurück, daher sind jetzt, bei allen unterstützten Distributionen, die Pfade und Dateinamen identisch, sodass wir hier die Installation distributionsunabhängig beschreiben können.
Hinweis: Bei den Paketen ist der Pfad, in dem die Dateien der Pakete abgelegt werden, immer /opt/symas/. Der Grund dafür ist: So kollidieren die Dateien aus den Symas-Paketen nicht mit den Dateien aus den Paketen der Distribution, falls Sie die Pakete noch installiert haben.
An dieser Stelle gehen wir auch noch einmal auf die Unterschiede zwischen der statischen und dynamischen Konfiguration ein. Im Rest des Buches werden wir dann ausschließlich die dynamische Konfiguration nutzen.
Der Grund ist der, dass die statische Konfiguration auf der Website https://www.openldap.org als deprecated angegeben wird. Das bedeutet, dass die Möglichkeit der Konfiguration über eine einfache ASCII-Textdatei leider auf Dauer nicht mehr möglich sein wird. In komplexen Installationen mit mehreren Providern ist die Konfiguration über die statische Konfiguration auch nicht mehr zeitgemäß.
Bei der dynamischen Konfiguration werden sowohl die Grundkonfiguration als auch alle weiteren Änderungen über LDIF-Dateien in einer speziellen Datenbank im LDAP gespeichert, und der LDAP-Server verwaltet sich quasi selbst.
3.0.1Die statische KonfigurationBei der statischen Konfiguration handelt es sich um die klassische Variante der Konfiguration. Alle Konfigurationsparameter werden in einer Konfigurationsdatei abgelegt. Immer, wenn Sie eine Änderung durchgeführt haben, ist es notwendig, dass Sie den LDAP-Server neu starten, damit die Änderung wirksam wird. Wenn Sie mehrere LDAP-Server einsetzen, müssen Sie die Konfiguration immer auf allen LDAP-Servern anpassen.
Nicht nur die grundlegende Konfiguration wird in der statischen Konfiguration in der Konfigurationsdatei abgelegt, sondern später auch alle ACLs und die Konfiguration der eventuell verwendeten Overlays (bei Overlays handelt es sich um eine Art Plug-in, das die Funktion des LDAP-Servers erweitert; mehr zum Thema Overlays finden Sie in Kapitel 10, «Einsatz von Overlays»).
Sie können die Konfiguration Ihres LDAP-Servers auch erst statisch beginnen und später auf die dynamische Konfiguration umstellen.
Da die Datei slapd.conf bei allen Distributionen denselben Inhalt hat, möchten wir Ihnen an dieser Stelle die einzelnen Zeilen der Konfiguration erklären. So können Sie in diesem Kapitel den Inhalt der statischen Konfiguration noch sehr gut mit der dynamischen Konfiguration vergleichen. In Listing 3.1 sehen Sie den Inhalt der Datei:
Listing 3.1 Die slapd.conf
# # See slapd.conf(5) for details on configuration options. # This file should NOT be world readable. # include /opt/symas/etc/openldap/schema/core.schema include /opt/symas/etc/openldap/schema/cosine.schema include /opt/symas/etc/openldap/schema/nis.schema include /opt/symas/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema pidfile /var/symas/run/slapd.pid argsfile /var/symas/run/slapd.args # Read slapd.conf(5) for possible values loglevel 256 # Load dynamic backend modules: modulepath /opt/symas/lib/openldap moduleload back_mdb.la moduleload argon2.la # The maximum number of entries that is returned for a search operation sizelimit 500 # The tool-threads parameter sets the actual amount of cpu’s that is used # for indexing. tool-threads 1 password-hash {ARGON2} ############################################# # Specific Directives for database #1, of type hdb: # Database specific directives apply to this databasse until another # ’database’ directive occurs database mdb maxsize 1073741824 # The base of your directory in database #1 suffix "dc=example,dc=net" # rootdn directive for specifying a superuser on the database. rootdn "cn=admin,dc=example,dc=net" #rootpw "geheim" rootpw "{ARGON2}$argon2i$v=19$m=4096,t=3,p=1$c2Fs..." # Where the database file are physically stored for database #1 directory "/var/symas/openldap-data" # Indexing options for database #1 index objectClass eq # Save the time that the entry gets modified, for database #1 lastmod on # The userPassword by default can be changed # by the entry owning it if they are authenticated. # Others should not be able to see it, except the # admin entry below # These access lines apply to database #1 only access to attrs=userPassword,shadowLastChange by anonymous auth by self write by * none access to * by * read access to dn.base="" by * read
Die Konfigurationsdatei besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil oberhalb der Linie aus Hashes ist der globale Teil, der für alle Datenbanken, die der OpenLDAP bereitstellt, relevant ist. Der Teil unterhalb betrifft immer eine bestimmte Datenbank. Der Parameter database mdb markiert dabei den Beginn einer neuen Datenbank.
Als Erstes werden die Schematadateien eingebunden, die Reihenfolge ist dabei sehr wichtig. Beim Start des LDAP-Servers werden die Dateien eine nach der anderen abgearbeitet. Da durch die Möglichkeit der Vererbung von Attributen eine Abhängigkeit zwischen den einzelnen Schemata besteht, müssen Sie immer wissen, welche Objektklasse eventuell Attribute einer anderen Objektklasse nutzt. Die Standardobjektklassen, die hier eingebunden sind, befinden sich schon in der richtigen Reihenfolge. Wenn Sie ein eigenes Schema mit eigenen Objektklassen erstellen, ist es wichtig, dass Sie am Anfang Ihres Schemas etwaige Abhängigkeiten kommentieren.
In den Zeilen pidfile /var/symas/run/slapd.pid und argsfile /var/symas/run/slapd.args werden die Prozess-ID und die Argumente, die beim Start des OpenLDAP-Servers verwendet werden, abgelegt.
Das loglevel legt fest, welche Ereignisse geloggt werden. Dabei werden die Zahlen nicht einfach hochgezählt, sondern die einzelnen Werte werden binär übergeben. Am Anfang ist ein loglevel 256 (stats) eine gute Einstellung, denn da werden alle Zugriffe geloggt. Welche Loglevel Sie verwenden können, finden Sie in der Manpage zur slapd.conf. Im späteren produktiven Betrieb stellt jede Art von Logging immer einen Flaschenhals da. Es ist daher sinnvoll, nachdem der OpenLDAP eingerichtet wurde, das Loglevel auf den Wert none zu setzen, dann werden nur noch systemkritische Fehler ins Log geschrieben. Setzen Sie das Loglevel auf 0, werden auch diese Meldungen nicht mehr ins Log geschrieben.
Die Parameter modulepath und moduleload werden immer dann benötigt, wenn Sie zusätzliche Module für zusätzliche Funktionen nutzen wollen. Bei den Symas-Paketen werden alle Overlays über Module bereitgestellt und müssen einzeln geladen werden.
Der Parameter sizelimit 500 legt fest, wie viele Antworten bei einer Suche zurückgegeben werden. Gerade wenn Sie einen großen LDAP-Baum mit mehreren Tausend Objekten pflegen, kann die Antwort den Server stark belasten. Deshalb diese Grenze. Über Filter können Sie die Suche einschränken. Die Übersteuerung der Einschränkung der zurückgegebenen Objekte bei der Suche muss immer direkt in der Datenbank definiert werden, für die sie zutreffen soll.
Wenn Sie sehr viele Indexdatenbanken einsetzen, um die Suche nach Attributen oder Objekten zu beschleunigen, kann es sinnvoll sein, mehr als nur eine CPU für das Indizieren zu verwenden. Testen Sie, ob eine weitere CPU für Sie Vorteile bringt.
Wir werden hier im Buch nur noch ARGON2 als Passworthash nutzen. Über den Parameter password-hash legen Sie den neuen Passworthash fest. Mehr zum Thema ARGON2 finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Argon2.
Mit database mdb beginnt nicht nur der Datenbankteil, sondern Sie legen auch den Datenbanktyp fest. Seit einiger Zeit wird nur noch der Datenbanktyp mdb empfohlen, alle anderen alten Datenbanktypen werden in Zukunft nicht mehr unterstützt.
Der suffix legt die oberste Ebene Ihres LDAP-Baums fest.
Beim rootDN handelt es sich um den Hauptadministrator, der immer alle Rechte hat und nie auf irgendeine Art und Weise beschränkt werden kann. Der Benutzer wird nicht in der Datenbank angelegt.
Das rootpw ist das Passwort für den rootDN. Halten Sie dieses Passwort immer unter Verschluss. Mit diesem Passwort können sämtliche Änderungen am LDAP-Baum vorgenommen werden. In der Beispieldatei sehen Sie, dass hier schon ARGON2 als Passorthash genutzt wird. Anders als bei der Verwendung anderer Passwordhashes nutzen Sie hier das Kommando echo -n "mein-geheimes-pw" | argon2 "saltsaltsaltsalt" -e, um den Passworthash zu erzeugen.
Mit dem Parameter directory legen Sie fest, in welchem Verzeichnis die Datenbankdateien abgelegt werden. Für jede Datenbank, die Sie mit dem LDAP-Server verwalten wollen, benötigen Sie ein eigenes Verzeichnis.
Über den Parameter index werden die Indexdatenbanken für diese LDAP-Datenbank festgelegt. Später werden wir noch näher auf die Indexeinträge eingehen.
Lastmod on speichert die Zeit der letzten Änderung für jedes Objekt in der Datenbank.
Am Schluss folgen die ACLs für die Zugriffe. Auf die ACLs gehen wir in Kapitel 9, «Berechtigungen mit ACLs», näher ein.
Tipp: Haben Sie bis jetzt Ihren LDAP-Server über die statische Konfiguration verwaltet, können Sie diese mit dem Kommando slaptest -F /opt/symas/etc/openldap/slapd.d -f /etc/ldap/slapd.conf in die dynamische Konfiguration umwandeln.
Bei der dynamischen Konfiguration werden alle Einstellungen des LDAP-Servers in einer eigenen Datenbank im LDAP abgelegt: Sowohl die Grundkonfiguration, die Erweiterung des Funktionsumfang durch Overlays als auch die ACLs werden mittels LDIF-Dateien in die Datenbank eingespielt. Kommentare können Sie in dieser Datenbank nicht ablegen, sodass Sie sämtliche Änderungen und Einstellungen extern dokumentieren müssen.
Der große Vorteil der dynamischen Konfiguration ist, dass Sie hier den LDAP-Server nach einer Änderung nicht neu starten müssen; die Änderung ist sofort wirksam, nachdem Sie die LDIF-Datei eingespielt haben. Auch Ihre ACLs passen Sie dann immer über LDIF-Dateien an; auch sie sind nach dem Einspielen sofort wirksam. Wenn Sie mit grafischen Werkzeugen arbeiten wollen, dann achten Sie darauf, ob das Werkzeug die dynamische Konfiguration bearbeiten kann. Wir werden in Kapitel 7, «Grafische Werkzeuge», noch darauf zu sprechen kommen.
Wenn Sie mehrere LDAP-Server einsetzen und diese vielleicht auch noch an unterschiedlichen Standorten stehen und Sie häufig Änderungen an der Konfiguration oder den ACLs vornehmen, dann ist die dynamische Konfiguration auf jeden Fall der bessere Weg. Mit der neuen Version 2.5 und 2.6 funktioniert jetzt auch die Replikation der dynamischen Konfiguration fehlerfrei. So können Sie Änderungen an der Konfiguration auf einem Server einspielen, und die Änderung wird auf alle anderen OpenLDAP-Servern repliziert. Durch den geänderten Replikationsprozess in den neuen Versionen können Sie so einen Multiprovider-Cluster aufbauen und die Konfiguration für den gesamten Cluster mit einer LDIF-Datei anpassen.
3.1Installation der Symas-PaketeEine Besonderheit der Symas-Pakete sei hier gleich am Anfang erwähnt: Der Dienst startet in der Standardeinstellung, nach der Installation, grundsätzlich mit der Benutzerkennung root. Das ist aber keine gute Idee und soll hier auch sofort geändert werden.
Aber als Erstes werden jetzt die Pakete installiert. Dafür benötigen Sie die Daten, um das Repository auf Ihrem System einzutragen. Damit Sie nach dem Installieren der Pakete auch gleich die Zugriffsrechte für die verwendeten Verzeichnisse anpassen, sehen Sie in Listing 3.2 ein Skript, mit dem Sie nicht nur die Pakete installieren können, sondern auch gleich einen Benutzer für den Dienst anlegen und die Berechtigungen im Dateisystem setzen:
Listing 3.2 Skript zur Installation der Symas-Pakete
#!/bin/bash DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -yq gnupg2 argon2 python3-ldap wget -O- https://repo.symas.com/repo/gpg/RPM-GPG-KEY-symas-com-signing-key\ | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/symas-com-gpg.gpg \ > /dev/null echo "deb [arch=amd64] https://repo.symas.com/repo/deb/main/release26 \ bullseye main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/symas26.list





























