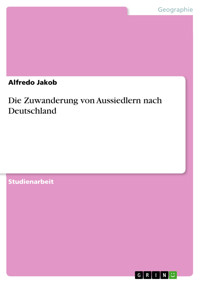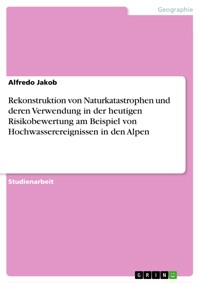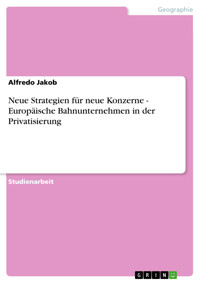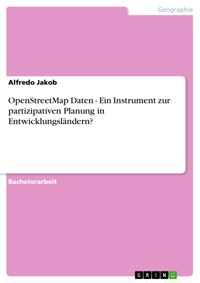
OpenStreetMap Daten - Ein Instrument zur partizipativen Planung in Entwicklungsländern? E-Book
Alfredo Jakob
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Geowissenschaften / Geographie - Kartographie, Geodäsie, Geoinformationswissenschaften, Note: 1,3, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Geographisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Art und Weise, wie bei OpenStreetMap (OSM) die Erstellung einer freien Weltkarte angestrebt wird, ist bereits von ihrer Grundidee her partizipativ: jeder kann alles beliebig verändern. Auch wenn Partizipation in einer Gesellschaft viel mehr als das Sammeln von Daten beinhaltet, werden zur Planung, Umsetzung und Evaluierung partizipativer Maßnahmen unbedingt Daten, unter anderem geographische, benötigt. Die Möglichkeiten, die OSM-Daten bei der partizipativen Planung bieten, werden in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet. Dabei werden diese anhand zweier Themenbereiche beleuchtet: Im ersten Teil wird das klassische Anwendungsfeld des Participatory Mapping analysiert, eine Methode, die seit den 1980er Jahren Einzug in die Entwicklungszusammenarbeit gehalten hat. Im zweiten Teil werden zwei aktuelle OSM-Projekte (Haiti und MapKibera) analysiert, welche unter zahlreichen momentan laufenden oder kürzlich abgeschlossenen OSM-Projekten durch ihre Komplexität und Tragweite innerhalb der lokalen Gesellschaft herausragen. In beiden Projekten gab es einen signifikanten Mangel an geographischen Daten, der durch diese Projekte behoben wurde. Hier sind bereits Kombinationen zwischen den klassischen Ansätzen der Entwicklungszusammenarbeit und den durch das Internet ermöglichten Entwicklungen und Innovationen zu erkennen. In der anschließenden Synthese wird zum einen geprüft, inwiefern sich die etablierten Anwendungsbereiche des Participatory Mapping mit OSM kombinieren lassen und welche Konsequenzen davon zu erwarten sind. Zum anderen werden die essentiellen Erkenntnisse und Neuentwicklungen, die aus den beiden aktuellen Projekten zu ziehen sind, aufgezeigt. Schließlich werden einige allgemeine Aspekte angesprochen, die bei einem partizipativen Projekt, das auf OSM zurückgreift, Beachtung finden sollten. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Grundlagen für erfolgreiche partizipative Projekte, die auf geographische Daten zurückgreifen, zu benennen und zu prüfen, inwiefern OSM einen Beitrag leisten kann, räumliche Zusammenhänge zu identifizieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die freie Weltkarte, genauso wie viele andere durch das Internet geprägte Entwicklungen, als ein Impulsgeber für weitere, politisch geprägte Prozesse fungiert, welche in das Entstehen neuer, auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region angepasster Internet-Portale münden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
OpenStreetMap Daten ‐ ein
Instrument zur partizipativen Planung
in Entwicklungsländern?
Bachelorarbeit
Page 4
5.3.1 Verfügbarkeit des Internets .................................................................................... 38 5.3.2 Kosten...................................................................................................................... 39 5.3.3 Qualität und Qualitätskontrolle .............................................................................. 40 5.3.4 Akzeptanz und Vertrauen........................................................................................ 41 5.3.5 Lizenz ....................................................................................................................... 41 5.3.6 Vergrößern von Projekten....................................................................................... 42
6. Fazit...................................................................................................................................... 43
Literaturverzeichnis................................................................................................................. 46
4
Page 5
1. Einleitung
Die Art und Weise, wie bei OpenStreetMap die Erstellung einer freien Weltkarte angestrebt wird, ist bereits von ihrer Grundidee her partizipativ: jeder kann alles beliebig verändern. Natürlich ist Partizipation in einem politischen System viel mehr als das Sammeln von Daten ‐ Partizipation räumt Akteuren die Möglichkeit ein, Einfluss und Kontrolle über sie betreffende Entscheidungen und Ressourcen zu treffen (WELTBANK 1996).
Jedoch benötigt jedes partizipative System Daten, unter anderem geographische: es wird stets hilfreich sein, die zur Diskussion stehenden Maßnahmen und Ressourcen zu verorten und in räumlicher Relation zu allen betroffenen Menschen und Gütern zu betrachten. Ein System wie OpenStreetMap, bei dem sämtliche Geoinformationen frei verfügbar sind, hat das Potential, als Datenquelle wie auch als Publikationsplattform zu dienen. Die Möglichkeiten, die OpenStreetMap‐Daten bei der partizipativen Planung bieten, werden in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet. Dabei werden diese anhand zweier Themenbereiche beleuchtet:
Im ersten Teil wird das klassische Anwendungsfeld des Participatory Mapping analysiert, eine visuelle Methode, die seit den 1980er Jahren Einzug in die Entwicklungszusammenarbeit gehalten hat (CHAMBERS 2008). Bei dieser Methode werden auf verschiedenste Weise durch die jeweils vor Ort beteiligten Menschen Karten erstellt, welche sowohl im Entstehungsprozess wie auch als fertiges Produkt vielerlei Ziele erreichen helfen. In diesem Themenkomplex wird auch darauf eingegangen, inwiefern moderne (Informations‐) Technologien bereits Einzug in die partizipative Entwicklungszusam‐ menarbeit gehalten haben.
Die modernen Informationstechnologien führen an den zweiten Teil heran, in welchem zwei aktuelle OpenStreetMap‐Projekte (Haiti, MapKibera) analysiert werden. Es existieren bereits heute eine ganze Reihe von Projekten, bei denen OSM‐Daten entweder als Grundlage verwendet werden oder OSM als Plattform zum Upload neu erfasster Zusammenhänge dient. Dazu gehören die Hilfsmaßnahmen nach dem Erdbeben Anfang 2010 auf Haiti (Maron 2010a), ein Entwicklungsprojekt zur Tourismusförderung in einem Nationalpark in Uganda (Soden 2009), ein Projekt zum Ausbau der Geodateninfrastruktur in Zentralafrika, unter
5
Page 6
anderem durch Upload einer große Menge von Straßendaten in OpenStreetMap (Development Seed 2009), das partizipativ angelegte Kartierprojekt MapKibera in Nairobi, Kenia (Hagen 2010), das bereits abgeschlossene Kartierprojekt „FreeMap“ in der Westbank und im Gazastreifen (JumpStart International 2008) oder die Etablierung einer aktiven OSM‐ Community in der Kaukasus‐Region (JumpStart International 2009). Die nun im Detail präsentierten Projekte auf Haiti und in Nairobi stechen aufgrund ihrer Komplexität und Tragweite innerhalb der lokalen Gesellschaft heraus. In beiden Projekten gab es einen signifikanten Mangel an geographischen Daten, der durch diese Projekte behoben und bei OpenStreetMap veröffentlicht wurde. Hier sind bereits Kombinationen zwischen den klassischen Ansätzen der Entwicklungszusammenarbeit und den durch das Internet ermöglichten Entwicklungen zu erkennen.
In der anschließenden Synthese wird zum einen geprüft, inwiefern sich die etablierten Anwendungsbereiche des Participatory Mapping mit OpenStreetMap kombinieren lassen und welche Konsequenzen davon zu erwarten sind. Zum anderen werden die essentiellen Erkenntnisse und Neuentwicklungen, die aus den beiden aktuellen Projekten zu ziehen sind, aufgezeigt. Schließlich werden einige allgemeine Aspekte angesprochen, die bei einem partizipativen Projekt, das auf OpenStreetMap zurückgreift, Beachtung finden sollten. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Grundlagen für erfolgreiche partizipative Projekte, die auf geographische Daten zurückgreifen, zu benennen und zu prüfen, inwiefern OpenStreetMap einen Beitrag leisten kann, räumliche Zusammenhänge zu identifizieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die freie Weltkarte, genauso wie viele andere durch das Internet geprägte Entwicklungen, als ein Impulsgeber für weitere, politisch geprägte Prozesse fungiert, welche in das Entstehen neuer, auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region angepasster Internet‐Portale münden.
6