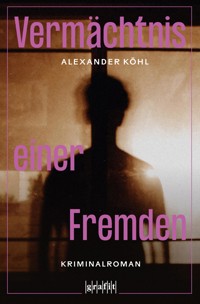8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Wie ein Lamm zur Schlachtbank Im Park Schönbusch in Aschaffenburg wird eine Leiche gefunden: ein alter Mann, nackt, gefesselt und mit aufgeschnittenen Pulsadern. Der Tote war Pfarrer. Kurz darauf schlägt der Täter ein weiteres Mal zu. Das Opfer: ein Mönch. Ein Rachefeldzug gegen Geistliche? Kommissar Basler ist sich sicher: Es wird weitere Tote geben. Doch er ahnt noch nicht, dass das letzte Opfer ein ganz besonderes sein wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Alexander Köhl
Opfertier
Kriminalroman
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Andrea
Und du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln, und wirst auf deinem Weg kein Glück haben und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang, und niemand wird dir helfen.
(5. Buch Mose, Kap. 28, Vers 29)
1
Mit der Unbarmherzigkeit von Maschinen hackten sie ihre Mordwerkzeuge in das auf dem Boden liegende Zuckerstück. Unschlüssig, in welche Richtung er ausweichen sollte, blieb er stehen. Seinen Blick von dem furchteinflößenden Spektakel abwendend, schaute er in den Himmel, in die gräuliche, nach Osten ziehende Wolkenbank. Bereits als kleiner Junge war er in das Taubengeheimnis eingeweiht worden. Hüte dich, hatten sie mit erhobenem Zeigefinger gewarnt. Hüte dich, dies Federvieh ist verflucht. Ist es ihnen erst einmal gelungen, einem jungen Burschen wie dir in den Kopf zu sehen, dann bist du verloren.
Ängstlich richtete er seinen Blick wieder auf die pickenden Vögel am Laternenfuß. Ob sie die Gedanken alter Männer wohl ebenso lesen konnten? Ein plötzliches und lautes Gurren ließ ihn zusammenzucken. Staunend verfolgte er das kleine Wunder, das sich zu seinen Füßen vollzog. Wie durch einen Wink des Herrn erhoben sich die Tauben und entschwanden eine nach der anderen in die kühle Herbstluft.
Erleichtert humpelte er die Straße hinunter. Schritt für Schritt begleitete ihn buntes Laub, das in Wolken um seine Füße wirbelte. Ein paar Ecken weiter kam er an einem Buchladen vorbei. Bücher – ja, das kannte er. Angezogen von den farbenfrohen Umschlägen im Schaufenster, blieb er stehen. Unwillkürlich musste er lächeln, als sein Spiegelbild auf der Scheibe auftauchte. Zaghaft strich er sich über den lichten Kranz aus Haaren. An seinem Mantel fehlten die beiden mittleren Knöpfe. Darunter lugte der blaue Strickpullover hervor, den er vor langer Zeit geschenkt bekommen hatte.
Eine seiner seltenen und fernen Erinnerungen stahl sich in seinen Kopf. Sein Neffe, seine Mutter, Schwester Marianne. Ja, die Schwester war’s. Die wollte, dass er den Pullover endlich wegwarf, in den Mülleimer steckte und sich einen anderen besorgte. Weil am Bündchen Fäden hingen. Fäden, mit denen er sich an Türgriffen verfing und die ihn dort wie einen Fisch an der Angel gefangen hielten.
Der Bauch der Buchhandlung war erfüllt von einem süßlichen Duft. Ein wohliger Geruch, der ihm vertraut war. Schnuppernd stellte er sich vor einen Büchertisch. Unsicher schaute er über seine Schulter, bevor er sich traute, nach einem der Bände zu langen. Als er mit dem Daumen über die Seitenränder fuhr, gab das Papier ein leises Flattern von sich.
«Kann ich Ihnen behilflich sein?»
Eine fremde Stimme, die auf einmal von hinten auf ihn eindrang. Drei, vier Sekunden lang verharrte er mit eingezogenem Kopf, dann drehte er sich langsam um. Der Mann, der ihn durch große Brillengläser ansah, lächelte freundlich.
«Mein Herr, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein?»
«Behilflich sein?»
«Ja, suchen Sie etwas Bestimmtes?»
«Frieden», war, was ihm spontan dazu einfiel.
«Meinen Sie etwa Krieg und Frieden von Leo Tolstoi?»
«Nein, Frieden», wiederholte er nun etwas sicherer und deutete auf sein schmerzendes rechtes Knie. Die Miene des freundlichen Mannes trübte sich, als er an ihm heruntersah. Seine Hose hatte am Knie einen Riss. Den hatte er sich zugezogen, als er beim Davonlaufen gestürzt war. Blut sickerte noch aus der Wunde und verfärbte den Stoff dunkel.
«Sind Sie verletzt? Soll ich Ihnen ein Pflaster holen?»
Mit zusammengekniffenen Lidern schüttelte er den Kopf, so lange, bis ihm schwindelig wurde. Als er die Augen wieder öffnete, waren alle Konturen um ihn herum verschwommen. Die Regale, der Mann, die Kasse und die Lampe. Doch dann, als die Gegenstände wieder an Schärfe gewannen, fiel sein Blick auf etwas, das er kannte. Ein freudiges Kribbeln durchströmte ihn, als er auf das Buch deutete.
«Wollen Sie etwa eine Bibel kaufen?»
Er nickte.
«Ein wunderschönes Exemplar. Eine Einheitsausgabe mit Ledereinband und modernen Illustrationen. Darf ich Ihnen die Heilige Schrift gleich einpacken?»
Hastig riss er dem Mann das Buch aus der Hand und lief, so schnell er mit seiner Verletzung konnte, auf den Ausgang zu.
«Halt! Bleiben Sie stehen! Zahlen! Sie müssen noch zahlen!»
Der Mann bekam ihn am Mantel zu packen.
Das Buch fiel ihm aus der Hand, und als der Mann sich danach bückte, humpelte er zur Tür hinaus.
Es dauerte, bis er wieder zu Atem kam. Keuchend schielte er zu den Straßenmusikern an der Ecke, die mit bauchigen Saiteninstrumenten und Klarinetten sentimentale Lieder spielten. Die Münzen im Instrumentenkasten funkelten verlockend. Diesmal jedoch widerstand er der Versuchung. Nachdem er einige Meter weitergelaufen war, spürte er, dass er Hunger bekam. Mit Sehnsucht dachte er an das Abendessen, das er verpasste. Sein Platz zwischen der pausbäckigen Frau und dem alten General mit dem langen seltsamen Namen würde leer bleiben. Namen! Sobald er sie genannt bekam, liefen sie wie Flüchtlinge vor ihm davon. Dabei waren gerade die Namen und die dazugehörigen Gesichter die größten Geheimnisse, die es in seinem Kopf zu hüten galt.
An einer Eckwirtschaft spähte er durch die Scheibe. Eine Schar Fremder hockte um die Tische. Essende und Trinkende, die er noch nie gesehen hatte. Unwillkürlich führte er, als würde er eine Gabel halten, seine Hand an die Lippen. Atem dampfte vor seinem Gesicht, als er kauend den Weg fortsetzte.
Hoch über dem Kopfsteinpflaster des Kirchplatzes thronte die Stiftsbasilika mit ihrem düsteren Arkadengang. Ehrfürchtig betrachtete er das Bauwerk, das er seit vielen Jahrzehnten kannte. Schon seit er aus dem Auto gestürmt war, hatte es ihn, wie von einer unsichtbaren Schnur geführt, hierhergezogen.
Nachdem er eine Weile im nur von Kerzenlicht beleuchteten Kirchenschiff gesessen hatte, verfing sich in seiner Nase erneut ein Geruch, den er kannte. Nicht so süßlich wie der bei den Büchern, aber mindestens ebenso vertraut. Es roch nach einem Busch oder Zweig, der verbrannt worden war. Rauch, dachte er, so wie er bei Totenmessen verströmt wird. Trotz des Duftes, der ihn ans Sterben erinnerte, und der Kälte, die von den Mauern abstrahlte, fühlte er sich auf einmal geborgen. Mit feucht glänzenden Augen schaute er nach vorne auf den Hauptaltar im Kirchenchor. Er lächelte, dann stimmte er das Kyrie an. Hoch und klar kamen die Verse über seine Lippen. Beim letzten Herr, erbarme dich spürte er, wie sich sanft eine Hand auf seine Schulter legte. Eine Männerhand, die ihm vertraut vorkam. «Na, mein Alter», flüsterte eine Stimme in seinem Rücken. «Da bist du ja. Kannst es eben nicht lassen. Wusste doch, dass ich dich in einer der Kirchen finde. Komm, jetzt wird’s aber Zeit, dass wir uns auf den Weg machen.»
Böiger Wind schlug ihnen entgegen, als sie in der einsetzenden Dämmerung am Rathaus vorbei den Dalberg hinunterliefen.
2
Einen Moment lang wandte Hauptkommissar Robert Basler den Blick vom Obduktionsbericht und schaute aus dem Fenster. Blätter von Rotbuchen und Ahornbäumen tanzten in der Luft. In den letzten Tagen hatte sich das Hoch eines herrlichen Altweibersommers leise, aber bestimmt verabschiedet und einem von Westen einziehenden Atlantiktief die Regie überlassen.
Ursprünglich hatte er nach Dienstschluss in die Innenstadt fahren wollen, der Fußgängerzone einen Besuch abstatten, in der Hoffnung, in einem der Schaufenster das rettende Etwas zu entdecken. Ein Geschenk, das er Nina an ihrem Geburtstag hübsch verpackt auf den Frühstückstisch legen konnte. Doch vor etwa einer Stunde hatte Kollege Paulson den Obduktionsbericht hereingereicht. Beim Lesen des Ergebnisses hatte er ein seltsam tiefes Gefühl der Erleichterung verspürt. Dr. Breuer, der Rechtsmediziner, konnte in der Leichensache Roswitha Möckel Fremdeinwirkung ausschließen.
Dana Möckel log also nicht, was den Tod ihrer altersschwachen Mutter betraf. Auf den Tag genau vor einer Woche war in der Dienststelle gegen 19 Uhr die Meldung des Notarztes eingegangen. Eine alte Frau aus der Herrleinstraße sei in der Badewanne ihrer Wohnung ertrunken, während die Tochter im Wohnzimmer mit ihrem Freund telefoniert habe. Eigenartig war das schon. Zumal sich tags darauf herausstellte, dass die Verstorbene ihrer Tochter ein beachtliches Erbe, bestehend aus einem Bank- und Aktienguthaben von über einer halben Million Euro, hinterließ und zudem ein Nachbar zu berichten wusste, dass Töchterchen Dana bis zur Halskrause in Schulden stecke und unmittelbar vor der privaten Insolvenz stehe.
Angeblich hatte es Roswitha Möckel zu Lebzeiten abgelehnt, ihre Tochter finanziell zu unterstützen, da diese Geld, sobald sie über welches verfügte, mit vollen Händen hinauswerfen würde. Im Grunde passte alles zusammen. Ein Motiv wie aus dem Lehrbuch. Das kaltherzige Luder von Mutter für eine Minute mit dem Kopf unter Wasser drücken, und sämtliche finanziellen Probleme waren gelöst. Der einzige Zeuge, den es gab, war der ergebene Freund am Ende der Strippe.
Doch Basler hatte der jungen Dana geglaubt, als sie ihn bei der Befragung hilfesuchend angesehen hatte. Auch ihren Selbstvorwürfen, die badende Mutter vernachlässigt zu haben und, während diese elendig ertrank, mit ihrem Freund über Besuche in Frankfurter Clubs geplaudert zu haben, hatte er Glauben geschenkt.
Hauptkommissarin Liebmann hingegen hatte diesbezüglich ihre Zweifel gehegt. Und die neue Kollegin, die, vom Gros der Abteilung emsig wie eine Bienenkönigin umschwärmt, erst die zehnte Woche im K1 Dienst tat, hatte ihre Meinung in etwas undiplomatischer Weise kundgetan. Am Ende einer zähen Debatte hatte sie ihm murmelnd fehlende Objektivität unterstellt, und als er nachgehakt hatte, was sie denn damit meinte, hatte sie doch tatsächlich behauptet, dass er sich von ein paar gezielt eingesetzten Augenaufschlägen dieses Früchtchens beeindrucken ließ.
Was ihn bei Liebmanns Äußerung gelinde gesagt auf die Palme brachte, war das, was von ihr unausgesprochen geblieben war, von dem er sich aber sicher war, dass sie es dachte: nämlich dass er, als in einem Forsthaus wohnender Hinterwäldler, schon Wallungen bekam, wenn er nur ein weibliches Wesen sichtete.
Dabei las er tatsächlich aus Danas Blicken, dass sie nicht log. Aber das hatte keineswegs mit koketten Augenaufschlägen zu tun. Der jungen Frau fehlte einfach das nötige schauspielerische Talent, und außerdem verfügte sie nicht über die Kaltblütigkeit, die eigene Mutter zu ermorden – das sagte ihm schlichtweg seine Menschenkenntnis.
Vielleicht wollte Liebmann ja etwas zu schnell ihren ersten Ermittlungserfolg bei ihnen am Untermain verbuchen? Dass er dieses Juwel, wie Kollege Henning Paulson sie euphorisch hinter ihrem Rücken feierte, an seiner Seite haben durfte, hatte er im Grunde seiner ehemaligen Kollegin Nina Gosh zu verdanken. Seit er und die halb indisch-, halb deutschstämmige Nina ein Liebespaar waren, hatte die Zusammenarbeit zwischen ihnen nicht mehr so reibungslos funktionieren wollen. Kritik war auf einmal persönlich genommen worden, und abends beim Essen hatte man über die kalt gewordene Mahlzeit Mordfälle endlos weiterdiskutiert. Vor drei Monaten hatte Nina dann die Entscheidung getroffen, Berufliches nicht weiter mit ihm zu teilen, und sich zum Raub versetzen lassen.
Nun hatte das Juwel Ninas Nachfolge im K1 angetreten. Frauke Liebmann war von Kaarst nach Aschaffenburg gezogen, weil ihr Mann im nahen Elsenfeld mit der Leitung einer Klinik für Kardiologie eine neue Herausforderung angenommen hatte.
In Gedanken noch seine Menschenkenntnis lobend, klappte Basler den Obduktionsbericht zu und legte ihn mitten auf Liebmanns Schreibtisch. Mittlerweile lohnte sich ein Besuch in der Innenstadt nicht mehr. Dafür konnte er sich auf einen gemütlichen Abend im Forsthaus freuen. Doch gerade, als er seine Outdoorjacke vom Türhaken nehmen wollte, klingelte das Telefon. Einen Moment lang überlegte er, es einfach zu ignorieren. Schließlich langte er doch nach dem Hörer. Ein Beamter der Zentrale teilte ihm mit, dass er eine Anruferin in der Leitung habe, die mit ihm sprechen wolle. Noch ehe er sich nach dem Anliegen der Dame erkundigen konnte, meldete sich eine nervös klingende Stimme, die sich als Tatjana Schad vorstellte.
«Mein Name, Herr Kommissar, der sagt Ihnen sicher nichts. Und zu tun hatten wir auch noch nie miteinander. Aber die Residenz Sonnenblick in Sasbach, die kennen Sie doch bestimmt? Ich arbeite dort als Pflegedienstleiterin.»
Basler kannte die Einrichtung vom Vorbeifahren und Hörensagen. Und er kannte Sasbach. Unter Schaudern erinnerte er sich an den Exorzismusfall, in dem er vor eineinhalb Jahren ermittelt hatte. Ein religiöser Eiferer hatte eine Familie fest im Griff gehabt, die glaubte, ihre Tochter sei von Dämonen besessen.
«Verzeihen Sie, dass ich mich an Sie wende, aber ich wusste nicht, wen ich sonst hätte verlangen sollen. Ihren Namen kenne ich noch aus der Zeitung.»
Spontan spukte Basler der absurde Verdacht durch den Kopf, Frau Schad könnte ihn jetzt wieder auf eine Teufelsaustreibung im Spessart aufmerksam machen.
«Und ich dachte», hörte er sie weiterreden, «an der Zentrale wimmelt man mich bestimmt ab und sagt, dass ich noch warten soll.»
«Womit warten?», versuchte Basler dem Anliegen der Frau auf den Grund zu kommen.
«Na, ob er wieder auftaucht.»
«Wer auftaucht? Und jetzt erzählen Sie bitte mal ganz von vorne.»
Von den Feldern jenseits der Straße drang das sonore Bellen eines Hundes zu ihm durch.
«Einer unserer Senioren wird seit heute Nachmittag vermisst. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie er das Sonnenblick verlassen konnte.»
«Sind Sie denn sicher, dass er die Anlage verlassen hat?»
«Natürlich. Wo soll er denn sonst abgeblieben sein?»
«Na, innerhalb der Anlage. Vielleicht hält sich der Vermisste ja noch in einem Zimmer eines anderen Bewohners auf. Oder in einem der öffentlichen Räume.»
«Er ist nicht zum Essen gekommen, und da haben wir die ganze Anlage durchsucht.»
«Wie heißt der Mann denn?»
«Entschuldigen Sie. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Konstantin Faber. Herr Faber kann sich selbst nur noch schwer orientieren. Er leidet unter Alzheimer im Frühstadium. Und da kann man doch mit einer Anzeige nicht warten, bis es Nacht wird.»
Das hatte auch niemand von der Pflegedienstleiterin verlangt. Und eigentlich hätte Frau Schad auch wissen müssen, dass sie sich, ohne Scheu zu haben, bei der Polizei melden konnte und sogar musste.
«Hat Herr Faber Verwandtschaft in der Umgebung, zu der er unterwegs sein könnte?»
«Nein, nur einen Neffen, aber der wohnt in Berlin.»
«Gut, können Sie mir Herrn Faber denn ein wenig beschreiben?»
«Herr Faber …», Basler hörte, dass Frau Schad leise schluckte, «Herr Faber ist meist etwas nachlässig gekleidet. Das liegt vielleicht daran, dass er nicht sonderlich vermögend ist. Und das wenige, was er an Geld besitzt, das spart er und steckt es in eine Art Geheimfach in seinem Allibertschränkchen. Heute Mittag, da bin ich ihm noch nach dem Essen beim Speisesaal begegnet. Da hatte er eine anthrazitfarbene Stoffhose und seinen marineblauen Pulli an. Der Pulli ist sein absolutes Lieblingsstück. Er trägt ihn beinahe täglich.»
«Und die Frisur?»
«Haare hat er kaum noch. Nur noch einen dünnen grauen Kranz um seinen Kopf.»
«Gibt es sonst noch irgendwelche besonderen Merkmale, die wir kennen sollten?»
«Welche besonderen Merkmale soll er denn haben?»
«Na, das frage ich ja Sie.» Baslers Blick streifte das Blatt, auf dem er den Namen notiert hatte. «Vielleicht hat Herr Faber ja Narben, eine auffällige Brille, einen Bart oder sonst irgendetwas, an dem man ihn erkennen könnte?»
«Ich weiß nicht so recht, aber Herr Faber hat panische Angst vor Tauben.» Einen Moment lang blieb es still in der Leitung. Dann vernahm Basler plötzlich ein leises, kaum wahrnehmbares Schluchzen am anderen Ende. «Ich … ich mache mir solche schrecklichen Vorwürfe. Noch nie … noch nie, seit ich im Sonnenblick arbeite, hat es so etwas gegeben. Dass einer unserer Senioren ausgebüxt ist. Nur einmal war unsere Frau Nonner für eine halbe Stunde weg. Das hat schon genug Aufregung gegeben. Dabei hat sie nur im Lift den falschen Knopf gedrückt und sich im Keller verlaufen.»
«Nun beruhigen Sie sich erst einmal, Frau Schad. Vermisste Senioren tauchen in der Regel von allein wieder auf. In ihrer Hilflosigkeit wenden sie sich früher oder später an irgendjemanden. Wir werden trotzdem eine Radiodurchsage veranlassen. Vielleicht meldet sich ja jemand, der Herrn Faber gesehen hat. Eine abschließende Frage hätte ich allerdings noch. Haben Sie eine Idee, wie Herr Faber die Anlage verlassen hat? Und vor allem, wie er von dort fortkommen konnte? Immerhin liegt die Residenz Sonnenblick ziemlich abgeschieden.»
3
«Hörst du denn nichts?» Die Stimme dicht an seinem Ohr mischte sich unsanft unter seinen Traum. «Robert, wach endlich auf. Das Telefon.» Auf einmal spürte er Ninas warme Hand auf seiner Schulter. Von unten aus der Küche drang tatsächlich das penetrante Läuten des Telefons. Verärgert über die nächtliche Störung, schlug er die Augen auf und war überrascht, dass das erste Grau des Morgens schon durch die Ritzen der Holzläden gekrochen kam.
Während er aus dem Bett schlüpfte, streifte sein Blick das Hochzeitsbild von Ninas Eltern, das auf ihrem Nachttischchen stand. Eine kleine, deutsche Frau und ein hochgewachsener, aus dem indischen Teil Kaschmirs stammender Kaufmann. Nina war erst fünfzehn gewesen, als ihr Vater während eines Kaschmirurlaubs in Jammu auf dem Weg zu einer Autovermietung spurlos verschwand. Unzählige Suchaktionen waren erfolglos verlaufen. Bis heute gab es keinerlei Hinweis, ob Ninas Vater abgehauen oder Opfer eines Verbrechens geworden war.
Barfuß die Treppe hinunterstolpernd, erkannte Basler an der offen stehenden Tür, dass das Badezimmer noch nicht belegt war. Üblicherweise nahm sein blinder Sohn Dani, der in Aschaffenburg in einer Praxis für Physiotherapie arbeitete, die Dusche als Erster in Beschlag.
In der Küche hing noch schwer der Duft der Pizza, die Nina am Vorabend gebacken hatte. Beim Essen hatte Nina aufgeregt berichtet, dass sie im Netz auf die Seite einer in Delhi ansässigen Detektei gestoßen sei, die sich auf die Suche nach Langzeitvermissten spezialisiert habe. Während Basler leise fluchend den Hörer von der Ladestation nahm, fragte er sich, wie er auf Dauer damit umgehen sollte, dass Nina nicht loslassen konnte und sich an jeden noch so winzigen Strohhalm klammerte, ihren Vater doch noch zu finden.
«Sorry, Robert, dass ich dich zu so unchristlicher Zeit aus den Federn schmeiße …», meldete sich am anderen Ende die Stimme von Polizeiobermeister Krausert, «… aber wir haben einen Leichenfund. Ein älterer Mann im Schönbuschirrgarten. Die Kollegen sind schon unterwegs, den Fundort sichern.»
Basler warf einen Blick auf die Küchenuhr und stellte fest, dass es kurz nach halb sieben war. «Aber es ist doch noch nicht einmal richtig hell», beschwerte er sich schlaftrunken. «Und wer um Himmels willen treibt sich so früh morgens im Irrgarten herum, dass er dort schon Leichen finden kann?»
«Ein Wachmann», antwortete Krausert, «der bei einer Spedition im Hafen arbeitet. Der ist nach Schichtende mit dem Fahrrad in den Park gefahren. Was er da ausgerechnet im Irrgarten wollte, musst du ihn schon selbst fragen.»
Den ersten Teil der Strecke durch den Wald legte er trotz der noch diffusen Lichtverhältnisse mit ausgeschalteten Scheinwerfern zurück. Das tat er häufig, denn er liebte es, wenn der Passat in der Dämmerung oder im Finsteren, nur gesäumt von der Kulisse dunkler Tannen, den Waldweg entlangschaukelte.
Basler hatte bereits seine Kindheit in dem abgelegenen Forsthaus verlebt. Sein Vater war damals Förster im umliegenden Revier gewesen. Anfang der Siebziger war dann das neue Forsthaus unten am Weiher gebaut worden. Und da Baslers Vater etwa zur selben Zeit in den Ruhestand gegangen war, hatte man ihm das alte Forsthaus zum Kauf angeboten.
Basler hatte das Haus dann von seinem Vater geerbt. Bis zu ihrem Tod wohnte dort auch Baslers Frau Martina. Eine glückliche junge Familie waren sie damals, die sich nicht davon abschrecken ließ, dass es dem alten Gemäuer an Wohnkomfort fehlte. Im Gegenteil: Sie hatten große Pläne. Nach Baslers Beförderung zum Hauptkommissar sollte zuerst die aus den Sechzigern stammende Wärmedämmung erneuert und die einfach verglasten Fenster durch modernere ersetzt werden. Doch dann ließ plötzlich eine folgenschwere Unachtsamkeit Martinas ihren Lebensplan wie eine Seifenblase zerplatzen: das Kramen nach einer Musikkassette im Handschuhfach des Simcas. Nur weil sie sich an der Sticky Fingers von den Stones, die er tags zuvor in den Kassettenschlitz geschoben hatte, bereits sattgehört hatte. Über den Unfall, den sie auf der A3 verursachte, berichteten die Medien sogar überregional. Wie durch ein Wunder verlor Dani bei dem Crash, den Martina mit ihrem Leben bezahlte, nur das Augenlicht.
Eigentlich hätte Basler nach dem Tod seiner Frau mit seinem Sohn in eine blindenfreundlichere Umgebung ziehen müssen. Runter in die Stadt, wo eine vernünftige Infrastruktur existierte. Doch es war der sechsjährige Dani, der sich mit Händen und Füßen dagegen sträubte und keine Veränderung akzeptieren wollte. Anfangs passte seine Mutter auf den Kleinen auf, während Basler selbst wie ein Zombie seinen Dienst versah.
Im Anschluss an jene trübe Zeit zogen die Jahre ins Land, ohne dass er einen nennenswerten Unterschied zwischen ihnen hätte ausmachen können, und fast ebenso schleichend wandelte sich das Modell der alleinerziehenden Vaterschaft in eines einer einigermaßen funktionierenden Wohngemeinschaft. Ändern an ihrem Männerhaushalt wollten bislang beide nichts. Und in seinem Fall lag es nicht daran, dass er sich aus Kummer über Martinas Tod eine Art lebenslanges Zölibat auferlegt hätte. Nur hatte er sich bis dato gehütet, eines seiner wenigen Abenteuer mit nach Hause zu nehmen. Doch mit Nina war es etwas anderes. Sie war keines seiner Abenteuer.
An diesem frühen Dienstagmorgen präsentierte sich der westlich der Aschaffenburger Innenstadt liegende und im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegte Park Schönbusch verlassen. So, als hätte ihn seit Ewigkeiten keine Menschenseele mehr betreten. Doch dass dieser Eindruck täuschte, war Basler bewusst, als er den Passat auf dem leeren Parkplatz abstellte, um die letzten Meter zum Leichenfundort zu Fuß zurückzulegen. Üblicherweise füllte sich die Anlage erst zu späterer Stunde, denn die zahlreichen Tempel, Wege, Wasserläufe und vor allem der malerisch gelegene Biergarten machten den Park nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische zu einer Oase der Entspannung.
Auf Höhe des Grand Bistros sah er, dass feine Nebelschwaden über die Ufer des Unteren Sees zogen. Die durch die Wolkendecke dringenden Sonnenstrahlen tauchten das sich in der Wasseroberfläche spiegelnde Schlösschen in majestätisches Licht. Entengeschnatter mischte sich unter das ferne Rauschen des Verkehrs. Beinahe herrschte Windstille. Nur eine kühle Brise wehte vom Wasser her, die kein Vergleich mehr zu dem Sturm war, der noch in der Nacht zuvor getobt hatte.
Basler entdeckte seine Kollegin schon von weitem. Mit langen Schritten kam sie vom Bus der Kriminaltechnik auf ihn zu. Die Dynamik in ihrem Gang und ihre makellose Aufmachung harmonierten bestens mit ihrem Eifer. Natürlich war sie schon vor ihm am Fundort eingetroffen.
An diesem Morgen wurde Liebmanns grazile Figur nicht wie sonst an Bürotagen von einem modischen Hosenanzug oder Kostüm in Szene gesetzt, sondern von enganliegenden Jeans und einer englischen Wachsjacke mit Cordkragen. Ihr schulterlanges kastanienbraunes Haar trug sie zur Arbeit in Gottes rauer Natur praktischerweise zu einem Knoten hochgesteckt. Auf den ersten Blick wirkte sie in ihrem sportlich-legeren Aufzug und den auf Hochglanz polierten Lederstiefeln nicht wie eine Kriminalbeamtin im Einsatz, sondern eher wie eine Gutsherrin, die im Begriff war, auszureiten.
Dass sie vor seinem Eintreffen schon Gelegenheit gehabt hatte, sich den Toten anzusehen, hätte sie nicht extra betonen müssen.
Die Laubdecke raschelte leise unter seinen Sohlen, während er Liebmann durch den Irrgarten folgte. Der Sturm der letzten Nacht musste die vielen Blätter in die Gänge geweht haben. Bereits als Kind hatte Basler den Irrgarten oft besucht. Doch dass es ihm dort sonderlich gefallen hätte, konnte er nicht behaupten. Zur spielerischen Schulung seines Orientierungssinns hatten ihn seine Eltern mit Rufen vom Turm aus durchs Labyrinth zu lotsen versucht und schließlich fürchterlich geschimpft, als er aufgeben und sich auf direktem Weg durch die Hecken drängen wollte.
Bei dem Toten handelte es sich um einen etwa siebzigjährigen Mann von korpulenter Statur. Er war nackt. Ein dichter, in bunten Farben schillernder Laubteppich bedeckte Beine und Schoß. Im schräg einfallenden Sonnenlicht und mit der herbstlichen Dekoration wirkte der Leichnam beinahe, als hätte ihn jemand arrangiert, um ihn malen zu können. Ein Kranz silbergrauer Haare umrandete das sonst kahle Haupt. Wie eine Tonsur, dachte Basler, die in Verbindung mit der bulligen Schädelform Erinnerungen an den Film Im Namen der Rose weckte. Die Lider des Mannes waren halb geschlossen. Buschige und borstige Brauen wachten über der Stirn, und auf der dünnbehaarten Brust klebte wie ein Orden das Blatt einer Hainbuche.
«Die Identität des Opfers», durchbrach Liebmann die drückende Stille, «muss erst noch geklärt werden. Bis jetzt haben die Kollegen weder persönliche Gegenstände noch Ausweispapiere finden können.»
Basler wandte sich von der Leiche ab und blinzelte, geblendet von der aufgehenden Sonne, in Richtung seiner Kollegin. Eine Taube hatte sich mittlerweile auf der Hecke zu Liebmanns Rechten niedergelassen und zerrupfte ein in den Ästen hängendes Papiertaschentuch.
«Unser Mann heißt wahrscheinlich Konstantin Faber.»
Auf seine ohne weitere Erklärung hingeworfenen Worte erntete er lediglich einen verdutzten Blick.
«Faber», er deutete auf den pickenden Vogel, «hatte angeblich panische Angst vor Tauben.»
Nein, unter die Hellseher, wie sich Liebmann mit in die Hüften gestemmten Händen erkundigte, sei er nicht gegangen.
Einen Moment lang genoss er ihren irritierten Gesichtsausdruck, dann berichtete er von der Vermisstenmeldung des Vorabends.
«Soweit man durchs Laub erkennen kann», sagte Liebmann, nachdem sie Baslers Ausführungen schweigend zugehört hatte, «ist die Leiche unbekleidet. Die Menge der Blätter, mit der der Mann bedeckt ist, ist Indiz dafür, dass er schon vor Ende des Sturms da gesessen hat.»
«Aber wo sind die Kleider? Der ist doch nicht einfach nackt im Irrgarten aufgetaucht.»
«Getötet wurde er aller Wahrscheinlichkeit nach hier.»
«Getötet? Kollegin Liebmann, warum glauben Sie, dass es kein Suizid ist? Faber kann sich doch auch in den Irrgarten gesetzt haben, um zu sterben. Er litt an Alzheimer, vielleicht wollte er seinem geistigen Zerfall zuvorkommen. Erfrieren soll angeblich ein angenehmer Tod sein.»
«Dafür ist es nachts noch nicht kalt genug, und außerdem spricht gegen Selbstmord die Blutlache, die hinter der Leiche im Boden versickert ist.» Liebmann deutete seitlich hinter dem Rücken des Toten auf einen dunklen Fleck, der fast vollständig vom Laub bedeckt war. «Die Pulsadern wurden mit kleinen Schnitten geöffnet. So ist er langsam ausgeblutet. Und dass er das allein zustande gebracht hat, dagegen sprechen schon die Kabelbinder, mit denen er am Gitter befestigt ist.»
Die Kabelbinder? Da war es wieder, ihr Oberwasser. Liebmann war ja schon vor ihm am Fundort eingetroffen. Ein Umstand, den sie ihm wohl bis zur Lösung des Falls aufs Butterbrot zu schmieren gedachte. Dabei wohnte sie mehr oder weniger um die Ecke im Nilkheimer Neubaugebiet und hatte nicht wie er eine halbstündige Fahrt im einsetzenden Berufsverkehr zurücklegen müssen.
«Die Schnitte und das viele Blut am Boden», gab Basler zu bedenken, «müssen aber nicht zwangsläufig zum Tod geführt haben.»
«Stimmt», pflichtete Liebmann bei. «Aber da die Leiche keine anderen sichtbaren Tötungsmerkmale aufweist, schlage ich vor, dass wir, bis uns das Ergebnis der Autopsie vorliegt, davon ausgehen.»
«Und was glauben Sie, bedeutet es, dass er nackt ist?»
«Vielleicht geht das in Richtung Demut und Büßen. Das war zumindest die spontane Assoziation, die ich hatte, als ich ihn gesehen habe: die Haltung der Leiche. Die auf den Rücken gefesselten Hände.»
Basler beugte sich über den toten Körper, um ihn von der Rückseite zu betrachten. Dabei dachte er an den Obduktionsbericht der Leichensache Möckel, den auf ihrem Schreibtisch zu entdecken Liebmann noch keine Gelegenheit gehabt hatte. Faber war tatsächlich mit zwei milchig weißen Kabelbindern am Gitter festgezurrt worden. Sie hatten sich oberhalb der Gelenke tief ins speckige Fleisch seiner Unterarme gedrückt. Und die Schnitte, die seine eifrige Kollegin angesprochen hatte, waren etwa zwei Zentimeter oberhalb der Fesseln angesetzt.
Als er sich wieder aufrichtete, fiel ihm auf einmal der Wachmann ein, der sich eigentümlich früh im Irrgarten aufgehalten und den Toten gefunden hatte. Doch gerade als er sich nach dem Verbleib des Mannes erkundigen wollte, hörte er Leybold nach ihnen rufen. Lautstärke und Richtung nach musste sich der Leiter der Kriminaltechnik in der Nähe des etwa hundert Meter entfernten Speisesaals aufhalten. Und tatsächlich, als er mit Liebmann dort eintraf, wartete Leybold vor den Sandsteinstufen des historischen Gebäudes und deutete auf ein zusammengelegtes Bündel Kleider.
«Schätze mal, die gehören zu eurem Kunden. Seltsam ist nur, dass es sich nur um einen Teil seiner Klamotten handelt.»
«Wieso nur einen Teil?», hakte Basler nach.
«Na, hier liegt nur die Unterwäsche, die Strümpfe, Hose und Schuhe. Etwas für obenrum, also einen Pulli oder Mantel, suchst du vergebens.»
4
Der Kontrast zu einem beinahe zwei Meter großen Hünen wie ihm hätte kaum deutlicher sein können. Basler schätzte die Körpergröße der Frau auf höchstens eins fünfzig. Mit müden Augen blickte sie im Vorraum der Sektionshalle zu ihm auf. Wahrscheinlich hatte sie die letzte Nacht aus Sorge nicht geschlafen. Und jetzt war die Sorge einer traurigen Gewissheit gewichen.
Schwer atmend stand Tatjana Schad mit dem Rücken zur Fensterfront. Während sie Luft holte, spannte die Haut über ihrem spitz hervorstehenden Brustbein dermaßen stark, dass Basler befürchtete, ihr Dekolleté könne feine Risse bekommen. Obwohl sie als Pflegedienstleiterin den Anblick von Leichen gewohnt sein musste, hatte sie die Identifizierung Konstantin Fabers sichtbar mitgenommen.
«Mir ist immer noch ein Rätsel, wie er das Gelände verlassen konnte. Niemand hat sein Verschwinden beobachtet.»
«Frau Schad», sagte Liebmann, bemüht, ein mitfühlendes Lächeln aufzusetzen. «Sie können doch unmöglich jeden Ihrer Bewohner rund um die Uhr beaufsichtigen … und auch nicht das Seniorenstift hermetisch abriegeln.»
«Aber …», widersprach die Pflegedienstleiterin, «… aber unser Herr Faber war Alzheimerpatient. Da muss man schon besonders aufpassen.»
«Meine Kollegin hat recht», mischte sich Basler ein. «Selbstvorwürfe helfen jetzt nicht weiter. Doch bevor wir Ihnen gleich nach Sasbach folgen, würden wir gerne noch ein paar Fragen klären.»
Auf ihr stummes Nicken hin wanderte Tatjana Schads Blick zu dem kleinen Lederrucksack, den ihre feingliedrigen Hände wie einen Schild vor ihren Oberkörper hielten.
«Soweit ich mich erinnere, erwähnten Sie gestern am Telefon, dass Herr Faber nur einen einzigen noch lebenden Angehörigen hat.»
Tatjana Schad nickte erneut. Dann nannte sie den Namen Bernhard Meister, ein Neffe des Ermordeten, der in Berlin wohne.
«Hat Herr Faber keine Kinder?»
«Nein», antwortete Tatjana Schad, ihren Blick wieder vom Rucksack hebend. «Er war doch katholischer Pfarrer.»
Ein merkwürdiger Zufall, dachte Basler: Beim Anblick des Toten hatte er unweigerlich an den Film Im Namen der Rose denken müssen. Und jetzt stellte sich heraus, dass Faber tatsächlich Geistlicher gewesen war.
«Bekam Herr Faber ab und zu Besuch von seinem Neffen?»
«Eigentlich nie. Weder von ihm noch von anderen.»
«Hat er jemals über persönliche Kontakte gesprochen, die er früher gehabt hat?»
Eine Frage, die die Pflegedienstleiterin verneinte. Sie habe sich immer etwas gewundert, dass der Herr Pfarrer nie über Persönliches gesprochen habe, da er von Natur aus eigentlich redselig gewesen sei. Auch wenn man nie richtig habe wissen können, was man ihm nun glauben sollte oder nicht. Als Konstantin Faber in das Seniorenstift gezogen sei, habe er bereits unter Alzheimer gelitten. Manchmal, sagte Tatjana Schad, sei er infolge seiner Krankheit auch ungewollt komisch gewesen. Habe fabuliert, dass er früher berühmt und berüchtigt gewesen sei, ohne erklären zu können, worauf sich sein angeblich verwegener Ruf begründe. Beim Kaffeeklatsch habe er schon mal das ‹Beichtgeheimnis› verletzt und verkündet, dass der Herr Oberbürgermeister im Edeka heimlich gestohlen habe. Und gerne habe er auch seiner Tischnachbarin Frau Böhnke mit einem geheimnisvollen Sklavenhaus Angst gemacht, das angeblich früher in Damm existierte.
«Und was war in der Zeit, bevor er zu Ihnen gekommen ist? Haben Sie darüber Informationen?»
«Viel weiß ich darüber nicht», erwiderte Tatjana Schad und schaute sie mit ihren kastanienbraunen Augen an, die ihr, in Kombination mit den hohen Wangenknochen, etwas leicht Slawisches verliehen.
«Ist Ihnen bekannt, ob er eine eigene Gemeinde gehabt hat? Und wo er aufgewachsen ist?»
Frau Schad dachte einen Moment lang nach, bevor sie antwortete. «Ich erinnere mich da an ein längeres Gespräch, das ich mit seinem Neffen geführt habe, als er ihn angemeldet hat. Wissen Sie, es gehört zur Philosophie unseres Hauses, dass wir uns erkundigen, mit wem wir es in unserer Einrichtung zu tun bekommen.»
Von Bernhard Meister hatte die Pflegedienstleiterin an diesem Tag erfahren, dass Konstantin Faber in Detmold aufgewachsen war. Seine Eltern waren dort Kaufleute gewesen. Schon früh musste der Junge gewusst haben, dass Pfarrer seine Profession sein würde. Mit der Inbrunst, mit der andere Cowboy und Indianer spielten, hatte er am zum Altar umfunktionierten Küchentisch Predigten gehalten. Studiert hatte er nach seinem Abitur irgendwo in Süddeutschland. In den Siebzigern war er eine Zeitlang Bundeswehrpfarrer im Saarland gewesen, bis er schließlich eine Gemeinde in Damm übernahm.
«Sie sagten vorhin», hakte Basler nach, «dass Herr Faber erst vor einem Jahr zu Ihnen gekommen ist. Wo hat er denn vorher gelebt?»
«In einer kleinen Einzimmerwohnung im Schneidmühlweg. Als er sich nicht mehr ohne fremde Hilfe vorstehen konnte, kam er zu uns.»
«Das ist doch ungewöhnlich für einen Pfarrer. Kümmert sich denn die Kirche nicht um ihre Leute?»
«In Fabers Fall brauchte sie das nicht. Er hatte ja seinen Neffen, der für die Kosten aufkam.»
Erstaunt zog Basler seine Brauen nach oben. «Dann ist Herr Meister aber ein sehr großzügiger Neffe.»
«Wie man’s nimmt. Er musste großzügig sein. Ihm blieb keine andere Wahl. Und daraus hat er in unserem Gespräch auch keinen Hehl gemacht. Es war das Vermächtnis seiner Mutter, dass er, wenn er ihr Erbe antritt, den Onkel bis zu dessen Lebensende versorgen muss.»
Basler wechselte einen raschen Blick mit Liebmann. Es war anzunehmen, dass sie Ähnliches dachte wie er. Durch Fabers Tod musste Bernhard Meister das Vermächtnis seiner Mutter nicht länger erfüllen und sparte so monatlich Miete von mehreren tausend Euro, die der Aufenthalt in der Residenz Sonnenblick sicherlich kostete.
«Mir fällt da aber noch etwas ein, das mir Herr Meister erzählt hat», unterbrach Tatjana Schad Baslers düstere Überlegungen.
«Es war, als ich mich nach traumatischen Erlebnissen oder Einschnitten im Leben unseres neuen Bewohners erkundigte. Da hat Herr Meister mit seiner Antwort ein wenig gezögert. Und erst als ich ihm versicherte, dass diese Informationen bei der Betreuung von Senioren sehr wichtig sein können, da hat er mit der Sprache herausgerückt und etwas Seltsames berichtet. Angeblich hat der Herr Pfarrer vor etwa zwanzig Jahren mit dem Gedanken gespielt, sein Kirchenamt niederzulegen.»
«Wieso denn das?», fragte Basler verwundert nach.
Das wisse sie nicht, antwortete Tatjana Schad. Aber laut Mutmaßung des Neffen habe dieser vermeintliche Entschluss nichts mit einer Frauengeschichte zu tun gehabt, wie es ja häufig der Fall sei, wenn Priester aussteigen wollten. Eines Tages war Konstantin Faber verzweifelt bei seiner Schwester in Norddeutschland aufgetaucht. Von Hinschmeißen war die Rede gewesen und davon, dass er irgendwo, wo ihn niemand kannte, Schafhirte werden wollte. Seine Schwester musste ihm gehörig ins Gewissen geredet haben. Im Anschluss an diesen Besuch verschwand er fünf Tage. Niemand wusste, wo er sich in dieser Zeit aufgehalten hat. Seine Kirchengemeinde hatte er einfach im Stich gelassen. Schließlich war er plötzlich und ohne jede Erklärung wieder in der Pfarrei erschienen.