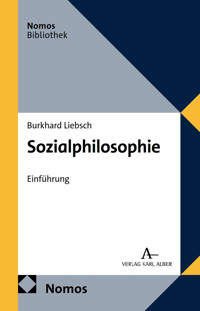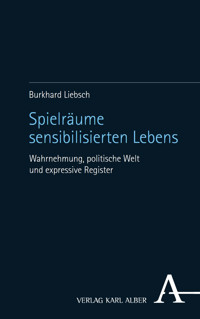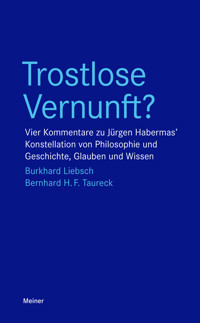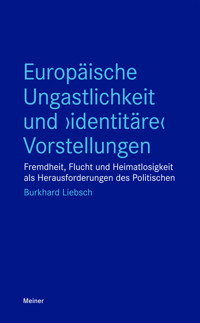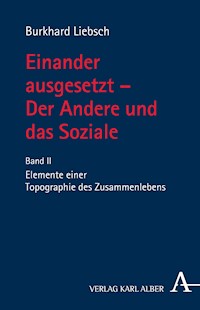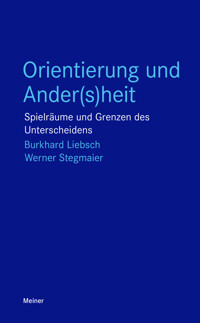
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erprobt eine neue Form philosophischen Schreibens: In sechs abwechselnd verfassten Kapiteln bringen die beiden Autoren, jeder in differenten Perspektiven und auf seine Weise, die sie gemeinsam berührende Frage zur Sprache: Kann man sich an Alterität, an Andersheit orientieren? Order unterläuft sie auf irritierende Art und Weise unsere Orientierungsbedürfnisse? Jede(r) Andere sei in ihrem bzw. in seinem Anderssein zu achten, so lautet eine verbreitete Forderung, die uns eine verbindliche Orientierung an der Alterität, Verschiedenheit oder Fremdheit Anderer nahegelegt. Darin liegt jedoch auch ein erhebliches Irritationspotenzial. Kann man sich an Anderen als solchen wirklich orientieren, wenn ihr Anderssein unaufhebbar bleibt? Verlangt Letzteres nach Orientierung und bietet es Orientierung, oder muss sich ein auf Orientierung elementar angewiesenes Leben gegen die von unaufhebbarer Alterität ausgehende Irritation durchsetzen? Versprechen nur Unterscheidungen in gewissen Spielräumen und Grenzen von einer Übermacht radikaler, nicht selten verabsolutierter Alterität zu befreien, die andernfalls auf fragwürdige Formen von Unterwerfung und Heteronomie hinauszulaufen droht? Das sind brisante Fragen, deren Bedeutung dieses Buch in einem Dialog zwischen den Verfassern beleuchtet. Es bezieht dabei zwei bislang noch kaum miteinander verknüpfte Diskussionsfelder aufeinander: die differenztheoretisch beschriebene Alterität des Anderen einerseits und durch Weisen des Unterscheidens strukturierte Orientierungen andererseits, ohne die unser Leben schlechterdings nicht auskommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Liebsch / Werner Stegmaier
Orientierung und Ander(s)heit
Spielräume und Grenzen des Unterscheidens
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
ISBN (PDF) 978-3-7873-4116-0
ISBN (ePub) 978-3-7873-4154-2
www.meiner.de
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2022. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbHFür Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
INHALT
Vorwort
Einleitung
Kapitel I · Orientierung durch Unterscheiden
Anhaltspunkte bei Nietzsche, Wittgenstein und Luhmann
Werner Stegmaier
Einleitung. Orientierung in unübersichtlichen Situationen: Unterscheidung als Prozess und Produkt
1. Unterscheiden als Prozess der Abgrenzung: Grenzen als Anhaltspunkte der Orientierung
2. Unterscheiden als Prozess der Abgleichung: Gleichsetzungen zur Vereinfachung der Orientierung
3. Unterscheiden als zeitlicher Prozess: Zeit der Neuorientierung
4. Alternativität des Unterscheidens: Entscheidungen zwischen Unterscheidungen und zwischen ihren Seiten
5. Asymmetrisierung des Unterscheidens: Wertungen als Halt in Unterscheidungen
6. Selbstunterscheidung im Unterscheiden: Distanz zum Gegenstand des Unterscheidens
7. Unterscheiden durch Sprache: Spielräume für Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit
8. Grenzen des Unterscheidens: Paradoxie und Anderheit
9. Unterschied als Produkt: Denken von Begriffen, Identitäten und Entitäten
10. Ordnungen aus Unterschieden: Unkontrollierte und kontrollierte Verallgemeinerungen
11. Agonale Ordnung von Orientierungen: Positionierung auf einer Seite von Unterscheidungen
12. Digitalisierung von Unterscheidungen: Technische Standardisierung globaler Orientierungsprozesse
Kapitel II · Das Auftauchen der Frage nach dem Anderen in radikaler Krisis der Welt
Alterität und Orientierung im Ausgang vom Werk Hermann Brochs
Burkhard Liebsch
1. Welt und Wirklichkeit nach der Zerstörung des Kosmos
2. Das Gegebene, Unterscheiden und Vergleichen
3. Erschüttertes Weltvertrauen
4. ›Du‹ und der Andere als solcher: Ende der Alteritätsvergessenheit?
5. Flucht in die Abgeschiedenheit und das Pathos der Erfahrung
6. Die Frage nach dem Anderen – in entweltlichter Welt und entwirklichter Wirklichkeit
7. Zwischen Literatur und Philosophie
8. Direkter Ansatz bei der Begegnung mit Anderen als solchen: Dialogisten und Sozialphänomenologen bis hin zu Emmanuel Levinas
9. Diskretes Nicht-Wissen – nicht-privativ vorgestellt
10. Bezeugte Alterität als bloßer ›Rest‹?
11. Orientierung im Unübersichtlichen durch ›Beobachtung‹?
12. Chiasma von radikaler Alterität und Orientierung
Kapitel III · Orientierung an Alterität
Werner Stegmaier
Einleitung
1. Die Welt, in der wir uns orientieren: Sich-Zurechtfinden in und Bewältigen von Situationen
2. Selbst-Beobachtung: Beobachten des Beobachtet-Werdens
3. Andere in der eigenen Welt: Orientierung am Gesicht des Andern
4. Orientierung als Sich-Ausrichten auf Alterität: Alltägliche Orientierungstugenden
5. Ethische Orientierung an Alterität: Infragestellung der eigenen Moralität durch andere Moralitäten
6. Politischer Umgang mit Alterität: Abstimmung statt Übereinstimmung mit Anderen
Kapitel IV · Nach dem (befreienden) Verlust eindeutiger Weltdeutungen
Unterscheidbare Alterität des Anderen als Surrogat?
Burkhard Liebsch
1. Vom metastabilen kósmos zur Radikalität des Unterscheidens
2. Der Name der Rose: Umberto Ecos Dekonstruktion ›mittelalterlicher‹ Orientierung
3. Anthropologische Konsequenzen: Von menschlicher ›Unbestimmtheit‹ bis hin zu Hans Blumenbergs Beschreibung des Menschen
4. Zur Sozialphilosophie menschlicher Alterität
5. Alterität als Orientierung und maßgeblicher Unterschied?
Kapitel V · Bilanz A
Angewiesenheit von Orientierung und Alterität aufeinander
Werner Stegmaier
1. Keine ›absolute Orientierung‹
2. Alteritätszugewandte Orientierung
3. Orientierung an Alterität im akademischen Diskurs
Kapitel VI · Bilanz B
Alterität, Orientierung und die Frage nach einer bewohnbaren Welt
Burkhard Liebsch
1. Alterität als umstrittene Kategorie oder als Widerfahrnis
2. Jenseits oder diesseits des Wissens
3. Alterität angewiesen auf Orientierung – in Perspektiven der Teilnahme und der Beobachtung
4. Normative Implikationen?
Siglen
Anmerkungen
Namenregister
VORWORT
Als ein elementares »Bedürfnis der Vernunft« galt es Kant, sich zu orientieren: physisch im »Gefühl eines Unterschiedes« am »eigenen Subjekt«, das die Himmelsrichtungen richtig bestimmen kann, aber auch geistig im »Raume des Übersinnlichen«, wo tiefe Nacht herrscht, wie er meinte. In jedem Fall sollte man sich selbst orientieren, selbst denken und nicht in womöglich selbst verschuldeter Unmündigkeit verharren. Als Unmündigkeit, Konformismus oder gar Hörigkeit würde man wohl heute noch eine unbedachte Orientierung an Anderen bezeichnen, gegen die sich Kant indirekt gewandt hatte. Dagegen ist etwa ein Jahrhundert später die kritische Orientierung an Anderen zu einem Politikum geworden. So beruft man sich oft auf Rosa Luxemburg, die postulierte, unsere Freiheit sei in erster Linie »die Freiheit des Andersdenkenden«, womit sie auch die Anderslebenden und -liebenden gemeint haben könnte, wie sie heute im Zentrum einer inklusiven »Politik der Differenz« stehen, die alle – einschließlich ihrer unabsehbaren Verschiedenheit – anerkannt sehen will und niemanden ›zurück-‹ bzw. ›draußenlassen‹ möchte. So, hoffen viele, könnte es endlich möglich werden, »ohne Angst verschieden« zu sein bzw. zu bleiben oder zu werden, wie es schon Theodor W. Adorno in seinen Minima Moralia verlangte, ohne damit eine bloße Utopie im Auge zu haben.
Wie auch immer es um die konkreten Realisierungsperspektiven einer solchen Politik bestellt sein mag, sie plädiert gewiss nicht für Fremdbestimmung anstelle der Selbstbestimmung, die Kant als Mündigkeit des Bürgers forderte. Und dennoch suggeriert sie eine früher nicht gekannte Maßgeblichkeit des ›Anderen‹ als solchen und scheint uns ans Herz zu legen, sich an seinem Anderssein zu orientieren. Wäre eine Politik, die jedem in Anbetracht seines Andersseins auf diese Weise gerecht zu werden verspricht, nicht angebracht? Oder sind alle Anderen nicht auf unübersehbare Weise ›anders‹, so dass allein damit, d. h. mit ihrer Alterität, keine ohne Weiteres konkretisierbare Orientierung zu verknüpfen wäre?
Kann oder soll man sich an Anderen orientieren, wenn sie sich auch als ›ganz anders‹ und derart fremd herausstellen können, dass es keinerlei ›Gemeinsamkeit‹ mit ihnen geben zu können scheint? Führen uns solche Fragen womöglich in religiöses Gelände, wo niemand definitiv zu sagen weiß, ob ein ›radikal‹ oder gar ›absolut‹ Anderer überhaupt existiert (wenn nicht im theologisch längst liquidierten ›Himmel‹), ob man ihm je ins Angesicht sehen oder unter die Augen treten kann oder ob es sich letztlich nur um eine gespenstische Vorstellung handelt, die uns vielleicht gewisse ›Ahnen‹ eingeflüstert haben, wie Paul Ricœur zu bedenken gab?
Schon diese Fragen machen deutlich, welch gewaltiges Irritationspotenzial in Begriffen wie Verschiedenheit, Differenz, Ander(s)-heit oder Alterität liegt. In der Gegenwart sind sie zu Leitfragen einer wirkungsvollen Identitätspolitik geworden. Sie soll für Entdiskriminierung sorgen, führt zugleich aber zu neuen Diskriminierungen, weil auch und gerade hier unterschieden werden muss. Desorientiert sie mehr als sie orientiert? Wäre da nicht zu klären, was Orientierung an Ander(s)heit und darüber hinaus Orientierung überhaupt bedeutet und was sie leisten kann? Es liegt nahe, sich dazu an die umfassende Philosophie der Orientierung zu wenden, die Werner Stegmaier 2008 vorgelegt hat. Auf der andern Seite aber muss man prüfen, ob die Andersheit der Anderen oder ihre in begrifflichen Unterscheidungen nicht mehr fassbare ›Anderheit‹ das Sich-Orientieren im Denken, wie Kant es nannte, nicht so irritiert und desorientiert, dass sie damit ›nicht fertig wird‹. Das Ergebnis könnte sein, dass das Einander-ausgesetzt-sein, wie es Burkhard Liebsch zuletzt ausgelotet hat, zu kreativen Neuorientierungen führt, die die aufklärerische Vernunft nicht leisten kann.
Die Philosophie der Orientierung findet wichtige Anhaltspunkte bei Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein und Niklas Luhmann, die Philosophie der Ander(s)heit oder Alterität bei Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Paul Ricœur. Orientierung und Alterität sowie dabei auch diese Autoren produktiv aufeinander zu beziehen, ist noch nicht versucht worden. Das soll in diesem schlanken Buch geschehen. Wir tun das in sechs aufeinanderfolgenden Beiträgen, in denen wir uns schrittweise weiter auf Ansätze des jeweils anderen beziehen und uns von ihnen zu denken geben lassen, ohne eigene dabei sogleich aufzugeben. So differenzieren sich beide Ansätze im Zeichen des andern. Dabei kommen auch Grundfragen des Sozialen und des Politischen ins Spiel. Ausgangspunkt ist das Unterscheiden als solches, die Orientierung durch Unterscheiden. Am Ende steht die offene Frage, wie Normen der Orientierung an Anderen damit zu verknüpfen sind.
Bochum und Greifswald, im August 2021
Burkhard Liebsch und Werner Stegmaier
EINLEITUNG
Womit auch immer wir in unseren Wahrnehmungen, Vorstellungen und Urteilen zu tun haben, unterscheiden wir oder ist schon unterschieden. Wo nichts unterschieden ist oder nichts sich unterscheidet, kann man sich dazu nicht verhalten. Dann tritt Orientierungslosigkeit ein, die zunächst Irritation, dann Verunsicherung, in bedrohlichen Situationen Angst und, wenn die Angst anhält, Verzweiflung und Depression auslöst. Kennt man sich nicht mehr aus, verstrickt man sich, so Wittgenstein, notorisch in philosophische Probleme.
Doch dahinter könnte selbst ein philosophisches Problem stecken, das auch Wittgenstein nicht mehr gestellt hat. Orientierungsschwierigkeiten werden, wenn sie nicht psychotischer Natur sind, meist rasch bewältigt. Aber wenn Sich-orientieren-Können zunächst einmal Unterscheiden-Können ist, beginnend mit Rechts und Links, Oben und Unten etc. und endend mit grundlegenden philosophischen Unterscheidungen, was heißt dann Unterscheiden? Wie funktioniert es und wodurch ist es möglich? Könnte es selbst ein, wenn nicht sogar das Problem sein? Worin und warum kann es versagen? Wenn wir durch Unterscheiden Wirklichkeit erschließen, wie verbürgt es die Wirklichkeit, die sich dadurch zeigt? Hat die Orientierung durch Unterscheiden Grenzen und wenn ja, wo? Darin, dass wir unvermeidlich individuell, von unseren jeweiligen Orientierungsstandpunkten aus unterscheiden und sich so überall Differenzen auftun? Oder an der Unbegreiflichkeit von Gegebenem schlechthin im Sinne von Hans Blumenberg? Wie gehen aus Unterscheidungen Begriffe hervor? Was sind und was veranlasst Begriffsbildungen? Was geschieht in Situationen, in denen die gewöhnlich gebrauchten Unterscheidungen und Begriffe nicht ausreichen? Wenn Unterscheidungen und Begriffe, um brauchbar zu sein, situationsgerecht sein müssen, gibt es da ein Maß der Situationsgerechtigkeit und der Feinheit des Unterscheidens? Wenn aber Menschen zuletzt unbegreiflich füreinander sind, wird dann jedes Unterscheiden und Begreifen Anderer nicht übergriffig?
Die Risiken des Unterscheidens durch Begriffe und des Übergriffig-Werdens des Begreifens kommen als theoretisches Problem in Sicht, wo es darum geht, ob man in schwer zu übersehenden Situationen ›die Sache trifft‹. In der herkömmlichen Erkenntnistheorie blieb das jedoch am Rande. Nichtsdestoweniger bekommt man es als praktisches Problem zu spüren in Kommunikationssituationen, in denen man mit seinen Unterscheidungen, die man arglos ›treffen‹ mag, andere ›treffen‹, nämlich ›verletzen‹ kann. Schon Platon hat das in einigen seiner Dialoge vorgeführt; voll bewusst wurde es im Zug der modernen Demokratisierung der westlichen Gesellschaften, als Einordnungen in vorgegebene Rangordnungen ihre Selbstverständlichkeit verloren. Seither ist die Aufmerksamkeit auf das Unterscheiden als solches gewachsen, wird immer mehr Unterscheidungssensibilität erwartet. Die aktuelle Gender-Debatte um Identitäten und Identifikationen könnte Ausdruck dieser fortschreitenden Sensibilisierung sein. Und gerade jetzt wappnet man sich wieder mit begrifflichen Festlegungen, die ihrerseits verletzen können.
Wenn zur Orientierung Unterscheidungen von unvermeidlich verschiedenen Orientierungsstandpunkten aus und in unterschiedlichen Perspektiven getroffen werden, man aber miteinander kooperieren will und kann, muss man sich beim Sich-Orientieren durch Unterscheiden immer auch an anderen orientieren; sonst bleibt man in seiner Orientierungswelt allein. Auch bei beiderseitigem Willen zur Kooperation können jedoch aus den Unterschieden der Orientierungsstandpunkte und -perspektiven, die oft erst im Zug der Kommunikation deutlich werden, ›Differenzen‹, Unstimmigkeiten entstehen, die beunruhigende Widersprüche aufbrechen lassen, das gemeinsame Handeln stören und manchmal zu ernsthaften und bedrohlichen Streitigkeiten zwischen Personen und Gruppen, wenn nicht zu Gewalt führen. Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten können nur scheinbar sein und zum Schein beruhigen. In der Orientierung an anderen Orientierungen, denen wir von Kind auf zu folgen gewohnt sind, erlahmt leicht die Sensibilität für die Situationsgerechtigkeit des Unterscheidens, und ›die Wirklichkeit‹, die dadurch verfehlt wird, kann dann ›zurückschlagen‹ – und nicht nur in der Kommunikation in Gestalt von mehr oder weniger heftigen Reaktionen des Anderen, sondern auch in dem, was wir ›Natur‹ nennen: Auch die ökologische Krise nach jahrhundertelangen schweren Eingriffen in sie ist ein schlagendes Beispiel für Fehlorientierungen an nicht hinreichend bekanntem Anderem. Möglicherweise haben die Gender-Debatte und die ökologische Krise, die wenig miteinander zu tun zu haben scheinen, beide im Problem der Orientierung durch Unterscheiden ihre Wurzel. Es könnte, obwohl es keineswegs neu ist, das aktuellste philosophische Problem sein.
Hier spätestens stellt sich das Problem der Alterität. ›Alterität‹ nennen wir heute die ›Andersheit‹ jenseits begrifflicher Unterscheidbarkeit oder, um sie von der Andersheit von begrifflich Unterschiedenem zu unterscheiden, die ›Anderheit‹. Sie wird unmittelbar und am stärksten unter Menschen erfahren. Jeder Mensch ist immer noch ›anders‹, als man ihn durch begriffliche Identifikationen, Registrierungen, Rubrizierungen, Einordnungen jeder Art unterscheiden kann. Die Anderheit aber, die man gerade bei solchen Identifizierungen erfährt, stellt philosophisch den Zugriff durch Unterscheidungen überhaupt in Frage. Sie verlangt in jedem Fall Differenzsensibilität, nicht nur generell als Sensibilität des Unterscheidens, sondern auch und vor allem als Sensibilität in Anbetracht der radikal fraglichen Unterscheidbarkeit und Bestimmbarkeit Anderer als solcher.
Der phänomenologische Befund ist deutlich: In persönlichen Kommunikationen wollen mündige Menschen nicht der subtilen Gewalt der Unterscheidungen anderer unterworfen werden; wird man von anderen auf die offenkundige oder subtile Gewalt seiner eigenen Unterscheidungen aufmerksam gemacht, kann das ebenso bedrücken. In kritischen Situationen wird man dann fragen, in welchen Grenzen Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten überhaupt notwendig sind und, wenn sie fraglos vorausgesetzt oder ausdrücklich eingefordert werden, ob man nicht daran arbeiten muss, jeweils die Anderheit des Anderen zu wahren. In modernen demokratischen Gesellschaften wird das sichtlich zu einem hohen Gut.
Aus potenziell destruktiven Streitigkeiten über einen nicht erreichbaren Konsens können konstruktive Kontroversen, Dialoge, Kompromisse und Kooperationen hervorgehen. In Kontroversen verteidigt man eigene Überzeugungen. Sie können zu Dialogen werden, in denen man bereit ist, auch Prinzipien zur Disposition zu stellen; das geschieht meist in Kompromissen, die dann Kooperationen auch jenseits von Konsensen ermöglichen. Kompromisse sind inzwischen so selbstverständlich geworden, dass sie jederzeit als ›zumutbar‹ empfunden werden; man erwartet, dass jede und jeder ›mit Kompromissen leben‹ kann. Dennoch kann man unter ihren Zumutungen leiden; die Übergriffigkeit der Unterscheidungen und Begriffe anderer, denen man sich unterworfen hat, bleibt als fortdauerndes Unbehagen an ihnen spürbar. ›Richtet‹ man sich mit ihnen ›ein‹, können daraus Dauerdiskrimierungen erwachsen: Die anhaltenden Diskriminierungen Andersfarbiger, Andersgläubiger und Andersdenkender sind hier die signifikantesten Beispiele.
Man hat uns beigebracht, hier Toleranz zu üben, mit Toleranz zu antworten. Toleranz kann jedoch auch so verstanden werden, dass sie sich auf ein bloßes Ertragen beschränkt. Dann mindert man wohl die Leiden an Diskriminierungen, geht ihnen aber nicht kritisch auf den Grund und macht sie nicht konstruktiv fruchtbar. Das Nachdenken über Alterität, das auch in der praktischen Philosophie lange am Rand blieb, muss hier weitergehen. Wir haben inzwischen vor allem von Philosophen wie Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Paul Ricœur, aber auch von Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Waldenfels gelernt, dass der Anspruch Anderer ›unter die Haut geht‹, bevor man sich ihnen begrifflich unterscheidend und vergleichend zuwendet, und dass man in der Zuwendung zu ihnen gar nicht frei ist, sondern die Sensibilität des Unterscheidens als eine Verpflichtung erfährt, die rechtliche und staatliche Verpflichtungen überbieten oder auch unterlaufen kann. Die Erfahrung der Alterität kann eingespielte Orientierungen erschüttern, und manchmal, wie in Fällen massiver staatlicher Übermächtigungen, ist sie die letzte Instanz, um diese zu erschüttern. Unser Bestehen auf universalen Menschenrechten gibt uns wohl einen starken Halt in unserer zwischenmenschlichen Orientierung. Aber hinter allgemeinen Rechten stehen einzelne Menschen, denen die Gerechtigkeit letztlich gerecht werden muss. Sie darf in einer Orientierung an der Alterität kein Abstraktum sein.
Wir wollen das Problem der Alterität also produktiv wenden: Kann man sich an Alterität und mehr noch: durch sie orientieren? Oder geht sie unvermeidlich mit einem gewissen Desorientierungspotenzial einher? Diese Fragen entfalten sich in einem ganzen Fragenkatalog: Bietet Anderheit Anhaltspunkte für die eigene Orientierung, um ihr gerecht zu werden? Ermöglichen Orientierung und Alterität einander oder schränken sie einander ein? Oder sind sie sogar aufeinander angewiesen? Wo liegt die Verantwortung dafür und wie konstituiert sich diese Verantwortung? Wo, bei wem in der Geschichte und der Gegenwart der Philosophie, in anderen Wissenschaften oder in der Literatur kann man dafür weitere Anhaltspunkte finden? Kann eine Philosophie der Orientierung anschlussfähig auch für ein Denken der Alterität sein oder fordert die Alterität eine Umkehrung im Denken der Orientierung? Und wenn wir auf den bisherigen philosophischen Diskurs der Moderne blicken: Ist das für die ›Lebbarkeit‹ des Lebens unabdingbare Unterscheiden der Lebenssituationen, der Handelnden in ihnen, der Handlungsspielräume, die sie lassen, und der Handlungszwänge, die sie ausüben, noch zusammenzubringen mit mehr oder weniger souverän unterscheidenden und entscheidenden Subjekten? Wie unterscheiden sich solche Subjekte selbst in der menschlichen Orientierung und wie nehmen sie dabei Bezug auf andere Subjekte und Rücksicht auf sie? Kann man das mit den geläufigen philosophischen Positionierungen durch -ismen abmachen? Sind Selbstpositionierungen durch solche -ismen auf der einen und Identifizierungen Andersdenkender durch sie auf der andern Seite nicht schon Abschottungen gegen die Alterität oder bestenfalls Ausdruck ihrer Tolerierung?
Die beiden Autoren dieses Buches versuchen die schwierigen Spannungsverhältnisse auszuloten, die sich zwischen den noch weitgehend getrennt voneinander diskutierten Grundbegriffen Orientierung und Alterität auftun. Dabei schwebt uns keine Synthese heterogener ›Positionen‹ vor, sondern ein Diskurs, in dem wir in einander kreuzenden Beträgen einander zu denken gegeben haben, wie einerseits Alterität Orientierungsprobleme aufwirft oder auch zu lösen verspricht und wie andererseits die menschliche Orientierung auf Alterität antworten kann, es aber auch mit einer radikalen Alteritätsproblematik zu tun bekommt, die sich nicht in ihr aufheben lässt.
Wir – der eine mehr in einer Beobachterperspektive auf Orientierungen, der andere mehr teilnehmend an Verstrickungen in Alterität – wollen das durch die beiden Gravitationspunkte Alterität und Orientierung markierte hochkomplexe Themenfeld sondieren und vermessen. Dadurch sollen auch die gegenwärtigen Identitätsdiskurse einen philosophischen Rahmen bekommen. Als Zeugen werden wir immer wieder einerseits Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein und Niklas Luhmann, andererseits Jacques Derrida, Emmanuel Levinas und Paul Ricœur aufrufen, deren heterogene Philosophien so im Lichte der jeweils anderen ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen erkennen lassen.
Mit unserem Dialog, der manchmal zur Kontroverse wird (und umgekehrt), riskieren wir eine neue Form philosophischer Schriften: Zwei Autoren schreiben über ein sie gemeinsam berührendes Thema, aber jeder in differenten Perspektiven und auf seine Weise, jeder anders. Die Alterität bleibt auch hier gewahrt. Wir haben uns jedoch entschieden, die sachlichen Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen; ein unmittelbarer persönlicher Austausch wie in einem sokratischen Dialog wäre wegen der grassierenden Corona-Pandemie zur Zeit der Entstehung des Buchs gar nicht möglich gewesen; künstlich inszenieren wollten wir ihn nicht. Wir legen sechs Kapitel vor, die, wechselnd vom einen und vom anderen verfasst, in drei Runden Schritt für Schritt aufeinander antworten, ohne ein vorgefasstes Programm abzuarbeiten: Die Gedanken sollten sich in der Auseinandersetzung selbst entwickeln, beide Ansätze aber auch ihre eigene Kohärenz zeigen. Die erste Runde wird eingeleitet durch einen Beitrag zur »Orientierung durch Unterscheiden« überhaupt. Auf ihn antwortet der Beitrag »Alterität jenseits des Unterscheidens«. Auf ihn folgen Vorschläge, das Denken der Alterität in das Denken der Orientierung einzubeziehen. Das lässt wiederum fragen, ob dann eine ihrerseits »unterscheidbare Alterität des Anderen« zum Surrogat der ursprünglich als »radikal« gedachten Alterität wird. In der dritten Runde werden Ergebnisse unserer Diskussion bedacht, in Gestalt wiederum zweier »Bilanzen« A und B, die einander ihrerseits die Waage halten: Danach sind Orientierung und Alterität wohl aufeinander angewiesen, wenn Menschen ihre Welt bewohnbar machen und erhalten wollen. Aber es ist offen, ob, wie und mit welchen Mitteln das bei aller jetzt denk- und erreichbaren Alteritätszugewandtheit der menschlichen Orientierung gelingen wird. Hier hätten weitere Forschungen anzuschließen.
KAPITEL I
Orientierung durch Unterscheiden
Anhaltspunkte bei Nietzsche, Wittgenstein und Luhmann
– Werner Stegmaier –
EinleitungOrientierung in unübersichtlichen Situationen: Unterscheidung als Prozess und Produkt
Wir orientieren uns, indem wir unterscheiden. Unterscheiden ist eine Orientierungsoperation, die Grundoperation der Orientierung. Orientierung und Unterscheidung sind auseinander zu verstehen.
Unterscheidungen als solche waren in der Antike und im Mittelalter ein großes Thema der Philosophie.1 Im Zug der Verrechtlichung und Demokratisierung der griechischen Stadtstaaten musste man genauer bestimmen, womit man es zu tun hat. Im Mittelalter stand man vor dem zentralen Problem der Unterscheidung eines Unbegreiflichen, Gottes. Als in der Moderne der religiöse Glaube ins Wanken kam, suchte man nach Regeln des Unterscheidens, die absolute Gewissheit gewährleisten sollten. Dabei ging es um Einheit in Hierarchien von Unterscheidungen. Seither kämpft man mit gesellschaftlich befreienden Wirkungen um Differenz und Diversität und entdeckt die Unbestimmbarkeit und Unentscheidbarkeit als Gegengewichte zur Bestimmtheit und Gewissheit. Zentrales Problem ist nun die unfassbare Komplexität der Welt und die Orientierung in ihr. Das komplexeste Organ der Welt, das menschliche Gehirn, erfindet technisch modellierbare Intelligenz ohne das Ziel eines endgültigen Wissens. Man weiß inzwischen, dass man sich immer nur vorläufig durch immer nur vorläufige Unterscheidungen orientieren kann. Orientierung und Unterscheidung rücken in den Mittelpunkt.
Sich zu orientieren heißt, sich in unübersichtlichen Situationen zurechtzufinden.2 Man geht heute davon aus, dass sich die menschliche Orientierung in laufender Auseinandersetzung mit immer neuen Situationen evolutionär entwickelt hat. Entsprechend vielfältig muss sie ihre Möglichkeiten zu unterscheiden differenziert haben. Neuro- und Informationswissenschaften, Psychologie und Soziologie machen viele Unterscheidungen der traditionellen Erkenntnistheorie obsolet, allen voran die Unterscheidung von Denken und Wahrnehmen. Sie sind selbst als Orientierungsentscheidungen in erkenntnistheoretischen Zusammenhängen zu verstehen, die sich auch anders treffen lassen. So kann man hier nicht mit einer abschließenden Theorie rechnen.3
Indem man in Situationen unterscheidet, orientiert man sich. Die Vergewisserung durch Selbstbezug hat eine lange Tradition in der Philosophie. Aristoteles’ Selbstbegründung des Satzes vom Widerspruch folgte in der Moderne Descartes’ Selbstbestätigung des Denkens im cogito sum, Kants Selbstbegrenzung der reinen Vernunft, Fichtes Selbstversicherung der Freiheit und Hegels Selbstentfaltung des Systems der philosophischen Wissenschaften. Nietzsche mit seiner Selbstentlarvung des Philosophierens als Wille zur Macht und Wittgenstein mit seiner Anleitung zur Selbsttherapie des Philosophierens fügten der Selbstvergewisserung die Seite der Selbstverunsicherung hinzu, Gödel bewies die Grenzen der Beweisbarkeit in formalen Systemen, Heidegger verunsicherte entschieden allen Halt an vermeintlich Feststehendem, Luhmann hat mit Spencer Brown das Unterscheiden selbst zum Thema des Unterscheidens gemacht, ohne noch den Selbstbezug als Selbstbegründung zu verstehen.4 Es ist Zeit, sich der Orientierung durch Unterscheiden selbst zuzuwenden.
Nach dem grimmschen Wörterbuch heißt im Deutschen5 ›unterscheiden‹ etwas mit Augen, Ohren und anderen Sinnen ›ausmachen‹, von anderem abgrenzen, z. B. ein Sternbild am Nachthimmel oder ein musikalisches Intervall (lat. discernere), metaphorisch etwas ›auseinanderhalten‹ (ähnliche Konstellationen, Dur- und Moll-Tonarten), von da aus auch etwas bezeichnen, benennen, ›unterteilen‹ (Äpfel) und Nicht-Zugehöriges nach Kriterien ›ausscheiden‹ (Birnen). Ehemals bedeutete ›unterscheiden‹ auch etwas von anderem räumlich trennen (Vögel durch Käfigwände), außerdem etwas hervorheben, betonen, deutlich machen, ausdrücklich festsetzen (ein Gebot) und etwas gegenüber anderem aufwerten (engl. distinguish). Etwas kann aber auch ›sich unterscheiden‹ (eine Farbe von einer andern), und man kann etwas ›in‹ etwas oder jemandem unterscheiden (den warmherzigen Menschen in der strengen Beamtin). Und so kann man auch sich von anderen dadurch abheben, also unterscheiden, dass man bei etwas oder jemandem einen Unterschied macht, wo andere keinen machen oder sehen, sich also selbst durch Unterscheiden von anderen unterscheiden.
All diese Spielarten des Unterscheidens, die in der alltäglichen Kommunikation, wenn auch oft schwer unterscheidbar, im Spiel sind, wurden in Wissenschaft und Philosophie mitsamt ihrem Orientierungswert bisher weitgehend ausgeblendet. Jürgen Mittelstraß etwa legt die wissenschaftliche Unterscheidung auf die »fundamentale Sprachhandlung der Prädikation« »in behauptender Intention« und mit »Begründungsverpflichtungen« fest und stellt »Orientierungen« als »pragmatische Unterscheidungen […] in bezug auf bestimmte Situationsmerkmale« daneben.6 Niklas Luhmann hat stattdessen im Rahmen seiner soziologischen Systemtheorie und im Anschluss an die mathematikförmigen Laws of Form von George Spencer Brown7 eine Theorie der Beobachtung entwickelt, in der die Zweiseitigkeit, Entscheidbarkeit und Prozessualität des Unterscheidens zur Geltung kommt8, und sein Schüler Dirk Baecker und dessen Schüler Athanasios Karafillidis haben sie weiterentwickelt.9 Die systemtheoretische Schule bekennt sich insgesamt zum ›Konstruktivismus‹: Sie löst die Theorie der Unterscheidung von der metaphysischen Ontologie ab, indem sie statt bei scheinbar an sich vorhandenen Gegebenheiten oder Begebenheiten bei Kommunikationen über sie ansetzt.
Für die philosophische Erschließung der Funktion des Unterscheidens in der menschlichen Orientierung reicht das jedoch nicht aus. Denn erstens umfasst Orientierung weit mehr als die Kommunikation mit anderen, und zweitens stößt das ›Konstruieren‹ von Unterschieden in unübersichtlichen Situationen rasch an Grenzen. Nietzsche einerseits und der späte Wittgenstein andererseits führen hier weiter. Auch wenn sie den Begriff selbst kaum gebrauchen, haben sie am vorurteilslosesten über die Bedingungen des Unterscheidens in der menschlichen Orientierung nachgedacht. Bei Nietzsche, Wittgenstein und Luhmann finden sich die stärksten Anhaltspunkte zum Thema Orientierung durch Unterscheiden.
Angeregt von Spencer Brown und Luhmann haben jüngst auch Dirk Rustemeyer und Katrin Wille unabhängig voneinander »Weisen des Unterscheidens« unterschieden.10 Auch sie setzen nicht schon eine Metaphysik, Epistemologie und Logik, keine irgendwie geartete Ordnung der Welt voraus, sondern fokussieren auf den Prozess des Unterscheidens selbst, um dessen vielfältige Produktivität zu erschließen. Sie wollen erkunden, wie Ordnung durch Unterscheiden zustande kommt, ohne dabei auf eine Gesamtordnung der Welt oder der Gesellschaft aus zu sein, die sich eine solche entwirft. Katrin Wille hält sich dabei an den Rahmenbegriff der Praxis, die sie anhand der Unterscheidung von Wunsch und Wille illustriert, Dirk Rustemeyer an den der Kultur, um ausführlich auch die Künste einzubeziehen. Beide setzen heuristisch auf Reihungen von »Kontrasten« und »Vergleichen« und stellen das alltägliche und ›praktische‹ Unterscheiden in den Vordergrund, dem gegenüber das wissenschaftliche und künstlerische zwar erhellende, aber nicht mehr maßgebliche Spezialfälle sind. Sie lösen sich vom Postulat der Eindeutigkeit als speziellem Bedürfnis der Logik, der Mathematik und der Wissenschaften und betonen stattdessen die unverzichtbaren Funktionen der Mehrdeutigkeit in der alltäglichen und künstlerischen Unterscheidungspraxis. Dazu gebrauchen sie wohl regelmäßig den Begriff der Orientierung, stoßen aber nicht zum philosophischen Problem der Orientierung überhaupt vor.
Das soll hier geschehen. Ich gehe den Weg philosophischer Heuristik weiter, um nun die Funktionen des Unterscheidens in der menschlichen Orientierung zu unterscheiden, und greife dabei, soweit möglich, auf bahnbrechende Einsichten in der Geschichte der Philosophie zurück.11 Ich gehe nun vom Begriff der Unterscheidung selbst aus – mit der Unterscheidung der Unterscheidung als Prozess (›unterscheiden‹) und als Produkt (›Unterschied‹). Ich beginne nicht schon wie die Luhmann-Schule mit einem Beobachter, der Unterscheidungen trifft, macht oder konstruiert – denn auch die Unterscheidung von Beobachtung (mit demselben Doppelsinn von Prozess und Produkt) und Beobachter ist schon eine Orientierungsunterscheidung –, sondern mit dem Prozess des Unterscheidens selbst. Ziel ist hier zunächst, die philosophische Unterscheidungs- und Orientierungsforschung wieder ein Stück weiterzuführen, um sie dann mit dem Denken radikaler Alterität zu konfrontieren.
1. Unterscheiden als Prozess der Abgrenzung: Grenzen als Anhaltspunkte der Orientierung
George Spencer Brown und Niklas Luhmann haben angeregt, die Unterscheidung als Handlung oder Prozess und ihr Ergebnis oder Produkt als Form zu fassen. Der Begriff der Form (morphé) gehört zum Grundbestand der Metaphysik des Aristoteles. Er soll dort die Beständigkeit der Veränderungen der Natur (physis) zum Ausdruck bringen. Veränderung wird dabei so verstanden, dass in bestehenbleibenden Formen laufend Stoff (hyle) ausgetauscht wird, in biologischen Arten die gleichförmigen individuellen Lebewesen. So wird die Form zum Wesen (ousía): Die gleichbleibende anschauliche Form der biologischen Art (eídos) ist Aristoteles’ Modell eines an sich bestehenden Allgemeinen, unter das wechselnde Individuen fallen, und damit zugleich ein logisches Modell. Sein technisches Modell der Form, etwa einer Skulptur, die in verschiedenen Materialien ausgeführt werden kann, legt die Metaphorik der Hohlform nahe, die unterschiedlich ausgefüllt werden kann. Die Verschränkung beider Modelle prägt das Denken der Form und mit ihm das philosophische Denken überhaupt bis heute: Sie lässt das Denken selbst als Form erscheinen, das verschiedenste Inhalte fassen kann und dabei selbst immer gleich, ›rein logisches‹ Denken bleibt. Noch Kant und Hegel halten fraglos daran fest.
Nach Darwin erkennt Nietzsche die Form als »flüssig« und nimmt ihr damit eben das, wofür Aristoteles sie eingeführt hatte: ihren festen Bestand.12 Ein Jahrhundert später gehen Spencer Brown und Luhmann noch weiter und setzen bei der Form als Operation der Formung an, um so ihre metaphysische Ontologisierung zu einem an sich bestehenden Wesen zu vermeiden. Sie denken die Veränderlichkeit der Form, indem sie dem geometrischen, geographischen oder geodätischen Modell der Grenzziehung folgen. Danach grenzt die Form, z. B. eine schlichte Linie im Sand oder auf Papier, lediglich zwei Seiten voneinander ab. Sie kann verwehen, durchgestrichen, ergänzt oder ersetzt werden. So wird sie zur bloßen Unterscheidung zweier Seiten und die Formung zum bloßen Unterscheiden. Obwohl die Form so nur noch abgrenzt, nicht mehr einen Inhalt umgrenzt, sprechen Spencer Brown und Luhmann weiterhin von ihrer Innen- und Außenseite. Die Innenseite soll nun die sein, um die es bei der Unterscheidung vorläufig geht, auf der etwas markiert, bestimmt und bezeichnet wird, die Außenseite das, wovon vorläufig abgesehen wird. Die Unterscheidung durch eine Form steht so nicht mehr für die Wahrheit eines Seins, sondern für die Gewichtung einer Orientierung.
Im phänomenologischen Sinn zeigt sich durch eine bloße Abgrenzung etwas als etwas (z. B. ein ›Mann im Mond‹ durch Kontraste von helleren und dunkleren Flächen auf der unebenen Mondoberfläche). Vor Aristoteles hatte Anaximander bei der bloßen Grenze (péras) angesetzt, die er vom Unbegrenzten (ápeiron) unterschied.13 Nach dem einzig von ihm erhaltenen Spruch, wortnah übersetzt: »Woraus den Seienden ihr Entstehen ist, in dasselbe entsteht auch das Vergehen, wie es sich gehört; denn sie geben einander Recht und leisten Buße für das Unrecht nach der Ordnung der Zeit«, ist Veränderung so zu verstehen, dass Grenzen in einem prinzipiell Unbegrenzten wechseln. Anaximander sieht darin noch, in rechtlich-ethischer Metaphorik, eine ausgleichende Gerechtigkeit.
Eine Grenze kann eine natürliche Grenze wie zwischen Land und Meer oder eine künstliche, eigens gezogene wie zwischen Besitztümern sein; man kann sie einerseits hinnehmen und andererseits eigens schaffen (im Beispiel eines Grenzflusses beides zugleich). Man kann die Grenzen, wiederum metaphorisch, auch von Raum und Zeit lösen und unter Verwendung der Unterscheidung von Wahrnehmen (in Raum und Zeit) und Denken (über Raum und Zeit hinaus) die Grenzziehung dem Denken zuschreiben. Denken ist für die griechische Antike eine natürliche Tätigkeit, so dass seine Abgrenzungen ihrerseits im Wesentlichen natürliche, schlicht hinzunehmende sind; das Denken weist die natürlichen Abgrenzungen lediglich auf und bringt sie in Begriffen zum sprachlichen Ausdruck.14 In letzter Konsequenz hat Parmenides so das bloße Sein gedacht – als von einem Denken gedachtes, das seinerseits dazu gedacht ist, das Sein zu denken. In diesem Sinn sind Denken und Sein, wie er sagt, dasselbe, die Unterschiede des Denkens also auch die Unterschiede des Seins, beide aber jeder Veränderung und Wahrnehmung entzogen, schlechthin beständig, schlechthin allgemein und damit schlechthinniger Halt der menschlichen Orientierung.15
Als Mathematiker und Formwissenschaftler sieht Spencer Brown ebenfalls von allen Inhalten ab. Er gibt nun einfach die Anweisung »Draw a distinction!«16 Vom Anlass der Anweisung spricht er nur andeutungsweise als von ihrem Motiv (motive) und Wert (value), später von einem Verlangen zu unterscheiden (desire to distinguish).17 Das Verlangen oder Bedürfnis zu unterscheiden ist das Bedürfnis der menschlichen Orientierung in einer Situation, in der man sich nicht auskennt und die man zu meistern hat; es war Kant, der das Sich-Orientieren in diesem Sinn als »Bedürfniß« der Vernunft in die Philosophie eingeführt hat.18 Ob und wie weit das Orientierungsbedürfnis durch eine Unterscheidung erfüllt wird, lässt sich nicht vorab bestimmen; es stellt sich erst im Fortgang des Orientierungsprozesses heraus.19 Mit anderen Worten: Die Relevanz einer Unterscheidung zeigt sich daran, dass man, wie man alltagssprachlich sagt, ›etwas mit ihr anfangen‹, das heißt die gegebene Situation so erschließen kann, dass sie dadurch erfolgreich ›bewältigt‹ wird, kurz: dass sie so orientiert, dass man ›weiterkommt‹.
Unterscheidungen werden dann zu Anhaltspunkten der Orientierung in einer unübersichtlichen Situation; auch diesen Begriff bietet schon die Alltagssprache an. Die Orientierung ›hält sich‹ an Anhaltspunkte und erfährt an ihnen zugleich die Widerständigkeit der Wirklichkeit gegen willkürliche Konstruktionen. Sie können für jede Orientierung in jeder Situation andere sein und je nach dem Orientierungsbedürfnis anders und dennoch nicht beliebig verstanden werden. Man kann sie ihrerseits unterscheiden, braucht dafür dann aber wieder Anhaltspunkte. So kommt man hinter die Anhaltspunkte einer Situation nicht zurück. Sie fallen auf (z. B. ein Kirchturm einem Wanderer, der den Weg zum nächsten Dorf sucht), werden vertrauenswürdiger, wenn weitere hinzukommen (ein Wegzeiger in der eingeschlagenen Richtung, Eintragungen auf der Landkarte). Passen sie zueinander, ergeben sie für die Orientierung Suchenden Sinn in Mustern, die wiederum zu Mustern in früheren Orientierungssituationen passen können.20
Wie Hirn- und Intelligenzforschung heute bestätigen, ist erfolgreiches Unterscheiden zunächst Erkennen von Mustern aus vorläufigen Anhaltspunkten. Neben oder hinter den entdeckten Mustern tritt anderes zurück, wird unauffällig, erscheint als nicht orientierungsrelevant. So entstehen durch Muster Grenzen im Unbegrenzten, von denen sich die Orientierung vorläufig leiten lässt. Erweisen sie sich als haltbar, glaubt man sie entdeckt zu haben, hält sie für real, an sich bestehend; wenn nicht, bleibt man vorsichtig und stuft sie als möglicherweise nur konstruiert oder fiktiv ein.
2. Unterscheiden als Prozess der Abgleichung: Gleichsetzungen zur Vereinfachung der Orientierung
Musterbildungen im Unterscheiden schließen Abgleichungen und Abgleichungen Gleichsetzungen ein. Bei Gleichem entfällt neuer Orientierungsaufwand, die Orientierung wird vereinfacht. Seit Leibniz geht man davon aus, dass es nichts Gleiches gibt, sondern dass dort Gleiches erscheint, wo man mit dem Unterscheiden aufhört (principium identitatis indiscernibilium).21 Es hängt also vom Unterscheiden selbst ab, ob etwas als gleich gilt oder nicht. Das »Gleichsetzen und Zurechtmachen«, notiert Nietzsche, »ist der Thatbestand, nicht die Gleichheit (– diese ist vielmehr zu leugnen –)«.22 Gleichsetzung beruht ihrerseits auf Vergleichung. Und Wittgenstein bemerkt: »Nimm nicht die Vergleichbarkeit, sondern die Unvergleichbarkeit als selbstverständlich hin.«23
Zum Abgleichen von Anhaltspunkten einer Situation (auch von Daten in wissenschaftlichen Erhebungen) muss man nicht schon vorab einen übergeordneten Begriff oder ein leitendes Kriterium des Vergleichs (tertium comparationis) haben; beide können sich in der Orientierung erst herausstellen. Das geschieht so, dass man zwischen Anhaltspunkten oszilliert (die Bäume dort, Birken und Buchen, stehen in einer auffallend geraden Reihe, sie könnten einen Weg markieren, das sind Alleebäume; Messwerte verteilen sich auf dem Bildschirm so, dass sie eine Parabel oder eine Hyperbel bilden könnten; meine Freundinnen reagieren auf diese Geschichte so, meine Freunde so, gibt es da geschlechtstypische Unterschiede?). Die menschliche Orientierung geht zumeist weniger deduktiv und induktiv als abduktiv im Sinn von Peirce vor. Erscheinen Anhaltspunkte in etwas gleich, kann man sich in dieser Hinsicht an ihnen gemeinsam orientieren. Man kann nun vorläufig von Weiterem absehen, die Orientierung wird beschleunigt.24
Das Vergleichen und Gleichsetzen hat Spielräume (auch wenn kein Ei einem andern gleicht, kann man Eier von Legehennen gleichermaßen vermarkten; aber man kann dann wieder unterscheiden, ob die Hennen in Käfige gesperrt sind oder frei auf der Wiese herumlaufen dürfen). Spielräume sind metaphorische Räume, in deren Grenzen etwas, hier das Vergleichen, ›frei spielen‹, d. h. etwas so oder anders unterscheiden oder gleichsetzen kann. Man kann sich, aus den unterschiedlichsten Gründen, auch scheuen oder weigern, etwas mit etwas zu vergleichen (im Extrem die Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten mit irgendetwas anderem). Zuletzt geht es, so Wittgenstein, darum, ob etwas mit etwas ›zu tun hat‹,25 und das kann in jeder Situation und für jede Orientierung in ihr etwas anderes sein (Legehennenbatterien mit Tierethik, Nationalsozialisten mit jetzigen Populisten). Man kann Gleichsetzungen in Familienähnlichkeiten zurücknehmen, wie Wittgenstein und auch schon Nietzsche sie nannte.26 Nietzsche hat sie philosophisch an »Sprach-Verwandtschaften«, Wittgenstein an »Sprachspielen« vorgeführt, aber z. B. auch an Photos seiner Geschwister, indem er deren Gesichtszüge schrittweise ineinander übergehen ließ; sie glichen einander in jeweils anderen Zügen, waren im Ganzen aber nicht gleich.27 Beim Abgleichen führen die einen Anhaltspunkte zu anderen Anhaltspunkten, die anderen zu wieder anderen, ohne dass man alle auf gemeinsame Begriffe bringen könnte und müsste.
Sosehr Nietzsche und Wittgenstein auf der prinzipiellen Unvergleichbarkeit und den Spielräumen, wenn nicht der Willkür des Gleichsetzens bestanden, so sehr war ihnen die Unumgänglichkeit des Vergleichens bewusst. Nietzsche sah sich in einem »Zeitalter der Vergleichung«, in dem man sich, nachdem der Halt an Religion und Metaphysik zunehmend unglaubwürdig wurde, in einer »Cultur der Vergleichung« zu orientieren suche28; Wittgenstein arbeitete, um sich »nicht durch das allgemeine Begriffswort verführen [zu] lassen«29, methodisch mit Vergleichen. Man kann beim Vergleichen einen Anhaltspunkt oder ein Muster von Anhaltspunkten zum Maßstab für andere nehmen, also etwas von etwas unterscheiden, das man schon als feststehend betrachtet (›schau, so eine Klappbrücke habe ich schon in Holland gesehen‹). Ein bekannter Anhaltspunkt wird zum Vergleichsgesichtspunkt für einen neuen. Solche Vergleichsgesichtspunkte kann man aber auch wieder in Frage stellen (›diese hier, eine Wippbrücke, erinnert mehr an eine Schaukel‹) – oder auch auf ihnen bestehen (›Klappbrücke ist Klappbrücke‹). Das heißt: Beim Vergleichen kann sich das Unterscheiden selbst festlegen oder in Bewegung halten, je nachdem, wie es in der Orientierung weiterkommt. Ergiebige Vergleichsgesichtspunkte sind wiederverwendbar, können zu Erkenntnis- und Differenzierungsgewinn führen (der eine Klappbrückentyp kann hier, der andere dort von Vorteil sein), aber auch zu Stereotypen erstarren (›Holland, das Land der Klappbrücken‹).30
Durch Gleichsetzungen sieht man von Ungleichheiten ab, macht aber zugleich auf sie aufmerksam. Das haben besonders Nietzsche und Luhmann hervorgehoben:31 Unterstellt man politisch die Gleichheit aller Menschen und fordert ihre Gleichbehandlung, treten desto mehr Ungleichheiten hervor. Der Gleichheitsbedarf kann darum auf verschiedenen Feldern der menschlichen Orientierung sehr unterschiedlich sein, anders z. B. in den Medien, die immer Neues, also Ungleiches berichten müssen, als im Recht, wo streng auf Gleichbehandlung geachtet werden muss, anders in der Wissenschaft, soweit sie allgemeine Gesetzlichkeiten eruieren will, als in der Wirtschaft, in der Erziehung, im Sport oder in der Kunst, wo Vergleichen Konkurrenzen anregt und gezielt Ungleichheiten hervorbringt.
3. Unterscheiden als zeitlicher Prozess: Zeit der Neuorientierung
Das Unterscheiden als Prozess der Abgrenzung und Abgleichung braucht Zeit, und die menschliche Orientierung kann und muss sich auf die Zeit einstellen und mit ihr mitgehen. Die Zeit war jedoch stets eines der schwierigsten Probleme der Philosophie. Den berüchtigten Gegensatz zwischen Parmenides und Heraklit – Sein schließt Zeit aus / alles Sein ist im Fluss, also Werden, also Zeit – hat Aristoteles so aufgelöst, dass er Zeit als Eigenschaft von Bewegungen und diese als wechselnde und damit wiederum zeitliche Eigenschaften von bleibendem Seienden unterschied; feststellbar würden Bewegungen durch die Abgrenzung eines früheren und eines späteren Zustands des Seienden. So wurde zur Bestimmung der Zeit zirkulär die Zeit selbst verwendet. Außerdem entstand das Problem, wie Zeit einerseits eine Eigenschaft von Bewegungen von Seienden und andererseits das sein kann, worin oder wonach Bewegungen verschiedener Seiender verglichen werden.32 Darüber hinaus ist das Sein der Zeit selbst ist nicht feststellbar, weil sie – schon nach Parmenides – stets zugleich ist, noch nicht und nicht mehr oder, wie es dann Aristoteles zuspitzt, das Jetzt immer zugleich dasselbe und ein anderes ist.33 Sagt man ›jetzt‹, ist das Jetzt, von dem man spricht, schon vergangen. Die Paradoxien oder Aporien der Zeit haben sich trotz immer neuer Versuche bis ins 20. Jahrhundert nicht auflösen lassen, bis Luhmann sie schließlich kreativ für seine Theorie nutzte – durch die Analyse des Begriffs der Unterscheidung selbst im Anschluss an Spencer Brown.
Sie argumentieren so: Unterscheidung hat, als Abgrenzung oder Form, zwei Seiten. Mit der Unterscheidung stehen beide Seiten gleichzeitig, also ohne zeitliche Unterscheidung, zur Verfügung; die Unterscheidung (distinction) erscheint zeitlos. Will man mit ihr aber etwas unterscheiden, also bestimmen und bezeichnen (indication), muss man auf eine ihrer beiden Seiten gehen (rechts oder links, zutreffend oder unzutreffend, vorher oder nachher), in Spencer Browns Sprache: die Grenze »kreuzen«, die die Unterscheidung zieht. Um eine Unterscheidung zu gebrauchen, muss man also zugleich ihre beiden Seiten im Blick haben und zwischen ihnen hin und her gehen, also einen Prozess vollziehen, der Zeit braucht.34 Geht man vom Prozess des Unterscheidens in der Orientierung aus, wird aus der Aporie ein Argument: Eben dadurch, dass das Unterscheiden zugleich mit Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit arbeitet, wird die Zeit merklich, was immer sie auch sei oder wozu sie in welcher Weise gehören mag. Der Zirkel, die metaphysischen Versuchungen und ihre Paradoxien verschwinden. Phänomenologisch zeigt sich die Zeit beim Unterscheiden; sie läuft beim Unterscheiden als Zeit des Unterscheidens mit, ohne dass sie selbst bestimmt oder bezeichnet werden müsste.35 Unterschieden wird sie von der Unterscheidung erst, wenn sie nicht mehr als deren Prozess, sondern als Produkt einer besonderen Unterscheidung betrachtet wird.
Dann kann sie zum festen Anhaltspunkt der Orientierung werden – indem sie durch Uhren gemessen und damit klar feststellbar wird. Sie erscheint dann als etwas, das es gibt wie anderes auch, als schlicht Vorhandenes. Darüber vergisst man jedoch, dass die Zeitmessung zum einen weiterhin Zeit braucht und zum anderen die Maßstäbe, nach denen sie gemessen wird (nach Aristoteles der Umlauf der Gestirne, heute die regelmäßige Frequenz elektromagnetischer Wellen bei den Schwingungen besonderer Atome) sich ihrerseits in der Zeit verändern, also wiederum ›ihre Zeit haben‹. Außerdem stehen in der menschlichen Orientierung der durch Uhren gemessenen Zeit weiterhin andere Arten des Zeit-Erlebens gegenüber (wie circadiane biologische Rhythmen oder das nachträgliche Empfinden von Kurzweiligem als lang, von Langweiligem als kurz).36 So ist die gemessene Zeit nur eine Unterscheidung der Zeit unter anderen.
In schwierigen Orientierungssituationen steht das Unterscheiden zudem unter hohem Zeitdruck: Um eine Situation zu bewältigen und Schaden abzuwenden, muss unter ihren möglichen Anhaltspunkten schnell unterschieden werden. Unterschiedliche Unterscheidungen können die weitere Orientierung aber gänzlich anders ausrichten (ist das ein möglicher Weg aus der Krise oder nicht?), wobei die Unübersichtlichkeit der Situation die Wahl unter ihnen schwer machen kann. Umso mehr würde man Zeit zum Unterscheiden brauchen, oft ohne sie zu ›haben‹. Zudem können in der Zeit des Orientierungsprozesses neue Anhaltspunkte für neue Unterscheidungen auftauchen und die bisherige Orientierung umsteuern, mitunter so stark, dass sie als gänzliche Neuorientierung erlebt wird (nach einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber droht Entlassung, da kommt das Angebot zur Teilnahme an einem start-up-Unternehmen, und ›ein neues Leben beginnt‹). Zeit wird am stärksten im Zug solcher Neuorientierungen erfahren und unterschieden: Die Gegenwart wird spürbar Vergangenheit, Zukunft tut sich auf.
4. Alternativität des Unterscheidens: Entscheidungen zwischen Unterscheidungen und zwischen ihren Seiten
Das zweiseitige Unterscheiden, wie es Spencer Brown und Luhmann vor Augen haben, bietet sich an, wenn etwas bestimmt und bezeichnet (marked) und dabei von anderem abgesehen wird (unmarked space). Doch Unterscheidungen sind nicht eo ipso zweiseitig. Wege können sich nicht nur in einen rechten und einen linken gabeln, sondern außerdem in halbrechter und gerader Richtung weiterführen. Und man könnte auch ohne Weg über das Feld weitergehen. Bei Farben, Tönen, Geschmäcken und Gefühlen kann man viele Nuancen unterscheiden, ohne dass man Begriffe für sie hätte. In perspektivischen Gemälden zeigen sich Unterschiede in kaum benennbaren Kontrasten wie Abstufungen der Größenverhältnisse und Abschattungen der Helligkeit und Deutlichkeit.37 Wenn die Orientierung durch Unterscheiden mit vielfältigen Alternativen zugleich umgehen kann, darf man sich philosophisch nicht einfach an zweiseitige, logisch klar definierbare Unterscheidungen halten, sondern muss auch hier unterhalb der Begriffe bei bloßen Anhaltspunkten der Orientierung ansetzen. Gemeinsam aber ist allem Unterscheiden, dass es Alternativen eröffnet, die Möglichkeit, jeweils auf die andere Seite begrifflicher Unterscheidungen oder zu anderen Anhaltspunkten überzugehen (›sehen wir die Lage einmal so‹). Über Alternativen aber muss laufend entschieden werden. ›Ent-scheidung‹ heißt eine Scheidung so wieder aufheben, dass man in seiner Orientierung weiterkommt.
Die Nötigung zum Entscheiden zwischen Möglichkeiten gehört zum Unterscheiden schon vor dessen Bewusstheit (beim Durchqueren unwegsamer Gelände muss man jeden Schritt richtig, aber ohne lange Überlegung setzen). Im Prozess der Orientierung, der Auslotung einer Situation auf Möglichkeiten hin, in ihr erfolgversprechend zu agieren (beim Gehen im Berg nicht abzustürzen), wird stets unter Ungewissheit unterschieden und entschieden. Was geht und nicht geht, zeigt sich beim Vorangehen. Das Unterscheiden, dem man dabei nur schwer ein Subjekt zuschreiben kann, erkundet die Orientierungssituation, die Entscheidung verändert sie, schafft schon eine neue Orientierungssituation und mit ihr auch wieder neue Ungewissheit. So muss man immer neu unterscheiden und entscheiden, mit welchen Unterscheidungen und Entscheidungen man am ehesten weiterkommt. Dabei schränken einmal getroffene Unterscheidungen und Entscheidungen die Spielräume wohl ein, in denen es weitergehen kann, geben aber nicht schon vor, mit welchen Unterscheidungen und Entscheidungen das am besten geschieht (man ist mit einem Unternehmen gestartet und muss nun Wege finden, sich mit ihm auf einem überraschend veränderten Markt zu behaupten). Denn an Unterscheidungen und Entscheidungen kann ganz unterschiedlich angeschlossen und über geeignete Anschlüsse an sie muss darum jeweils neu entschieden werden (man tauscht im Unternehmen Programme oder Personen aus, um weiterzukommen). Nur so kann sich der Orientierungsprozess für eine unbestimmte Zukunft offenhalten. Ein Modell dafür ist die Kunst. Sie ist frei am Anfang, dann lässt jede entschiedene Formung nur noch solche zu, die zu dieser passen, doch dabei bleiben immer noch alternative Möglichkeiten.38
In der menschlichen Orientierung ist der Spielraum der Entscheidungen für Unterscheidungen dennoch limitiert: durch Faktoren wie individuelle Charaktere, Vorlieben und Interessen, eingespielte Gewohnheiten und Routinen, sprachliche und kulturelle Standards, soziale Normen und juristische Gesetze, Autoritäten auf verschiedensten Feldern usw. Sie ersparen jeweils neue und eigene Orientierungen und damit neue Unterscheidungen und Entscheidungen. Denn die Kapazitäten der Orientierung können sich unter Menschen zwar erheblich unterschieden, sind im Prinzip aber begrenzt. Werden sie überschritten, wird das Unterscheiden und Entscheiden unter Ungewissheit überfordert, tritt Desorientierung ein, kommt Unruhe, Angst, wenn nicht Panik und Verzweiflung auf (›Epidemie – die Kinder können nicht zur Schule, wir können nicht zur Arbeit, die Großeltern vereinsamen, was jetzt?‹). Wissenschaften können gezielt Orientierung geben, weil sie das Unterscheiden gezielt limitieren: durch die inhaltliche Abgrenzung von Forschungsfeldern und durch methodische Regelungen der Anschlüsse von Unterscheidungen aneinander. Sie erhöhen die Zielgenauigkeit des Unterscheidens, schränken aber auch dessen Fokus ein. Forschungseinrichtungen, aber auch Organisationen wie Unternehmen, Banken, Ministerien, Parlamente, Parteien, Verbände, Gerichte usw. ermöglichen planvolles Handeln, indem sie sich auf bestimmte Parameter des Unterscheidens und Prämissen des Entscheidens festlegen.39 Werden die Möglichkeiten des Unterscheidens und Entscheidens auf diese Weisen eingegrenzt, steigt die Orientierungssicherheit, und der Zeitdruck entspannt sich. Brechen jedoch solche Ordnungen ein, wird das rasch als ›Chaos‹ erlebt.
5. Asymmetrisierung des Unterscheidens: Wertungen als Halt in Unterscheidungen
Zu leichteren Entscheidungen verhelfen zugleich Wertungen der beiden Seiten von Unterscheidungen. Luhmann gebraucht hier den Begriff der Asymmetrisierung: Wenn Entscheidungen für die eine Seite nahegelegt werden sollen, werden die Seiten der Unterscheidungen unterschiedlich gewichtet und in diesem Sinn vereinseitigt.40 Sie werden dann zu wertenden Unterscheidungen. Das geschieht unauffällig im Spielraum der Bedeutungen des Wortes ›Wert‹, der von wertneutralen ›formalen‹ Werten zweiseitiger Unterscheidungen (links / rechts, positiv / negativ, 1 / 0) über ökonomische und lebenspraktische Werte (günstig / ungünstig, gut / schlecht) bis zu moralischen Werten (gut / böse, verlangt / verboten) reicht.41 Die ersten lassen Entscheidungen ganz frei (›beides möglich‹), die zweiten empfehlen die eine Seite der Unterscheidung (›besser dies als jenes‹), die dritte fordert, die andere Seite auszuschließen (›dies, nicht jenes‹). Nietzsche hat in Zur Genealogie der Moral gezeigt, wie fließend die lebenspraktische Unterscheidung gut / schlecht in die moralische gut / böse übergeht. Dabei sind positive Werte wie Glück, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit oft schwer zu bestimmen und darum strittig, während es für die negativen, Unglück, Versklavung, Ungerechtigkeit, Täuschung, meist allseits plausible Anhaltspunkte gibt. Beides zusammen, die Asymmetrisierung von Unterscheidungen und der Ausschluss ihrer negativen Seite, geben der Orientierung Halt und festigen sie. Ethiken können darauf aufbauen.
Aber auch dieser Halt ist nicht unerschütterlich. Denn vor allem die positiven Werte sind stark kulturabhängig und können darum im Kulturenvergleich fragwürdig werden.42 Entscheidungstheorien entgehen dem, wenn sie bestimmte Präferenzen (wie Rationalität oder Glücks- oder Gewinnstreben) schon voraussetzen; dann werden Entscheidungen auch statistisch berechen- und vorhersagbar. Solche Präferenzen sind in der menschlichen Orientierung jedoch keineswegs eindeutig; situative Abweichungen, Mehrfachmotivationen, Profilierungsbemühungen43, gezielte politische Provokationen, religiöse Fundamentalismen, aber auch schon bloße Ironisierungen und Ridikülisierungen gängiger Werte schaffen neue Entscheidungsspielräume.44 Auch persönliche Idiosynkrasien und Abwehrhaltungen können einer Orientierung Halt geben. Dann stützt sie sich auf ihre eigenen Asymmetrisierungen.
So wird die Wertesituation ihrerseits unübersichtlich; in modernen Gesellschaften befindet sie sich in ständigem Wandel. Menschliche Orientierung muss darum lernen, auch Wertungen in Unterscheidungen zu sichten, verschiedene Wertunterscheidungen zu gewichten und zu entscheiden, welche Unterscheidungen zu welcher Zeit in welchen Situationen angemessen sind. Wertorientierung ist nicht nur Orientierung an Werten, sondern auch über Werte. Sie geht dann in eine reflektierte Moral im Umgang mit Moralen über.45 Anfänglich individuelle Abweichungen (eine frugale Lebensweise mitten im Wohlstand, eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft) können sich in gesellschaftlichen Transformationsprozessen rasch verbreiten und gesamtgesellschaftliche Umorientierungen auslösen (Rettung des Erdklimas vs. Ernährungs-, Mobilitäts- und Heizungsluxus, Entdiskriminierung vs. Bestehen auf Traditionen). Während Neuorientierungen in neuen Situationen alltäglich sind, werden derartige Neuentscheidungen über wertende Unterscheidungen als Umorientierungen erfahren: ›das Leben‹ im Ganzen wird dann ›anders‹, als ›neue Zeit‹ erlebt – und findet in neuen asymmetrischen Unterscheidungen neuen Halt (klimaschädlich / klimaneutral, politisch korrekt / inkorrekt).
6. Selbstunterscheidung im Unterscheiden: Distanz zum Gegenstand des Unterscheidens
Entscheidungen über Unterscheidungen drängen die Frage auf, wer oder was da unterscheidet und entscheidet. Die indoeuropäischen Sprachen und die Tradition der europäischen Philosophie legen für Prozesse Akteure nahe, die sie betreiben. Aus dem Wehen des Windes wird der Wind, der weht, aus dem Bewusstseinsstrom das Bewusstsein, das sich etwas bewusst macht, aus dem Pronomen ›ich‹ ein Ich, das denkt und dabei über Unterscheidungen entscheidet.46 Im Prozess des Unterscheidens wird etwas unterschieden, an dem die Orientierung dauernden Halt finden soll, von Aristoteles noch eine Substanz, an der Eigenschaften wechseln oder die sie von sich aus austauscht; in der Moderne werden daraus Täter, die aus Geschehen Tätigkeiten machen, Kräfte, die bestimmte Bewegungen vorantreiben, Subjekte, die sich von alldem Vorstellungen bilden. Hinter oder über alldem kommt als Schöpfer und schlechthin Tätiger Gott zu stehen und als Form der Unterscheidung die Einheit des sich aus sich selbst entwickelnden Systems, wie es exemplarisch Hegel gedacht hat.47
Beobachtbar sind jedoch nur die Prozesse selbst, einschließlich der Prozesse des Beobachtens. Das hinzugedachte Subjekt dieser Prozesse kann, aufgrund seiner Unbeobachtbarkeit, im Fall der menschlichen Orientierung wieder in einem weiten Spielraum unterschieden werden, etwa als Mensch, Seele, Bewusstsein, Person, Vernunft, Geist oder auch als Gesellschaft mit ihren Unterscheidungen wie Wissenschaft, Medien, Politik usw. Das individuelle Subjekt kann man ausstatten mit einem Leib, der es am Leben erhält, einer Umgebung, von der sich der Leib nährt, mit einer Gesellschaft, die ihm seine Sprache beibringt und seine Funktionen zuteilt, usw. und es so mit Handgreiflichem vernetzen. Man kann es aber auch von alldem trennen und als völlig autonom, als allein vorstellendes und denkendes Subjekt etablieren, das mit freiem Willen Verantwortung für all seine Unterscheidungen und Entscheidungen übernimmt. Das ist von ausschlaggebender Bedeutung für Ethik, Recht und Politik. Und doch wird nach Nietzsche hier lediglich im »Bann bestimmter grammatischer Funktionen« ein Unterscheidendes vom Unterscheiden unterschieden.48 Schließt man an ihn und Wittgensteins radikaler Konsequenz daraus »Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es nicht« an,49 bleibt nur der Rückgang auf das Unterscheiden selbst. Und ihn hat wiederum Luhmann versucht.50
Luhmann setzt beim Begriff der Beobachtung als Einheit von Unterscheiden und Entscheiden an. Auch die Beobachtung ist Prozess und Produkt zugleich; Luhmann denkt sie als Prozess des Gebrauchs einer Unterscheidung (distinction) zur Bezeichnung (indication) von etwas als Gegenstand; dieser Gegenstand ist der dann bestimmte Unterschied als Produkt der Unterscheidung. Um aber etwas als etwas zu beobachten, muss die Beobachtung sich selbst vom Beobachteten unterscheiden (sonst bleibt es bei bloßen Vorstellungen, Fiktionen oder Träumen). Diese