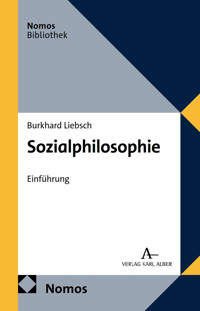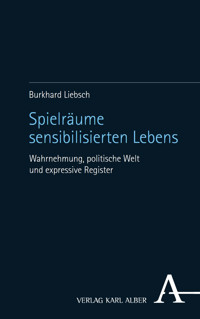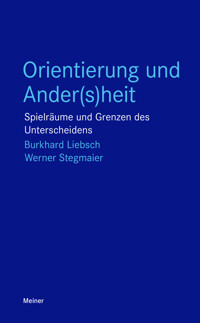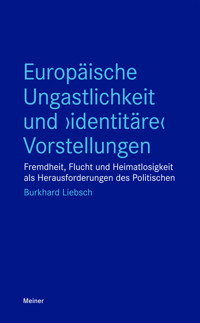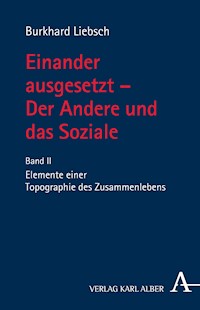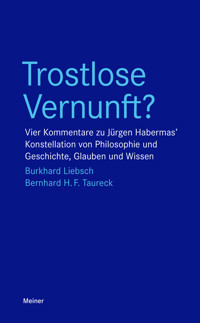
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Als Aufklärer will Habermas nicht zu jenen »leidigen Tröstern« gehören, über die schon Kant seinen Spott aus gegossen hat. Vielmehr bekennt er sich wie bereits Hegel zur »prinzipiellen Trostlosigkeit« philosophischen Denkens und gibt auch jede Aussicht auf finale Versöhnung eines Geistes preis, der aus der Asche jeglicher Vernichtung »verjüngt« hervorgehen können sollte, um so Kapital aus dem Tod zu schlagen. Darüber hinaus verzichtet Habermas auch auf Glücks, Sinn oder Erlösungsversprechen, die sublunare Wesen ›letztlich‹ vielleicht allein interessieren. Er legt einen weiten Weg der Ernüchterung zurück, an dessen vorläufigem Ende wir heute stehen, wo Philosophie durch rigorose Aufklärung da rüber, was sie vermag – und was nicht –, ihre eigene Auflösung zu gewärtigen hat. Burkhard Liebsch und Bernhard H. F. Taureck gehen in vier historisch und sozialphilosophisch ausgerichteten, reichhaltigen Kommentaren den Stationen dieser Ernüchterung nach und verdeutlichen, welche Potenziale Habermas' eigentümliche Konfiguration von Glauben und Wissen, Philosophie und Geschichte opfert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Liebsch | Bernhard H. F. Taureck
Trostlose Vernunft?
Vier Kommentare zu Jürgen Habermas’ Konstellation von Philosophie und Geschichte, Glauben und Wissen
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-3972-3
eISBN (ePub) 978-3-7873-4016-3
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2021. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbH.Für Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
INHALT
Vorwort
Kapitel I · Geschichtliche Perspektiven ›heil‹-loser Vernunft
Jürgen Habermas’ implizite Geschichtsphilosophie – und was sie vermissen lässt
Burkhard Liebsch
1. Geschichte der Philosophie als Philosophie der Geschichte? | 2. Rückblick auf Herder | 3. Zur geschichtsphilosophischen Dimension kommunikativer Rationalität | 4. Verarmung kommunikativer Vernunft und autonomer Selbstbestimmung | 5. Geschichte als Lernprozess? | 6. Gegenthesen | 7. Schluss
Kapitel II · Philosophie und religiöser Glaube
Versuch weiterführender Überlegungen in Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas
Bernhard H. F. Taureck
Einleitung | 1. Das thematische Spektrum. Das Ziel: Fortsetzung des philosophischen Denkens | 2. Religionskritik und die Rückkehr des Heiligen | 3. Elemente und Modelle des Profanen und des Sakralen | 4. Erstes Beispiel: Die scholastische Mittelalterzeit | 5. Zweites Beispiel: Was in der Zeit Machiavellis geschah | 6. Drittes Beispiel: Die Zeit Kants, Goethes, Hegels, Schleiermachers | 7. Transzendenz: Wozu christliche Gläubigkeit dient. Nietzsches verfehlte Rechtfertigung des Christentums | 8. Die fides qua und die fides quae bei Habermas | 9. Inwiefern universalisiert das Christentum den Sinn der Achsenzeit? | 10. Was bedeutet religiöser Glaube? | 11. Luther: Erlösung als selbstentzweiter Glauben | 12. Gott als Abgrund bei Kant und Einsamkeit Gottes bei Hegel
Kapitel III · Rückhaltlos verweltlicht?
Philosophie vor ihrer Auflösung oder Verwirklichung
Burkhard Liebsch
1. Nichtendenwollende Moderne | 2. Praktische Perspektiven trostloser Philosophie | 3. Da-sein, Geschichte und Gewalt | 4. Vom Bedürfnis nach Selbstvergewisserung zur Sensibilität | 5. Konterkarierte Rationalität | 6. Endlich in der Welt angekommen? | 7. Ausgesetzt und ausgeliefert?
Kapitel IV · Beantwortung der Frage:
Welche verborgene Rolle spielt Habermas’ demokratisches Projekt in seinem Opus magnum von 2019?
Bernhard H. F. Taureck
1. Drei Optionen | 2. Demokratie als Projekt | 3. Die übersehene Aspektdifferenz einer künftigen Demokratie | 4. Inwiefern demokratisch-selbstbezügliche Herrschaft des Allgemeinen zur Selbstzerstörung des Staatsvolkes führen würde | 5. Inwiefern Habermas an die US-Republik unter dem Namen einer »Demokratie« anknüpft | 6. Welcher Topologie folgt Habermas? | 7. Votum für eine Erweiterung der okzidentalen Rationalität durch die Weisheitslehren des Laotse als Konsequenz aus der Achsenzeit
Anmerkungen
Namenregister
VORWORT
Wir befinden uns gegenwärtig politisch-ökologisch in einer verfahrenen, hyperkomplexen globalen Lage, in die wir nicht zuletzt durch Exzesse technischen und ökonomischen Könnens geraten sind, dem seit langem nicht nur fatale destruktive Begleiterscheinungen und Kehrseiten vorgerechnet werden. Sie werfen auch die radikale Frage nach Ursachen auf, die eine instrumentelle, an berechenbarem Gewinn orientierte Mentalität selbst – und nicht etwa bloß die von ihr mitzuverantwortenden Kollateralschäden – zu revidieren zwingen. Ist diese Mentalität tief in der Anthropogenese verwurzelt? Oder in einer missverstandenen Auffassung des biblischen Imperativs, sich die Erde ›untertan‹ zu machen? Ging daraus langfristig die in der Neuzeit verbreitete Geringschätzung der Natur hervor, zu deren maître et possesseur sich ökologisch außerordentlich ignorante, im Grunde rücksichtslose, juridisch nur mit Mühe in Schach zu haltende Subjekte aufgeworfen haben, die sich in ihrem Willen zu immer mehr Macht in gewaltsame Antagonismen verstrickten, aus denen längst auch Kriege, die noch Hegel als zu geistigem Fortschritt dienlich meinte rechtfertigen zu können, keinen wenigstens vorübergehenden Ausweg mehr weisen? Betreffen diese radikalen Fragen eine spezifisch westliche Pathologie der Geschichte, der wir in Europa rest- und alternativlos verfallen sind, oder hat sie ungeachtet immer wieder gewiesener Auswege längst die im Entstehen begriffene Weltbürgergesellschaft erfasst? Wie auch immer man diese Fragen im Einzelnen beantworten wird, nicht zu bestreiten ist, dass sie Teil einer derzeit rigorosen nachträglichen Prüfung aller uns geschichtlich geradezu ausmachenden Überlieferungen sind, auf die wir in der Suche nach »Selbstvergewisserung« – ein von Jürgen Habermas oft verwendetes Wort – weniger denn je einfach zurückgreifen können.
Es sind die aus der weltfremden Ferne ihrer Biogenese zu uns stoßenden Nachkommen, unsere Kinder und Kindeskinder, die, sobald sie ›alt genug‹ sind, von uns wissen wollen, was es mit der Welt auf sich hat, in der sie sich zu ihrem Erstaunen und Erschrecken vorfinden, ohne dass sie irgendjemand um ihre vorherige Einwilligung gefragt hätte (oder hätte fragen können). Mit umso mehr Recht fragen sie gegenwärtig, wie es zur aktuellen Verfassung dieser zugleich technisch außerordentlich fortgeschrittenen und ökologisch destruktiven Welt kommen konnte. Welchen Anteil hatte und hat weiterhin daran neben unserem konkreten Verhalten auch unser Denken, auf das gerade die Philosophen so überaus stolz sind, die es mit Hegel, Husserl oder Heidegger als angeblich ursprünglich europäisches für sich in Anspruch nehmen? Machen sie nicht im Grunde immer noch glauben, an ihrem Denken werde die Welt genesen und nicht etwa zugrunde gehen – vorausgesetzt, man begreift es als ›auf-den-Grund-gehendes‹ und zugleich ›Gründe gebendes‹? Wie auch sollte die Welt an einer derart aufgefassten Vernunft Schaden erleiden?
In einer weltgeschichtlichen Situation, wo uns derart radikale Fragen bedrängen und verunsichern, ist es ein riskantes Unterfangen, mit einer Besinnung auf den Zusammenhang von Geschichte und Philosophie aufwarten zu wollen, wenn sie sich nicht einfach auf ›Philosophiegeschichte‹ beschränken soll, die allenfalls von ›akademischem‹ Interesse wäre. Riskant ist es besonders deshalb, weil ein solcher Versuch damit rechnen muss, überbordenden, keinesfalls auf unsere ›geistige‹ Geschichte reduzierbaren Fragen wie den angedeuteten in der Gegenwart ausgesetzt zu werden, die den Sinn jedes Versuchs tangieren, Philosophie und Geschichte mit Blick auf die Gegenwart so in Beziehung zu setzen, dass man sich davon auch etwas für die gegenwärtig so eminent gefährdet erscheinende Zukunft unserer Nachkommen versprechen kann.
Mit seinem jüngsten, hier diskutierten Werk Auch eine Geschichte der Philosophie (2019) zielt Habermas ja keineswegs nur auf die Vergangenheit dieser Disziplin, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben mag, sondern mitten ins Herz unserer politischen Gegenwart; und zwar mittels zweier begrifflicher Hebel (Wissen und Glauben), die er in der Überzeugung neu zu konfigurieren verspricht, dass bloß instrumentelle und epistemische Weltverhältnisse, wie sie die okzidentale Welt bislang bestimmt haben, genauso in eine Sackgasse führen wie ›gläubige‹, im weitesten Sinne religiöse, die sich über alle kognitiven, kritisch zu prüfenden Ansprüche hinwegsetzen. Deshalb sucht Habermas nach Verschränkungen von Wissen und Glauben, die offenbar keine dialektische Synthese zulassen, sondern einander widerstreiten und vielfache Konflikte heraufbeschwören, sich aber auch gegenseitig herausfordern und es dabei verhindern, dass wir uns als epistemische oder religiöse Subjekte je selbst genügen. Das ist, glücklicherweise, muss man wohl sagen, ausgeschlossen, wo es sich bei der fraglichen Zeit, die es gedanklich zu begreifen gilt, wie bei Habermas um eine gesellschaftliche Zeit bzw. um die Zeit vergesellschafteten Lebens handelt, dem wir nach der Überzeugung vieler seit langem geradezu restlos ausgeliefert zu sein scheinen. So befindet François Ewald, es gebe schlechterdings »kein Außerhalb der Gesellschaft« mehr.1 Wie viele andere auch scheint er sich mit einer transzendenzlosen, sich vollkommen selbst genügenden Immanenz ohne Weiteres arrangieren zu wollen. Dabei müsste er doch wissen, wie sehr sich gerade im vergangenen 20. Jahrhundert Autoren unterschiedlichster Provenienz darum bemüht haben, zu zeigen, dass niemand je in jener Zeit und in der Geschichte aufgehen kann, in der sie praktisch und narrativ Gestalt annimmt. Dokumentiert die Geschichte nicht über weite Strecken unsere radikale Auslieferung an die Schrecken einer Gewalt, die auf Auswege und Fluchten aus aller Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit zu hoffen zwingt, sei es in meditativer Versenkung, im weltabgewandten Exil eines Eremiten oder in negativ-theologischer Ausrichtung auf das Andere von Zeit und Geschichte? Dennoch, oder vielmehr gerade deswegen, insistierte Imre Kertész, der Auschwitz überlebt hat, liege das »Heil des Menschen« zwar »außerhalb seiner geschichtlichen Existenz – jedoch nicht in der Vermeidung geschichtlicher Erfahrungen, im Gegenteil, in ihrem Erleben, ihrer Aneignung und der tragischen Identifizierung mit ihnen«. Das Wissen erschien ihm sogar als »die einzig würdige Rettung, das einzige Gut«.2 Das schreibt einer, dessen einziges Zuhause nach seinem eigenen Bekunden das Exil war – fern von »jeder möglichen Zuflucht« – und der in seinem »ausgesetzten Leben« allen »grauenhaften Siegen« zu widerstehen versprach und dabei doch wusste, dass die unaufhebbare Negativität seiner (und unserer) »ausgesetzten Gegenwart«3, in der das Exil zu einer allgemeinen »Befindlichkeit« zu werden scheint4, etwas Besseres herbeizuführen versprechen muss.
Wie auch immer aber jene vergesellschaftete Zeit, der sich viele, allen voran Fundamental- und Radikaldemokraten, offenbar restlos zu überantworten bereit sind, praktisch geschichtliche Form annimmt und in Richtung auf eine womöglich zu fördernde, zu bejahende Zukunft auszurichten wäre (eine politische Hauptsorge nicht nur von Habermas) – sie kann nicht über all das verfügen, was unter Titeln wie Exteriorität, Außen, Neutralität, Reales, unaufhebbare Alterität und radikale Fremdheit von Emmanuel Levinas über Michel Foucault, Maurice Blanchot und Jacques Lacan bis hin zu Bernhard Waldenfels zur Sprache gebracht und gegen eine »Alteritätsvergessenheit« (Marcel Hénaff) in Stellung gebracht worden ist, die einen Grauschleier indifferenter Immanenz über alles und jeden zu legen droht. Angeblich leben wir durch und durch in Wissensgesellschaften; und Algorithmen drohen wirklich ›alles‹, jedenfalls alles Verwertbare, über uns in Erfahrung zu bringen. Aber ist die Rede von Erfahrung hier nicht bloß noch eine façon de parler, eine abgedroschene Redensart? Kann von Erfahrung im Ernst überhaupt noch die Rede sein, wo jegliche radikale Alterität ›vergessen‹ und wie bei Habermas unbesehen einer »Aneignung« von allem und jedem das Wort geredet wird?
Wie auch immer es sich damit verhalten mag: Derartige, das philosophische Denken des 20. Jahrhunderts umtreibende, erstaunlicherweise bei Habermas allerdings kaum abgebildete Fragen (von den Genannten werden nur Foucault und Levinas ohne weitere Diskussion wenigstens flüchtig gestreift) verlangen nach gastlichen Orten, an denen sie aufzuwerfen wären, ohne dass immer schon vorentschieden wird, was wir im Hinblick auf denkbare Antworten wissen oder glauben können, sollen, dürfen … – und wen dieses vielleicht problematischste aller Personalpronomen (›wir‹) überhaupt meint. Suggeriert es nicht eine Einheit, ein Einverständnis oder eine Gemeinschaft aller Menschen, von der man sich vielerorts weiter entfernt denn je, mag es um eine in statu nascendi sich befindende Welt-Gesellschaft politisch stehen, wie es wolle? Nach wie vor droht man sich gegenseitig atomare Verstrahlung und terroristische Vernichtung an; weitgehend ungehindert verwüsten die Einen die ökologischen Lebensgrundlagen der Anderen; und ein desozialisiertes, gegen öffentliche Supervision weitgehend abgeschirmtes Finanzkapital setzt mit seinem high frequency trading quasi täglich alles aufs Spiel. Was vermag in derart vergesellschafteten Zeiten noch jenes Wissen, das in der aristotelischen Metaphysik als geradezu selbstverständliches Worumwillen menschlichen Lebens beschrieben wird? Und was erst irgendein Glaube, der sich darum scheinbar gar nicht schert?
Mit und gegen Habermas sind nicht zuletzt diese Fragen neu und radikal aufzuwerfen. Wir streben mit den folgenden vier Beiträgen selbstverständlich keinen vorzeitigen Abschluss der Debatte an, die seine beiden Bände anstoßen werden. Zudem wollen wir keine probaten, vermeintlich besseren, gar globalen ›Lösungen‹ für die Problematik einer zeitgemäßen Konfiguration von Wissen und Glauben offerieren, die bei Habermas eigentümlich überpolitisiert erscheint und alles, was kommunikativer Rationalität entgeht, einem am Ende in jeder Hinsicht ›trostlosen‹, ›privaten‹ und (im altgriechischen Sinne des Wortes) ›idiotischen‹ Leben überlässt.
Das von Habermas mehrfach wiederholte Eingeständnis ist bezeichnend genug, der im Grunde einzige Inhalt seines Projektes sei die schrittweise verbesserte Institutionalisierung von Verfahren vernünftiger kollektiver Willensbildung, die weit über das Politische hinaus rationalisierend in die sogenannte Lebenswelt eingreife, aber keinerlei Trost biete angesichts unserer vielzitierten Endlichkeit, mannigfaltigen politischen Scheiterns und der Verzweiflung angesichts des Versagens von Staat, Recht und transnationalen Organisationen – eines Versagens, das uns gegenwärtig drastisch vor Augen geführt wird, wo populistische Akteure jenseits und diesseits des Atlantiks erfolgreich auch den demokratischen ›Geist‹ eben der Institutionen von innen unterhöhlen, auf die viele ihre kosmopolitischen Hoffnungen gesetzt haben.
Das Eingeständnis der Trostlosigkeit sollte aber auch jedem eine Warnung sein, der ernsthaft glaubt, mehr versprechen zu können (ohne dabei Gefahr zu laufen, etwa in eine trivialisierte Beratungsphilosophie abzugleiten, die das Elend der Welt womöglich nur kaschiert). Vorläufig erlauben wir uns im Folgenden denn auch lediglich heterodoxe Nachfragen mit Blick auf von Habermas teils ignorierte, teils anders rekonstruierte Überlieferungen, aber auch mit Rücksicht auf praktische Herausforderungen der Gegenwart und einer Zukunft, der mit kommunikativer Rationalität allein, wie sie Habermas unentwegt verteidigt, nicht beizukommen sein wird.
In einer heroischen Denkbewegung versucht Habermas die griechische Metaphysik, ihre christliche Fortsetzung, die Renaissance, Kant, den Deutschen Idealismus und den nachfolgenden Aufbruch der Philosophie in Richtung einer terra incognita als Lernprozess zu verstehen, wobei zugleich fernöstliche Varianten der Achsenzeit mitbedacht werden. Habermas bleibt dabei vergangenheitsorientiert, während er zugleich bemüht ist, seine von ihm dargestellte Vergangenheit als Wissensvoraussetzung der Gestaltung einer universellen Zukunft nahezulegen. Dabei kommt Marxens Vision, dass das Reich der Freiheit nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft liegt, allerdings zu kurz. Zugleich gebührt ihm das Verdienst, Philosophiegeschichte nicht bloß als Spur eines erloschenen Lebens zu beschreiben, sondern als Weg, den vielstimmiges Denken weiterhin selbst zu bahnen hat. Während der Grundkatastrophe des Ersten Weltkriegs verfasste 1917 der Lyriker Antonio Machado im am Krieg nicht beteiligten Spanien jenes bekannte Gedicht über den Weg:
Wanderer, es sind deine Spuren
der Weg, sonst nichts;
Wanderer, es gibt keinen Weg,
was Weg ist, entsteht gehend.
Gehend entsteht Weg,
und blickst du zurück,
so siehst du den Pfad,
zu dem du nie mehr zurückkehrst.
Wanderer, es gibt keinen Weg,
es gibt eine Kielspur im Meer.5
Machados Zeilen fassen auch die prekäre Lage des philosophischen Denkens zusammen. Das Vergangene wird Zukunft, die neu zu bahnen ist. Es kommt – als nicht-apokalyptische, sondern eher als im griechischen Sinn tragische Offenbarung – darauf an, dass man dessen innewird, was man zuvor bereits ohne Wissen innehatte.
Nachdem beide Autoren im Zuge eines über einjährigen Dialogs gemeinsam zu ermitteln versucht haben, wie heute der Krieg als Drohung zu verstehen ist6, setzen sie hier zum zweiten Male zu einer gemeinsamen, komplementären, aber mit Absicht nicht dialektisch synthetisierten Einschätzung der Gewalt der Gegenwart an. Weit mehr als Habermas beunruhigt uns diese Gewalt; und wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass sie ›uns alle‹ betrifft und zur Auslotung künftig noch zu begehender Wege zwingt. ›Uns‹, das heißt: jeden einzelnen, jeden als Einzelnen, unverfügbar Anderen, und alle Menschen weltweit, die in ihrer unaufhebbaren Alterität dennoch zusammengehören – was sie wenigstens negativ vor allem die Gewalt lehren müsste, die sie in ihren politischen Verhältnissen derart heraufbeschwören, dass sie diese ganz zu ruinieren droht. Diese Sorge teilen wir mit Habermas. Anders als er aber haben wir heterogene, irreduzibel vielstimmige Überlieferungen im Blick, die dazu verhelfen sollten, diese Verhältnisse so weit wie möglich aufzuklären. Und wir sind uns mehr als Habermas dessen bewusst, dass das Denken dabei nicht umhinkann, von dem zu zeugen, was ihm inkommensurabel bleibt, ohne sich in Wissen oder Glauben ›aneignen‹ zu lassen.
Ob in Formen des Wissens, des Glaubens oder vernünftiger Freiheit, bei Habermas dient letztlich alles genau dem: der Aneignung, wie sein vielleicht wichtigster, aber auch verräterischster operativer Begriff lautet. Dieser zeigt verlässlich an, wo es an fälliger Distanz zur Last des so überaus gewaltträchtigen geistigen Erbes fehlt, das Habermas unentwegt für eine offenbar als vorbildlich betrachtete Rationalität genuin okzidentaler Herkunft in Anspruch nimmt. Was wir hier vorlegen, lässt sich in dieser Perspektive als Zwischenstation im Prozess weiterer Distanzierung verstehen, die weder diese Rationalität einfach verwerfen soll noch auch vergessen darf, was ihr inkommensurabel bleibt. Bedenken wir auch dies: Wenn uns Monate einer seit langem drohenden und dann betäubend peripher und zentral einsetzenden Pandemie inzwischen von uns selbst trennten, folgt dann aus Habermas und den hier vorgestellten Gedanken die Frage: Dass wir uns dort sammeln könnten, wo zuvor nur Ausweglosigkeit vermutetet wurde?
BL/BT, im September 2020
KAPITEL I
Geschichtliche Perspektiven ›heil‹-loser Vernunft
Jürgen Habermas’ implizite Geschichtsphilosophie – und was sie vermissen lässt
– Burkhard Liebsch –
Es steht außer Frage, daß keines der historischen philosophischen Systeme in der Lage war, [den geschichtlichen Menschen] gegen den Schrecken der Geschichte zu verteidigen.
Mircea Eliade1
Hier müssen wir, wider die mächtige Sprachlosigkeit, zu sprechen beginnen.
Peter Härtling2
1.Geschichte der Philosophie als Philosophie der Geschichte?
Philosophen, die ihre Berufung in weitgehend dekontextualisierter Begriffsanalyse sehen, wird nachgesagt, sie glaubten, ihr analytisches Tun mache Erinnerung an die Genealogie der von ihnen bearbeiteten Begriffe weitgehend überflüssig, Philosophie komme insofern ohne Geschichte aus. (Woraus Kontrahenten unnachsichtig den Schluss ziehen, in diesem Fall komme die Geschichte ohne Weiteres auch ohne solche Begriffsarbeiter aus.) Die gegenteilige Position besagt, Philosophie gehe in ihrer eigenen Geschichte auf. Philosophie und Geschichte der Philosophie wären dann im Grunde dasselbe – zumal wenn es sich nur um Fußnoten zu Platon handelt, wie manche meinen (1/432, 772 f.3). Zumindest seit Platon ›dreht sich‹ Philosophie demnach um das, was dieser in der Form einer Wiederholung fingierter sokratischer Dialoge vorgedacht hat, bietet seitdem aber »nichts Neues unter der Sonne«. Dieses noch von Hegel in seinen Vorlesungen über die Vernunft (in) der Geschichte in Anlehnung an das Buch Kohelet (1.10) wiederholte Diktum würden die Philosophen zumindest mit Blick auf die Geschichte ihrer Disziplin bis heute nur bestätigt finden.4 Was diese Geschichte inzwischen hervorgebracht hat, nimmt sich so gesehen aus, als sei es gleichsam vorgezeichnet gewesen in ihren Anfängen, die nachträglich als Ursprünge erscheinen.
Habermas schließt sich weder der einen noch der anderen Richtung an. Weder will er ahistorische Begriffsanalyse betreiben noch auch die Philosophie, die ihm vorschwebt, in deren Geschichte aufgehen lassen. Vielmehr glaubt er, dass sie originäre, in unserer Gegenwart sich stellende Probleme aufwirft, deren Vorlauf seine Geschichte der Philosophie zu rekonstruieren unternimmt. Letztere entspringt auf diese Weise einer nachträglichen Deutung dessen, was die Anfänge der Philosophie freigesetzt haben. Von diesen Anfängen her lassen sich allerdings vielfältige Geschichten der Philosophie nacherzählen. Der bestimmte Artikel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie unvermeidlich selbst vom Plural affiziert wird. Wie die Vielzahl der bereits vorliegenden Philosophiegeschichten in der Einheit einer philosophischen Geschichte aufgehen können soll, weiß offenbar niemand anzugeben. Die Geschichte der Philosophie, die alle bereits erzählten Geschichten der Philosophie(n) in sich aufheben würde, gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Letztere erweisen sich als genauso inkompossibel wie plurale Perspektiven, die sich nicht zum Gesamtbild einer Stadt oder gar des Universums zusammensetzen lassen (wie es einst Leibniz vorschwebte). Habermas hält sich mit verschiedenen Geschichten von diversen Philosophien allerdings gar nicht erst auf. Vielmehr liegt ihm an einer normativen Rekonstruktion einer Vorgeschichte des gegenwärtig als richtig Eingesehenen, das er als geschichtlich orientierungswirksam zur Geltung bringen möchte, also so, dass es in gegenwärtig sich abspielende und zukünftige Geschichte eingreifen kann. Ohne den geringsten, ohnehin nicht zu erfüllenden Anspruch auf Vollständigkeit des historisch Vergegenwärtigten will Habermas Letzteres in praktischer Absicht so rekonstruieren, dass es reale Geschichte rational auszurichten erlaubt. Was unter dem Titel Auch eine Geschichte der Philosophie präsentiert wird, zielt in Wahrheit geschichtsphilosophisch auf Rationalitätsansprüche, denen weiterführende geschichtliche Prozesse gerecht werden sollen, sofern sie eine Angelegenheit menschlicher Praxis und Willensbildung sind.
Aber ist das Attribut ›geschichtsphilosophisch‹ nicht ganz und gar obsolet? Bezieht es sich nach klassischem Verständnis nicht auf die Einheit einer alles und jeden umfassenden Geschichte, die (ungeachtet diverser Rehabilitierungsversuche) längst zerfallen bzw. nicht mehr glaubwürdig darzulegen ist? Heute hat alles (s)eine Geschichte. Die Wassermühle als überholte Technik ebenso wie das Wasser selbst, transnationale Machtgefüge ebenso wie jeder Einzelne, ja sogar das angeblich infolge eines »Urknalls« entstandene Universum und auch die sogenannte Dunkle Materie und Energie, aus der es nach aktuellem physikalischem Erkenntnisstand überwiegend besteht. Sind nicht selbst die kleinsten subatomaren Partikel aus Anderem entstanden? Die entsprechenden Genealogien bewahrheiten sich indessen erst heute, in unserer Gegenwart.
Heute gilt als weitgehend unbestritten, dass es lange keine ›Geschichte‹ im Singular gab, allenfalls Geschichten. Reinhart Kosellecks Rede von einem Kollektivsingular Geschichte ist in diesem Zusammenhang die Standardreferenz.5 Vor der Geschichte gab es demnach Geschichten und vor diesen wiederum nur Ahistorisches. Geht man von komplexen Geschichtsvorstellungen auf deren elementarere ›Vorläufer‹ wie die parataktische Annalistik zurück6 und fragt dann, was ihnen wiederum vorausging, so ist damit zu rechnen, dass sich früher oder später alle Spuren verlieren in einer hunderttausende von Jahren währenden Zeit der Anthropogenese, deren Anfänge nichts Schriftliches und nicht einmal Höhlenmalerei, sondern nur Knochen, gewisse Fragmente und Relikte hinterlassen haben. Genauer: Hinterlassen haben sie streng genommen gar nichts. Relikte etc. sind nur übrig und erhalten geblieben.7 So zeugen sie von immer neuem, schierem Untergang, dessen mineralische Produkte die obersten Schichten der Erde ausmachen.8
Heute wissen wir: Wir sind aus Toten/m zusammengesetzt. Aber das allein macht keine Geschichte aus. Vielmehr setzt dieser Begriff im üblichen Verständnis einen Anfang voraus, der sich auf ein Ziel oder Ende zubewegt (hat), sei es auch nur ein Abbruch oder Untergang, von dem man wenigstens nachträglich erzählen kann, ohne dabei das jeweils Spätere als im Vorangegangenen präformiert oder determiniert ausgeben zu müssen. Solange eine Geschichte im Gang ist, muss vorläufig unentschieden bleiben, worin sie mündet. Und davon sollte auch eine nacherzählte Geschichte noch etwas ahnen lassen, die die Kontingenz dessen, was hätte anders kommen können, nicht einfach unterdrückt, sei es durch nachträgliches Teleologisieren, sei es durch Retrodiktionen, die deutlich machen, ›wie es kommen musste‹, sei es durch einen (un-)happy endism, der das (un-)glückliche Ende schon im Voraus kennt.9
So weit geschichtliche Überlieferung zurückreicht, bezeugt sie das Interesse der Menschen an nachvollziehbaren Konfigurationen von Anfängen und Enden – sei es im Mythos, sei es in narrativen Praktiken der Verknüpfung von res gestae in der Form einer historia rerum gestarum. Aber von einfachen Fabelkompositionen, die Aristoteles in seiner Politik als mythos bezeichnete, über das historisch reflektierte Erzählen, wie wir es bei Thukydides finden, bis hin zur Etablierung einer Geschichte, die nicht nur ganze Ethnien und politische Lebensformen, Dynastien, Imperien und Weltreiche, sondern schließlich die Menschheit im Rahmen einer Welt- und Universalgeschichte umfassen sollte, war es ein weiter Weg. Und dieser Weg scheint sich insofern als Sackgasse erwiesen zu haben, als man nicht wissen kann, ob diese Geschichte nicht nur diverse Anfänge (ohne bereits absehbares Ende) erkennen lässt, sondern darüber hinaus einen Ursprung und ein Ziel hat, wie es noch Karl Jaspers für denkbar hielt.10 Von einer Geschichtsphilosophie, die quasi kraft Amtes diese Fragen entscheiden könnte, weil man ihr höhere oder tiefere Einsicht in die entscheidenden geschichtlichen Zusammenhänge zutraut, kann keine Rede mehr sein und konnte wohl nie die Rede sein, wenn Karl Löwith, Habermas’ wichtigster Gewährsmann in dieser Hinsicht (1/597 ff.), recht hat mit seiner Behauptung, dass es sich zu keiner Zeit je um Fragen philosophischen Wissens, sondern stets nur um Fragen des Glaubens gehandelt haben kann.11 Theologisch motivierter Glaube habe dazu verleitet, auch auf die Geschichte als zu einem guten Ende führende zu bauen, die sich nicht darin erschöpfen sollte, einfach so katastrophal wie bisher weiterzugehen oder abzubrechen, zu verkümmern oder zu versanden (um das Mindeste zu sagen), sondern Rettung und Heil verspricht.
Löwith ging es in seinem Klassiker Weltgeschichte und Heilsgeschehen nicht darum, den Ursprung religiösen Glaubens aufzuzeigen, sondern darum, zu entlarven, wie er zu einem Glauben an die Geschichte führen konnte, der im Wesentlichen zwei Deutungen zulässt: Entweder führt ›die‹ Geschichte für jeden Einzelnen, das eigene Volk oder alle Menschen zu einem guten, Rettung und Heil versprechenden Ende, das ›nach‹ ihr oder im Anderen der Zeit eintreten wird, oder aber sie realisiert selbst dieses gute Ende und entpuppt sich, allen widersprechenden Evidenzen zum Trotz, ihrerseits als ein Heilsgeschehen, das so oder so, auch unter ›säkularisierten‹ Bedingungen, zu quasi paradiesischen Zuständen führen wird.12 Löwith hielt es für unbestreitbar, dass sich nichts dergleichen wissen lässt und dass der entsprechende Glaube an die Geschichte seine Glaubwürdigkeit längst vollkommen eingebüßt hat, so dass geschichtstheologisch entscheidende Fragen wie die, ob das Eschaton in der Geschichte oder durch sie hindurch erreichbar ist (1/604), ob es selbst geschichtliche Wirklichkeit werden kann oder sie ein für alle Mal abbrechen muss, aus seiner Sicht bereits merkwürdig überholt wirkten. Habermas bescheinigte ihm einen »stoischen Rückzug vom historischen Bewußtsein«13 überhaupt, das auf jegliche philosophische Deutung ›der‹ Geschichte verzichtet und sich damit abfindet, dass wir zwischenzeitlich, zwischen Geburt und Tod, nur insoweit geschichtlich existieren, als Weisen der Erzählung davon Rechenschaft ablegen können, wie man sie bereits in der Antike kannte, ohne die geringste Vorstellung von einer Geschichte zu haben, deren Ursprung und Ziel alle Geschichten einbegreifen könnte. Was bleibt? Vor uns und nach uns eine Nicht-Geschichte, die jeglicher Erinnerbarkeit spottet. Demnach »gibt es keine Erinnerung an die Früheren, / und auch an die Späteren, die erst kommen werden, auch an sie wird es keine Erinnerung geben / bei denen, die noch später kommen werden«, wie es bereits im Buch Kohelet heißt. Selbst ein Erzähler und Geschichtsschreiber wie Thukydides, der mit seinem Werk einen »Besitz für immer« hinterlassen wollte, bietet dementsprechend ein Bild von »furchtbarer Diesseitigkeit«, wie ein Kommentator meinte.14
Mehr als zweieinhalbtausend Jahre später bestätigt die moderne Kosmologie diesen Befund: Alles, was man Geschichte nennt, kann nur eine zwischenzeitliche Angelegenheit sein. Nicht einmal Knochen werden zurückbleiben, wenn die Sonne in annähernd vier Milliarden Jahren der Erde als Roter Riese bedrohlich nahe rücken und alles auf ihr versengen wird, was bis dahin nicht emigrieren konnte. Unsere zwischenzeitlichen Geschichten wird niemand erzählen können, ganz gleich, ob sie früher oder später zum Ende kommen. Wir sind nur eine Episode und womöglich objektiv »verloren«, wie Edgar Morin und Anne B. Kern in ihrem Versuch einer planetarischen Politik für die Erde schreiben, die sich trotz allem als terre-patrie sollte erweisen können.15
Was die großen monotheistischen Religionen dagegen eint, ist wenn nicht nur, so doch im Wesentlichen ihr Widerstand gegen dieses in der modernen Kosmologie affirmierte, aber seit jeher befürchtete Verlorensein – von Ägypten mit seinen Pyramiden, die wenigstens privilegierten Machthabern den Weg in ein ungefährdetes Jenseits eröffnen sollten, wo die Zeit keinen Schaden mehr anrichtet, über das Judentum bis hin zum Christentum und Islam mit der Erwartung, aus exiliertem irdischem Leben eines Tages in paradiesische Verhältnisse ewiger Geborgenheit heimkehren zu können.16 Jedes Mal handelt es sich um Religionen, denen Habermas die Idee rettender Gerechtigkeit und ein Heilsversprechen zuschreibt – im Gegensatz zu einer Geschichte, in der fast nichts ›wiedergutgemacht‹ werden kann17, jedenfalls gerade nicht das, was am allermeisten danach verlangt: das Schlimmste, das Äußerste, die extreme Gewalt, das Böse, wie es – von Vergil, Dante und John Mil-ton einmal ganz abgesehen – besonders seit Bartolomé de Las Casas und Carl v. Clausewitz bis hin zu Hannah Arendt, Eric Hobsbawm, Kate Millet, Tzvetan Todorov u. v. a. beschrieben wird.
Seit Löwiths Buch ist nicht mehr dessen Kernthese strittig, dass sich ›moderne‹ Geschichtsphilosophie in die Perspektive jenes Versprechens eingeschrieben hat. Umstritten ist vor allem seit Hans Blumenbergs Verteidigung der »Legitimität der Neuzeit« dagegen, wie dies zu deuten ist, ob als Säkularisierung, Transformation oder Abbruch der entsprechenden theologischen Erbschaft. Dass die von Geschichtsphilosophen beschriebene Weltgeschichte selbst als Heilsgeschehen, also als durch Geschichte selbst herbeigeführtes Heil zu verstehen ist, daran mag allerdings niemand mehr glauben angesichts solcher Lehrstücke wie der Transformation des Marxismus in Leninismus und schließlich Ultrabolschewismus und Stalinismus sowie eines chauvinistischen Nationalismus in rassistische Vernichtungspolitik. Insofern hat heute jeder Hegelianer einen schweren Stand, der der Weltgeschichte eine wogegen auch immer ›heilsame‹ immanente Vernunft glaubt wenn nicht nachweisen zu können, so doch nach wie vor unterstellen zu dürfen, um schließlich an sie zu glauben.
Viel mehr Zustimmung erfährt dagegen die Geschichtstheorie Kants – abzüglich seines Vertrauens auf eine letztlich alles zum Guten wendende »Vorsehung« –, die mehrfache, schier unüberwindliche Missverhältnisse wie die zwischen guten Absichten und üblen Folgen, antagonistischer »ungeselliger Geselligkeit« und Fortschritt, individueller Lebenszeit und Weltgeschichte unumwunden zugibt, ohne sie dialektisch aufheben zu wollen.18 Gerade angesichts dieser Missverhältnisse suchte Kant den pragmatischen Sinn jedes Einsatzes für das künftig Bessere zur Geltung zu bringen, ohne zu beschönigen, dass die Handelnden selbst davon womöglich ›nichts haben‹. Dabei begegnete Kant der Vorstellung, ein gutes Ende der Welt-Geschichte (falls es ein solches geben sollte) sei auf intentionale Weise erreichbar, ebenso mit Skepsis wie der bloßen Hoffnung darauf, es werde irgendwann von außen in sie einbrechen und die Geschichte der Menschen abbrechen – die, aus heutiger Sicht zumal, längst keinen immanent fortschrittlichen und insofern auch legitimen Sinn mehr erkennen lässt. Es mag noch hier und da gewisse Fortschritte geben (etwa medizinische; auch die aber so gut wie nie ohne Kehrseiten); doch der Fortschritt, der die Geschichte der menschlichen Gattung im Ganzen erfassen und zu einem guten Ende bringen könnte, ist offenbar nicht mehr zu verteidigen. Selbst Hegel hätte allerdings ohne Weiteres zugestanden, dass es sich hier nicht bloß um eine Frage des Wissens um das Ende handeln kann. Es komme darauf an, wie man die Geschichte »ansieht«, lehrte er bekanntlich. Es handele sich um eine Frage der Perspektive. Nehme man die richtige ein, nämlich diejenige, die alle anderen Perspektiven vernünftig in sich einbegreift, so werde einen die Geschichte ebenfalls »vernünftig ansehen« – bzw. sie werde sich ›vernünftig‹ ausnehmen (VG, 31).
Mit Rekurs auf den gleichen Begriff, den der Perspektive (oder verwandte Begriffe wie Sehe-, Gesichts- und Standpunkt), hat man bestritten, Hegel selbst könne der unvermeidlichen Endlichkeit und Selektivität seines eigenen Geschichtsdenkens entkommen. Das Prinzip des weltgeschichtlichen Denkens, nämlich die »Totalität aller Gesichtspunkte« (VG, 32), hilft uns in der Sache nicht weiter. Wir sind nicht nur als endliche Wesen nicht dazu in der Lage, eine solche Totalität zu konstruieren. Geschichtliche Perspektiven erweisen sich wie auch visuelle von vornherein als inkompossibel und lassen sich daher nicht zum Geometral einer Perspektive zusammenfügen, die alle anderen in sich zu integrieren vermöchte. Darauf wird von Maurice Merleau-Ponty bis hin zu Paul Veyne mit Recht insistiert. 19
Kein Denken erscheint so gesehen provinzieller als gerade dasjenige, das seiner eigenen Standortbindung entkommen zu können meint; keines dagegen offener als dasjenige, das sich in dieser Hinsicht unumwunden als anfechtbares zu erkennen gibt, das nicht für sich in Anspruch nimmt, privilegierte Einsicht in die (eine) Geschichte aller zu haben, und sich dem Schrecken stellt, den viele mit dem Gedanken verbinden, sie seien rückhaltlos ›der‹ Geschichte ausgeliefert. Wie sollte dieser Gedanke in der ausweglosen Lage derjenigen zu ertragen gewesen sein, die realisierten, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs dazu verurteilt zu sein, zu verrecken, wie im Archipel Gulag oder in den Vernichtungslagern der Nazis durch Arbeit vernichtet oder wie unter Pol Pot und vieler anderer Despoten und Mittäter ohne Umschweife oder nach langer Folter spurlos ›liquidiert‹ zu werden? Fällt nicht im Tod jedes Opfers im Grunde ein vernichtendes Urteil über die Geschichte? Ging mit jedem von ihnen nicht die Welt unter? So überzogen solche Fragen auf den ersten Blick auch anmuten mögen, prominente Philosophen wie Emmanuel Levinas und Jacques Derrida haben sie aufgeworfen und uns als erratische Einsprüche gegen jedes Denken hinterlassen, das naiv, skrupellos oder selbstgerecht noch auf ›das Kommen des Besseren‹ setzen will und den ›Preis‹ zu rechtfertigen bereit ist, um den es angeblich ›erkauft‹ werden muss.
Zeigen solche Fragen ohne Weiteres, wie anachronistisch sich die Idee einer (zeitgemäßen) Geschichtsphilosophie im Grunde längst ausnimmt, die viele tatsächlich für eine nach Kant, Hegel und F. W. J. Schelling erledigte Angelegenheit zu halten scheinen, welche allenfalls noch von historischem Interesse sein kann? Nicht unbedingt, denn schon Voltaire, auf den man den Ausdruck philosophie de l’histoire zurückführt, glaubte zu wissen, dass die Geschichte nur eine Reihenfolge unaufhörlicher Gewalt, Verbrechen und Kriege darstellt (was Sigmund Freud und viele andere sinngemäß wiederholt haben). Und auch Johann Georg Herder, an den Habermas anknüpft – bezeichnenderweise, indem er den Genitiv umdreht, so dass aus einer Philosophie der Geschichte scheinbar etwas ganz anderes, nämlich eine Geschichte der Philosophie wird –, lag nicht daran, die Gewaltsamkeit der res gestae zu beschönigen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass Habermas’ Geschichte der Philosophie wiederum auf eine Geschichtsphilosophie hinausläuft, die sich nicht bloß auf eine Untersuchung der Genealogie der eigenen Begriffe beschränkt, sondern annimmt, mit diesen komme genau die Vernunft zur Sprache, die die Geschichte des Abendlandes und letztlich aller Menschen trotz allem voranzubringen verspricht. Das soll wenigstens nachträglich deutlich geworden sein und dabei zugleich einen zukunftsweisenden Orientierungsbedarf befriedigen, ohne dass es nötig wäre, einen der Geschichte immanenten ›Geist‹ zu hypostasieren. Wenn das zutrifft, müsste sich zeigen, dass nicht nur die Philosophie nicht ohne ihre Geschichte auskommt, sondern auch die Geschichte der Philosophie bedarf; genauer: dass sie nach dieser, von Habermas rekonstruierten Philosophie geschichtlicher Vernunft verlangt, die in der Gegenwart kommunikativer Rationalität ihren letzten Rückhalt haben soll. In dieser Hinsicht markiert Habermas’ Rückbezug auf Herder zugleich eine kritische Distanz.
2.Rückblick auf Herder
Mit Blick auf Voltaire und die »Trümmer der weltlichen Geschichte« (43) entwirft Herder20 eine Philosophie dieses Gegenstandes, der er, wie Habermas seiner Geschichte der Philosophie, ein einschränkendes »auch« voranstellt.21 Ihr Thema ist, wie die Menschheit nach und nach die Erde erobert, ihrem Bilde und der noch von Kant und Hegel bemühten Vorsehung gemäß, die die Menschheit die Stufen einer universalgeschichtlichen Leiter erklimmen lässt (44, 49, 51). Dabei bleibt unvermeidlich das Meiste auf der Strecke, und alles in Wahrheit Weiterführende muss gelernt werden (50, 65). Letzteres zeigt sich »verteilt in tausend Gestalten«; »und doch wird ein Plan des Fortstrebens sichtbar«, Herders »großes Thema«: nämlich eine »leitende Absicht auf Erden« – wider die Franzosen, die unter »dem blendenden Titel ›Aus der Geschichte der Welt‹« alles Mögliche zum Beweis ihrer Zweifel hernehmen, ob sie je etwas anderes lehrt als fortwährendes Scheitern (70 f.). Dagegen macht Herder geltend, wie alles »nichts als Grundlage« für das Spätere ist und so die Chance bietet, »eine verfallene Welt zu bessern« (71, 75).
Dabei verspottet er jene naiven Aufklärer, die eine allgemeine »Verbesserung der Welt […] zu Philosophie und Ruhe herleiten« wollen. »In unserem Jahrhundert ist leider so viel Licht!«, ruft Herder aus22 und unterstellt, es könne auch an einem Übermaß von Aufklärung liegen, dass man das Wichtigste nicht erkennt. Frisst ein weitgehend poliziertes Europa nicht seine Kinder (81 f.)? Sind etwa im Ernst »die ewigen Völkerzüge und Verwüstungen, Vasallenkriege und Befehdungen [sowie] Kreuzzüge« zu verteidigen, aus denen die aufgeklärte europäische Gegenwart hervorgegangen ist? Nicht verteidigen, nur erklären will Herder sie als »Werkzeuge zu großem Guten in der Zukunft«, gerät dabei freilich selbst in die Nähe einer geradezu verächtlich kommentierten »Lieblingsphilosophie des Jahrhunderts«, die lehrt, warum das alles hat sein müssen, »ehe das runde, glatte, artige Ding erscheinen konnte, was wir sind« (83 f.). Dem will Herder »nichts hinzusetzen« bis auf einige seines Erachtens unbestreitbare Befunde: Simple Mechanik, tausende kleine Zufälle, mitwirkende Ursachen, »gleichsam hingeworfene Begebenheiten« und Kräfte, »denen sich die Menschen meistens widersetzten«, wo sie die Folgen nicht übersahen – das macht Geschichte aus. All das erweist sich als »von Menschen unüberdacht, ungehofft, unbewürkt« (88). Und was infolgedessen aus ihnen wird, erscheint als bloße Resultante einer Geschichtlichkeit, die sie nicht in den Griff bekommen – weshalb sie allen Grund haben, sich nicht bloß als deren »Mittel« zu verstehen (84). So widersetzt sich Herder jenen »Affen der Humanität«, die solche Bedenken gar nicht hegen und den »erbärmlichen Fehlschluss« von ihrer historischen Bildung auf wirkende Ursachen begehen (93, 96). Alle Bildung, Erziehung und Aufklärung habe jedoch keinerlei Wirkung. Ihre »Schätze liegen da und werden nicht gebraucht«. Und alle Lehrbücher der Erziehung, »wie wir tausend haben«, vermögen offenbar nichts daran zu ändern, dass die Welt bleiben wird, wie sie ist (98 f.). Und doch wähnt man in Europa »gewissermaßen alle Völker und Weltteile unter unserm Schatten«, hält »die Wilden, je mehr sie unsern Branntwein und Üppigkeit lieb gewinnen, auch unsrer Bekehrung reif«. Sollen sie doch »alle Menschen wie wir sein«, so »poliziert und glücklich«, wie wir in unserem gesellschaftlichen Leben anscheinend ja sind, das in Wahrheit nur zu Resignation, Saturiertheit, Selbstgerechtigkeit, »ewiger Ruhe, Friede, Sicherheit und Gehorsam in Europa« führt (101 f.), während gleichzeitig »drei Weltteile durch uns verwüstet« werden und der »große Gott Mammon« herrscht. Ungeachtet dieser exportierten Gewalt sei alles »wie überschwemmt mit schönen Grundsätzen, Entwicklungen, Systemen, Auslegungen – überschwemmet, daß fast niemand mehr den Boden sieht und Fuß hat« (96). Man hat Manufakturen, Handel, Künste, Ruhe, Sicherheit und die Regierungen »mit nichts mehr in sich zu kämpfen«. Was will man mehr? Herder bemerkt dazu: »Man glaubt Satire zu lesen«; und »warum den Kranken stören, ohne daß man ihm hilft?« (110 f.)
Doch er lässt es mit solchem Sarkasmus nicht bewenden, wo er auflistet, was gegen ein naiv-aufklärerisches Geschichtsverständnis zu setzen ist: Geschichte ist keine »schöne Progression« in Richtung auf irgendein Ideal. »Wahrscheinlich« bleibe »der Mensch immer Mensch« (ungeachtet tausendfacher Modifikationen) und zugleich »immer nur Werkzeug« einer auf individuelles Glück keinerlei Rücksicht nehmenden Geschichte. So gesehen wäre eine »Physik der Geschichte« womöglich doch einer Philosophie dieser Angelegenheit vorzuziehen, die sich nicht zu »ruhiger Abwartung des Folgeganzen« durchringen kann (112) und bereits auf gezielte Beschleunigung der Geschichte sinnt. Diese stellt sich für Herder vorderhand jedoch als »tausendgestaltige Fabel« dar, die »voll eines großen Sinns« sein mag, aber menschlicher Verfügung nicht untersteht (113). Vorarbeiten zur Realisierung dieses Sinns mag es genug geben, aber alles scheint in Unordnung zu sein. Herder sieht sich nicht auf dem Gipfel universalen Fortschritts, sondern in einem »Abgrund […], von allen Seiten verloren«. Nur darauf hofft er, dass sich jene Fabel als »Gang Gottes über [!] die Nationen« und als »lebendige[r] Kommentar[] der Offenbarung« erweisen wird (118 f.). »Geschichte der Menschheit im edelsten Verstande, du wirst werden«, ruft Herder aus und hofft auf die »Eräugnisse« seiner Zeit (120) – ähnlich wie wenig später Kant auf das »Geschichtszeichen« des allenthalben angesichts der Französischen Revolution zu spürenden Enthusiasmus (vgl. 2/367).
Doch weiß Herder, dass die Nachwelt über die Fruchtbarkeit aller geschichtlichen Ereignisse (die er als »Eräugnisse« offenbar für grundsätzlich sichtbar hält) entscheiden muss, in der auch das Überlieferte gegebenenfalls fruchten wird, ohne dass »man selbst Ernte erwarten« dürfte (125). In der Nachwelt »nahen« auch wir uns womöglich »einem neuen Auftritte, wenn auch bloß durch Verwesung«, wenn einmal andere über die Europäer triumphieren werden (131). Dabei mag es zu »unersetzliche[n] Verluste[n]« kommen, die aber, so glaubt Herder, »für die Hand der Vorsehung noch Werkzeug« sein werden, welche »auch über Millionen Leichname zum Ziel« kommen soll (128). »Alle bloß körperliche und politische Zwecke zerfallen wie Scherb und Leichnam, die Seele, der Geist, Inhalt fürs Ganze der Menschheit, der bleibt«, koste es, was es wolle. So bezeugt Herder, dass er (so wie jeder Andere, der sich als »Bruder« erweisen soll) »nichts, das Ganze aber alles sei« (136) – im Gegensatz zu Einzelnen, »die im Wahn des Freien handeln«. Das fragliche Ganze dürfte sich, wenn überhaupt, allerdings nur einem »Allanblick« erschließen, über den tatsächlich niemand verfügen kann. Geschichtliche Perspektiven, wie sie seinerzeit Johann Martin Chladenius von Leibniz her dachte, lassen sich nicht in einem universalen Über-Blick zusammenfügen. »Ein Standpunkt«, von dem aus »das Ganze nur unsres Geschlechts zu übersehen« wäre, lässt sich nicht einnehmen (137). So erscheinen »Reisebeschreibungen« derjenigen vielleicht doch als vielsprechender, die »in Europa nichts zu tun« haben und mit »einer Art philosophischer Wut« die Erde erkunden, um womöglich einst zu finden, »was wir am wenigsten suchten: Erörterungen der Geschichte der wichtigsten menschlichen Welt« – vorausgesetzt, »unsere Zeit wird bald mehrere Augen öffnen« … (119).
3.Zur geschichtsphilosophischen Dimension kommunikativer Rationalität
Es lohnt sich, diese vom Offenbarungsglauben gleichsam überschirmten Grundgedanken Herders in Erinnerung zu rufen, denn man muss sich fragen, warum Habermas, dem eine derartige Rückversicherung seines geschichtstheoretischen Denkens scheinbar gar nicht zur Verfügung steht, mit seinem Buchtitel gerade an Herder anknüpft.23 Was wie der Lapsus einer schlichten und irrtümlichen Verdrehung erscheint (so dass aus ›Philosophie der Geschichte‹ im Sinne Herders bei Habermas eine ›Geschichte der Philosophie‹ werden kann), führt nämlich auf den Kern eines viel stärkeren theoretischen Anspruchs, als es der zweite Titel auf den ersten Blick verrät: So, wie Habermas die Geschichte der Philosophie rekonstruiert, kommt nämlich – mit eher verdeckter als expliziter Absicht – eine veritable Geschichtsphilosophie heraus, die es nahegelegt hätte, direkt Herders Buchtitel zu wiederholen, die jedoch nicht mit all jenen Hypotheken belastet sein soll, welche sich seinerzeit Isaak Iselin, Friedrich Schiller, Kant und Hegel, aber auch, jenseits des Rheins, Voltaire, Turgot, Rousseau, Condorcet und viele andere aufgebürdet hatten. Deshalb setzt sich Habermas mehrfach sowohl von einer bloß optimistischen Fortschrittsideologie als auch von einer idealistischen Geschichtsmetaphysik auf den Spuren Hegels ab. Gleichwohl zielt seine Rekonstruktion der Geschichte der Philosophie offenbar auf eine kommunikative Rationalität, der er zutraut, eine im Sinne des normativ Richtigen zu bejahende Zukunft anzubahnen. Diese Rationalität soll ebenso wie diese Zukunft uns alle angehen und unterstellt so die vernünftige Einheit einer universalen Geschichte, die nicht länger als ein im Ganzen narrativ darstellbarer Ereigniszusammenhang vorgestellt wird.
Auf den ersten Blick scheint Habermas mit dem Buchtitel Auch eine Geschichte der Philosophie freilich nur ein Signal der Bescheidenheit zu geben, so als wollte er sagen: Ich biete auch eine Geschichte der Philosophie neben vielem anderem bzw. noch eine, unter mehreren Geschichten, bereits zahlreich vorliegenden und nach wie vor womöglich konkurrierenden, die sich nicht zu einer einzigen Geschichte und in diesem Sinne auch zu einer Philosophie der Geschichte zusammenfügen lassen. Letzteres würde dazu passen, dass ›Geschichtsphilosophie‹ weithin für eine ganz und gar obsolete Angelegenheit gehalten wird, (a) nachdem sich keine erzählbare Geschichte mehr denken lässt, die die kontingente Vielzahl bereits bekannter (und zukünftig zu erwartender, noch unbekannter) Geschichten in sich aufzuheben vermöchte; (b) nachdem nicht mehr überzeugend auf einen Ursprung zurückzugreifen ist, in dem ein der Geschichte immanentes Ziel angelegt zu denken wäre; (c) nachdem die Mediatisierbarkeit eines jeden im Prozess einer wie auch immer ›fortschreitenden‹ Geschichte radikal in Frage steht, die keine ›Opfer‹ rechtfertigen kann; (d) nachdem wir vor einem anscheinend unüberwindlichen Missverhältnis zwischen dem Leben jedes Einzelnen und Resultanten geschichtlicher, nicht im Ganzen ›machbarer‹ Prozesse stehen, an denen handelnde Subjekte allenfalls mitbeteiligt sind. So gesehen sind wir in eine disparate, ursprungs- und ziellose Vielzahl miteinander verflochtener, aber auch einander widerstreitender Geschichten verstrickt, ohne aber je ganz in ihnen aufgehen zu können, wie auch immer wir uns praktisch zu ihnen verhalten mögen. Jeder Einzelne erweist sich als ›anders‹ im Sinne radikaler, unaufhebbarer Alterität, nicht bloß als vergleichsweise ›verschieden‹ von Anderen, wie es eine »Politik der Differenz« (und auch Habermas selbst) oft beschreibt. Und Zukunft sollte nur eine Geschichtlichkeit haben, die es zuließe, ohne Angst ›anders‹ zu bleiben. Andernfalls wäre Geschichte nur eine fortwährende Form der Repression menschlicher Alterität, als die sie ein Autor wie Levinas tatsächlich charakterisiert hat, um nach religionsphilosophischen Auswegen zu suchen.24 Doch sind wir mit praktischen Herausforderungen konfrontiert, die gemäß Arnold Toynbees challenge-response-Schema unbedingt nach Antworten verlangen und es nicht zulassen, sie zu ignorieren. Dazu zählt unter anderem der viel zitierte Klimawandel auf dem Blauen Planeten, den die Jüngeren inzwischen glauben »retten« zu müssen angesichts eines arroganten menschlichen Selbstbewusstseins, das durch seine eigenen technischen, militärischen, machtstrategischen und ökonomischen Erfolge sein desaströses Scheitern selbst heraufbeschwört.
Habermas realisiert sehr wohl, wie angesichts dessen neue Fragen auf uns eindrängen – weit über jene Was-ist-Fragen hinausgehend, mit denen bereits Sokrates seine Schüler traktiert hat: Was ist Mut?25 Was ist Besonnenheit?26 Was ist Falschheit?27 Was ist Gerechtigkeit?28 Was ist Freundschaft?29 Was ist Schönheit?30 (1/432) – und auch weit über jene Problemstellungen hinausgehend, die viele unter Hinweis auf Kants Kritik der reinen Vernunft für die schlechterdings klassischen Fragen der Philosophie ausgeben31, die uns erhalten bleiben werden: »Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?« und schließlich die Frage, in der angeblich alle anderen Fragen kulminieren: »Was ist der Mensch?«32 Ist das überhaupt eine gut gestellte Frage?33 Wie kommen wir überhaupt dazu, Fragen zu stellen? Und an wen, wenn nicht nur an uns selbst? Sollten wir nicht auch fragen: An wen können wir uns wenden? Wer wird mir, wem kann ich Gehör schenken? Wie kann das geschehen, und wie kann sich das zeigen? Können wir ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben? Was droht uns, wenn dieses scheitert? Werden wir am Ende mundtot (gemacht) und insofern sprachlos, so dass wir nicht einmal mehr fragen können? Werden wir insofern aus der Welt, in der wir uns vorfinden, herausfallen und vorzeitig für Andere ›tot‹ sein? Setzen jene klassischen Fragen nicht erstaunlicherweise einfach voraus, dass wir ›da‹ sind und uns oder Andere infrage stellen können? Wie aber ist das allererst möglich? Ist es dazu nicht erforderlich, dass wir überhaupt im Rahmen einer sozialen Welt koexistieren, dass wir dadurch erst einmal »Welt teilen« (wie Luce Irigaray sich ausdrückt34) – und zwar so, dass sich das nicht auf ein bloßes »Mitsein« beschränkt (wie es noch Jean-Luc Nancy im Anschluss an Heidegger beschrieben hat35), sondern ein wirklich lebbares Leben ermöglicht, in dem nicht schon das bloße Dasein der Einen den Tod der Anderen heraufbeschwört?36 Was aber macht ein solches – Andere und die Welt nicht usurpierendes – Leben aus? Verlangt es am Ende nach einem sozialen Staat?
Auch Habermas erwägt, »ob sich nicht das Format jener [klassischen] Fragestellungen überlebt hat« (1/11), die an anderer Stelle allerdings wieder als »die substanziellen der Philosophie« eingestuft werden (2/299, 301, 372, 711), in denen man nur mit Mühe oder gar nicht jene »Fragen des Zeitgeistes« wiedererkennt, denen die Philosophie sich doch auch stellen sollte, wenn sie im Ernst noch den Anspruch erheben will, nicht nur als Begriffsanalytik oder als gänzlich historisierte um sich selbst zu kreisen, sondern ihre Zeit in Gedanken zu fassen (2/539), was man im Anschluss an Hegel in der Tradition der sogenannten Kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule, als deren wichtigster ›Erbe‹ Habermas heute vielfach gilt, als zentralen Anspruch begriffen hat.
Schließlich ist inzwischen auch eine anscheinend »völlig neue Art von normativen Fragen« wie die nach dem »Ende der Naturwüchsigkeit des menschlichen Organismus« aufgetaucht, deren öffentliche Diskussion angeblich »noch nicht einmal ernsthaft begonnen« hat (2/594).37 Somit stellt sich das grundsätzliche, von Habermas aber nicht eigens aufgeworfene Problem, wie sich ›die‹ Philosophie, die es in der unterstellten Einheitlichkeit gar nicht gibt, zu vorgängiger Nicht-Philosophie