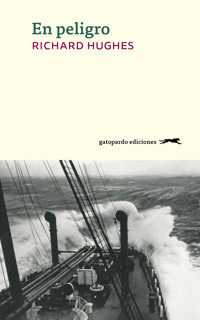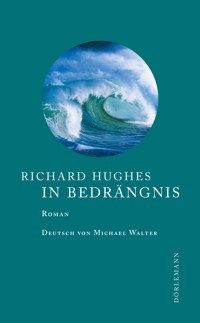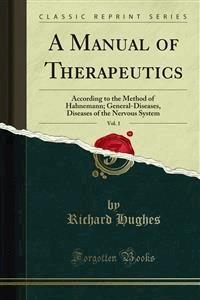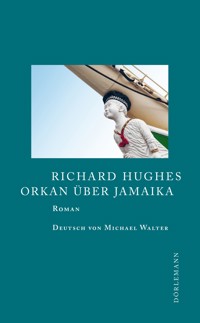
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt des Romans steht die zehnjährige Emily Bas-Thornton. Sie lebt mit ihrer Familie auf Jamaika, doch als ein Orkan über die Insel hinwegfegt und das Wohnhaus der Familie davonträgt, beschließen die Eltern, ihre Kinder nach England heimzuschicken.John, Emily und die »Krümel« werden einem Schiff anvertraut, das jedoch gekapert wird. Die Kinder bleiben durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände an Bord des Schiffes mit den überaus freundlichen Piraten … und erleben in der Folge zahlreiche Abenteuer, ehe sie an Bord eines Dampfers nach England gelangen.Richard Hughes erzählt in einem atemberaubenden Abenteuerroman, dass das Berüchtigte keineswegs so gefährlich und das Unschuldige so harmlos ist, wie es den Anschein macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Hughes
Orkan auf Jamaika
Roman
Aus dem Englischenvon Michael Walter
DÖRLEMANN
Die englische Originalausgabe »A highwind in Jamaica« erschien 1929 bei Chatto & Windus in London. Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © The Estate of Richard Hughes 1929 © für diese Ausgabe Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung eines Fotos von xyz Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-898-3www.doerlemann.ch
Inhalt
Kapitel Eins
Zu den Früchten der Abschaffung der Sklaverei auf den Westindischen Inseln gehören unzählige Ruinen, die entweder unmittelbar neben den übrig gebliebenen Häusern stehen oder nur einen Steinwurf entfernt: verfallene Sklavenunterkünfte, verfallene Zuckerrohrmühlen, verfallene Siedehäuser; und häufig auch verfallene Herrensitze, deren Erhaltung zu kostspielig gewesen wäre: Erdbeben, Feuer, Regen und eine verheerende Vegetation haben rasche Arbeit geleistet.
Eine Szene auf Jamaika ist mir sehr deutlich in Erinnerung. Es gab dort ein großes, aus Stein erbautes Haus, Derby Hill (wo die Parkers wohnten). Einstiger Mittelpunkt einer florierenden Plantage. Im Zuge der Befreiung ging sie, wie viele andere, pleite. Die Gebäude der Zuckerfabrik stürzten ein. Zuckerrohr und Guineagras erstickte der Busch. Die Feldneger verließen geschlossen ihre Hütten, um irgendwo zu leben, wo nicht einmal die Aussicht auf Arbeit sie belästigte. Dann brannten die Unterkünfte der Hausneger ab, und die drei verbliebenen treuen Diener bezogen den Herrensitz. Die zwei Erbinnen des gesamten Anwesens, die beiden Miss Parker, waren allmählich in die Jahre gekommen und infolge ihrer Erziehung lebensuntüchtig. Und dies ist die Szene: Ich besuche in irgendeiner Angelegenheit Derby Hill und wate durch hüfthohes Dickicht bis zur Haustür, die jetzt dauernd offen steht, weil ein üppig wucherndes Gewächs sie aufdrückt. Kräftige Kletterranken hatten alle Jalousien am Haus abgerissen und verdunkelten nun an deren Stelle die Räume, und aus diesem maroden, halbvegetabilen Dämmer lugte eine greise, in schmuddeligen Brokat gehüllte Negerin. Die beiden alten Miss Parker verlebten ihre Tage im Bett, denn die Neger hatten ihnen sämtliche Kleider weggenommen; sie waren halb verhungert. Auf einem silbernen Serviertablett wurde, in zwei gesprungenen Worcester-Tassen und drei Kokosnussschalen, Wasser zum Trinken gebracht. Bald erschien, in einem alten, ihren Tyrannen rasch abgebettelten Kattunkleid, eine der Erbinnen und werkelte lustlos im Chaos; sie versuchte, altes verkrustetes Blut und verklebte Federn geschlachteter Hühner von einem vergoldeten Marmortisch zu wischen, etwas Vernünftiges zu sagen und nebenher eine goldbronzierte Uhr aufzuziehen; schließlich kapitulierte sie und geisterte traumverloren zurück ins Bett. Nicht lange danach, so meine ich, ließ man beide vollends verhungern oder, da dies in einem so überaus fruchtbaren Land nahezu unmöglich war, mischte ihnen vielleicht gemahlenes Glas ins Essen – es gab verschiedene Gerüchte. Wie auch immer, sie starben.
Eine solche Szene prägt sich tief ein; weit tiefer als der gewöhnliche, weniger romantische Alltag, der den wirklichen Zustand einer Insel im statistischen Sinne widerspiegelt. Natürlich spielten sich derlei Melodramen selbst in der Übergangszeit nur ganz vereinzelt ab. Viel typischer war da beispielsweise Ferndale, ein ungefähr 15 Meilen von Derby Hill entferntes Anwesen. Dort stand nur noch das Aufseherhaus: Der Herrensitz war komplett eingestürzt und dem Erdboden gleichgemacht worden. Im steinernen Parterre des Aufseherhauses tummelten sich Ziegen und Kinder, zum bewohnten, aus Holz gebauten ersten Stock gelangte man über eine doppelte Holztreppe an der Außenseite. Bei einem Erdbeben verrutschte der obere Teil nur ein klein wenig und ließ sich anschließend mit großen Hebeln wieder zurechtrücken. Das Dach deckten Schindeln: Nach sehr trockenem Wetter leckte es wie ein Sieb, und in den ersten Tagen der Regenzeit wurden Betten und andere Möbel hastig verschoben, um sie dem Getröpfel zu entziehen, bis die Holzschindeln aufgequollen waren.
Die Leute, die damals dort lebten, hießen Bas-Thornton, keine eingeborenen »Kreolen« von der Insel, sondern eine Familie aus England. Mr. Bas-Thornton betrieb irgendein Geschäft in St. Anne, wohin er auf einem Maultier auch täglich ritt. Mit seinen langen Beinen bot er einen ziemlich lächerlichen Anblick, und da er ebenso launisch war wie ein Maultier, lohnte es sich meist, einen Streit zwischen den beiden zu beobachten.
Unweit des Wohnhauses befanden sich die verfallenen Mühlen und Siedehäuser. Diese beiden Gebäude liegen nie dicht beieinander; die Mühle, deren Wasserrad die mächtigen, senkrechten Walzen antreibt, steht auf höherem Terrain. Von hier fließt der Zuckerrohrsaft in einem keilförmigen Trog zum Siedehaus, wo ein Neger mit einem Graspinsel etwas Kalkmilch unterrührt, damit die Brühe granuliert. Dann kommt der Saft in große Kupferbottiche, unter denen Reisigbündel und »Bagasse«, d.h. ausgepresstes Zuckerrohr, verbrannt werden. Ein paar Neger schöpfen die brodelnden Bottiche mit lang gestielten Kupferkellen ab, während ihre Freunde in einem Dunst aus heißem Dampf danebensitzen, Zucker lutschen oder Bagasse kauen. Die abgeschöpfte Menge rinnt mit einer deftigen Beimischung aus Unrat – Insekten, sogar Ratten und was Negern sonst noch alles an den Sohlen klebt – über den Boden und in einen anderen Bottich, um Rum zu destillieren.
So hat man es zumindest damals gemacht. Moderne Methoden kenne ich weder, noch weiß ich, ob es überhaupt welche gibt, denn im Jahr 1860 habe ich die Insel zum letzten Mal besucht, und inzwischen ist viel Zeit vergangen.
Aber bereits vor diesem Jahr zählte all das auf Ferndale längst zur Geschichte; die großen Kupferbottiche waren umgestürzt, und oben in der Mühle lagen die drei großen Vertikalwalzen lose herum. Dort floss kein Wasser mehr, der Bach hatte sich ein anderes Bett gesucht. Die Kinder der Bas-Thorntons krochen oft durch die Wasserrinne zwischen welkem Laub und den Trümmern des Wasserrades in den Hohlraum dahinter. Dort fanden sie eines Tages einen von der Mutter für kurze Zeit verlassenen Wurf Wildkatzen. Emily wollte die winzigen Kätzchen in ihrer Schürze nachhause tragen, aber sie bissen und kratzten so wütend durch das dünne Kleidchen, dass Emily eigentlich ganz froh war – abgesehen von ihrem gekränkten Stolz –, dass ihr alle bis auf eines entwischten. Dieser Kater, Tom, wuchs bei ihnen auf, ohne je wirklich zahm zu werden. Später zeugte er mit ihrer alten Hauskatze, Kitty Cranbrook, etliche Würfe Junge; und Tabby, der einzige Überlebende dieser Nachkommenschaft, Tabby gelangte auf seine Art ebenfalls zu Berühmtheit. (Tom jedoch verschwand bald für immer im Dschungel.) Tabby war treu und erwies sich als ausgezeichneter Schwimmer; er paddelte den Kindern zum Vergnügen rund durch den Badeteich hinterher und maunzte hin und wieder vor Begeisterung. Außerdem liebte er das tödliche Spiel mit Schlangen. Er lauerte einer Klapperschlange oder einer Schwarzotter auf, als handele es sich nur um eine Maus, stürzte sich von einem Baum oder von sonst wo auf sie und kämpfte mit ihr auf Leben und Tod. Einmal wurde Tabby dabei gebissen, und alle heulten Rotz und Wasser, weil sie nun mit seinem spektakulären Todeskampf rechneten, aber Tabby verschwand einfach im Dschungel und fraß dort wahrscheinlich irgendein Kraut, denn nach einigen Tagen erschien er wieder in alter Frische und mit unverändertem Appetit auf Schlangen.
Im Zimmer von John, dem Rotschopf, wimmelte es von Ratten. Er fing sie in großen Fallen und ließ sie dann später frei, damit Tabby sie vertilgen konnte. Einmal schnappte sich der ungeduldige Kater die Falle samt Inhalt und lief damit unter großem Gejaule in die Nacht hinaus, und als die Falle scheppernd über die Steine schrappte, sprühten die Funken. Auch diesmal kehrte Tabby nach einigen Tagen geschmeidig und hochzufrieden zurück, aber seine Falle sah John nie wieder. Eine weitere Plage waren die Fledermäuse, die sein Zimmer ebenfalls zu Hunderten heimsuchten. Mr. Bas-Thornton knallte mit der Viehpeitsche und erledigte höchst elegant eine Fledermaus im Flug. Aber das verursachte nachts einen Heidenlärm in dem nur schuhschachtelgroßen Zimmer: Das ohrenbetäubende Knallen mischte sich mit dem leisen, durchdringenden Kreischen des verdammten Viehzeugs.
Ihre Eltern mochten das durchaus anders sehen, aber für englische Kinder war es so etwas wie das Paradies; besonders damals, als zuhause in England kein Mensch ein derart verwildertes Leben führte. Hier auf Jamaika musste man schon ein wenig fortschrittlicher sein oder dekadent, je nachdem, wie man das nennen will. Auf den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen zum Beispiel wurde nicht groß geachtet. Mit langen Haaren hätte sich die abendliche Suche nach Zecken und Nissen langwierig gestaltet: Emily und Rachel trugen die Haare kurzgeschnitten und durften auch alles, was die Jungs durften – auf Bäume klettern, Schwimmen gehen und verschiedene Tierfallen aufstellen; sie hatten sogar zwei Taschen in ihren Kleidern.
Ihren Lebensmittelpunkt bildete eher der Badeteich als das Haus. Jedes Jahr nach der Regenperiode wurde ein Damm quer über den Fluss gebaut, und so hatte man die ganze Trockenzeit über einen ziemlich großen Teich zum Schwimmen. Ringsum standen Bäume: Riesige aufgeplusterte Kapokbäume, zwischen denen Kaffeebäume, Blauholz sowie prächtige rote und grüne Pfeffersträucher gediehen; in dieser Umrahmung lag der Teich beinahe völlig im Schatten. Emily und John hängten Vogelschlingen in die Bäume – Lame-foot Sam hatte ihnen gezeigt, wie man sie baut: Schneide einen biegsamen Zweig und binde an das eine Ende eine Schnur. Das andere Ende wird so angespitzt, dass man eine Frucht als Köder darauf spießen kann. Genau unter diesem Dorn flacht man den Zweig etwas ab und bohrt dann durch den abgeplatteten Teil ein Loch. Schnitze einen kleinen Pflock, der genau in dieses Loch passt. Danach knüpfe eine Schlinge in das Ende der Schnur und biege den Zweig, als würdest du einen Bogen spannen, bis die Schlinge durch das kleine Loch gefädelt werden kann. Blockiere das Loch mit dem Pflock und lege die Schlinge um den Zweig herum aus. Spieße den Köder auf die Spitze und hänge die Falle ins Geäst eines Baumes. Der Vogel landet auf dem Pflock und pickt an der Frucht, der Pflock fällt heraus, die Schlinge zieht sich um seine Füße straff zusammen: dann schnell aus dem Wasser und durch irgendeine umständliche Prozedur wie »Ene, mene, muh, und raus bist du!« entscheiden, ob man dem Vogel den Hals umdreht oder die Freiheit schenkt – so lässt sich für beide Seiten – Kind und Vogel – die Spannung und Ungewissheit über den Augenblick der Gefangennahme hinaus verlängern.
Ganz klar, dass Emily große Pläne hegte, um den Negern etwas Gutes zu tun. Christen waren sie natürlich schon, an ihrer Sittlichkeit gab es also nichts zu bessern; ebenso wenig brauchten sie eine warme Suppe oder etwas Selbstgestricktes; aber sie waren betrüblicherweise ungebildet. Nach ausgedehnten Verhandlungen erklärten sie sich schließlich einverstanden, dass Emily Little Jim das Lesen beibringen durfte; aber der Erfolg blieb ihr versagt. Nicht weniger leidenschaftlich versuchte sie, Hauseidechsen zu haschen, ohne dass sie ihre Schwänze abwarfen, was sie nämlich tun, wenn sie Angst bekommen; es erforderte unendliche Geduld, um sie heil, das heißt, ohne sie zu erschrecken, in eine Zündholzschachtel zu sperren. Grüne Graseidechsen zu fangen war genauso heikel. Emily musste still sitzen und wie Orpheus pfeifen, bis die Tierchen aus ihren Schlupfwinkeln krochen und vor Aufregung die rosa Kehlen blähten; dann fing sie sie ganz behutsam mit einem langen, zu einem Lasso geschlungenen Grashalm. Ihr Zimmer beherbergte viele solcher Haustiere; manche davon waren lebendig, andere wahrscheinlich tot. Sie hatte auch folgsame Elfen und einen Hausgeist beziehungsweise ein Orakel: der Weiße Mäuserich mit dem Gummischwanz, der stets bereit war, eine strittige Frage zu klären und dessen Entscheidungen unwiderruflich galten – besonders für Rachel, Edward und Laura, die Kleinen (oder Krümel, wie man sie in der Familie nannte). Emily, als seine Dolmetscherin, genoss selbstverständlich gewisse Privilegien, und mit John, der älter war als Emily, legte er sich klugerweise gar nicht erst an.
Das Orakel war allgegenwärtig, die Elfen beschränkten sich mehr auf einen Ort; sie hausten in einem kleinen Loch im Hügel, wo zwei Palmlilien Wache standen.
Den meisten Spaß hatten sie mit einem großen, gegabelten Baumstamm. John hockte rittlings auf dem Hauptstamm, und die anderen schoben ihn an zwei Astgabeln durchs Wasser. Die Krümel planschten natürlich nur im Flachen, aber John und Emily tauchten. John machte einen richtigen Kopfsprung, während Emily stocksteif mit den Füßen voran ins Wasser hüpfte; dafür sprang sie aber von höheren Ästen als er. Als Emily acht Jahre alt war, hatte Mrs. Thornton gemeint, sie sei jetzt zu groß, um weiter nackt zu baden. Der einzige Badeanzug, den sie auftreiben konnte, war ein altes Baumwollnachthemd. Emily sprang in den Teich wie sonst auch. Erst verlor sie durch das von der Luft aufgeblähte Nachthemd die Balance, dann schlang sich der nasse Stoff um Kopf und Arme, sodass sie beinahe ertrunken wäre. Danach scherte man sich wieder den Teufel um die Schicklichkeit, es lohnt sich kaum, deswegen zu ertrinken – zumindest nicht auf den ersten Blick.
Aber einmal ertrank wirklich ein Neger im Teich. Er hatte sich den Bauch mit gestohlenen Mangofrüchten vollgeschlagen, und da ihn sein schlechtes Gewissen sowieso schon quälte, dachte er, er könnte sich auch gleich noch im verbotenen Teich abkühlen und mit einmal bereuen für zwei Vergehen büßen. Er konnte nicht schwimmen und hatte nur ein Kind (Little Jim) bei sich. Das kalte Wasser und sein übervoller Magen verursachten einen Schlaganfall: Jim stupste ihn ein paar Mal mit einem Stöckchen und lief dann erschrocken weg. Ob der Mann am Schlag gestorben war oder ob es sich um Tod durch Ertrinken handelte, sollte eine gerichtliche Untersuchung feststellen; und nachdem sich der Arzt eine Woche in Ferndale aufgehalten hatte, erklärte er, der Mann sei zwar ertrunken, aber auch bis oben hin mit grünen Mangos vollgestopft gewesen. Dies brachte den großen Vorteil mit sich, dass kein Neger mehr im Teich baden wollte, aus Angst, der »Duppy« oder Geist des Toten könnte ihn holen. Näherte sich also ein Schwarzer, wenn John und Emily badeten, dann taten sie immer so, als würden sie gerade vom »Duppy« gepackt, worauf der Neger völlig fassungslos davonrannte. Nur ein einziger Neger auf Ferndale hatte tatsächlich jemals einen Duppy gesehen: Aber das reichte völlig. Man kann einen Duppy nicht mit einem lebendigen Menschen verwechseln, weil ein Duppy den Kopf nämlich verkehrt herum auf den Schultern trägt und auch immer eine Kette mit sich herumschleppt; außerdem darf man ihn niemals ins Gesicht hinein Duppy nennen, denn das verleiht ihm eine gewisse Macht. Das hatte der arme Kerl nicht bedacht und bei dessen Anblick laut »Duppy!« gerufen. Seither plagte ihn ein schreckliches Reißen.
Lame-foot Sam wusste die meisten Geschichten. Er hockte den ganzen Tag auf der Steinterrasse, wo der Nelkenpfeffer getrocknet wurde, und pulte Würmer aus seinen Zehen. Die Kinder fanden das zuerst grauenvoll, aber er wirkte ganz zufrieden dabei; und wenn solche Würmlein ihnen selbst unter die Haut krochen und ihre Eiersäckchen ablegten, dann war das durchaus nicht nur unangenehm. John überlief sogar ein prickelndes Gefühl, wenn er an so einer Stelle rieb. Sam erzählte ihnen die Geschichten von Anansi: Anansi und der Tiger und wie Anansi einmal das Kinderzimmer des Krokodils hütete und so weiter. Er wusste auch ein kleines Gedicht, mit dem er sie schwer beeindruckte:
Quacko Sam
Sein ganz feine Mann:
Er tanzen alle Tänze, wo ein Schwarzer kann:
Er tanzen den Schottischen, er tanzen den Jig
Er tanzen so lange, bis seine Füße dick.
Vielleicht lag hier ja der Ursprung von Sams Gebrechen: Er war ausgesprochen gesellig. Man sagte ihm eine Unmenge von Kindern nach.
II
Der den Teich speisende Bach trat aus dem Dschungel als Wasserader zu Tage, die zu Entdeckungsreisen einlud; trotzdem kamen die Kinder bei ihren Erkundungen nur selten weit. Jeder Stein musste umgedreht werden, in der Hoffnung, darunter einen Flusskrebs zu finden, oder John hatte sein Sportgewehr dabei, das er mit Wasser lud, um auf fliegende Kolibris zu schießen, die als Jagdbeute für jedes massivere Geschoss viel zu winzig und zart waren. Denn nur wenige Meter weiter wuchs ein Frangipanibaum: Ein leuchtendes, blattloses Blütenmeer, das fast verschwand hinter einer Wolke aus Kolibris, deren Glanz die Blüten überstrahlte. Viele Schriftsteller sind bei dem Versuch gescheitert, ein so funkelndes Juwel wie den Kolibri zu schildern – es ist schlicht unmöglich.
Kolibris bauen ihre winzigen Wollnester auf den Astspitzen, dort, wo keine Schlange sie erreichen kann. Sie kümmern sich hingebungsvoll um ihr Gelege und lassen es selbst dann nicht im Stich, wenn man sie anfasst. Aber die Kinder wagten nie, diese zarten Geschöpfe zu berühren; sie betrachteten sie unverwandt mit angehaltenem Atem – und die Vögel hielten ihren Blicken stand.
An dieser überirdisch leuchtenden Barriere blieben sie meist hängen; nur selten dehnten sie ihre Erkundungen weiter aus. Dies geschah, glaube ich, nur einmal, nämlich an einem Tag, als Emily besonders schlechte Laune hatte.
Es war ihr zehnter Geburtstag. Sie hatten den ganzen Morgen im gläsernen Dämmerlicht des Badeteichs vertrödelt. Jetzt kauerte John nackt am Ufer und bastelte eine Falle aus Weidenzweigen. Die Krümel tobten und alberten im Seichten. Emily hockte, um sich abzukühlen, bis zum Kinn im Wasser, und Hunderte von frisch geschlüpften Fischchen kitzelten mit ihren forschenden Mäulchen jeden Zentimeter ihres Körpers wie mit ausdruckslos hingetupften Küssen.
Neuerdings empfand sie sowieso jede Art körperlicher Berührung als unangenehm – aber das hier war einfach ekelhaft. Schließlich ertrug sie es nicht länger, stieg aus dem Teich und zog sich an. Rachel und Laura waren zu klein für einen langen Spaziergang, und am allerwenigsten, das spürte sie, hätte sie einen der Jungs dabeihaben wollen. Also stahl sie sich hinter Johns Rücken leise davon und bedachte ihn im Weggehen, ohne recht zu wissen warum, noch mit einem bitterbösen Blick. Schon bald war sie im Gebüsch verschwunden.
Sie watete im Flussbett ziemlich rasch etwa drei Meilen aufwärts, ohne sonderlich auf ihre Umgebung zu achten. So weit draußen war sie noch nie gewesen. Dann weckte eine bis zum Wasser hin abfallende Lichtung ihr Interesse. Hier entsprang der Fluss. Emily hielt entzückt den Atem an: Unter einer Bambusgruppe sprudelte er aus drei verschiedenen Quellen kalt und klar hervor, genau so, wie es sich für einen Fluss schickte. Eine phantastische Entdeckung, und ein Fund, der nur ihr allein gehörte. Sie sandte augenblicklich ein stummes Dankgebet gen Himmel, dass ihr der liebe Gott so eine herrliche Geburtstagsüberraschung beschert hatte, vor allem, weil bis dahin alles schiefzugehen schien. Dann stocherte sie mit dem Arm zwischen Farnkraut und Brunnenkresse in den Kalksteinquellen.
Als es hinter ihr platschte, drehte sie sich um. Ungefähr ein halbes Dutzend fremder Negerkinder waren die Lichtung heruntergekommen, um Wasser zu holen, und glotzten sie jetzt erstaunt an. Emily erwiderte die Blicke. Plötzlich erschraken die Kinder, warfen die Kalebassen weg und hoppelten wie Hasen über die Lichtung davon. Emily folgte ihnen sofort, aber gemessenen Schritts. Die Lichtung verengte sich zu einem Pfad, der sie bald zu einem Dorf führte.
Alles hier war verwildert und verwahrlost und von schrillem Stimmengewirr erfüllt. Ringsum verstreut standen kleine einstöckige Flechtwerkhütten, die unter den gewaltigen überhängenden Bäumen fast verschwanden. Irgendeine Ordnung ließ sich nicht erkennen, die Hütten standen regellos herum, kamen überall zum Vorschein; es gab keine Zäune und nur ein paar Stück klapperdürres, räudiges Vieh. Inmitten des Ganzen dunstete ein Schlammtümpel, in dem eine Gruppe halbnackter Neger und splitterfasernackter schwarzer und brauner Kinder zusammen mit Gänsen und Enten planschten.
Emily machte große Augen; sie gafften zurück. Als Emily näher kam, verschwanden sie sofort in den verschiedenen Hütten und beobachteten sie von dort. Ermutigt durch das beruhigende Gefühl, furchteinflößend zu wirken, drang Emily weiter vor und fand schließlich einen Alten, der den Mund aufmachte: »Hier Liberty Hill, Stadt von Schwarze Mann, Nigger, wo früher weggelaufen von Bushas (Aufseher) kommen hier zu leben. Piccaninnies (Kinder) noch nie gesehen Buckras (Weiße) …« Und so weiter. Es war eine von entlaufenen Sklaven erbaute und immer noch bewohnte Zufluchtsstätte.
Und Emilys Freudenbecher quoll über, als sich noch einige mutigere Kinder herauswagten und ihr respektvoll Blumen schenkten – eigentlich nur, um ihr blasses Gesicht mehr aus der Nähe sehen zu können. Stolzgeschwellten Herzens verabschiedete sie sich gönnerhaft und schwebte den langen Rückweg wie auf Wolken nach Hause, zurück zu ihrer geliebten Familie, zurück zu dem mit Stephanotis umkränzten Geburtstagskuchen, der im Glanz von zehn Kerzen erstrahlte und in dem der Sixpenny zuverlässig in dem Stück steckte, das schließlich auf dem Teller des Geburtstagskindes landete.
III
So verlief eigentlich typischerweise das Leben einer englischen Familie auf Jamaika. Meist blieb man nur ein paar Jahre dort. Die Kreolen – Familien, die schon länger als eine Generation auf den Westindischen Inseln lebten – entfalteten allmählich ein paar Eigenheiten. Sie entledigten sich einiger traditioneller geistiger Mechanismen Europas und entwickelten Ansätze einer neuen Einstellung.
Die Bas-Thorntons kannten so eine Familie, der im Osten der Insel ein baufälliger Besitz gehörte. Emily und John wurden eingeladen, ein paar Tage bei ihnen zu verbringen, doch Mrs. Thornton hatte Bedenken, weil sie einen schlechten Einfluss befürchtete. Die Kinder dort waren ein wilder Haufen, und sie gingen oft, zumindest vormittags, barfuß wie die Neger, was in einer Weltgegend wie Jamaika, wo die Weißen den Schein wahren müssen, beileibe keine Nebensächlichkeit ist. Sie hatten eine möglicherweise nicht hundertprozentig reinblütige Gouvernante, die die Kinder mit einer Haarbürste gnadenlos vertrimmte. Andererseits herrschte auf dem Besitz ein gesundes Klima, und da Mrs. Thornton es eigentlich gut fand, wenn ihre Kinder auch einmal mit den Kindern anderer Familien verkehrten, selbst wenn dieser Umgang alles andere als ideal schien, gab sie ihre Erlaubnis.
Es war der Nachmittag nach besagtem Geburtstag, und die Fahrt in dem leichten Einspänner dauerte ewig. Dem dicken John und der dünnen Emily hatte es vor Aufregung die Sprache verschlagen, und ihnen war richtig feierlich zumute. Sie fuhren schließlich zum ersten Mal in ihrem Leben zu anderen Leuten auf Besuch. Stunde um Stunde quälte sich der Einspänner über die holprige Straße. Endlich erreichten sie die Abzweigung nach Exeter, dem Besitz der Fernandez. Es war Abend geworden, und der für die Tropen typische rasante Sonnenuntergang nahte. Die Sonne wirkte ungewöhnlich groß und rot und irgendwie unheildräuend. Der Weg, bzw. die Zufahrt bot einen phantastischen Anblick; Traubenbäume mit ganzen Büscheln aus Früchten, in der Größe zwischen einer Stachelbeere und einem Pippinapfel, säumten die ersten hundert Meter; hie und da leuchteten die roten Beeren von Kaffeebäumen, die zwischen den verkohlten Stümpfen auf einer Lichtung neu angepflanzt worden waren, aber bereits wieder vernachlässigt wirkten. Dann kam ein massives Steintor in einer Art gotischem Kolonialstil. Man musste es umfahren, denn seit Jahren hatte sich niemand mehr die Mühe gemacht, die schweren Flügel aufzustemmen. Einen Zaun gab es nicht und hatte es nie gegeben, also bog der Weg einfach um das Tor herum.
Und hinter dem Tor begann eine Allee prächtiger Schirmpalmen. Keine anderen Bäume, nicht einmal uralte Buchen oder Kastanien, bilden grandiosere Alleen. Sie schießen in einem Schwung glatte hundert Fuß empor bis zur gefiederten Krone; Palme neben Palme neben Palme erstrecken sie sich in einer Doppelreihe himmlischer Säulen endlos weiter, bis vor ihnen sogar das gewaltige Haus zur Größe einer Mausefalle schrumpfte.
Als sie zwischen den Palmen dahinfuhren, ging die Sonne plötzlich unter, der ringsum aus dem Boden hochflutenden Dunkelheit trat fast augenblicklich der Mond entgegen. Unversehens versperrte ihnen, gespenstergleich schimmernd, ein altersblinder, weißer Esel den Weg. Da Flüche nichts fruchteten, musste der Kutscher absteigen und ihn beiseiteschieben. Der charakteristische Lärm der Tropen erfüllte die Luft: Moskitos sirrten, Zikaden zirpten, Ochsenfrösche plärrten wie Gitarren. Der Lärm dauert die ganze Nacht und fast den ganzen Tag, er ist penetranter, markanter als selbst die Hitze oder die unzähligen Stechtiere. Unten im Tal erwachten die Glühwürmchen; wie auf ein ständig weitergegebenes Signal hin schwappte Lichtwoge um Lichtwoge durch die Schlucht. Von einem benachbarten Berg erscholl die Abendserenade der Kakadus: Ein betrunkener Männerchor grölte zum scheppernden Klang aneinanderschlagender Eisenträger, die mit rostigen Bügelsägen malträtiert wurden: ein grässlicher Radau. Doch soweit sie ihn überhaupt bemerkten, fanden Emily und John den Krach ganz amüsant. Durch die Geräuschkulisse vernahm man jetzt etwas anderes: die Stimme eines betenden Negers. Sie gelangten bald in seine Nähe. Wo ein von goldenen Früchten strotzender Orangenbaum im Mondschein dunkel und hell schimmerte, saß, in einen funkensprühenden Schleier Abertausender Leuchtkäfer gehüllt, der alte schwarze Heilige zwischen den Zweigen und sprach laut, trunken und vertraulich mit seinem Gott.
Fast unvermittelt standen sie vor dem Haus und wurden sofort ins Bett verfrachtet. Weil alles ganz schnell gehen musste, verzichtete Emily auf die Abendwäsche, zog dafür aber ihr Nachtgebet ungewöhnlich in die Länge. Sie presste andächtig die Finger fest auf die Lider, bis sie Funken stieben sah, obwohl ihr davon immer ein bisschen schlecht wurde; und dann kletterte sie vermutlich schon schlaftrunken ins Bett.
Anderntags ging die Sonne auf, wie sie untergegangen war: groß, rot und rund. Eine stechende, ungute Hitze. Emily, die in dem fremden Bett früh erwacht war, stand am Fenster und beobachtete einen Neger, der die Hennen aus den Hühnerställen ließ, wo man sie wegen der Truthahngeier nachts einsperrte. Der Schwarze betastete jedem schläfrig heraushüpfenden Huhn den Bauch, um zu prüfen, ob heute mit einem Ei zu rechnen sei; wenn ja, dann wurde das Huhn wieder eingesperrt, damit es sein Ei nicht irgendwo im Busch legte. Es herrschte bereits eine Gluthitze. Mit markerschütterndem Gebrüll, durch allerlei Schikanen und mithilfe eines Kälberstricks zwängte ein anderer Schwarzer eine Kuh in eine Art Pranger, damit sie sich beim Melken nicht hinlegen konnte. Von der Hitze schmerzten dem armen Tier die Hufe, und im Euter fieberte eine kümmerliche Tasse Milch. Obwohl Emily am schattigen Fenster stand, schwitzte sie wie nach einem Dauerlauf. Der Boden hatte durch die Dürre Risse bekommen.
Margaret Fernandez, mit der sich Emily das Zimmer teilte, glitt lautlos aus dem Bett, trat neben sie und krauste die Stupsnase im blassen Gesicht.
»Guten Morgen«, sagte Emily höflich.
»Riecht nach Erdbeben«, meinte Margaret und zog sich an. Emily fiel die schlimme Geschichte mit der Gouvernante und der Haarbürste ein; da Margaret trotz ihrer langen Haare offensichtlich keine benutzte, musste das Gerücht wohl stimmen.
Margaret war lange vor Emily fertig und knallte im Hinausgehen die Tür zu. Als Emily ihr etwas später folgte, adrett und aufgeregt, traf sie niemanden an. Das Haus war leer. Draußen entdeckte sie John, der sich unter einem Baum mit einem Negerjungen unterhielt. An seinem lässigen Gehabe erkannte Emily, dass er über die Bedeutung von Ferndale im Vergleich zu Exeter übertriebene Geschichten (keine Lügen) erzählte. Sie rief ihn nicht, denn im Haus herrschte Stille und ihr als Gast stand es nicht an, daran etwas zu ändern, darum ging sie zu ihm nach draußen. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche und fanden einen Stallhof, wo die Neger ein paar Ponys sattelten; die Fernandez-Kinder standen tatsächlich barfuß daneben, also stimmte auch dies Gerücht. Emily hielt bestürzt die Luft an. Im selben Augenblick flitzte ein Huhn über den Hof, tappte auf einen Skorpion und fiel tot um wie von einer Kugel getroffen. Doch Emily schockierten weniger die mit dem Barfußgehen verbundenen Gefahren als das Ungehörige daran.
»Los«, sagte Margaret, »hier ist es viel zu heiß. Wir verziehen uns runter nach Exeter Rocks.«
Die Kavalkade saß auf – Emily im Vollgefühl ihrer ehrbar bis zur Wadenmitte zugeknöpften Stiefel. Irgendjemand hatte Essen eingepackt und Kalebassen mit Wasser. Die Ponys kannten offensichtlich den Weg. Immer noch war die Sonne rot und groß, und der wolkenlose Himmel glich einer blau glasierten Terrakotte; aber dicht über dem Boden waberte ein schmutziggrauer Brodem. Unterwegs Richtung Meer passierten sie eine Stelle, wo gestern noch eine ansehnliche Quelle gesprudelt hatte. Jetzt schien sie ausgetrocknet. Aber gerade, als sie vorbeiritten, schoss ein Wasserschwall heraus, dann versiegte die Quelle wieder, obwohl es unterirdisch weitergurgelte. Doch den Mitgliedern der Kavalkade war heiß, viel zu heiß, um miteinander zu reden, sie saßen möglichst locker auf den Ponys und sehnten das Meer herbei.
Die Morgenstunden verrannen. Die sengende Luft erhitzte sich immer mehr, als speise sie sich nach Belieben aus einem gewaltigen Glutreservoir. Die Ochsen bewegten die schmerzenden Hufe bloß, wenn sie den heißen Boden nicht mehr ertrugen; selbst die Insekten waren zu matt, um zu lärmen, die sonnensüchtigen Eidechsen verkrochen sich und ächzten. Es war so still, dass man das leiseste Summen noch meilenweit gehört hätte. Nicht einmal die nackten Fische bewegten freiwillig die Flossen. Die Ponys liefen nur weiter, weil sie mussten. Die Kinder ließen nicht einmal ihre Gedanken spielen.
Sie erschraken bis ins Mark, als unmittelbar in der Nähe ein Kranich einmal verzweifelt trompetete. Dann senkte sich wieder tiefe Stille herab. Der Schock trieb ihnen den Schweiß doppelt heftig aus den Poren. Sie ritten immer langsamer. Im Schneckentempo erreichten sie schließlich das Meer.
Exeter Rocks ist berühmt. Eine Bucht am Meer, ein nahezu vollkommener Halbkreis im Schutz des Riffs. Ein abfallender weißer Sandstrand überbrückt die paar Schritte zwischen dem Wasser und der unterspülten Grasnarbe – und fast in der Buchtmitte springt eine Felsenbank weit vor ins unergründlich tiefe Wasser. Ein schmaler Spalt in den Felsen leitet das Meer in einen kleinen Teich oder eine Miniaturlagune hinter der Felsbastion. Dort, sicher vor Haien und vor dem Ertrinken geschützt, wollten sich die Kinder den ganzen Tag im Wasser aalen, träge wie Schildkröten. Der Wasserspiegel der Bucht war glatt und reglos wie Basalt und trotzdem glasklar wie erstklassiger Gin, obgleich man eine Meile weit entfernt die Brandung gegen das Riff donnern hörte. Das Wasser im Teich konnte nicht glatter ruhen. Keine Meeresbrise wollte sich regen. Kein Vogel durchmaß den trägen Äther.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich aufrafften, ins Wasser zu gehen; sie legten sich auf den Bauch und starrten hinab – tief, tief hinab auf die Seefächer und Seefedern, die scharlachrot gefiederten Entenmuscheln und Korallen, die schwarzgelben Schleierfische, die Regenbogenfische – hinab auf diesen Wald perfekter Weihnachtsbäume, der dem tropischen Meeresgrund entsprießt. Als sie dann aufstanden, wurde ihnen schwindlig und schwarz vor Augen, und im Nu trieben sie wie Ertrunkene im Schatten eines Felsvorsprungs, nur die Nasen ragten aus dem Wasser.
Ungefähr eine Stunde nach Mittag drängten sie sich, schwammig vom warmen Wasser, im kargen Schatten eines Panamafarns, aßen vom mitgebrachten Proviant das, worauf sie Appetit hatten, tranken ihren ganzen Wasservorrat leer und bedauerten, dass er nicht größer war. Dann geschah etwas sehr Eigenartiges: Denn als sie dort saßen, hörten sie einen merkwürdigen Ton – ein seltsames Rauschen, als fege ein Sturmwind über ihren Köpfen dahin – aber das Eigenartige war, kein Lüftchen regte sich. Dann folgte ein scharfes Zischen und Brausen wie von einem ganzen Schwarm Raketen oder einem Geschwader riesiger Schwäne – Roks-Vögel vielleicht, die in der Ferne vorüberrauschten. Alle blickten auf, doch es gab nichts zu sehen. Der Himmel: leer und klar. Lange bevor sie erneut ins Wasser gingen, war alles wieder still. Nur John spürte nach einer Weile ein Pochen, als klopfe jemand von außen sacht an die Badewanne, in der man lag. Doch ihre Badewanne hier besaß keinen Außenrand, sie bestand aus der ganzen fest gefügten Welt. Es war seltsam.
Bei Sonnenuntergang waren sie vom langen Aufenthalt im Wasser so schwach, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnten, und so salzig wie gepökelter Speck. Aber kurz bevor die Sonne sank, gaben sie sich gemeinsam einen Ruck, verließen die Felsen und gingen los und stellten sich neben ihre Kleider, die unter den Palmen lagen, wo auch die angebundenen Ponys warteten. Im Sinken wurde die Sonne noch größer und färbte sich nicht rot, sondern matschig violett. Sie tauchte hinter der westlichen Spitze der Bucht unter, die sich immer tiefer einschwärzte, bis ihre Wasserlinie verschwand und fester Stoff und Spiegelung zu einem scharf umrissenen symmetrischen Muster verschmolzen.
Kein Hauch einer Brise kräuselte das Wasser; trotzdem erzitterte es einen Augenblick lang, zerbrach die Spiegelbilder und lag dann wieder glatt wie Glas. Die Kinder hielten den Atem an und warteten, dass es geschah.
Aufgeschreckt von einem unterseeischen Aufruhr reckte ein Schwarm von Fischen die Köpfe aus dem Wasser; sie schossen pfeilschnell über die Bucht und pflügten glitzernde Wellen auf; dahinter erstarrte alles bald wieder zu härtestem, dunklem, dickem Glas.
Einmal gerieten die Dinge in leichte Vibration wie ein Sitz in einem Konzertsaal, und wieder hörte man das geheimnisvolle Flügelrauschen, obwohl unter den irisierenden, aufgeblähten Sternen nichts zu entdecken war.
Dann geschah es. Das Wasser in der Bucht verebbte, als hätte jemand den Stöpsel gezogen; nur einen Lidschlag lang schimmerten ein Fußbreit Sand und Korallen an der ungewohnten Luft; dann kehrte das Meer in Miniatursturzwellen zurück, die bis zum Fuß der Palmen hochspritzten. Grassoden wurden weggespült, und am entgegengesetzten Ende der Bucht stürzte ein kleiner Felsbrocken ins Wasser: Sand und Zweige prasselten herab, von den Bäumen tropfte diamantengleich der Tau: Vögeln und anderem Getier stockte die Stimme nicht länger, sie schrien und brüllten, sogar die gelassenen Ponys hoben die Köpfe und wieherten schrill.
Das war alles. Ein paar Augenblicke nur. Dann reklamierte die rasch zurückkehrende Stille ihr rebellisches Reich. Die Bäume standen unbeweglich wie Säulen einer Ruine, jedes einzelne Blatt lag brav an seinem Platz. Das Schaumgebrodel verflüchtigte sich, und nun erschienen die Spiegelbilder der Sterne, als träten sie hinter Wolken hervor. Still, ruhig, dunkel, sanft, als hätte es nie eine Störung gegeben. Auch die nackten Kinder verharrten reglos neben ihren ruhigen Ponys, Tau im Haar und auf den Lidern, die runden Kinderbäuche glänzten.
Doch Emily hielt es nicht länger aus. Das Erdbeben stieg ihr zu Kopf. Sie begann zu tanzen, hopste schwerfällig herum. John ließ sich anstecken. Er schlug auf elliptischer Bahn unablässig Purzelbäume im feuchten Sand, bis er unversehens im Wasser landete, wo ihm so schwindlig wurde, dass er kaum noch sagen konnte, wo oben und unten war.
Jetzt wusste Emily, wozu sie Lust hatte. Sie kletterte auf ein Pony, galoppierte den Strand entlang und versuchte, wie ein Hund zu bellen. Die Fernandez-Kinder beobachteten sie ernst, aber keineswegs missbilligend. John, mit Kurs auf Kuba, schwamm um sein Leben, als würden die Haifische schon nach seinen Zehen schnappen. Emily trieb ihr Pony ins Meer und peitschte es so lange, bis es zu schwimmen begann. So folgte sie John in Richtung des Riffs und kläffte sich heiser.
Erst nach hundert Metern hatten sie sich restlos verausgabt. Dann hielten sie wieder auf den Strand zu, John klammerte sich schnaufend und keuchend an Emilys Bein, beide hatten sich etwas übernommen, ihre Begeisterung erlahmte. John japste:
»Wer nackt reitet, kriegt Hautschwamm.«
»Ist mir doch egal«, sagte Emily.
»Wart’s ab«, sagte John.
»Mir egal!« leierte Emily.
Das Ufer schien weit entfernt. Als sie es erreichten, hatten sich die Übrigen schon angezogen und machten sich zum Abmarsch bereit. Bald zog die ganze Gruppe im Dunkeln nach Hause. Margaret sagte:
»Das war’s also.«
Keiner antwortete.
»Ich hab das Erdbeben schon heute früh beim Aufstehen gerochen. Stimmt’s, Emily?«
»Was du nicht alles riechst!«, sagte Jimmie Fernandez. »Dauernd riechst du irgendwas!«
»Sie hat eine ganz feine Nase«, sagte Harry, der Jüngste, voller Stolz zu John. »Sie braucht bloß an schmutziger Wäsche zu schnuppern, schon weiß sie, wem die gehört. Das kann sie.«
»Kann sie nicht«, sagte Jimmie, »sie tut bloß so. Als ob jeder anders riechen würde!«
»Kann ich doch!«
»Hunde können so was«, sagte John.
Emily sagte nichts. Natürlich roch jeder Mensch anders, darüber musste man nicht streiten. Sie zum Beispiel konnte immer ihr eigenes Handtuch von Johns unterscheiden, sie merkte sogar, wenn jemand anderes ihres benutzt hatte. Aber das zeigte nur wieder einmal, was für Leute diese Kreolen waren: so ganz ungeniert über Gerüche zu reden.
»Jedenfalls habe ich vorhergesagt, dass es ein Erdbeben gibt, und genauso war es«, meinte Margaret.