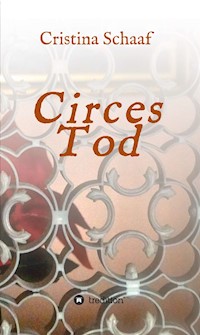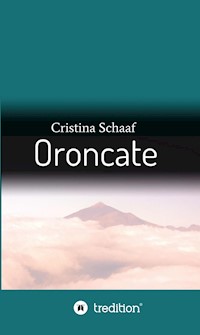
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sich Sofia uns gegenüber endlich offenbarte und ihrem Geheimnis ein Ende setzte, war ich zeitweise davon überzeugt, nie wieder glücklich sein zu können. Es war weniger die Hoffnung, die mir weiterhalf, sondern meine absolute Überzeugung, meiner Tochter beiseite stehen zu wollen und sie zu stützen, solange es nötig sein sollte. Mit diesem Buch möchte ich mich an alle Mütter und Väter wenden, die mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind. Mögen sie darin Inspiration, Mut und Trost finden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Oroncate
Cristina Schaaf
Oroncate
© 2020 Cristina Schaaf
Umschlaggestaltung, Korrektorat,
Layout: Susanne Dahler
978-3-7497-0484-2 (Paperback)
978-3-347-00624-9 (Hardcover)
978-3-347-00625-6 (e-Book)
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie, detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für die Prinzessin
Vorwort
Heute vor genau einem Jahr, am 20. Mai, bekamen wir Sofias E-Mail. Draußen überzieht, so wie damals, das gleiche helle Grün unsere mitteleuropäische Landschaft: die saftigen Zweige voll zarter Triebe leuchten neben den alten, mattbraunen Tannenzapfen der Fichten, in der Stille des frühen Abends.
Gerade versuche ich, mich an jenen Nachmittag zu erinnern, an jede Szene des Tages, der mein Leben so veränderte, und an dessen Morgen ich eine andere Frau war als an dessen Abend. Die dickbäuchigen Wolken, die den deutschen Frühlingshimmel immer wieder durchziehen, beobachte ich mit einem Gefühl der Dankbarkeit und des Staunens: weil bisher alles gut gelaufen ist, und weil mir vorgeführt wird, wie sich alles im Laufe eines Jahres wandeln kann; eines folgt dem anderen und dann, zwölf Monate später, trägt dieser Tag wieder denselben Namen, obwohl er ein ganz anderer ist: der zwanzigste Mai.
Seit elf Tagen habe ich Sofia nicht sprechen können. Man sagte mir, sie sei im Schweigen, eine Selbsterfahrungsübung, die sie auf Beschluss ihres Therapeuten José durchführen muss. Seit zehn Monaten ist sie nun in Therapie, in der geschlossenen Einrichtung des Proyecto Vida, über sechstausend Kilometer von uns entfernt. Seit einem Jahr habe ich eine andere Tochter als die, die ich mein Leben lang zu haben glaubte.
Nun hadere ich nicht mehr mit mir. Es kann sogar sein, dass ich in diesen Monaten die wichtigsten Unterweisungen meines Lebens erhalten habe. Es gibt Zeiten, in denen ich ein so ruhiges Glück empfinde, wie ich es mir nur bei fortgeschrittenen, praktizierenden Buddhisten vorstellen kann. Es gibt auch Zeiten, an denen ich so verzweifelt bin, dass ich gar keinen Weg mehr sehe, keine Hoffnung kenne, und sich wieder die Idee in mir ausbreitet, im Leben gründlich versagt zu haben. Ich verstehe jetzt, was es heißt, am Leid zu wachsen. Ich verstehe jetzt, was es heißt, dass das Leben einen Sinn hat, so verborgen er auch sein mag. Ich erlebe am eigenen Leib, dass Wunden heilen können, wenn wir unsere Sicht auf die Dinge ein wenig verändern.
Ich habe erfahren, wie einsam ich sein kann, und ich durfte gleichzeitig erleben, wie viele mitfühlende, verständnisvolle Menschen sich um mich herum befinden. Dafür bin ich dankbar, auch dafür, dass meine Tochter noch am Leben ist und ihren eigenen Weg Richtung Glück eingeschlagen hat.
Allen Freunden und Verwandten möchte ich an dieser Stelle von Herzen danken, dafür, dass sie immer wieder aufs Neue mit ihrem Interesse und Wohlwollen meine Last erträglicher gemacht haben und mir dazu verholfen haben, an eine Zukunft zu glauben.
Dem Leben - was es auch immer sein mag - danke ich für all diese Erkenntnisse und Geschenke und für mein Wachstum, und sei es auch so schmerzhaft wie es manchmal anscheinend nötig ist.
Mir fehlte jene klare Freude, und sogar auch die Aufregung, die in mir das Reisen schon seit Kindesbeinen hervorrief, an jenem Sonntag eines Monats Mai, auf dem Weg zum Flughafen, kurz nach sieben Uhr morgens, im Sonnenschein des reifen Frühlings, durch die französische Landschaft, die noch ruhte und zu schlafen schien, vielleicht weil ich immer noch nicht wusste, einfach nicht verstehen konnte, weshalb und warum ich so unvorhergesehen diese Reise in aller Eile angetreten hatte, nachdem ich alle Termine abgesagt hatte, Termine, auf die ich mich seit Monaten vorbereitet, auf die ich mich außerordentlich gefreut hatte, die wichtig für mich waren. Nun gab es aber plötzlich nichts, absolut gar nichts, was wichtiger für mich war, als diese übereilte Reise, die mir keine Freude bereitete, was mich zunächst eher seltsam überraschte und ziemlich beunruhigte, wie etwas bedrohlich Fremdes, dem man nie zuvor begegnet war.
Auf der französischen Autobahn, die wie jeden Tag unbeirrt durch das blühende Elsass führte, fuhren kaum Autos. Der Verkehr war spärlich an jenem Sonntagmorgen. Auch die Sonne war nicht anders, sie war so wie jeden Tag, und ich fragte mich plötzlich, ob es wirklich die selbe Sonne war, die jetzt auch auf der Insel scheinen, und die jetzt unsere - meine - Sofia sehen würde.
Ein Satz drehte sich gebetsmühlenartig in meinem Gemüt, der sich in mir irgendwann während der letzten Tage eingenistet hatte und aus irgendeinem Buch stammte, ein Satz, der mich nicht mehr loslassen wollte: „Was uns bleibt ist nur das, was wir verloren haben.“ Er untermalte aufdringlich meine Stimmung, die Landschaften, durch die wir, ohne viel zu reden, im leicht dunstigen Morgenlicht fuhren, die traurigen Gedanken und die düsteren Befürchtungen, die mich seit einer Woche permanent begleiteten: zwei Wächter, die unbeirrt Tag und Nacht, ohne zu ermüden, ihren Beschattungsauftrag durchführten, eisern und gnadenlos.
Wir hielten kurz an einer Raststätte an, um etwas zu trinken, und als wir wieder ins Auto steigen wollten, stand neben uns ein ausgewachsener Storch, wie eine Modigliani Figur. Er stolzierte mit seinen langen, purpurroten Beinen auf uns zu, hielt dann plötzlich inne und lief misstrauisch und in langen Schritten schwankend davon.
Ich dachte an die Störche von Avila, damals, im Sommer 2006, die zu Hunderten auf dem Dach der Kathedrale nisteten, und die wir von unserem Hotelzimmer aus ungestört beobachten konnten. Es war August und die Steppe um Avila, diese karge, bis zum Horizont reichende, gelbschimmernde Weizenlandschaft Kastiliens, breitete sich unter der langen, im kühlen Schatten der Kathedrale verlaufenden granitgrauen Stadtmauer zu unseren Füßen aus. Durch das tiefe Blau über der Hochebene zogen die Störche jeden Abend und jeden Morgen ihre Kreise, klapperten mit ihren spitzen, scharfen Schnäbeln, und die Luft war erfüllt von einem wirren Kastagnetten-Konzert bizarrster Art.
Eine Woche vorher war meine Mutter gestorben. Während ich ihre kleine Hand hielt, die sich auf einmal wie ein lebloser Spatz anfühlte, war sie mir entschlafen. Jeden Abend in Avila, als ich die Störche beobachtete, dachte ich mit neuem Wohlwollen und Erstaunen daran, wie man mir als Kind erzählt hatte, dass wir Menschen von dem Storch gebracht werden, über die weiten Strecken des Himmels. Jene Störche in Avila wurden mir zum Trost, sie wurden wieder zum Fabelwesen meiner Kindheit, die ich für immer und nun endgültig mit dem Tod meiner Mutter verloren hatte. Der Storch und die Mutter, der Storch und die Mutter und die Tochter.
Nachdem wir am Flughafen meinen Koffer aufgegeben hatten, fiel es uns beinahe leicht uns zu trennen, weil diese Reise eine ganz andere Reise war als alle früheren Reisen, und weil wir uns auffallend schnell verabschiedeten und jede Art von Gefühlsregung zu vermeiden wussten, als wäre es nicht die richtige Zeit dafür. In nur einer Woche würde Peter nachkommen, um sich mit mir und meiner Tochter auf der Insel zu treffen.
Ich wartete in der Nähe des Gates. Die Halle füllte sich nach und nach mit Reisenden, Familien mit ihren Kindern, denen man die Gelassenheit und Heiterkeit des Urlaubs ansah, das Reisefieber, die freudige Erregung, die man am Anfang der gerade erst angebrochenen Ferien verspürt. Ich beobachtete sie, und ich wollte mir nicht anmerken lassen, dass ich nicht dazu gehörte, dass meine Reise auf die Insel kein Vergnügen versprach, keine Erholung und keine freudigen Erlebnisse, sondern viel eher mit noch nie da gewesener Enttäuschung, Verzweiflung und Verdruss drohte.
In der Maschine hatte ich einen Fensterplatz reserviert. Es würde ein langer Flug werden und ich hatte keine Lektüre dabei, da ich mich seit einigen Tagen nicht mehr auf das Lesen konzentrieren konnte. Neben mir nahmen zwei junge Männer Platz, in kurzen Strandhosen und Sandalen, die sehr aufgedreht wirkten, sich laut auf Bayrisch unterhielten und ihre Reiseeuphorie nicht bändigen wollten. Selten war ich mir so fremd vorgekommen; fremd auf Reisen, fremd in Deutschland, fremd der Insel gegenüber, fremd in meiner eigenen Haut, in meinem eigenen Kopf. So ähnlich war es mir auch im Sommer 2006 ergangen, als meine Mutter in Madrid im Sterben lag. Solange ich denken konnte, stellte mich Spanien, meine geliebte und zurückgelassene Heimat, immer wieder auf die Probe.
Es waren die Alpen, die nach einer Weile auftauchten und bestimmt war die Spiegeloberfläche, die ganz unten auf der Landkarte so glitzerte, der Bodensee. Es war mein inzwischen vertrautes Mitteleuropa, wo ich mich seit Jahren heimisch und sicher fühlte, wo ich seit beinahe vierzig Jahren gelernt hatte, frei und glücklich zu leben, nach meiner leidvollen Vergangenheit in Spanien. Ich hatte mich dem Fenster zugewandt, und signalisierte eindeutig, dass ich in kein Gespräch verwickelt werden wollte.
Unter mir lagen Meere von hier und da aufgerissenen, bläulichen Wolken, und es war sehr ungewohnt, alleine an diesem Sonntagnachmittag in der gleißenden Maisonne über den Wolken dahin zu ziehen. Ich hatte das Gefühl für die Zeit verloren. Zwischendurch musste ich ernsthaft überlegen, ob es Frühling oder Winter, ob Ostern schon vergangen war, oder bald Weihnachten sein würde. Dafür liefen in meinem Geist auffällig viele Szenen aus einer lange zurückliegenden Vergangenheit ab, Geschichten über Geschichten aus meinem Leben, die vorher nicht da gewesen zu sein schienen, als hätten sie sich in der Kiste eines vergessenen Speichers befunden, die plötzlich und wie von Geisterhand aufsprang, und all diese Episoden unvermittelt hervorquellen ließ, Episoden, die ich mir geschworen hatte, für immer zu vergessen.
Nach nur einer Woche hatte ich plötzlich das Gefühl, um Jahre gealtert zu sein. Binnen sieben Tagen war ich merkwürdigerweise schlagartig 56 Jahre alt - oder hatte ich es vorher einfach nicht bemerkt? Wie vieles war mir denn in den letzten drei oder vier Jahren dadurch entgangen, dass ich endlich das Leben führen durfte, das ich immer gewollt hatte, ein Leben, das ich in vollen Zügen genoss? Es schien mir so, als hätte mich das Glück, das sich nach langen Jahren des Wartens und Hoffens zu mir gesellt hatte, blind gemacht für alles, was an Ungereimtheiten um mich herum passierte. Aber war das wirklich so gewesen? Es schmerzte, mir immer und immer wieder dieselbe Frage stellen zu müssen. War ich nicht genug aufmerksam gewesen, wie hatte ich die Realität so übersehen können?
Sofia hatte sich verändert, und das hatte ich ganz und gar nicht übersehen, sondern sehr früh erkannt, was mich nicht nur besorgte, sondern auch befremdete. Aber alle Menschen um mich herum hatten versucht, es mir auszureden. Ich solle mir doch keine Gedanken machen, Sofia sei schon immer sehr patent gewesen und meine Reaktion sei unangebracht, ja, eine übertriebene, mütterliche Reaktion. Das sei nicht angemessen, hatten alle gesagt. Gerade als Sofia vor einem Jahr ihre Arbeitsstelle verloren hatte, und Peter es mir erzählte, war ich alarmiert gewesen, vielleicht sogar eine Nuance zu sehr alarmiert. Für einen kurzen Augenblick hatte ich richtige Panik verspürt, und mir kam der Gedanke, ohne dass ich dafür eine Erklärung hatte: „Jetzt ist alles aus!“
Oft hatte ich mich in den letzten Tagen an diesen Gedanken erinnern müssen und nun war mir klar, dass es eine Eingebung oder meine Intuition gewesen sein musste, die mich damals so erschrocken hatte. Peter aber beruhigte mich, und bat mich, nicht hysterisch zu werden. „Sofia hat alles im Griff, die solltest du doch kennen! Sie bekommt zwei Jahre lang Arbeitslosengeld und eine größere Summe als Abfindung. Damit will sie zunächst einmal ein halbes Jahr aussetzen und dann in Ruhe einen Arbeitsplatz suchen. Ich finde das sehr vernünftig von ihr, das wird sie auch schaffen, wie sie bisher alles geschafft hat, was sie sich in den Kopf gesetzt hat.“
So hatte ich mir dann auch gesagt, wie um mich zu besänftigen, „Sei nicht hysterisch, Beatriz! Du benimmst dich wie eine überspannte Glucke, und das wolltest du nie werden. Sofia weiß sehr genau, was sie tut und sie hat immer wieder bewiesen, dass sie eine sehr kluge und zuverlässige, erwachsene Frau ist!“
Sofia hatte sich mir gegenüber sehr ablehnend gezeigt, als ich sie am Telefon fragte, was passiert sei. Während des Gesprächs machte sich jene Spannung bemerkbar, die Sofia seit zwei Jahren befiel, sobald über Themen aus ihrem Leben gesprochen wurde. Jeder Versuch, die aufkeimende Aggression zu besänftigen, verursachte noch weitere Spannung. Ich verstand auch nicht, was sie so sehr ärgerte, wollte ich doch einfach nur von ihr hören, wie es ihr ging und was sie für Pläne hatte. „Mir geht es wunderbar, ausgesprochen phantastisch geht es mir, beinahe so gut wie noch nie“, versicherte sie euphorisch. „Mir geht es immer wunderbar, bis du ein Drama daraus machst! Komm bloß nicht auf die Idee, mich unter Druck zu setzen, denn ich werde mich ein halbes Jahr lang nirgendwo bewerben! Vielmehr werde ich mein Leben endlich genießen und nur schöne Sachen tun. Nach einem halben Jahr werde ich genau in dem Bereich arbeiten, der mir Spaß macht, ob es dir gefällt oder nicht.“ Sie war mir sehr fremd, wenn sie mich ohne ersichtlichen Grund so anschrie, und ich ließ sie in Ruhe, wie mir alle rieten.
Wieder kamen mir ihre gescheiterten Beziehungen in Erinnerung. Ich war sehr betrübt, dass sie so viel Schmerz erlebt haben musste. Sie tat mir sehr leid. Nun konnte ich mir einerseits nicht verzeihen, es nicht eher bemerkt zu haben und gleichzeitig war ich wütend, weil ich es sehr wohl bemerkt hatte und trotzdem nicht weitergekommen war, weil mir von allen Seiten gesagt wurde, ich solle keine Übermutter sein und sie doch einfach in Ruhe lassen. Selbst Elena und Yalman, die mir so nahe gewesen waren, dass ich tatsächlich gedacht hatte, sie seien meine Freunde, verwandelten sich in meine Gegner und warfen mir vor, Sofia zu unterdrücken und zu bevormunden. „Sofia möchte eine Auszeit einlegen“, sagte mir Yalman „und das ist völlig legitim, wo sie ihr ganzes Leben lang nur gearbeitet hat. Nun wünscht sie sich einzig und allein deinen Segen“, erklärte er mir im Brustton der Überzeugung. Er glaubte nicht, dass sie schon immer meinen Segen hatte, seit ihrer Geburt, und dass ich sie nur unterstützen wollte. Er bestand darauf, dass Sofia und ich schon immer ein sehr angespanntes Verhältnis gehabt hatten. Das war mir völlig neu.
Im Flugzeug sitzend, hoch über dem Atlantik, erinnerte ich mich mit einem bitteren Geschmack im Mund wieder daran, wie Sofia versucht hatte, unsere Freunde gegen uns aufzuwiegeln. Selbst vor meiner Ausbildungsstätte in Köln hatte sie nicht halt gemacht und dort angerufen, im Rausch der Wut, um mit meinem Studiendirektor zu sprechen und ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass ich geisteskrank sei. Als man mir dies im Institut erzählte, konnte ich es anfangs nicht glauben: das konnte nicht meine Tochter sein, da lag bestimmt ein Missverständnis vor! Diese extremen Reaktionen hatten mir zu denken gegeben, jedoch nicht so viel, dass sie mir die Augen geöffnet hätten, dass ich wirklich Alarm geschlagen hätte. Eher führte ich es auf die belastenden Ereignisse der letzten Jahre zurück und auf den schlechten Einfluss, den Axel und Dieter auf sie ausgeübt hatten.
Irgendwann während des Fluges, im Schweben und im Zweifeln und im Hoffen, schlief ich ein. Es war weniger die Verbitterung, es war eher der Schmerz, der mich so erschöpfte und lähmte. Im Traum stand ich vor Sofia, in der Diele meiner Madrider Wohnung, vor der Tür des Aufzugs. Sie schaute mir lange regungslos in die Augen, ohne zu blinzeln. Sie wirkte wie versteinert: „Du warst immer nur unglücklich. Ich fühlte mich immer dazu verpflichtet, dich zu schonen, Mama.“ Ich wollte sie umarmen, aber sie sprang zurück, holte ungeschickt ihr Handy aus der Tasche und begann zu telefonieren, als sei ich nicht da. Dann drehte sie sich um und ging sicheren Schrittes in mein früheres Schlafzimmer. Meine Mutter lief ihr entgegen und fragte: „Kind, wie ist das nur möglich? Wie ist das nur möglich?“ Dann hörte ich den alten Madrider Aufzug losfahren und wurde davon wach. Es war jedoch der Getränkewagen, der von der Stewardess durch den Gang geschoben wurde. Das Erwachen warf mich wieder in die neue Realität zurück. Ich war unterwegs zur Insel, auf einer Reise, die ich mir nie hätte träumen lassen.
Sofia war nicht zu der Präsentation meines Buches gekommen. „Ich bin dabei, mich überall zu bewerben. Wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde, will ich hier auf der Insel sein.“ Wir waren froh, dass sie endlich mit der Arbeitssuche begonnen hatte. Nachdem ich sie aber tagelang nicht erreichte, wurde ich wieder unruhig. Nach vielen Versuchen bekam ich sie endlich ans Handy. „Ich komme gerade zur Tür herein, mit dem Hund. Wir waren soeben spazieren! Ich koche mir schnell etwas. Kann ich Dich in einer halben Stunde anrufen?“ fragte sie außer Atem. Aber sie rief nicht an.
Spätestens da hätte ich eindeutig merken müssen, dass etwas nicht stimmte, etwas, das wahrscheinlich so bedrohlich war, dass ich es mir gegenüber nicht eingestehen wollte oder konnte. Denn ich schrieb ihr eine SMS mit meiner Befürchtung, sie wolle nicht mit mir reden, und darauf folgte direkt eine Antwort: „Hab' doch etwas Geduld!“
Erst zwei Tage später erhielt ich eine weitere Botschaft von ihr, sie sei bei ihren netten kubanischen Nachbarn gewesen, daher hätte es nicht geklappt. Sie schickte mir viele Küsschen, auch von den Kubanern. Ich solle sie doch nicht so bedrängen und unterdrücken. Ich kannte diese Nachbarn nicht, sie hatte sie vorher nie erwähnt. Nun tauchten sie wiederholt auf Fotografien in ihrem Blog auf: ausgelassen tanzende Farbige, mit Biergläsern in der Hand, mit großen runden Augen in die Kamera lächelnd. Ich fragte mich, ob ich ihnen bei unseren nächsten Besuch auf der Insel auch begegnen würde, und der Gedanke jagte mir große Angst ein. Inzwischen hatte Lollo die Fotografien in Sofias Blog auch gesehen und meinte: „Denen will ich nicht in einer dunklen Gasse begegnen.“ Aber da wussten wir schon, welche Bewandtnis es mit den Kubanern auf sich hatte, und nun wirkten sie verständlicherweise auf uns alle sehr bedrohlich.
Nach dieser Episode nahm ich mir endgültig vor, konsequent von Sofia Abstand zu halten, damit sie mich nicht immer wieder wegstoßen und ich nicht unter dem Schmerz leiden musste, nicht mehr an sie heran zu kommen. Sie war mir gegenüber extrem aggressiv. Allerdings schien es außer mir niemandem in der Familie und in meiner Umgebung aufzufallen. Für mich wurde es wirklich Zeit, sie in Ruhe zu lassen und nicht mehr anzurufen, bis sie die Initiative ergriff. Peter jedoch fand meinen Entschluss nicht gut. Er wollte den Kontakt zu ihr aufrecht erhalten. „Distanziere dich von deiner Mutter, wenn es für dich zurzeit richtig ist. Aber ich bin für dich da, ich will mit dir in Verbindung bleiben. Was hältst du davon?“, schlug er ihr vor.
Manchmal schrieben sie sich E-Mails, und dadurch gab mir Peter das Gefühl, sie irgendwie im Blick zu behalten. Eines Tages berichtete sie, nun wolle sie noch ein großes Abenteuer erleben, bevor sie wieder die Arbeit aufnahm, und deshalb plane sie mit den Kubanern für sechs Wochen nach Kuba zu fliegen. Alle ihre Freunde würden sie dazu ermutigen und jetzt fehle ihr nur noch unser Segen. Wieder läuteten die Alarmglocken, denn wir fanden es sehr merkwürdig, dass sie nach einem Jahr Arbeitslosigkeit solche Pläne hatte.
„Nimmt sie vielleicht Drogen?“ fragte mich eines Tages meine Freundin Myriam. Aber den Gedanken fand ich so vollkommen abwegig, dass ich ihn weit von mir wies.
Mittlerweile lag eine dichte Wolkendecke unter uns. Die zwei jungen Männer neben mir schienen sich darüber zu ärgern und befürchteten, schlechtes Wetter auf der Insel zu bekommen. Noch nie war mir die Idee eines Strandurlaubs auf der Insel absurder vorgekommen. Die Insel hatte sich für mich in eine Hölle verwandelt, in eine unberechenbare Hölle, die unserer Familie einen brutalen Schlag verpasst hatte.
Plötzlich erblicke ich ihn von Weitem, den Guade, den Vater Guade, dessen unverkennbarer Gipfel teilnahmslos und gleichzeitig unnachgiebig aus dem Wolkenmeer herausragte. Nach Tausenden von Kilometern bläulicher und weißer Wolken, ließ er sich sehen, kolossal groß und verführerisch wie ein überdimensionaler Loreley-Felsen im Meer.
Ich näherte mich ihm aus der Luft und war von einem lauten Vorwurf erschüttert, der in mir bei seinem Anblick entstand, einem vorsintflutlichen, verzweifelten Aufschrei: „Vater Guade, was hast du mit meiner Tochter getan, die ich dir im Paradies anvertraut habe?“
Doch er schwieg sein jahrtausendealtes Schweigen, während sich die Maschine in der Luft drehte, als würde sie sich vor ihm verneigen, und dann Kurs auf den Süden der Insel nahm. Nur der Guade war sichtbar, ringsum war die Insel von dichten, grauweißen Wolken bedeckt, durch die man die Küstenstreifen nur erahnen konnte, als würde der unerbittliche Vulkan alles verbergen, verschleiern wollen, als hätte er kein Mitgefühl, nur ein tief verstecktes, schwarzes Lavaherz. „Ich werde dir mein Herz wieder entreißen, das du mir gestohlen hast!“, schwor ich ihm und mir selber von der Luft aus, während mir lavaheiße Tränen bis zum Kinn flossen, und ich mir die Silhouette des Vulkans tief einprägte, um sie niemals, niemals wieder zu vergessen.
Wir waren früher als erwartet gelandet, und so stand ich mit meinem Koffer in der Hand und mit verweinten Augen in der Ankunftshalle des Flughafens. Plötzlich fühlte ich mich alt und gebrechlich, schaute etwas benommen um mich herum und suchte in der Menge nach Sofia. Ich hatte sie fünf Monate vorher zum letzten Mal gesehen, an Weihnachten. Da war uns schon aufgefallen, dass sie sehr verhärmt wirkte, ja beinahe ungepflegt. Hatte sie sich früher gerne in Schale geworfen, wirkte sie nun um Jahre gealtert: das Haar war grau geworden, sie schminkte sich nicht mehr und machte sich nicht zurecht, ihre Haut war fahl und bleich. Wir dachten aber, das läge an ihrer Situation, weil sie arbeitslos war und sparen musste.
Es war mir bange ums Herz, weil ich mir nicht ausmalen konnte, wie sie inzwischen aussehen würde. „Ich bin sehr mager geworden“, hatte sie mir am Telefon berichtet, nachdem sie sich zu dem großen Schritt entschlossen hatte, ihrem Geheimnis ein Ende zu setzen und uns alles zu erzählen. Sie hatte mir geschrieben und signalisiert, dass sie wieder Kontakt zu mir haben wollte. Sie müsse einiges in ihrem Leben in Ordnung bringen und uns von etwas berichten, dass uns wohl sehr schockieren würde. Alle ihre Freunde wüssten schon Bescheid, jetzt hätte sie sich ein Herz gefasst und nun wolle sie auch uns reinen Wein einschenken und um unseren Segen bitten.
Als ich ihre Zeilen las, wusste ich, dass dies die Präambel zu der schlechtesten Nachricht war, die ich in meinem Leben bekommen würde. Ich munterte sie jedoch auf, sich uns zu öffnen und erklärte ihr, dass ich immer bereit gewesen war, ihr zu helfen und ihr zuzuhören. Erleichterung und eine große Belastung überfielen mich, es gab kein Zurück mehr.
Als ich zwei Tage später nach Hause kam und Peter mich dazu drängte, mich direkt an den Tisch zu setzen, damit das Essen nicht kalt wurde, merkte ich sofort, dass etwas in der Luft lag. Jedoch hörte ich nicht auf diesen Teil in mir, wie um mich zu schützen, wie um mir etwas Zeit einzuräumen. Erst nachdem wir gegessen hatten, schaute mich Peter ernst an, nahm meine Hand und eröffnete mir, es wäre eine E-Mail von Sofia angekommen, ich solle mich nicht aufregen, er habe gewollt, dass ich vorher etwas esse.
Bei so viel Vorsicht seinerseits wusste ich direkt, dass es etwas sehr Gravierendes sein musste. „Ist es sehr schlimm?“ fragte ich bange, und schon meldeten sich die ersten Tränen.
„Ja. Du kannst es gleich lesen, ich bin bei dir“, versuchte er mich zu beruhigen. „Was ist es?“ Ich wollte es von ihm hören, bevor ich es schwarz auf weiß geschrieben sah. „Drogen. Kokain. Sie muss einen Entzug machen.“
Es dauerte noch eine ganze Weile, bis ich mich an den Computer setzen konnte und ihre Zeilen las, die sie ein paar Stunden früher auf der Insel verfasst hatte, und ich spürte, wie schwer es ihr gefallen war, die richtigen Worte zu finden, uns das alles zu schreiben, uns eine so schlechte Nachricht übermitteln zu müssen. Sie warte auf einen Therapieplatz… sie sei zurzeit clean… es wäre immer mehr geworden… außer Kontrolle geraten …paranoide Anfälle… nun würde alles wieder gut werden… der Psychiater habe ihr Medikamente verschrieben… fünf verschiedene Psychopharmaka…. starke Depressionen… Selbstmordgedanken… eine Psychose… eine lange Geschichte… wenn ich nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte, würde sie es verstehen… der Entzug ginge über sechs Monate… arbeiten wäre nicht drin, würde lange nicht möglich sein…
Ich las die Zeilen immer wieder, immer wieder, und hoffte innigst darauf, irgendwann in der Lage zu sein, das nicht mehr lesen zu müssen, weil mich jemand oder etwas aus diesem Bann herausziehen würde, aus dieser Fata Morgana. Doch es war keine Fata Morgana, und ich las ihre Worte wieder und wieder, wie um Weiteres zu erfahren, um es zu verstehen, um es überhaupt zu glauben. Der Entzug ginge über sechs Monate. Sie nähme fünf Psychopharmaka, die ihr der Psychiater verschrieben habe. Paranoide Anfälle. Die letzten Jahre wären so hart für sie gewesen… jetzt wolle sie sich der Realität stellen. Alles wäre so furchtbar gewesen… sie hätte tot sein können… sie hätte ein sehr trauriges Leben geführt…
Peter stand hinter mir und hielt mich an den Schultern, während meine Tränen ohne Absicht und ohne Verzweiflung, Tränen ohne Namen, still zu fließen begonnen hatten. Ich wollte meinen Koffer packen und los fliegen, aber mir kamen alle Termine der nächsten zwei Wochen in den Sinn und ich stellte erschrocken und erleichtert fest, dass es vollkommen unmöglich war, alles fallen und liegen zu lassen.
Wie Schuppen von den Augen fiel mir die Metamorphose ein, die ich an ihr über die letzten Monate beobachtet hatte. Der Schmerz, der mich zu ersticken drohte, brachte auch Klarheit, eine Klarheit, die mich überrollte und blendete, die ich erst einordnen musste.
Die Welt hatte aufgehört sich zu drehen und was nun geschah, war völlig fremd. Lähmung machte sich in mir breit, als wäre ich schlagartig zum Invaliden geworden. Mir kam in den Kopf, dass man sicherlich einiges planen musste, aber ich war dazu nicht in der Lage. Dafür vernahm ich in mir immer wieder die Worte, die ich gelesen hatte: Der Entzug ginge über sechs Monate. Paranoide Anfälle. Fünf Psychopharmaka. Sie habe aber alles im Griff, ich solle mir bloß keinen Kummer machen. Ich solle mir bloß keinen Kummer machen.
Wie oft hatte ich in den letzten drei Jahren diesen Satz von ihr gehört? Es täte ihr so gut, uns das alles endlich erzählen zu können, nach so viel Leid und Verzweiflung. Sie hatte den Kokainkonsum nicht mehr im Griff, schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Das Wort Kokain verätzte mich, es war obszön und verletzend. Wieso hatte ich dieses Wort nicht geahnt, wieso war mir dieses Wort, Kokain, nicht eingefallen, ein so mächtiges, bedrohliches Wort? Wie blind war ich gewesen?
Nach so vielen Jahren im Leben wundere ich mich nicht mehr über sogenannte Synchronizitäten, die man landläufig als Zufall bezeichnet. Meistens habe ich solche Zufälle in Zeiten von großer Umwälzung erlebt, in Situationen, die tiefgreifende Veränderungen mit sich brachten. Den Zusammenhang aber kenne ich nach wie vor nicht, ich habe für dieses Phänomen keine Erklärung. Merkwürdig ist es auf jeden Fall, dass bestimmte Ereignisse gleichzeitig stattfinden.
Nur ein paar Tage vorher hatte Guido beschlossen, mich in meiner Praxis zu besuchen, nachdem wir uns zwölf Jahre lang nicht gesehen und so gut wie gar keinen Kontakt gehabt hatten. Zuletzt trafen wir uns bei der Beerdigung seines Bruders, meines ersten Mannes Manuel. Guido und seine Frau Marga hatten aber während all dieser Zeit Kontakt zu Sofia. Sie sind ihre Taufpaten, und sie reisten mehrmals im Jahr auf die Insel, um Guidos Eltern zu besuchen, meine Ex-Schwiegereltern, die seit den siebziger Jahren dort wohnten. Ich hatte Guido und seine Familie aus den Augen verloren. Er hatte sich überraschenderweise bei mir gemeldet und wollte sehen, was aus mir geworden war, wie mein Leben verlief, wo ich arbeitete. So hatten wir vereinbart, uns in meiner Praxis zu treffen, genau einen Tag nach Sofias Geständnis.
Ich zog es vor, ihnen zunächst nichts von Sofias Geschichte zu erzählen. Es war wirklich nicht der passende Moment. Es berührte mich sehr, Guido und Marga nach so langer Zeit wieder zu sehen. Sie fragten natürlich nach Sofia, und ich brachte es fertig, ihnen klar zu machen, dass es ihr gut ginge. Diese Lüge zu erzählen fiel mir so schwer, wie keine andere in meinem Leben. Ich wollte aber vorher mit Sofia sprechen, bevor ich Guido und Marga in ihr Problem einweihte. Mit Pilar - meiner Schwester - hatte ich schon geredet. Sie war erschüttert und fassungslos, so wie wir alle. Sie brauchte auch mehrere Tage, bis sie es endlich begriff: Sofia, unsere Vorzeigetochter, unser braves Mädchen, das uns seit Kindesbeinen nur Freude bereitet hatte, war kokainabhängig geworden. Unser Kind, das wir jahrelang für glücklich, zufrieden und erfolgreich hielten, war innerhalb von drei Jahren in den Abgrund gestürzt und so todunglücklich gewesen, dass sie sich beinahe ums Leben gebracht hatte.
Sobald ich morgens aufwachte, befiel mich tiefe Traurigkeit, sodass mir nach nur wenigen Tagen klar wurde, dass es unmöglich war, in Deutschland zu bleiben, und dass die einzige Erleichterung meines Kummers darin bestand, alle Termine abzusagen und zu ihr auf die Insel zu fliegen.
Jeden Tag erfuhren es andere Freunde von uns. Es war Sofias Wunsch, dass es alle wussten, die sie kannten. Ich fand es sehr mutig von ihr, und sehr klug, dass sie die Geschichte nicht unter den Teppich kehren wollte. Für mich war ihr Entschluss entlastend, weil ich dann auch offen mit meinen Arbeitskollegen und Bekannten reden konnte. Überall stieß ich auf Verständnis und Trost.
„Ich werde Sofia mein Leben lang dafür dankbar sein“, musste ich öfters erzählen, „dass sie mich erst mit dem Problem konfrontiert hat, nachdem sie auf dem Weg zur Lösung war.“ Ich stellte mir vor, wie schwer es für uns gewesen wäre, sie in der Zeit zu erleben, als sie der Meinung war, sie könnte den Umgang mit Kokain schon dosieren, sie hätte alles im Griff. So, wie sie uns erzählte, hatte sie aus eigenem Willen die Therapiestelle aufgesucht, im Entzugsdelirium, und hatte sich alleine Hilfe geholt, ohne uns damit zu behelligen.
Das grelle Äquatorlicht der Insel zeigte sich plötzlich verschwenderisch stolz durch die großen Fenster des Flughafens, als gäbe es keine Wolken mehr um den Vater Guade. Wie oft schon waren Peter und ich dort angekommen, voller Urlaubspläne und froh darüber, mit Sofia ein paar schöne Tage zu verbringen! Wie glücklich waren wir dann immer, wenn sie uns freudestrahlend entgegenkam, unsere Koffer in ihr Auto brachte und uns bei sich ein Abendessen vorbereitete! Hatte das alles in einem anderen Leben stattgefunden, oder war es an einem anderen Ort gewesen, gar auf einem anderen Planeten? Wo war der Schuldige, der das alles kaputt gemacht hatte?
Die vielen Touristen, die an mir vorbei huschten und sich lebhaft und fröhlich unterhielten, kamen mir absurd und unpassend vor. Die großen bunten Plakate, die das Kasino der Hauptstadt ankündigten, oder die vielen tropischen Gärten, die Delfin-Shows, die Vulkan-Ausflüge, hatten plötzlich den Charakter eines bedrohlichen, verlogenen Alptraums. Draußen wehte eine feine Brise, die die Palmenblätter glitzern und die Mitteleuropäer in Shorts und Badesandalen strahlen ließ. Dazwischen plötzlich, in großen Schritten auf mich zukommend, erblickte ich unvermittelt Sofia, in einem kurzen, geblümten Kleid, mit ihren dunkelbraunen Locken im wetlook, in weißen Römersandalen, Haut und Knochen, mit großen fragenden Augen, leicht gerunzelter Stirn, braungebrannt von der Sonne und trotzdem blass wirkend, seltsam blass, wie mager sie doch ist, wie extrem mager sie geworden ist; die Schulterknochen stehen ab; und an der Leine springt neben ihr ein ausgewachsener Podenco-Rüde, so schmal und ungelenk wie sie, ihr Hund César, den ich zuletzt vor über einem Jahr als Welpen gesehen habe. Beide kommen auf mich zu in langen Schritten, mir scheint die Zeit still zu stehen und alle Menschen, die sich in der Vorhalle des Flughafengebäudes befinden, sehe ich nicht mehr – sie sind verschwunden - und ich höre auch nichts mehr, als hätte man den Lautstärkeregler am Fernseher abgedreht: nur Sofia und César, und ihre Augen, rund und groß und etwas verängstigt, und wie sie auf mich zukommt und mich leicht verlegen anlächelt.
„Mama, mein Mamachen“, stammelt sie und drückt mich an sich, etwas hölzern. Der junge Hund springt an mir hoch und leckt mir das Gesicht ab, bellt, will beißen, ist verspielt und nicht zu bändigen. Mir kommt der Gedanke, dass sich Sofia und César ähneln, als seien sie miteinander verwandt. Mich wundert es, dass ich trotz tiefstem Kummer anscheinend noch dazu fähig bin, so vergnügliche Ideen zu entwickeln. Ich bin betreten und leer und finde keine Worte, die ich aussprechen könnte. Sofias Haut war sonnengegerbt, während ihre Augen so wirkten, als wären sie geleert worden, ihre Pupillen, wie ein Scherenschnitt des Vulkans Guade. Ich hatte noch unseren Landeanflug vor Augen und wie wir durch die Wolkendecke schwebten, die Vater Guade über seine Flanken und Füße ausgebreitet hatte, um all diesen Horror, der mir jetzt näher kam, zu verstecken. Vor mir stand nun das Ende des Geheimnisses.
Nach und nach, während wir in der tropischen Wärme der Abendsonne zu Sofias Auto liefen, fielen mir einzelne Details an ihr auf. Sie wirkte verhärmt, sehr dürr, war etwas desorientiert und eingeschüchtert. Trotzdem spürte ich durch all ihren Kummer die Freude, die sie darüber empfand, dass ich gekommen war. „Ich kann es verstehen, dass ihr nicht alles liegen lassen könnt um zu mir zu kommen“, hatte sie am Telefon gesagt. Als ich mich aber nach mehreren schlaflosen Nächten doch dazu entschied, auf die Insel zu fliegen, war sie richtig dankbar und glücklich darüber.
„Wie musst du so einsam gewesen sein, mein geliebtes Kind?“ sagte ich ihr in Gedanken, weil ich nicht recht wusste, wie ich mich ihr gegenüber verhalten sollte, während sie mich mit großen, leeren Augen anschaute, und nur mit den Mundwinkeln zu lächeln versuchte.
Wir fuhren zu ihrem Appartement. Es war mir seltsam zumute, als wir beide dort ankamen, genau so, wie wir immer zu Beginn unserer Ferien mit Peter angekommen waren. Nun war ich aber alleine. Der junge Hund bellte übermütig und rannte die Treppe hoch, während mir Sofia den Koffer hinauftrug.
Die kleine Wohnung war nicht wieder zu erkennen. Sämtliche Wände waren von dem Hund verkratzt worden, die Farbe blätterte ab, alle Möbelstücke waren beschädigt: die Vitrine, die wir ihr gekauft hatten, wies an vielen Ecken Bisse auf, die Sitzkissen der Stühle waren zerfleddert, die Couch beinahe in Fetzen. Mitten im Raum stand ein überdimensionaler Hundezwinger, den sie nicht auf den Balkon hatte stellen wollen, um César bei sich zu haben, weshalb man im Wohnzimmer kaum Platz hatte, um sich zu bewegen. Mit Brettern hatte sie Abtrennungen gebaut, damit der Hund nicht ins Schlafzimmer oder ins Bad laufen konnte. Die Glasscheibe der Balkontür war vollkommen verschmiert, die Markise auf dem Balkon, auf die sie an heißen Sommertagen so viel Wert gelegt hatte, war an den Enden zerrissen. César sprang mich an und bellte, und ich verlor beinah den Halt und fiel gegen die Wand. Er wirkte sehr aufgeregt und Sofia erklärte mir, dass er es nicht gewohnt war, einen anderen Menschen außer ihr in der Wohnung zu sehen.
Der Tag war plötzlich doch wolkenverhangen und das graue Licht in dem vernachlässigten Raum unterstrich die deprimierende Atmosphäre. Während ich meinen Koffer auspackte und meine Kleidung wie in Trance in den Schrank legte, den Peter und ich so oft bei früheren Besuchen benutzt hatten, war es mir unmöglich zu realisieren, dass ich mich auf der Insel der Glückseligkeit befand. Schlagartig hatte ich das Gefühl, mich auf eine viel zu große Mission eingelassen zu haben, ich kam mir plötzlich sehr klein und alt vor, ohnmächtig und überfordert. Zwischendurch versuchte ich mir vorzustellen, wie Sofia die vierzehn Monate seit unserem letzten Besuch verbracht hatte, ohne Arbeit und nur in Gesellschaft des Hundes, der immer größer wurde, und um den sie sich nach und nach nicht mehr richtig kümmern konnte.
Was ich sah nahm mir die Luft zum Atmen. Sofia war still und sehr unbeteiligt, wie unter Hypnose, oder wie unter Schock, während César immer wieder Anlauf nahm und mich ansprang, bis Sofia ihn in seinen Zwinger einsperrte, wodurch das Tier noch nervöser und lauter wurde. Sie aber reagierte nicht darauf. Sie setzte sich auf den Balkon, schaute starr ins Leere und rauchte eine Zigarette nach der anderen in langen, gierigen Zügen. Sie bewegte sich keinen Millimeter, verfiel zwischendurch, so als wäre ich nicht da, in eine Art Katalepsie, und die einzige Bewegung war die, die Zigarette an die Lippen zu führen und dann den Rauch auszuatmen.
Im Innenhof hörte man die Urlauber im Schwimmbad plantschen, lachen und schwimmen. Sofia aber schien es nicht wahrzunehmen. Ich beobachtete sie vom Zimmer aus, sie saß mit dem Rücken zu mir, bewegungslos. Ihr Umriss reflektierte sich in der schmutzigen Glasplatte ihres Wohnzimmertisches. Die Silhouette von der dürren Sofia auf der Tischplatte, rief mir wieder die Silhouette des Vulkans ins Gedächtnis. Das Bild brannte in meinem Herzen wie Lava.
Erinnerungen an jenen Sommer kamen auf, als sie sich die Wohnung gekauft hatte und wir sie zum ersten Mal besuchten. Eine strahlende Sofia, die uns stolz alles zeigte: „Ist die Anlage nicht schön? Schaut mal! Sogar ein Schwimmbad haben wir im Garten!“ Wir waren glücklich darüber, dass sie alles gut im Griff hatte und ihr Leben genoss. Zusammen hatten wir im Norden der Insel IKEA aufgesucht, das erste IKEA-Geschäft, das in Spanien eröffnet wurde, und verschiedene Möbel für ihren Balkon und für das Wohnzimmer gekauft. Abends saßen wir dann zu dritt in der Abenddämmerung und genossen die frische Brise. Wo war das alles geblieben? War das derselbe Platz? Hatten wir uns alle getäuscht?
Damals, als sie die Wohnung kaufte und einen guten Posten als Direktionsassistentin im Hotel bekam, waren die Madrider Großeltern noch nicht geschieden. Sofia war ihr ganzer Stolz und selbst als sie sich ein paar Jahre später trennten, war Sofia für sie immer eine Quelle der Freude gewesen. Sie hatten sie sehr geliebt und bewundert, weil sie immer fröhlich und fleißig war. Zum Glück mussten sie dieses Desaster nicht miterleben.
Oma María war fünf Jahre, Opa Horst vier Jahre davor verstorben. Ich wagte nicht mir vorzustellen, was das für ein Familiendrama gewesen wäre, wenn sie dieses Unglück miterlebt hätten. Dieser Gedanke machte mir wieder klar, wie schwer wir es alle in der Familie gehabt hatten, wo es keinen Platz für Probleme gab, wo es immer oberstes Gebot gewesen war, nicht zu scheitern; wenn es dann doch nicht zu vermeiden gewesen war, dann durfte es um Himmelswillen keiner erfahren, keiner merken. Meine Eltern, in erster Linie mein Vater, hätten es nicht verkraftet, eine drogensüchtige Enkelin zu haben. Vor allem darum, weil dies in ihren Augen ein schlechtes Licht auf sie selbst geworfen hätte.
So war ich aufgewachsen, und Sofia, die ich schon im Alter von 19 Jahren bekam, hatte diesen beinahe nicht auszuhaltenden Leistungsdruck von Kindesbeinen an mitbekommen. Der Gedanke machte mir Angst: ich war froh, dass meine Eltern diese Tragödie nicht miterleben mussten. Nicht, weil ich sie schonen wollte, sondern weil sie uns im Unglück zusätzliches Leid und Kummer verursacht hätten, dessen war ich mir sicher.
Der Hund César lief auf den Balkon und pinkelte in die Ecke. Sofia schimpfte kraftlos mit ihm. „César, das macht man doch nicht!“ Später erzählte sie mir, dass sie ab einem bestimmten Moment auch nicht mehr die Kraft gehabt hatte, ihn richtig zu erziehen. „Vielleicht bin ich auch nicht in der Lage, konsequent zu sein. Vielleicht kann ich das auch nicht", sagte sie, und mir fiel auf, wie wenig sie inzwischen von sich hielt, als wäre ihr gesamtes Selbstwertgefühl zerbröckelt.
Sofia hatte den kleinen Hund von Freunden bekommen, einen Tag nachdem er geboren wurde. Die Hundemutter hatte ihn verstoßen, und dem Welpen drohte der Hungertod. Sofia wurde gefragt, ob sie den Kleinen haben wollte. Eigentlich hatte Sofia Zeit ihres Lebens Angst vor Hunden, aber als sie dieses winzige, hilflose, wimmernde Wesen sah, das auf ihre Handfläche passte, war sie so von ihm berührt, dass sie sich spontan entschloss, ihn zu adoptieren und sich um ihn zu kümmern.
Sie suchte noch am gleichen Tag einen Tierarzt auf, und ließ sich erklären, worauf sie zu achten hatte. Der Tierarzt meinte, dass der kleine Welpe ohne seine Mutter wahrscheinlich eingehen würde. Doch Sofia nahm sich fest vor, es zu schaffen, und was sich Sofia vornahm, schaffte sie auch. Sie kaufte eine Hundebox, Decken, spezielles Milchpulver und so zog sie das kleine Wesen mit dem Fläschchen auf, gab ihm den Namen César, und er wurde zu einer Art Kind für sie.