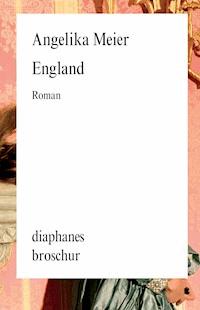18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Verbannung aus Kalifornien – so lautet das Urteil für Mary Lynn Osmo, in einem früheren Leben mäßig erfolgreiche, platinblonde Schauspielerin. Sie hat einen perfekten Mord begangen, so perfekt, dass sie sich selbst dieses Mordes bezichtigen muss. Die Verbannung, in die sie von Gouverneur Green und dem väterlichen Richter geschickt wird, führt Mary Lynn dann aber nur tiefer hinein ins vertrocknende goldene Land der Sonne und an die Frontier ihrer eigenen Geschichte.
Eine insolvente Solaranlage, die von einem sektiererischen Deutschen geleitet wird, sieben heimatlose Veteranen, das Gefängnis-Motel Court Inn, ein kleines Mädchen, das von Schrumpfköpfen besessen ist, der Gefängniskoch, der zum Marshal wird und zum Objekt der Begierde, der Konsultant für indianische Angelegenheiten, ein Diner in der Mojave-Wüste, auf Notbooten heimkehrende Familien am Strand von Los Angeles sind die Wegbegleiter und Stationen einer Geschichte, die in schönster Traumlogik ins deutsch-amerikanische Herz der Helligkeit führt – und in eine noch immer offene Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Ähnliche
Angelika Meier
Osmo
Inhalt
Diese Schuld kann ich
nicht länger leugnen:
Beginnen will ich
immer von neuem.
Franz Maria Bögl,
1.
„Angeklagte, Sie haben das letzte Wort.“
„Ich möchte sagen, dass mir alles sehr, sehr leid tut und dass ich mich bei den Angehörigen entschuldigen möchte.“
„Bei wem? Das Opfer hatte keine Angehörigen.“
„Oh, äh nein, ich meine natürlich … meine, natürlich … meine Angehörigen.“
Mary Lynn hob endlich den Kopf, sah den Richter zum ersten Mal seit Prozessbeginn fest an und wandte sich dann, beflügelt vom Mut, der eigenen Wahrheit im irritierenden Spiegel des richterlichen Vierauges ins Gesicht zu sehen, ebenso entschlossen dem Saal zu, in dem die kaum zu bändigende Meute des Auftakts ein paar wenigen älteren Leuten Platz gemacht hatte, die vereinzelt wie letzte Spielfiguren einer sinnlos langen Partie von Irgendwas in den Bänken hockten. Die Uhr über dem Richterkopf summte zwölf, mit nur einem langen Summer, der sich ähnlich anhörte wie der, mit dem sich das Chipkartenschloss ihrer Zellentür stets unerwartet öffnete, nur leiser und etwas freundlicher, und in Mary Lynns halbtaubem Kopf summte es summ, summ, summ, Bienchen summ herum und dann in the summer, in the city, in the summer … Um das idiotische Gesumm abzustellen, versuchte sie, sich ganz auf das blütenweiße Taschentuch zu konzentrieren, mit dem sich der Mann in der ersten Reihe andächtig langsam über seine Clownsglatze fuhr. Tatsächlich hatte er gar keine Clownsglatze, denn für die bräuchte es doch einen Kranz komisch langer Haare um die Glatze herum. Wo aber auf diesem Kopf noch etwas wuchs, wurde es der Glatze gleichgemacht, doch der dunkle Haarschattenring auf dem zwei, höchstens drei Tage unrasierten Schädel und das lächerlich saubere weiße Taschentuch mussten Mary Lynn heute zur Komödie reichen. Er konnte sich seine sommersprossig gebräunte Halbkugel eigentlich nur wegen eines mittlerweile bloß noch lexikalischen Wissens um die da draußen jetzt zur Gluthitze hochfahrende Augustsonne wischen, denn hier drinnen, im fensterlosen Saal, hatte die Aircondition alles in frostigem Griff.
Mit leichtem Unbehagen registrierte Mary Lynn, wie ihr Anwalt, der sich robensolidarisch für den kurzen Moment der Urteilsverkündung und den, wie zu befürchten stand, nicht ganz so kurzen des richterlichen Resümees ihrer Geschichte mit ihr erhoben hatte, ihre Hand griff und drückte, ja beherzt quetschte, und mit interesselosem Wohlgefallen bemerkte sie durch diesen feucht verlogenen Druck, wie schön saftig, kühl und weich ihr eigener Handballen war. Wie ein frisches kleines Gummibaumblatt. Ein solches befremdlich angenehmes Zusammentreffen mit einem eigenen Körperteil wäre früher Anlass zu einer kleinen Verzweiflung gewesen, jetzt aber half es ihr bei der tierhaften Versenkung in die wie für die Aufnahme des Schlussspruchs sorgfältig entleerten Gesichter der Saalzuschauer und damit etwas über die lehrreichen Reden des Richters hinweg. Wozu auch genau hinhören, wo doch das Urteil vom ersten Verhandlungstag an feststand? Denn, genau, nie hat dieses Gericht jemand Geständigeren als die Angeklagte erlebt, ja sag ich doch, und nie haben die Wände dieses Saales die Stimme eines Menschen gehört, der sich einverstandener mit seiner Bestrafung erklärt hätte, na also, was denn noch? Und doch, Zweifel bleiben, mag sein, aber nun soll er bitte dennoch endlich zum Schluss kommen, die leise Stimme des Zweifels, sie schließt kurz die Augen, lässt sich nicht abstellen, fällt im tadellos geraden Stehen wahrscheinlich in einen kurzen, tiefen Schlaf, wird wachgerissen durch den Anwalt, der ihr nun nicht mehr nur die Hand quetscht, sondern ihren ganzen Oberkörper freudig an sich presst, und da erst setzen sich die richterlichen Worte in ihrem verschlafenen Kopf zusammen, und zwar zum ersten Mal in der Geschichte, nein, nicht der ihren, sondern der dieses Gerichts, ein Präzedenzfall also in der Geschichte der Beziehungsform Der Staat von Kalifornien gegen, erstmals muss eine Urteilsverkündung trotz Geständnisses, ja sogar umfassenden Geständnisses mit der souveränen Niederlageformel Aus Mangel an Beweisen anheben. Dieser Mangel bedeutet allerdings keinen Freispruch und auch keine Straffreiheit, keine gänzliche jedenfalls, denn das In-dubio-pro-reo muss mit dem Wohl der Allgemeinheit abgewogen, gewissermaßen gegengewogen werden, und schließlich ist auch das Wort der Angeklagten zu berücksichtigten, mag es auch letztlich nicht glaubwürdig sein, aber eine gewisse Würde der Schuld kann einem solchen, zu aller Schuld entschlossenen Menschen nicht abgesprochen werden, also Strafe, aber weder Tod noch endgültiges Wegsperren, sondern schlicht: Verbannung. Und freilich erfolgt das Urteil in diesem Fall ohne Möglichkeit einer Revision.
Der Anwalt freut sich noch immer, der Saalälteste gratuliert im Namen aller regulären Prozessbesucher, Mary Lynn bedankt sich mit einem bezaubernd verwirrten Lächeln, verlässt majestätisch schüchtern nickend den Saal und wandert geradewegs nach draußen ins gleißende Sonnenlicht.
Der palmengesäumte Platz vor dem Gerichtsbungalow ist vollkommen leer und lässt den heißen Sand ungestört als wär’s Sonntag Walzerrunden auf seinen glatten hellen Steinplatten drehen. Mary Lynn setzt halb affektiert blinzelnd, halb tatsächlich kasperhauserblind ihre am linken Flügel mit Hansaplast geflickte Ray Ban auf und denkt seufzend: Jetzt erst begriff sie die Größe Amerikas.
„Zu spät, Osmo, zu spät.“
Sie sollte erschrocken herumfahren, tut’s aber nicht, man kann nicht sein Leben lang erschrocken herumfahren, die Augen aufreißen und kleine Geräusche machen, selbst wenn man es noch so gut kann, gerade dann musste hier, musste ab jetzt Schluss sein damit und mit allem, was man noch so gut kann, und so antwortet sie der Stimme in ihrem Rücken liebenswürdig, aber unbewegt:
„Für mich ist es nie zu spät.“
„Oh je, wohl den falschen Glückskeks erwischt, wie?“
Jetzt erst kann sie sich in Ruhe umdrehen. Es ist niemand da, selbstverständlich nicht, aber aus dem Gerichtsgebäude kommen nun die übrigen Prozessbeteiligten und Besucher, die meisten bleiben noch ein Weilchen schwatzend unter dem lang nach vorn ausgestreckten Sonnendach versammelt, das noch erahnen lässt, dass der Empfangsraum des Gerichts in der Mitte des letzten Jahrhunderts, in den unbeschwerten Tagen des unendlichen Durchreiseverkehrs, einmal einer der schönsten Tankstellendiner der Gegend war.
Die Gruppe löst sich allmählich auf, der Richter schüttelt den Aufbrechenden die Hand und kehrt schließlich schwerfällig in sein Gericht zurück, nur Mary Lynns Anwalt und der alte Gerichtsdiener stehen noch rauchend im Schutz des pastellgelben Betonbaldachins. Der Gerichtsdiener redet unaufgeregt, aber ununterbrochen auf den Anwalt ein, Mary Lynn kann ihn nicht richtig verstehen, der Wind lässt die Worte auf dem kurzen Weg zu ihr abschwirren wie ein Frisbee, aber sie weiß ohnehin, es ist die immer gleiche Litanei, der alte Mann klagt darüber, wie sehr ihm die undichten Räume hier zu schaffen machen. Geht einem alles durch Mark und Bein. Wo fängt das an und wo hört das auf? Kannste nicht mehr sagen, Mann. Wo kommt einer her und wo geht er hin? Kannste nicht mehr sagen, Mann. Manchmal biste mitten im Leben und manchmal … Dazu brummt und nickt der Anwalt in regelmäßigen Abständen, als wolle er dem Gerichtsdiener dabei helfen, seinen Über-Stock-und-Stein-Rhythmus zu halten.
Die Stiche in die Schläfen werden tiefer, der Schwindel nimmt langsam Fahrt auf, aber erst als der Anwalt zu ihr aufblickt und sie heftig gestikulierend dazu auffordert, doch aus der verdammten Sonne raus, zu ihnen unters Dach zu kommen, begreift Mary Lynn endlich, dass sie im Freien steht, und augenblicklich und zum ersten Mal in ihrem Leben buchstäblich verliert sie den Boden unter den Füßen. Sie hört noch, dass das ja auch kein Wunder sei, womit sie sich vollkommen einverstanden erklären könnte, wenn sie bloß in der Lage wäre, irgendetwas zu erklären. Aber ist vielleicht einfach nicht die Zeit für Deklarationen. Später. Vielleicht.
Jetzt erst mal wieder zu sich kommen in der Küche des Richters, immerschön der Reihe nach, besonders wenn alles auf einmal zu geschehen scheint. Vorsichtig, beide Hände um die Tasse geklammert, den heißen Kaffee, heiß, gut,alone: bad, together: good, armes Köpfchen, riesengroß, kreierte ein Monster, schlürfen, aber möglichst geräuschlos, derweil der Richter, den runden Rücken Mary Lynn mütterlich zugekehrt, an seinem Herd in einer riesigen Pfanne herumfuhrwerkt und der Gerichtsdiener umständlich den Tisch deckt. Für jedes Glas, jeden Teller, jedes Besteck, für Butter und Toastbrot schlurft er jeweils zwischen dem Tisch und den Schränken hin und her. Aber die Wege in der kleinen Küche sind schließlich kurz, kaum vorhanden im Grunde, wozu also sollte er sich unnötig überladen, womöglich sogar etwas fallenlassen, statt den einen Schritt mehr zu tun? Nur der Anwalt ist bei Mary Lynn sitzen geblieben, fühlt trübe durch sie hindurchschauend noch einmal ihren Puls am Handgelenk, drückt zwischendurch seine Zigarette auf der Untertasse aus, was er mehr zu genießen scheint als sie zu rauchen, und lässt dann seinen Blick am Richter vorbei durch die schmale Fensterfront über der Küchenzeile nach draußen schweifen, wo ein halbwüchsiger Birnbaum stumm unter der Hitze leidend die Blätter hängen lässt. Die Männer schweigen alle drei, sogar der Gerichtsdiener hält den Mund, und auch sonst ist kein Geräusch zu hören, sodass Mary Lynn sich schon fragt, ob etwas mit ihren Ohren nicht stimmt, bis der Richter ein selbstvergessen munteresso!vernehmen lässt. Er löst den Knoten seiner Schürze, zieht sie von seinem grauen Anzug ab wie eine abgestorbene Haut und wirft sie über den Stuhl, alles in einer zauberhaft flinken einhändigen Bewegung, wie sie nur jahrzehntelange Übung hervorbringt, und dann verteilt er die Rühreier auf die Teller.
„Keinen Toast, Larry?“ Der Richter schaut amüsiert auf den Teller des Anwalts. „Noch immer unter dem Low-Carb-Regime?“
„Ich habe es Barbara versprochen“, der Anwalt zuckt lächelnd die Achseln, „ich geb mir Mühe mit den Kohlehydraten, reduzier den Feierabendwein auf ein angeblich sowieso viel genussreicheres einziges Glas, und dafür lässt sie mich mit dem Rauchen in Frieden. Angeblich. Irgendwann mal. Hoff ich.“
„Ein ewiger Vergleich, so ’ne Ehe, häh?“
„Sie haben gut reden, Richter.“
„Ja, ein Junggeselle hat immer gut reden.“
„Über alles zwischen Himmel und Erde“, fügt der Gerichtsdiener ernst hinzu, ohne auch nur im Essen innezuhalten.
„Naja“, der Richter wackelt vergnügt mit dem Kopf, „minimal ausgleichende Gerechtigkeit für die stillen Qualen der Verkarstung. Wobei ich mir mitunter nicht mal sicher bin, ob dieses Reden überhaupt eine Kompensation ist oder nicht eher noch eine zusätzliche Strafe.“
Er lacht, aber der Gerichtsdiener stößt düster zwischen den Zähnen hervor:
„Ein Fluch ist es, ein Fluch. Das ist, was es ist! Weil hier keiner mehr weiß, wo der Himmel anfängt und die Erde aufhört, und dazwischen wuchert es überall unselig, das wächst und wächst, und trotzdem wird alles immer enger, da braucht’s keine Kälte, keinen Zug, geht einem auch so durch Mark und –“
„Jaja, ist gut, Walter“, der Richter klopft seinem Gerichtsdiener gutmütig auf den Rücken, „essen Sie, Miss Osmo, dass Sie uns wieder zu Kräften kommen, das ist schließlich der Sinn der Übung hier.“
„Ja … ja, danke“, tatsächlich hat sie das Rührei kaum angerührt, „wann … was glauben Sie, Richter, wann wird das Urteil vollstreckt?“
„Es wird überhaupt nicht vollstreckt, wir geben Ihnen ja nicht die Spritze. Essen Sie! Sie werden sich einfach nur dran halten und also den Staat Kalifornien verlassen.“
„Verlassen, wohin? Kann ich entscheiden, wohin ich –“
„Natürlich. Sie können gehen, wohin immer Sie wollen. Außerhalb des Territoriums von Kalifornien sind Sie schließlich eine freie Frau“, er bestreicht einen Toast mit reichlich Butter und legt ihn beiläufig auf Mary Lynns Tellerrand, „gehen Sie nach Tokio oder Paris oder spazieren Sie meinetwegen bloß die paar Meilen rüber nach Arizona, nur über den Colorado, und da bleiben Sie für den Rest Ihres Lebens und spucken zu uns rüber – wie Sie wollen.“
„Tatsächlich?“
„Natürlich nicht!“ Er tätschelt ihr mitleidig die Hand. „Sie werden schließlich nicht bloß ausgewiesen, sondern verbannt. Haben Sie schon mal gehört, dass sich jemand den Ort seiner Verbannung aussucht?“
Eine Antwort erübrigt sich so selbstverständlich, dass Mary Lynn automatisch, wenn auch viel zu apathisch, zu überlegen beginnt, ob ihr nicht vielleicht doch schon einmal etwas Derartiges zu Ohren gekommen sein könnte. Wäre es nicht möglich? Keine Regel ohne Ausnahme. Wobei fragwürdig ist, ob eine Ausnahme in diesem Fall überhaupt noch als regelrechte, also regelbekräftigende Ausnahme gelten könnte oder sie nicht im Gegenteil eine regelaußerkraftsetzende Präzedenz darstellte. Ja, eine Ausnahme, vielleicht sogar bereits die bloße Möglichkeit einer Ausnahme käme hier einer Aufhebung der Regel gleich, einer ersten und vielleicht auch nur einzigen, mag sein, das kassiert sich so leicht, vielleicht aber wäre eine solche Ausnahme auch schon ein Bruch ein für alle Mal, und damit eine neue Regel, ein neuer Tag, eine neue Grenze. Muss es nicht für alles eines Tages einmal eine Präzedenz geben? Beginnt nicht alles Gute in diesem Land schließlich noch immer mit einem Nein, Euer Ehren, ich zitiere: Der Staat von Illinois gegen Owen Ponte, 1984, oder Ähnlichem? Unmöglich ist es nicht. Vorerst keine weiteren Fragen an den Richter, stattdessen schiebt sie sich zufrieden seufzend das ganze Ei auf einmal in den Mund, murmelt dabei nur vorwurfsvoll Es ist kalt geworden, als wäre es die Schuld der anderen, dass sie jetzt erst zu essen anfängt, da schickt der Anwalt der rhetorischen Frage des Richters hinterher:
„Was den großen Vorteil für Sie hat, dass Sie nirgendwo Asyl beantragen müssen.“ Er lächelt kurz aufmunternd, dann bewölkt sich seine Stirn wieder. „Denn wie die Chancen dafür stünden, muss ich Ihnen wohl kaum sagen.“
„Ja – nein.“ Sie wischt sich den Mund ab und erhebt sich leicht schwankend. „Dürfte ich wohl Ihr Badezimmer benutzen, Richter?“
„Natürlich! Die rechte Tür gegenüber. Aber erschrecken Sie nicht. Hängt ein Spiegel drin. Ist ja ein Badezimmer. Die sind so. Und sieben Jahre sind nun mal sieben Jahre.“
„Keine Sorge. Ich bin darauf vorbereitet.“
Beim Hinausgehen schließt sie die Küchentür nur zum Schein, bleibt draußen stehen und lauscht, Stirn und Nase an die Wand neben der Tür gedrückt, Zehen gegen die Fußleiste gestoßen, Hände über dem Steiß locker ineinandergelegt, nicht verschränkt, die vordere Handfläche offen, als erwarte sie, dass ein Komplize etwas in sie hineinlegt. Kerzengerade kann man so stehen und dabei doch die eingebogenen Schultern hängen lassen, stundenlang, wenn es sein muss oder wenn man will, was im Laufe der Jahre dasselbe wird, wenn es gilt, für ein paar Stunden das gefährliche Hin und Her in engstem Raum zu vermeiden, und für einen Moment stellt sie sich lächelnd vor, der Gerichtsdiener müsste sein Leben lang den Tisch decken in der kleinen Küche des Richters. Das Hin und Her, aber eben auch das eingesunkene Sitzen auf der Pritsche, das schmerzhafte Einsinken ist strengstens zu vermeiden, noch gefährlicher fast als das brabbelnde Hin und Her. Stattdessen also stehen, bewegungslos, so lange wie möglich, Beine und Becken halten der Stirn die Stellung, mit der Zeit macht einen die Haltung demütig und zäh. Hier draußen aber kann sie nicht weiter so herumstehen und lauschen, sie hört ja überhaupt nichts mehr. Es scheint, das Gespräch in der Küche ist vollkommen verstummt.
Erst als sie sich von der Wand ablöst und zum Bad hinüberschleicht, hört sie, wie der Richter leise zu fluchen beginnt, über die Idioten in L.A. und die Idioten im Bundesberufungsgericht in San Francisco, die ihnen in vereinter Idiotie den verdammten Fall aufgebürdet hätten, und dann auch noch über die Idioten in Sacramento, die sich nun zu allem Übel, obwohl doch sie damals zuallererst dieses Verfahren verlangt hätten, um die Umsetzung des Urteils drücken wollten, seit drei Tagen erzähle man ihm, der Gouverneur werde auf der Stelle alle notwendigen Schritte veranlassen. Seit drei Tagen auf der Stelle! Anscheinend halte man sie allerorten für Meisteridioten, denen man alles erzählen könne. Die Meisteridioten in ihrem elenden Wüstenkaff, warum auch sollte sie der Herr Gouverneur anständig behandeln? Noch als Mary Lynn Licht macht für das Bild im Spiegel und dabei ängstlich die Luft anhält, hört sie ihn fluchen. Er hat ja recht, sieben Jahre sind sieben Jahre, und die können nun mal nicht spurlos – doch, anscheinend doch. Da hat sich nichts eingezeichnet,es müsste doch Spuren geben, wenn Sie die Wahrheit sagen würden!, nichts, auch wenn sie sich für einen Moment nicht wiedererkennt, sie ist ja auch nicht wiederzuerkennen, aber das liegt nur am veränderten Rahmen, darauf war sie eingestellt, hatte sogar einen stärkeren Effekt erwartet. Denn weil ihr Haar schon seit Jahren kurz geschnitten, penibel seitengescheitelt ist und natürlich nicht mehr hellblond gefärbt, wusste sie, auch ohne es zu sehen, dass sie ein wenig wie ein seltsam erschöpfter zwölfjähriger Junge aussehen müsste. Und wenn man sich jahrelang mit der flachen Hand über den Hinterkopf fährt, habituell, ohne es also noch zu bemerken und doch nichts anderes tatsächlich mehr zu spüren, und ohne dabei zu wissen, ob die liebe Hand den armen Kopf trösten will oder nicht vielmehr die arme Hand sich von dem lieben Rund des Kopfes und der Berührung des weichen kurzen Kaninchenfells trösten lässt, dann braucht man keinen Spiegel mehr, um zu wissen, wie man aussieht, man weiß – es interessiert mich nicht mehr. Und dann ist doch die dünne weiße Baumwollbluse, die sie ihr heute Morgen gegeben haben, so schön, ganz weich, so weich, das begreift man kaum. Sie streichelt über Kreuz ihre schönen weichen Blusenärmel, umfasst ihre Ellbogen und wiegt sich selbst, summt sogar leise ein wenig und schämt sich nicht dafür, nicht einmal, als sie ihren Anwalt wieder lässig triumphal sagen hört:Kein Körper, kein Fall.Sie haben keinen Fall hier, Herr Staatsanwalt.
2.
Im Schneckentempo schiebt sie den Einkaufswagen durch die Regalkorridore, sodass der Gerichtsdiener vor ihr trotz seiner tattrigen Langsamkeit bequem beiläufig alles Mögliche aus den Regalen links und rechts in den Wagen schmeißen kann. Auf die Lässigkeit, mit der er scheinbar achtlos, ja wahllos Dinge in den Wagen fallen lässt, ist er sicher sehr stolz. Denn plötzlich fällt ihr ein, auch einmal, ohne es je gewusst zu haben, stolz gewesen zu sein auf diese unbemerkt geglückten Übungen in beiläufigem Leben. Keine große Sache alles. Genau wie sie muss er dieses Bild von sich selbst zwischen den Regalen des Safeway schon tausend Mal gesehen haben, auch wenn er, daraufhin befragt, sich gewiss an keinen einzigen Film erinnern könnte, in dem er auch nur annähernd vorkäme, in dem annähernd er selbst vorkäme. Aber der Spiegel ist doch immer da, kreisrund, always around for you, schräg über unseren Köpfen, auch wenn die Kameras ihn längst überflüssig gemacht haben. Eigentlich bloß noch aus symbolischen Gründen hängt er da, doch als subliminal anreizende Abschreckung verdient er sich sein Gnadenbrot redlich, denn noch immer, und so wird es bleiben, till the end of time, versuchen die Leute, so wie der Gerichtsdiener jetzt gerade, und so wie sie selbst es früher auch getan hat, heimlich ihr eigenes Bild auf diesen Fluren mitgehen zu lassen, auch wenn er, zur Rede gestellt, freilich vorgäbe, nicht zu verstehen, wovon um Himmels willen sie da nur redete. Er würde sich taub stellen und weiter vor dem Wagen herlaufen, traumwandlerisch sicher oder hoffnungslos traumverloren, was ist schon der Unterschied? Beim Einkaufen träumt er immer von einem anderen Leben und doch nur von genau dem, was ist. Immer sorgt er sich, quält ihn etwas anderes, und doch geht es nur um den perfekten Winkel, in dem die Melba-Cracker im Wagen landen. Jedes Mal aufs Neue tauscht er seine Freiheit gegen diesen melancholischen Gang und bekommt sie mit dem Tausch sofort zurückerstattet, seine Melancholie ist ein weites Feld, weiter als die Prärie, und King Size ist nicht etwa eine Entschädigung für den Tausch der Prärie gegen Suburbia, es braucht gar keine Reparationen, wenn man still und stumm gegen sich selbst Krieg führt, nein, King Size ist vielmehr das älteste Stammeswort für die Größe des Königs, für die übermenschliche Würde der Selbsterniedrigung, mit der er im Bettlergewand des Kunden hienieden seiner einsamen Wege geht. Plötzlich dreht er sich zu ihr um und hält ihr ein Glas Mangopüree unter die Nase, auf dem eine Comicmango mit riesigen, weißen Zähnen wie eine deformierte Sonne lacht:
„Mögen Sie das?“
Sie zuckt die Achseln:
„Keine Ahnung. Mir ist alles recht.“
„Ich finde ja“, nachdenklich dreht er das Glas in den Händen, „dieses Zeug sieht aus wie Babyscheiße, und wahrscheinlich schmeckt’s auch so, aber Frauen mögen sowas normalerweise.“
„Na dann“, sie lächelt, „sollt ich’s wohl mögen.“
„Gut.“
Vorsichtig stellt er das Glas in den Wagen und nickt mehrmals bekräftigend, als sei er zufrieden, mit ihr eine gütliche Einigung gefunden zu haben. Nach dem Einkaufen lässt er Mary Lynn den kurzen Weg über den West Hobson Way zurück nachhause, zur Rückseite des Gerichtskomplexes, fahren, wo der Richter gerade die Hauswand und den Asphalt vor seiner Wohnung mit kaltem Wasser aus einem Gartenschlauch abspritzt für ein wenig Abkühlung. Als er sie sieht, dreht er schnell das Wasser ab, schaut sie dabei mit bekümmertem Ausdruck durch die Windschutzscheibe an, und ihr scheint, er hat ein schlechtes Gewissen, da sie ihn bei einer solch sträflichen Verschwendung kostbaren Wassers erwischt haben. Aber das ist es nicht. Als sie aussteigt, verkündet er mit fester Stimme:
„Der Gouverneur hat angerufen.“
Natürlich, irgendwann musste er ja anrufen. Bloß hatte sich nach sieben Tagen im Haus des Richters perfide die Hoffnung in sie hineingeschlichen, die Leute in Sacramento hätten sie vielleicht vergessen in ihrem elenden Wüstenkaff, und sie könnte einfach hierbleiben.
„Sie werden vorerst hierbleiben können.“
„Bei Ihnen, Richter?“
„Nein. Nein“, lahm kopfschüttelnd schiebt er seine Brille auf den Kopf und wischt sich mit dem aufgerollten Hemdsärmel über Stirn und Augen, „nicht bei mir. Aber hier in Blythe. Also fast, nur paar Meilen draußen. Jedenfalls direkt um die Ecke. Walter und ich können Sie besuchen kommen, wenn Sie wollen – nicht wahr, Walter? … Hey, Walt!“
„Wohin, Sir, … werde ich …?“
„Auf die Solarfarm. Herrgott, Walt, wach auf! Immer schläft der alte Trottel in dem verdammten Auto ein, wie ein Baby, kann man mittlerweile froh sein, wenn er nur auf dem Beifahrersitz wegdöst …“
„Solar – was?“
„Bis das Urteil rechtskräftig ist, werden Sie auf den Sonnenfeldern arbeiten.“
„Sonnenfelder? Soll das ein Scherz sein?“
„Glaube ich kaum. Stehen Sie nicht rum, Miss Osmo, lassen Sie uns erst mal die Einkäufe reinholen.“ Er öffnet die Rückladetür, drückt Mary Lynn die erste braune Papiertüte in die Arme, nimmt selbst eine und ruft dabei durch den Wagen nach vorn:
„Wach endlich auf, Walt! Komm schon, steig aus, alter Junge!“
Vom Beifahrersitz kommt noch immer kein Lebenszeichen, und einen zerdehnten, wie in der Sonne auseinandergeflossenen Moment später, in dem er Mary Lynn kurz mit herabhängendem Unterkiefer angestiert und dann die Tüte wie ein rohes Ei zurück auf die Ladefläche gestellt hat, stürzt der Richter mit einem kleinlaut gefluchten Nicht schon wieder, Herrgott! um den Wagen herum. Gemeinsam zerren sie den zusammengesackten Gerichtsdiener aus dem Wagen, lagern ihn im schmalen Schatten des kurzen, mützenschirmartigen Vordachs, schön gerade auf den Rücken, den Kopf weit in den Nacken gelegt, wie ein toter Vogel, der Richter versucht, ihn zu beatmen, geht nichts hinein, kommt nichts zurück, reißt ihm das Hemd auf und presst ihm beide Hände in die Mitte des Brustkorbs, während sie steif danebensteht und mit dem Telefon des Richters, das sie erst nicht richtig zu bedienen weiß, den Krankenwagen ruft. Der Richter findet keinen Rhythmus, sie sieht es genau, tut und sagt aber nichts, bis er keuchend zwischen Beatmung und Herzdruckmassage ruft:
„Drücken Sie weiter. Ich hab nicht genügend Kraft.“
„D-das … kann ich nicht.“
„Los, verdammt!“
„Nein! Ich würd ihn nur umbringen … ich mache schlimme Dinge –“
„Halten Sie die Klappe jetzt, verdammt, und machen Sie schon!“
„Der Arzt muss doch jeden –“
„Es gibt genau zwei Notärzte in ganz Riverside County, bis einer von den beiden Clowns kommt, ist Walt tot, also –“
„Aber wenn ich ihn anfasse, ist er auch –“
„Ich bring Sie um, Mary Lynn!“
Sie kann es ja, die Hände aufeinander, gestreckte Ellbogen, die tiefe Mulde, obwohl da gar keine Mulde ist, der Angstekel vor den immer zu weichen Rippen, splittrig und weich zugleich, so schlecht gemacht, der Mensch, ihr Götter, dabei wär’s nicht so schlimm, wenn sie ihm eine Rippe bräche, passiert oft dabei, wär nicht so schlimm, ist aber auch gar nichts im Weg, gibt alles nach, alles nachgiebig, schneller, fester, ha! ha! ha! ha!, stayin’ alive, stayin’ alive, die 100 bpm halten, nicht nachlassen, abwechselnd drückt sie und beatmet der Richter, es hat keinen Zweck mehr, er versperrt sich, wie wütend sie auch drückt, er will das Leben nicht von ihr zurück, würd ich auch nicht, lässt sich auch nicht mehr vom Richter rufen, aber da, ja, doch, tatsächlich, kommt der Alte zurück, röchelt vorwurfsvoll, atmet, schlägt, ist wieder weg, kommt wieder – bleibt, ha, ha, ha, ha! Ich hab ihn, ich hab ihn, verloren. Sanft schiebt der Notarzt sie beiseite, endlich mit Strom, dem wird er sich nicht widersetzen können, da, na endlich, der Arm fliegt in die Luft, fliegt brav bei jedem Stoß, doch an dem lachhaft selbständigen Hochschwirren des Arms sieht man, dass der Rest der Puppe tot ist, sie setzen ihm weiter zu, machen nur kleine Andachtspausen, wenn die höfliche weibliche Maschinenstimme sagt Wiederbelebung unterbrechen. Wo kommen nur plötzlich all die Leute her? Sie alle wollen das Wunder sehen. Die Polizei drängt sie zurück, es gibt hier nichts zu sehen, dabei kann man etwas doch ganz deutlich sehen und sollte auch jeder das Recht haben, es zu sehen: Es gibt da nichts zu sehen. Wenn einer stirbt, ist da nichts zu sehen, nichts, nicht in dem bläulichweißen Gesicht des Mannes, noch in deinem viehdummen eigenen – doch, doch, plötzlich spricht die leblose Maske zu dir: Wiederbelebung unterbrechen.
Und dann, alleingelassen, denn der Richter ist, entschieden hilflos, mit in den Krankenwagen gestiegen, steht sie dumm vor der Wohnungstür herum und hört die Stimme noch lange, nein, hört sie eigentlich gar nicht, tut nur so, hätte nur gern den fortgesetzten Nachhall des höflichen Befehls in ihrem Kopf, sagt ihn daher stumm sich selbst immer wieder ins Ohr, freilich, um ihn überhaupt hören zu können, nicht mit der eigenen Stimme, sondern mit der der anderen weiblichen Maschine. Jemand hat die in der Sonne glänzende gelb-schwarze Schlange, die zuvor von wahrscheinlich demselben Jemand schlampig um die drei kümmerlichen Palmen vor der Einfahrt gewunden worden war, wieder entfernt, der Ort ist keine Szene mehr, die Leute sind alle verschwunden, Mittagessen oder Siesta halten oder weiterarbeiten oder beklommen am Tisch den Kopf schütteln oder betroffen daherschwätzen, und still ist es wieder, so still, dass man glaubt, das wabernde Lüftchen, das kaum sichtbare Zittern der kurzen, satt auberginefarbenen Schatten der Palmenblätter auf dem hellen Asphalt zu hören.
Später trägt sie die Einkäufe ins Haus, was soll sie auch anderes machen, schmeißt weg, was in der Sonne schlecht geworden ist oder auch nur schlecht geworden sein könnte, also fast alles, obwohl sicherlich nichts außer der Milch schlecht geworden ist, holt also fast alle Dinge wieder aus dem Müll, wirft nur die erneut weg, die im Müll schmutzig geworden sind oder sein könnten, also fast alle, holt die wieder raus, die allenfalls oberflächlich schmutzig geworden sein dürften, die man daher problemlos abspülen oder abputzen kann, also fast alle, die Mülltonne hier ist ohnehin sauberer als die meisten Schlafstätten dieser Welt, und wegwerfen ist schlecht, aufheben gut, aber andererseits ist doch nur wegwerfen gut, alles weg, alles gut. So vergeht die Zeit, und als der Kühlschrank und die Küchenschränke schließlich vollgeräumt sind, ist eine halbe Ewigkeit vergangen, nein, gerade mal eine halbe Stunde.
Sie wünschte, sie hätte ein Telefon wie alle anderen, wozu auch immer, öffnet die klapprige Fliegentür zum Innenhof und hockt sich unschlüssig auf das Holztreppchen, das vom Wohnzimmer in den winzigen Garten des Richters führt. Das Gras des akkurat quadratischen Fleckchens Rasen und die anstelle einer deutlicheren Abgrenzung zum übrigen Hof um es herum gepflanzten hüfthohen, weißen Oleanderbüsche sind vollkommen verbrannt, die haben’s hinter sich, nur der arme Birnbaum vor dem Küchenfenster wird noch einigermaßen regelmäßig gegossen und quält sich entsprechend. Im Bungalowtrakt gegenüber, den das Gericht schon seit vielen Jahren an einen Motelbetreiber verpachtet, sind die sonnengelb-weiß-gestreiften Vorhänge wie immer zugezogen. Keines der vier Zimmer, den Erzählungen des Gerichtsdieners zufolge ursprünglich einmal acht Gefängniszellen, scheint belegt zu sein, jedenfalls hat sie die ganze Woche keinen Menschen da drüben gesehen, und auch abends oder nachts kein Licht hinter den Vorhängen.
Wahrscheinlich sollte sie nicht frei im Hof herumlaufen, sollte das private Territorium des Richters nicht verlassen, ausdrücklich gesagt hat er es jedoch nicht. Und sie kann einfach nicht mehr hier herumsitzen, und vor der Wohnung ist ihr auch auf einmal bang, das weit offen stehende Zimmer des Gerichtsdieners, die nur zur Hälfte zusammengelegte Wäsche auf dem Bett, die neben der Kommode gestapelten Zeitungen, die unerhebliche, doch gerade in ihrer Unerheblichkeit so peinliche Unordnung eines Menschen, der ein starkes Ordnungsbedürfnis hat, es aber nicht mehr recht zu befriedigen vermag.
Die neuen Sandalen knarren unangenehm, schlechtes Leder, immer wieder bleibt sie stehen und lauscht, doch außer dem entfernten Rauschen von der Interstate ist im ganzen Hof nichts zu hören. Etwas kleiner ist er, als es ihr vom Fenster aus schien, vor allem aber viel weniger trist. Dass der Hof vollkommen schmucklos ist, ausgelegt mit billigsten Betonplatten, von denen sich obendrein viele an den Verbundstellen ungut anheben, und man nicht einmal den kleinen, nierenförmigen Motel-Pool mit der üblichen Zierbordüre aus bunten Fliesen umsäumt hat, wodurch dieser von weitem aussieht wie eine bei einem Erdbeben eingestürzte Stelle des Bodens, ist von nahem besehen, wenn man herumlaufen, alles umkreisen kann, gar nicht mehr bedrückend. Die drei neben dem Einsturzloch unheilvoll durchhängenden Holzliegestühle stehen auf einmal beruhigend souverän auf ihrem unsentimental verwitterten Beton, sie wollen nur klarstellen, dass momentan niemand ihre Dienste braucht, da in dem Pool nun mal selbstverständlich kein Wasser ist. Anstelle des Wassers befindet sich dort, als wolle man jederzeit zeigen können, wie ernst man die Notverordnung nimmt, eine Tischtennisplatte. Einen anderen Zweck kann diese Möblierung kaum haben, denn spielen lässt sich in dem Pool sicher nicht, zumindest dem Spieler am engeren Ende der Niere bliebe zwischen Platte und Beckenrand nicht einmal genug Platz, um sich umzudrehen.
„Wollen Sie ’ne Runde spielen?“
Mit einem kleinen Aufschrei fährt Mary Lynn herum, tatsächlich erschrocken, furchtbar, Jesus Christus, denn vor ihr steht, wie ein Geist, weil sie mit so kleinen Menschen nicht mehr rechnen kann, ein etwa zehnjähriges Mädchen und mustert sie mit dem für alles aufgeschlossenen Ernst, mit dem eben nur Geister und Kinder einen ansehen können.
„Jesus, hast du mich –“
„Entschuldigung. Wollt ich nicht.“
„Sicher?“
Das Mädchen legt den Kopf schief, zuckt kurz verlegen mit der Schulter und grinst dann schräg zu Mary Lynn hinauf, die erleichtert zurückgrinst.
„Wo kommst du so plötzlich her?“
„Von da“, das Mädchen zeigt mit langem Arm auf eines der Motel-Fenster, „ich hab hinter dem Vorhang gestanden und Sie beobachtet. Da dacht ich …“
Wieder zuckt sie die eine Achsel. Mary Lynn nickt, als wäre das die selbstverständlichste Erklärung, und fragt gedehnt, unter dem Schirm ihrer Hand zu dem Fenster hinüberblinzelnd:
„Seit wann …? Bist du mit deiner Familie gerade erst angekommen?“
„Ich bin doch kein Gast“, das Mädchen schüttelt unwirsch den Kopf, als wäre das eine überaus dumme und obendrein herabwürdigende Annahme, „ich wohne hier. Mein Vater ist der Manager des Court Inn.“
„Oh …“, was soll sie schon dazu sagen, „das muss aufregend sein. In einem Motel zu wohnen.“
„Naja, wohnen tun wir ja nicht im Motel, sondern vorne im Gerichtstrakt. Da“, sie dreht sich ruckartig in die andere Richtung, und ihre kinnlangen, strohhalmglatten blonden Haare haben Mühe, so schnell hinterherzuschwingen, „die drei Fenster, neben dem Büro des Richters, da wohnen wir. Mein Vater macht ja auch die Gerichtskantine.“ Nach einer kleinen Kunstpause fügt sie stolz hinzu: „Er hat Ihnen auch immer Ihr Essen gekocht.“
„Oh …“, einen Moment glaubt Mary Lynn, sich übergeben zu müssen, „das ist ja … toll.“
„Ja, mein Vater ist der beste Koch von ganz Riverside County.“
„Ich wette, das ist er. Und deine Mutter?“
„Weg, schon ewig“, sie stöhnt, als wäre das einzig Schlimme daran, immer wieder diese Frage beantworten zu müssen.
„Wie heißt du denn eigentlich?“ Mary Lynn lächelt wieder souveräner. „Wer ich bin, scheinst du ja genau zu wissen.“
„Jeder hier kennt Sie. Schon wegen der Postkarten. Früher ist mein Vater sonntagnachmittags manchmal zu Ihrem Prozess gegangen. Aber da war ich noch klein und durfte nicht mit. Und später sagte mein Vater, es lohnt sich nicht mehr, da hinzugehen.“
„Und du bist …?“
„Oh, Verzeihung. Sally.“ Sie streckt ihr höflich die Hand hin. „Sally Cassidy.”
Eher verwirrt als tatsächlich amüsiert auflachend nimmt Mary Lynn die Hand an:
„Sehr erfreut, Sally Cassidy.“
Das Mädchen will Mary Lynns Hand nicht wieder loslassen, sondern schaukelt vergnügt und wohl auch ein bisschen verlegen lächelnd damit hin und her, schaut wieder reichlich schief zu ihr hinauf und fragt schließlich verschwörerisch:
„Kann ich Sie was fragen?“
„Klar.“
„Haben Sie einen umgelegt?“
„Ja. Hab ich.“
Weil Mary Lynn so ernst durch sie hindurchschaut, stutzt Sally erschrocken, hält ihre gerade noch schaukelnde Hand plötzlich still, doch dann steigt langsam ein gurgelndes Lachen aus ihrem Bauch auf, und Mary Lynn lächelt wieder nachsichtig, halb gequält, halb gerührt. Mittlerweile deutlich erschöpft von der Konversation, freut sie sich wehrlos darüber, dass das Kind sich freut.
„Wie genau haben Sie ihn umgelegt?“
„Ich möchte jetzt nicht weiter reden. Ich bin müde, weißt du.“
„Nur noch das, bitte!“
„Ich sagte nein. Ich werde nichts weiter dazu sagen.“
„Soll ich meine Schläger holen?“
„W-was?“
„Na“, Sally zeigt mit dem Kinn auf die Tischtennisplatte, „wollten Sie nicht spielen?“
„Äh, nein, ich glaub lieber nicht, bei der Hitze. Bin auch nicht gerade in Form“, sie macht andeutungsweise einen Schritt rückwärts, „also dann …“
„Was wollen wir dann machen?“
„Also, ich werd mal wieder …“
„Ich könnte Sie herumführen. Ihnen alles noch mal zeigen.“ Einladend lächelnd zieht sie ihre Brauen weit hoch, als wäre sie nicht die Tochter eines Motelbetreibers, sondern eines Autoverkäufers, und ihre ohnehin schon riesigen graublauen Augen werden noch riesiger. „Den Gerichtssaal. Ihre Zelle sogar, sie ist offen jetzt. Wir könnten reingehen?“
„N-nein, danke.“
„Ist Ihnen nicht gut?“ Ängstlich runzelt sie die runde Stirn wie ein junger Hund, nimmt Mary Lynn, die nicht antworten kann, wieder fest bei der Hand und spricht viel leiser weiter. „Ich glaube, Sie sind gar nicht so, wie die Leute sagen.“
„So?“ Schwer atmend macht Mary Lynn sich von ihr los, lässt sich in einen der durchhängenden Liegestühle sacken und kommt dabei mit dem Hintern hart auf dem Boden auf. „Was sagen die Leute denn, wie ich bin?“
„Naja, sie sagen, Sie sind …“, Sally lässt ansatzweise den Zeigefinger neben ihrer Schläfe kreisen, faltet dann aber hektisch die Hände auf dem Rücken, als wolle sie den Zeigefinger verstecken.
„Tja weißt du, wenn die Leute sowas über einen anderen Menschen sagen“, noch immer etwas kurzatmig und mit zitternden Armen versucht sie, sich wieder aus dem Stuhl herauszustemmen, „haben sie damit ja meistens recht. Hilfst du mir hoch, bitte?“
Das Mädchen hilft ihr auf die Beine, nickt ihr verständig zu und sagt dann gestelzt ernst:
„Ich könnte Ihnen vielleicht ganz prinzipiell helfen, Miss Osmo.“
„Vielen Dank“, sie unterdrückt ein Lachen, „aber ich brauche prinzipiell keine Hilfe, oder zumindest keine prinzipielle Hilfe. Doch ich wäre dir ausgesprochen dankbar, wenn du mich kurz rüber zur Wohnung des Richters begleiten könntest.“
Eifrig legt Sally sich Mary Lynns Arm um die Schulter, was vollkommen übertrieben ist, und auf dem Weg sagt sie beruhigend leichthin:
„Mir gefällt Ihr Overall. Er steht Ihnen sehr gut.“
„Danke.“
„Ich mag auch gern weiß.“ Sie umfasst Mary Lynns Taille, legt ihr die weiche Kindertatze zutraulich auf den Hüftknochen, bleibt dann aber abrupt stehen und blickt unter Mary Lynns Schulter geklemmt fröhlich zu ihr hinauf. Sie sieht aus wie eine kleine Handpuppe. „Ich glaube, Sie müssen einfach nur mehr essen, dann wird schon alles wieder gut. Möchten Sie, dass ich meinen Vater hole, dass er Ihnen was kocht?“
„Ganz gewiss nicht.“
3.
Erleichtert, das Kind endlich los zu sein, zieht sie im Bad hektisch den engen Overall, der ihr unter den Achseln klemmt und klebt, und die Unterwäsche gleich mit aus, wäscht beides flink im Waschbecken, unbehaglich nackt darüber gebeugt, den starren Blick des Spiegels meidend, so wie sie seit einer Woche alles, was sie auszieht, sogleich wäscht, um mit den knapp bemessenen Wäschestücken, die ihr die Gerichtsverwalterin am Morgen nach dem Prozessende auf die Wohnzimmercouch des Richters gelegt hat, nicht in einen Engpass zu geraten. Sorgsam wringt sie alles aus, hängt es auf die Wäscheleine über der Badewanne, wäscht dann erst und so sparsam wie möglich sich selbst und zieht schließlich eine von den drei schönen weißen Blusen und ein Paar weiße Shorts an.
Allmählich scheint ihr, der Richter kommt gar nicht mehr wieder. Und was dann? Hätte sie ihm doch bloß, nachdem sie die Ambulanz gerufen hat, sein Telefon nicht zurückgegeben, in der Aufregung hätte er es sicher gar nicht gemerkt. Dann könnte sie jetzt zwar auch nirgendwo anrufen, weil sie es nicht wagte, im Krankenhaus ihren Namen zu nennen und den Richter ausrufen zu lassen, aber sie wüsste: Er würde sie anrufen – sie anrufen müssen, ganz einfach deshalb, weil sie im Besitz seines Telefons wäre.
In der Küche stopft sie im Stehen eine Scheibe Brot in sich hinein, angelt eine Dose mit gefüllten Weinblättern aus dem Schrank, schreckt dann aber doch vor den scharfen Innenkanten solcher Dosen zurück, schon richtig, dass sie einem sowas nicht in die Hand geben, macht sich stattdessen das Glas Mangopüree auf, pfui Teufel, mehr Zucker als Mango, aber vielleicht hilft’s dem Gerichtsdiener. Sie will doch guten Willen zeigen.
Ihr wird schneller schlecht, als sich der Hunger auch nur besänftigen lässt, schon fährt der Löffel zum siebten Mal die zittrige Seilbahn zwischen Mund und Glas hinauf, doch da stürzt der grellorangefarbene Matsch in den makellos weißen Schnee hinab. Die Stirn sinkt langsam in die Hand, die Augen werden gnädig bedeckt gehalten, darunter zuckt der wie zu einem schrecklich falschen Lachen verzerrte Mund, lautloses Vorspiel zu Rotz und Wasser, die nicht kommen wollen, vielleicht endgültig versiegt sind, also fasst sie sich tief einatmend wieder, und die Bluse wird nur flüchtig mit Küchenkrepp abgewischt. Wen kümmert’s, den Fleck kriegt sie sowieso im Leben nicht mehr raus.
Abgeschlossen ist das Zimmer des Richters nicht, was doch von Vertrauen zeugt, und sie schnüffelt ja auch nicht, will nur einmal einen Blick hineinwerfen. Das Zimmer ist gar kein richtiges Zimmer, sondern nur eine Kammer. Karg und licht, ein einfaches Bild: Links ein Bett, rechts ein Schreibtisch, und sauber in der Mitte ein breiter beiger Pinselstrich von einem alten, dicken Kokosläufer, auf dem man gefahrlos von der Schwelle hinübersetzen kann an ein schönes großes, blassblau lackiertes Holzfenster. Dort angelangt schaut sie jedoch kaum nach draußen, sondern dreht sich gleich wieder um, lehnt den Rücken zaghaft ans Fensterkreuz und blickt zurück, und mit ihr hat sich das Bild gedreht, gewendet wie ein Schicksal, ist gar kein Bild mehr, sondern ein kleine Welt. Auf einmal steht nun rechter Hand das schmale Bett, frisch und ordentlich bezogen, bescheiden flankiert von einem Nachtschränkchen, von dem das schwarze Plastikfurnier an allen Ecken und Kanten abplatzt, sodass man automatisch zerstreut mit der Hand darüber fährt, und links ist jetzt der winzige Birkenschreibtisch, an dem sitzend man die Augen an der leeren Wand ausruhen lassen könnte, dahinter in der Ecke, dem Eintretenden von der Tür verdeckt, steht eine kleine Kommode, und in trauter Einsamkeit man selbst.
Den spärlich versilberten Fotorahmen von der Kommode zu nehmen wagt sie nicht, beugt sich mit zusammengekniffenen Augen darüber, um die fast verblichene Schwarz-Weiß-Fotographie darin zu betrachten. Drei junge Männer in Farmer-Latzhosen, zwei Schwarze und ein Weißer, mit offenen Mündern breit lächelnd, sind um ein dickes rundes Auto herum gruppiert, der Weiße hat ihm den Fuß aufs Trittbrett gestellt wie auf ein erlegtes Tier, zur überflüssigen Bekräftigung der Geste stemmt er die Faust auf den Oberschenkel des aufgestellten Beins. Die beiden anderen, ordentlich links und rechts des Autos und seines Bezwingers hingestellt, haben die Mützen abgenommen, halten sie in den gefalteten Händen vor der Brust, wie in ritueller Ehrfurcht vor dem erlegten Wagen, was zu ihrem fröhlichen Lächeln so wenig passen will, dass es scheint, als habe man die heiteren Köpfe nur aufgeklebt auf diese andächtigen Körper.
Schwindelnd richtet sie sich wieder auf, ihr Blick torkelt lahm und hektisch zugleich, einer halb betäubten Fliege gleich, einmal im Kreis die Wände entlang – nein, keine weiteren Bilder. Und auch sonst nichts, nur über dem Kopfteil des Bettes ist, unpraktisch hoch an die Wand geschraubt, eine billige Hotelleselampe, sie ähnelt einem Hundeknochen, ein waagrecht angebrachtes, gilbweißes Stück Plastikrohr, aus dem rechts und links unumwunden zwei mattweiße Glühbirnen herausragen. Über dem Bett sieht die Lampe aus wie die Karikatur eines Stammeskopfschmucks. Keine persönlichen Gegenstände, keine Bücher. Auf dem Schreibtisch nur das übliche elektronische Gerät. Auch auf dem Nachtschränkchen liegt nichts, sie zieht die Schublade auf, findet ein Buch darin. Natürlich, nur ein einziges Buch, wie sich’s gehört für einen anständigen Menschen. Doch der kleine, in dunkelgrünes Leinen gebundene Band ist viel zu schlank für das Buch der Bücher, vielleicht nur seine umgänglichere Hälfte. Nein, ein Gedichtband, scheint’s. Zerstreut blättert sie durch die dünnen, glatten, elfenbeinweißen Seiten, im Vorüberfliegen fällt hier und da raschelnd ein Wort, deutsche Worte, ja tatsächlich, es ist Deutsch. Jetzt erst schlägt sie das Buch ordentlich vorn auf. Auf dem Vorsatzblatt steht in nüchternen Lettern der Name Franz Maria Bögl und darunter, etwas größer, schwungvoller das Wort Ahorun. Mit leichtem Unbehagen legt sie das Buch wieder zurück, versucht sich zu erinnern, auf welcher Seite der Schublade, wo genau, ganz genau das Buch gelegen hat, es will ihr nicht einfallen, weil sie gar nicht darauf geachtet hat, bevor sie es herausgenommen hat. Wie dumm. Was für ein Anfängerfehler!
„Lassen Sie nur. Ich wollte es Ihnen sowieso schenken.“
„Mir? Wieso?“, kommt es belämmert aus ihr heraus. Der Kopf wackelt ihr ein wenig wie der einer schlechtgeführten Marionette, als sie sich ungelenk zu ihm umdreht, doch sie ist viel zu erleichtert, dass er wieder da ist, um erschrocken oder auch nur peinlich berührt zu sein.
„Nun, es ist auf Deutsch. Ich kann es nicht lesen. Und Sie sind schließlich Deutsche, oder nicht?“
„N-nicht direkt, nein …“
„Ja Gott, aber indirekt. Sie verstehen es noch, Deutsch, meine ich, oder nicht?“
„Ein wenig“, behutsam legt sie das Büchlein auf dem Nachtschränkchen ab, als fürchte sie, es könne aufwachen und zu schreien anfangen, „wirklich nur ein –“
„Naja, reicht doch. Manchmal versteht man sogar mehr, wenn man nur wenig versteht. Ist man mitunter schneller im Bilde. Also nehmen Sie’s schon, Herrgott! Und kommen Sie endlich da raus!“
Gegen klare Befehle lässt sich nichts einwenden, das unliebsame Buch, die ungewollte Sprache wird umstandslos adoptiert, auf der Stelle ins verdrehte Herz geschlossen, mit beiden Händen an die Brust gedrückt, und dann, aber ganz schnell!, in zwei großen Sätzen zurück auf die Schwelle gesprungen. Demonstrativ die Brauen runzelnd macht der Richter seine Kammer wieder zu, zieht überflüssigerweise ein paarmal an der Klinke, bis Mary Lynn ein ordnungsgemäß verschämtes Räuspern herausbringt:
„Es tut mir leid, ich … wollte eigentlich gar nicht schnüffeln.“
„Wollen wir nie.“
„Nein wirklich, ich –“
„Beruhigen Sie sich, ich glaub Ihnen doch! Wir wollen das eigentlich gar nicht. Denn wenn einer nicht da ist, und wir schauen uns heimlich in seinem Zimmer um, ist es, als wäre er tot. In dem Moment, wo ich mir seine Sachen anschaue, ist er tot. Ein ausspioniertes Zimmer verwandelt sich immer in das Zimmer eines Toten. Und das Zimmer eines Toten …“
Er bricht ab, lässt den Kopf hängen und seine Schultern zucken.
„Ist Walter …? Hat er es …?“
„Nein“, langsam schüttelt er den noch immer tief herabhängenden Kopf und seine Stimme kippelt zwischen ihren Lagen, „er hat es nicht geschafft. Ich hab es nicht geschafft.“
Bevor sie etwas dummes Tröstendes sagen kann, fasst er sich:
„Kommen Sie, legen Sie das Buch auf die Couch rüber, und dann fahren wir ein Stück, wir müssen ohnehin was essen.“
Es ist schon spät am Nachmittag, die letzte Glut des Tages hat sich an die Hauswand zurückgezogen, lehnt dort mit geschlossenen Augen, in stiller Erwartung der kühlen Schattenzungen auf dem Asphalt, die bald auch sie sanft zudecken werden.
Der alte Chevrolet Kombi mit all sein Beulen und immer wieder flüchtig überpinselten Roststellen sieht noch erbärmlicher aus als sonst, wahrscheinlich nur, weil er seit heute Vormittag, seit es passiert ist, unbewegt schief in der Auffahrt herumsteht und man ihm daher lächerlicherweise einen leichten Schock unterstellt. Um irgendetwas Aufheiterndes von sich zu geben, fragt Mary Lynn:
„Was soll eigentlich dieser uralte Chevy? Finden Sie nicht, es sieht reichlich kokett aus, wenn der Bezirksrichter in so einer Schrottkarre durch die Gegend fährt?“
„Das County ist bankrott, und das sollen die Leute auch sehen. Daran muss man sie unermüdlich erinnern. Irgendjemand muss es ja tun.“ Indigniert zuckt er mit der Nasenspitze, wirft ihr dann mürrisch die Autoschlüssel zu. „Mal abgesehen davon fahren jetzt Sie und nicht ich die Schrottkarre durch die Gegend. Und außerdem ist das keine Schrottkarre, sondern ein 1980er Malibu, von dem nur noch ein paar wenige Exemplare auf unserem Planeten kreuchen, ein echter Oldtimer also.“
Ächzend arbeitet er sich auf der Beifahrerseite in den Wagen hinein, sie dreht widerwillig den Anlasser, will den Richter nicht neben sich haben, nicht da auf dem Beifahrersitz, lässt den Wagen vom Hof rollen und murmelt in den Rückspiegel blickend:
„Ich dachte immer, ein Oldtimer sei ein altes Schmuckstück von Auto, das von irgendjemandem hingebungsvoll gepflegt wird.“
„Falsch. Um einen echten Oldtimer kümmert sich kein Schwein, er macht schön unauffällig seine Wege, bis er irgendwann ebenso unauffällig am Straßenrand verreckt.“
„Meinetwegen.“ Sie zuckt trotzig die Achseln über den auf ihrem Weg zum Lenkrad etwas zu lässig durchhängenden Armen. „Jeder, der verreckt, tut eine gute Sache. Das wissen Sie ja.“
„Ja, na klar.“ Er schraubt ihr mühsam seinen ganzen Oberkörper zu und lächelt plötzlich wieder gütig. „Ich glaub Ihnen kein Wort. Das wissen Sie ja.“
„Was auch immer.“ Sie kann noch so diszipliniert geradeaus auf die Straße starren, dank ihres hochauflösenden Gesichtsfelds sieht sie dieses schrecklich gütige Lächeln dennoch klar und deutlich. „Wo geht’s lang?“
„Fahren Sie, fahren Sie. Ich sag dann schon.“
„Einfach geradeaus?“
„Ja. Hier, hier rein, links in die 11th Avenue.“
„Hier?“
„Mm-hm. Nein, nein, die nächste.“
Er scheint kein Ziel zu haben, lässt sie am Ende der 11th wieder wenden, im Zickzack bis zur 3rd runterkurven, ein Stück durch die kernlose Mitte über den Lovekin Boulevard, wo die hohen Palmen links und rechts der Straße sich im Wind wiegen, gezwungen heitere Winks geben, dass es hier unmöglich trist sein kann, vorbei an Tankstellen, Fastfood-Restaurants, billigen Cafés und zwischen all den Läden und Parkplätzen viel ödem, weil nie gänzlich leerem Raum, immer mit irgendeinem Zeug möbliert, das sich nicht entscheiden kann, ob es nun Müll sein will, und als solcher nur mal kurz hier abgestellt, oder, schlimmer noch, mit geschmacklosestem Bedacht genau hier hingestellter, vollkommen sinnloser Gebrauchsgegenstand.
Durch diesen Ort fahren alle nur hindurch, tanken nur schnell auf dem Weg nach Tucson oder schlafen nur schnell auf dem Weg zurück nach San Diego, niemand bleibt, außer denen natürlich, die in den Fastfood-Läden und Cafés und Motels und Tankstellen arbeiten und dafür ihre Kinder aufs College schicken, ja, da war grad das Schild, Palo Verde College, dafür, dass auch diese irgendwann in einem der Fastfood-Läden arbeiten, stolz darauf, dass seit Ewigkeiten alle nur hier durchfahren, während sie aber bleiben, seit Generationen schon. Weil aber freilich immer weniger Menschen hier durchfahren, fahren auch schon seit Generationen immer mehr Kinder direkt nach dem College, besser direkt nach der Highschool nur noch ein letztes Mal hier durch, schnell noch mal tanken, ich komm ja bald wieder, Papa, ja, ich versprech’s, Mama, und dann so schnell wie möglich weg von hier, nach L.A. oder San Francisco, besser noch ganz weg, nach New York, meinetwegen auch bloß Chicago, meinetwegen auch mitten im Winter, scheiß auf die ewige Sonne, hat mir nie was Gutes getan, sowieso, was hilft mir die Sonne ohne das Meer?
Überall grellstumpfe, körperlose Farben, dazwischen viel roher Beton, Einstöckiges von äußerster architektonischer Unklarheit – ein Anfang, ein Anbau, ein Absatz auf der Treppe in den Himmel? Ist das Geld ausgegangen oder die Ehefrau Zigaretten holen, oder sind das alles kleine skulpturale Lektionen in wahrem Buddhismus? Oder in kubanischer Improvisationskunst, denn wo die Sonne immer scheint, kann es nicht ganz hässlich werden. Wird schon gut ausgehen. Am Ende. Deinem oder meinem? Aber für diesen Schluss fehlt hier dann doch das tropisch dunstige Licht, das alles mild und fett und golden erscheinen lassen könnte statt hart und trocken wie hier. Wie von der Trockenheit ausgewaschen, ja, nicht verblichen, sondern klarerweise ausgewaschen.
Weiter und weiter dirigiert er sie durch die kleine Stadt und über ihre Ränder hinaus und dann gleich wieder hinein, der Chevy webt ein irres Muster in die Stadt, nein, stopft sie eher schlampig zu, das arme löchrige Ding, und doch scheint ihr, diese für sie bloß quälend ziellose Fahrt gehorche einer kunstvollen Partitur in seinem Kopf, fast hört sie die Melodie, ja, hier noch mal rechts, ja, ja, hier, das singt sich beinahe. Nun lässt er sie durch ein paar breite Wohnstraßen fahren, wieder Einstöckiges, aber diesmal in saturierterer Formlosigkeit, man muss sie wohl Bungalows nennen, mit Gärten für den Gärtner, und am Ende der Straße dann der Weg ins fast Offene – ein unbestelltes Feld, ein bisschen Grün, ein bisschen Erde, ein bisschen Leben, der totale Tod. Warum haben sie mich nicht drin bleiben lassen? Riverside Avenue, ja, fahren Sie hier links, ja, ja, die Kehle schnürt sich ihr zu, panisch kurbelt sie das Fenster runter, kurbelt es sofort wieder hoch, der Wind, der Sand, die Augen tränen ihr hinter den dunklen Gläsern ihrer Sonnenbrille, in dieser Welt kann ich mich nicht bewegen und in der andern auch nicht, aber die Menschen hier, was hält sie, was hat sie nur hierher …?
Als könne der Richter ihre Gedanken lesen, stöhnt er plötzlich laut auf und singt dann getragen, fast klagend und doch hintergründig jubilierend die alte deutsche Liedzeile: