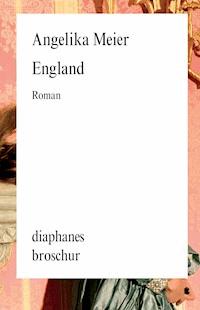19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
In ortloser Höhe thront eine gläserne Klinik über den Angelegenheiten der Normalsterblichen. Dr. Franz von Stern, der als Arzt selbstverständlich mit einer zusätzlichen Hirnrindenschicht und einem Mediator zwischen den Rippen ausgestattet ist, versagt als Referent in eigener Sache: Unfähig, den geforderten Eigenbericht für seine Klinikleitung zu verfassen, erzählt er sich zurück in seine Vergangenheit. Eine »Ambulante« erscheint ihm als Wiedergängerin seiner Frau, und im vermeintlichen Wahngerede seiner Patienten sucht er nach dem Echo der eigenen Geschichte. Irrealer als die Gegenwart, dieses taghelle Delirium, kann das Erinnerte nicht sein, und so macht von Stern sich auf, seine verglaste Welt zu verlassen.
Angelika Meiers Roman spielt in einer Welt, in der »mangelnde Gesundheitseinsicht« ein tödlicher Befund ist: eine fröhlich-düstere Elegie auf uns fast vergangene Gegenwartsmenschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Ähnliche
Angelika Meier
Heimlich, heimlich
mich vergiss
Roman
diaphanes
I’ve come to hate my body and all that it requires in this world I’d like to know completely what others so discreetly talk about
Velvet Underground, Candy Says
Alles schweigt; nur das Schwarze Meer rauscht …
Puschkin, Fragmente aus Onegins Reise
1.
Patient schreit unablässig. Dennoch muss ich ihn für eine Weile sich selbst überlassen und gebe ihm bloß die Flasche mit dem Opium-Rhabarbersaft, in der Hoffnung, ihn so für ein paar Minuten ruhigzustellen. Opium und Rhabarber, das ist alles, was ich momentan für Sie tun kann. Er saugt gierig am Gumminuckel der Flasche, während er mich vorwurfsvoll durch die Fenstergläser seiner Brille anstarrt, und mir fällt auf, dass ein weiteres Regiment seiner Haare die gestrige Spezialbehandlung für einen Rückzug hinter die feindliche Stirnlinie genutzt hat. Ich nicke dem Patienten verständnisvoll oder eigentlich eher um Verständnis bittend zu – ich weiß, dass ich als sein Arzt und Referent die Pflicht habe, mich fortwährend um ihn und seine Schreierei zu kümmern. Aber schließlich ist er nur ein Patient von vielen, und vor allem ist es ebenso meine Pflicht, als Referent in eigener Sache den Bericht über mich selbst vorschriftsmäßig bis Ende des Jahres der Klinikleitung einzureichen. Ich drehe dem Patienten also den Rücken zu, und erwartungsgemäß beginnt er wieder zu schreien. Er beginnt zu schreien und ich beginne zu schreiben.
Kaum dass ich der Tastatur auch nur die drei Buchstaben des Wortes Ich übergeben kann, muss ich bereits wieder unterbrechen. Schreierei des Patienten nimmt unmenschlichen oder eher übermenschlichen Ausdruck an. Seufzend erhebe ich mich von meinem Schreibtisch und gehe zurück an sein Bett. Seine Flasche ist leer, weshalb er sie wütend gegen die Wand geworfen hat, was ihn sichtlich noch wütender gemacht hat, weil die Plastikflasche im Gegensatz zu ihm einfach nicht kaputtgehen will, und während ich mich, abermals und diesmal bösartigerweise wie eine der Schwestern demonstrativ lang-, länger-, allerlängstmütig seufzend, nach der Flasche bücke, achte ich reflexartig darauf, ihm weder Rücken noch Hinterkopf für einen seiner Faustschläge oder Fußtritte anzubieten. Ich gehe pfeifend in den Flur, um die Flasche an einem der Zapfhähne aufzufüllen, er beobachtet mich durch die Glaswand, wird dabei ruhiger, seine Schreierei mündet in einen hellen, wortlosen Singsang, der schließlich ausrollt in der leisen Brandung seines üblichen verwunderten Gemurmels der Worte Pamplona! Pamplona!
Diesmal endlich nimmt er die Flasche mit einem höflichen Nicken entgegen, wackelt leicht mit dem Kopf, als er sie wie eine Jazzklarinette vor seinem Gesicht aufragend an die Lippen setzt und das Mundstück des Gumminuckels mit den Zähnen prüft, dann schließt er genüsslich trinkend die Augen. Ich setze mich wieder an den kleinen Schreibtisch in der Ecke seines Zimmers, und solange er trinkt, beobachte ich ihn über den Rand meines Bildschirms hinweg, mein Kinn gestützt auf die beiden Daumen der über den aufgestellten Ellbogen gefalteten Hände, die wie in einem verzweifelten oder wohl eher frömmlerischen Gebet Mund und Nase bedecken. Die Augen darüber werden langsam glasig, während sie die wiegende Bewegung des Patienten taxieren.
Jetzt müsste ich schreiben, wenigstens noch schnell einen ersten Satz, denn er wird gleich zu sich kommen und zu sprechen beginnen. Ich kann zusehen, wie sich die idiotische Entstellung seiner Züge wieder einmal mit erstaunlicher Schnelligkeit auflöst, ein Naturschauspiel wie in einer meteorologischen Animation, der Geist kehrt schrittweise in sein Gesicht zurück, und so schiebe ich meinen Eigenbericht wieder auf.
»Sagen Sie, Herr Doktor, habe ich Ihnen eigentlich schon einmal gesagt, dass Sie eine alte ausgelaufene Rotweinflasche sind?«
»Sie haben es das ein oder andere Mal erwähnt, Herr Professor.«
»Hm ja, mir war auch so. Nun ja, man kann es nicht oft genug sagen. Wo waren wir gestern stehengeblieben?«
»Sie haben versucht, mir Ihre Vorstellung von der Astrologie als eines auf die Zukunft projizierten Namensfetischismus darzulegen.«
»Ah ja, richtig. Schreiben Sie mit?«
»Ja natürlich«, ich wechsele schnell die Datei. »Fahren Sie fort. Ich bin ganz Ohr.«
»Ach, Sie verstehen es ohnehin nicht, ihr Ärzte versteht nie etwas von den wesentlichen Dingen des Lebens!«
»Mag sein, aber seien Sie unbesorgt, zum bloßen Aufschreiben wird mein Verständnis schon ausreichen.«
»Na gut, dann schreiben Sie. Böser Doktor, verschlagenes Aas, elender Hurensohn, Satanssonde! Liebes Buch, liebes gutes Papier!«
»Soll ich das …?«
»Nein, natürlich nicht, ich denke noch nach. Früher schien es mir so, als ob die Ambivalenz der Sternbilder je nach der inneren Kultur der Zeit entweder zu Magie, also einer monströsen kultischen Ekstase, geführt hat, oder aber zu einer mathematisch-kontemplativen Diastase, also zu Entformung, Kosmologie. Ja, genau so hat er’s … hab ich’s gesagt. Haben Sie das?«
»Ja, ja.«
»Entweder Magie, also der Glaube, die Zeichen der Zeit lesen zu können, die Namen beim Wort nehmen, über die Gestaltlosigkeit der Welt triumphieren, mit den kleinen verschmierten Händen am Heiligen herumtappen, oder aber entrückende Durchsicht, Distanz, Abstraktion. Haben Sie das?«
»Ja, ja.«
»Verstehen Sie es auch?«
»Hm … so ungefähr, kommt drauf an, wie’s weitergeht.«
»Ja, darauf kommt es euch immer an, immer wissen wollen, wie’s weitergeht, ihr Rattensäue von Ärzten!« Mit seiner von der Schreierei kaputten Stimme lacht er sein kratziges Spottlachen. »Prognose durchaus günstig – Prognose durchaus ungünstig! Je nachdem, wie der Herr Doktor gerade scheißt oder fickt, aber immer wissen wollen, wie’s weitergeht! Aber damit ist jetzt Schluss! Darauf kommt es heute nicht mehr an! Nie mehr!«
»Sie beruhigen sich jetzt, Professor, oder ich stecke Sie wieder ins Bett – ohne Rhabarberopium!«
Patient verfällt in Schimpfparoxysmus, brüllt die üblichen gemeinsten Obszönitäten, lässt sich aber durch Androhung von fünftägiger Bettruhe und Vorzeigen der Schlafmittelsonde schnell beruhigen, entschuldigt sich, gibt zu, dass seine Raserei halbe Pose war, und räumt ein, dass der Tag nicht recht geeignet ist für die Fortführung seiner wissenschaftlichen Arbeit. Danach bis zum Abend durchgängig gut, nett und rücksichtsvoll, darf Referenten zum Abendessen auf die große Terrasse begleiten.
Da Patient trotz von ihm selbst eingeräumten besseren Wissens in durchgängiger Zwangsvorstellung gefangen, dass in das Essen die moussierten Leichen seiner von der Klinikleitung ermordeten Familienmitglieder gemischt werden, bekommt er neuerdings Vor-, Haupt- und Nachspeise doppelt serviert, sodass er von dem jeweils einen Teller relativ angstfrei essen kann, solange der zweite Teller unberührt danebensteht und Patient sich durch diese List versichern kann, seine Liebsten nicht verspeist zu haben.
Nach dem Essen überaus zufrieden und still, nickt mit schräg in die Hand gestütztem Kopf im Takt der leise herüberwehenden Musik, lächelt dankbar in Richtung der Musiker. Unwillkürlich ahme ich ihn nach. Es ist ein unwirklich schöner Maienabend, die Luft ist die leichteste des Jahres, sonnengewärmt und doch frisch, und Fliederduft umhüllt das ganze Haus. Noch immer etwas flach einatmend, lasse ich meinen tagesstieren Blick von der Leine, er lässt sich ins Gras fallen und rollt dann auf der sanften Kaskade der sattgrünen Wiesen hinab ins Tal, wo ich ihn wegen der einsetzenden Dunkelheit aus den Augen verliere. Nun endlich ergreift von meinen Augen ausgehend ein köstliches schwarzes Nichts meinen gesamten Kopf, weshalb ich das Gemurmel des Patienten lange für ein unsichtbares Bächlein halte, bis sich mit seinem lauter werdenden Gerede auch die Leinwand vor mir wieder mit der Abendlandschaft füllt.
»Konsequent, konsequent – inkonsequent, inkonsequent! So hat er’s gesagt! So und nicht anders! Pamplona, Pamplona!«
»Ja, Herr Professor.«
»Herr Doktor, Sie sind ein schlimmer Sünder, wissen Sie das überhaupt?«
»Ja, Herr Professor.«
»Im Ernst, wollen Sie nicht mir all Ihre Sünden gestehen?«
»Ich bin nicht katholisch, Professor, ich glaube nicht an die Beichte.«
»Was soll dann aber aus Ihnen werden?«
»Das steht in den Sternen.«
»Tatsächlich? Ich dachte nicht, dass dort … um Gottes willen, kommen Sie!« Er springt auf, die Patienten und Ärzte an den Nebentischen sehen mürrisch zu uns herüber, weil er das Streichquartett nun entschieden stört. »Wenn es dort oben noch immer etwas zu lesen gibt – wir müssen das aufzeichnen gehen, kommen Sie, kommen Sie, um Himmels willen!«
»Schschsch, gut, gut, gut«, ich ziehe ihn am Arm wieder herab auf seinen Stuhl, sehe ihn begütigend oder vielleicht eher drohend an. »Ich habe nur gescherzt, verzeihen Sie, das war dumm von mir, ich hätte wissen müssen, dass Sie das aufregen würde. Seien Sie unbesorgt, dort oben steht nichts.«
»Aber … aber …«, er nimmt verwirrt seine Brille ab und putzt sie so kräftig mit dem über die Kante herabhängenden Tischtuch, dass ich fürchte, das Fensterglas könnte jeden Moment zerbersten. »Wenn das so ist … was wird dann aus Ihnen?«
Ich zucke die Achseln:
»Das entscheidet die Klinikleitung. Sobald sie meinen Bericht bekommt.«
»Ach, Gott sei Dank!« Er atmet auf und setzt sich dann auch die Brille wieder auf. »Dann hat ja alles seine Ordnung!«
»Kommen Sie, Professor, es ist schon spät, ich bringe Sie zu Bett.«
»Ach nein, bitte noch nicht! Es ist doch noch früh, kommen Sie, wir wollen uns noch ein wenig ins Gras setzen.«
»Na schön, aber nur kurz, ja? Und dann werden Sie ohne Theater ins Bett gehen, verstanden?«
»Jaja, ohne Theater, immer ohne Theater …«
Er bahnt sich mit herabhängendem Kopf einen unsinnig geschlängelten Weg über die dunkle Holzbohlenterrasse, umrundet manchen Tisch zweimal, während ich geduldig am Rand der Terrasse auf ihn warte und ihn dann dort wie üblich an die Hand nehme, weil er den einen ersten Schritt von der Terrasse auf die Wiese hinunter nicht allein machen will. Sobald das geschafft ist, nimmt er Haltung an, die Hände in den Hosentaschen schlendert er mit weltmännisch zurückgebogenem Oberkörper und federnden Knien ein kleines Stück die steile Wiese hinab und lässt sich schließlich zufrieden stöhnend auf seinen Hosenboden nieder. So sitzen wir ein Weilchen schweigend nebeneinander im Gras, die Arme locker um die weitgeöffneten Knie gelegt, beide in dem gleichen hausüblichen Abendanzug, nur dass meiner deutlich besser sitzt, weil ich zwanzig Jahre jünger als er und auch sonst alles bin, was man sein muss, um einen Anzug anständig sitzen zu lassen, was von Vorteil ist, weil die meisten Menschen diese Eigenschaft noch immer mit einer schier unbegrenzten Menge von Kompetenzen und einem positiven Charakterbild verwechseln.
»Werden Sie mich in Ihrem Eigenbericht erwähnen, Herr Doktor?«
»Nein, warum sollte ich? Ich habe nur über mich selbst Rechenschaft abzulegen.«
»Oh, könnten Sie das noch mal sagen, bitte?«
Ich tue ihm den Gefallen, was ihn sichtlich beruhigt. Er nickt ein paarmal langsam und kräftig, um sich mit dieser Bewegung das Gehörte in sein limbisches System zu füllen, von wo aus es mit Hunderten von Schläuchen zur Löschung seiner Schwelängste in seinen ganzen Körper weitergeleitet wird. Während er das Löschwasser rinnen lässt, macht er kleine Zischgeräusche und grinst mich dabei doppeldeutig an. Er schämt sich seiner Obsession für seinen symbolischen Körper und ist zugleich mächtig stolz auf diesen Bilderwahn. Höchste Zeit, dieses abendliche Ritual abzubrechen:
»Na, nun ist gut, jetzt halten Sie Ihr Wasser, Professor!«
Aber da ist es schon geschehen, ich sehe es an seinem plötzlich gequälten Gesichtsausdruck, und zugleich sehe ich die fluchende Schwester vor mir, die ihm vor dem Zubettgehen wieder die vollgepinkelten Hosen wird ausziehen müssen. Ich klopfe ihm tröstend oder eher hinterhältig auf den Oberarm, um ihn an demselben sogleich hochzuziehen, aber er macht sich schwer und fängt an zu jammern:
»Ach nein, bitte bitte, noch nicht ins Bett! Bitte bitte, noch nicht!«
»Schluss jetzt, hoch mit …«
»Werden Sie in Ihrem Bericht um Vergebung bitten?«
»Schluss, verdammt noch …«
»Nein, bitte, nur diese eine Frage beantworten! Werden Sie?«
Stöhnend lasse ich ihn los und mich selbst zurück ins Gras sinken. Das Tal ist vollkommen in der Dunkelheit verschwunden, aber der Fliederduft ist bei uns geblieben und sinkt diskret neben uns in die nun nicht mehr nur für den Patienten feuchte Wiese.
»Nein, ich denke nicht. Das wäre unanständig, scheint mir.«
Patient nickt verständnisvoll, seine geistigen Kräfte sind plötzlich alle, wie immer, wenn er mit unfehlbarem Instinkt wittert, dass es auf seine Autorität ankommen könnte, loyal um ihn herum versammelt. Blick und Stimme sind vollkommen klar, nur von einem souverän dosierten Hauch Wehmut durchzogen:
»Ja, das würde ich auch so sehen. Mal abgesehen davon, dass es sinnlos ist, ist es wohl tatsächlich auch unanständig oder zumindest unfein, die Sache so offen auszusprechen. Sehen Sie, ein kluger junger Kollege von mir hat einmal gesagt: Man bittet stets um Vergebung, wenn man schreibt. Wozu also noch drauf rumreiten, wie?«
»Tja, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, Herr Professor, aber in jedem Fall ist es wohl unfein. Kann ich Sie dann jetzt endlich ins Bett bringen?«
»Ja natürlich, worauf warten wir noch? Ich bin schrecklich müde – ich weiß gar nicht, ob ich den Weg noch schaffe. Helfen Sie mir doch! Warum helfen Sie mir denn nicht, Sie elender Hurensohn! Satanssonde, verfluchte!«
»Ja, Herr Professor. Und hoch!«
Der Weg ins Bett ist immer der beschwerlichste. Wie ein Säufer hängt Patient an Referent, sodass seine Schlaftrunkenheit mich den ansteigenden Weg zurück nur torkelnd bewältigen lässt. Die kleinen Abendgesellschaften haben ihre Tische vorschriftsgemäß verlassen, nur eine notorisch nachzüglerische junge Patientin in einem weißen asiatischen Seidenkleid schlittert spielerisch ungeschickt, eine Hand in den Nacken ihres Arztes gelegt, der ihre Taille umfasst, über die stumpfen Terrassenbohlen in den gläsernen Bungalow der Klinik zurück. Sie kichern beide leise, bis der Arzt, mein werter Kollege Dr. Dänemark, an der großen Schiebetür angelangt, ihren Arm von seiner Schulter entfernt, mit strenger Miene das Ende des Unsinns anmahnt und die brav oder wohl eher spöttisch nickende junge Frau am Ellbogen gefasst ins Haus bringt, das jetzt in der wunderlich geräuscharm vor sich gehenden Besorgung der Nachtvorkehrungen hell erleuchtet wie ein Lichtquader in der fliederduftigen Dunkelheit schwebt.
2.
Stunden später, ich habe außer dem Professor zwei überaus fordernde Patientinnen versorgt, sitze ich auf einem der mitternächtlich verwaisten Flure endlich wieder vor meinem leeren Bildschirm, lausche geistesabwesend oder eher ablenkungssüchtig auf die gedämpften Nachtansagen, die über die zentrale Sprechanlage aus meinem Rechner rieseln, Dr. Holm in den Sprechsaal, bitte, Dr. Holm bitte in den Sprechsaal! Dr. Engelein, bitte zum GV, Dr. Engelein zum GV, bitte!, und versuche dabei, das eine richtige Wort zu finden, den richtigen Ton, und finde ihn natürlich nicht, weil ich ihn zu sehr und also eigentlich auch gar nicht suche. Ich weiß mir nicht mehr anders zu helfen, als, mag dies auch meine Eitelkeit kränken, auf die hausübliche Berichtseingangsformel zurückzugreifen, und mit einem resignierten Seufzen schreibe ich:
Ich erkläre hiermit, dass ich mir vollkommen im Klaren darüber bin, dass die medizinische Arbeit am Menschen, ähnlich wie die Architektur, eigentlich mehr eine Arbeit an einem selbst ist. Ich bitte Sie daher hiermit, in genauester Ansehung meiner Person darüber zu urteilen, inwieweit ich bisher dieser Arbeit habe gerecht werden können. Denn Ihnen allein bin ich offenbar, wie auch immer ich sein mag, Sie allein, als mein ärztliches Innerstes, vermögen mich zu lesen, und so unterbreite ich meinen Bericht Ihrem Angesicht zur Kenntnisnahme, schweigend und auch nicht schweigend: Es schweigt der Mund, es schreit das Herz.
»Jaja, die vorgegebenen Worte gehen einem leichter in die Tastatur als die eigenen, wie?«
Erschrocken zucke ich zusammen, ich habe Dr. Dänemark nicht kommen hören, er steht gebeugt hinter mir und schaut mit süffisantem Lächeln über meine Schulter auf den Bildschirm. Seine Wange ist so nah an meiner, dass ich sein überfeines Rasierwasser riechen kann, ich atme stockend ein, und er nickt ein paarmal schläfrig lächelnd, bevor er sich schwungvoll wieder aufrichtet und mir schulterklopfend, schon halb im Weitergehen zuruft:
»Sie machen das schon ganz richtig, von Stern, halten Sie sich an die Formalien, dann wird’s schon schiefgehen – hat bei mir jedenfalls funktioniert. Ich bin schließlich noch immer hier, wie’s aussieht.«
»Ja, danke für den Tipp – gute Schicht noch!«
»Ihnen auch, Kollege, Ihnen auch!«
Referent schaut Dänemark nach, wie dieser den endlosen Flur scheinbar selbstvergessen pfeifend hinabwandert, und Referent ist fast sicher, dass Dänemark weiß, dass Referent weiß, dass es gefährlicher Unsinn ist, zu glauben, man könne die Klinikleitung mit einem bloßen Formalbericht abspeisen. Leicht verärgert, aber im Grunde eher über meine Unsicherheit als über ihn, schüttele ich den Kopf und schreibe noch schnell den letzten Satz der Standardexposition: Sie vernehmen von mir Wahres nur, wenn Sie zuvor es mir gesagt haben, bevor ich mich zu meinem Kontrollgang aufmache.
Die Hände hinter dem übertrieben geraden Rücken gefaltet, gehe ich langsam den Flur auf und ab, drehe den Kopf rhythmisch nach links und rechts und löse so ein wenig die Nackenverspannung. In allen Zimmern ist Ruh, Patienten liegen friedlich schlafend in ihren schönen großen Betten auf dem champagnerfarbenen Seidenbatist, bis auf diejenigen, die Erlaubnis haben, die Laufkur auch nachts abzuhalten. Während ich wie immer mit geschärften Sinnen und geistiger Teilnahmslosigkeit die schlafenden, nur durch die Glaswände getrennten Gesichter betrachte, die als ruckelnde Bilderreihe an mir vorüberziehen und die mir stets im Morgengrauen, wenn ich selbst für zwei Stunden schlafe, das neonblaue Nachbild eines Schlafmusters vor das innere Auge werfen, murmele ich den letzten Satz meiner Berichtseröffnung immer wieder vor mich hin: Sie vernehmen von mir Wahres nur, wenn Sie zuvor es mir gesagt haben. Sie vernehmen von mir … Der Satz mag lediglich als vage Orientierungshilfe oder sogar als bloße Formalie gelten, ich weiß nicht, ob andere, die ihn vor mir niedergeschrieben haben, heimlich über ihn gelacht haben oder nicht. Mir wird nur plötzlich klar, dass er wahr ist, tatsächlich wahr, und so will ich nun geduldig darauf warten, dass man mich wird vernehmen lassen, was ich Wahres werde schreiben können.
Diese Entdeckung meiner Hörigkeit im wörtlichsten Sinn oder eher dieser Entschluss zu ihr ist zwar etwas peinlich, weil meinem Selbstbild, das insofern vollkommen mit der Wirklichkeit übereinstimmt, als ihm ausschließlich die tadellose Erscheinung meines Spiegelbilds zugrunde liegt, nicht recht gemäß, aber dann doch ungeheuer erleichternd, und so mache ich mich, nach Abschluss meines Kontrollgangs, auf den Weg in den Sprechsaal, um Dr. Holm abzulösen.
Die Rotunde des Sprechsaals, die bei genauerer Hinsicht gar keine Rotunde, sondern ein Achteck ist, dessen Eckgelenke lediglich ein wenig im Fett der baröckelnd gerundeten Wände zwischen ihnen verschwinden, ist wie immer gleißend hell erleuchtet, und die vier hohen, in alle Himmelsrichtungen weisenden Flügeltüren sind so weit geöffnet, dass sie sich in tänzerisch überdehnter Hingabe umgeklappt an die Außenwände des Saals schmiegen, als wolle der Saal den vier in ihn mündenden Himmelskorridoren seine Brüste wie die einer monströs schönen Leiche entgegenstrecken. Wie immer wenn ich, das ikonographische Register meines Standes peinlich befolgend, die Hände souverän fahrlässig in den ausgebeutelten Taschen meines Kittels vergraben, dem Sprechsaal entgegenflaniere, schüttle ich mit herablassend gerührtem Lächeln den Kopf, um zu verhehlen, dass der Anblick des verschmockten Saals mich trotz seiner offenkundigen Lächerlichkeit und trotz all der Jahre, die ich nun schon hier arbeite, jedes Mal mit einem Unbehagen erfüllt, das Angst zu nennen mir zu theatralisch erscheint.
Referent darf sich nicht vom Sprechsaal einschüchtern lassen, so steht es sogar in seinem Arbeitsvertrag, in einer eigentlich durchaus überflüssigen Klausel. Referent hat ihn nicht zu fürchten, da er ja schließlich alles über ihn weiß. Im Gegensatz zu den Patienten weiß er, dass die runde Form des Saals, seine Ausrichtung in alle vier Himmelsrichtungen, seine weißrosa muschelgekalkten Steinwände, übrigens die einzig steinernen im ganzen Haus, der seltsam helle Eichenparkettfußboden, die hohen, weißen Holztüren, das blendende Licht, das er pausenlos in die Flure ausstrahlt – dass all das nur zum Schein darauf hindeutet, dass er das lichte Herz der Klinik ist. Mögen die Patienten ihn auch dafür halten, weil sie nie einen vollständigen Überblick über die Station, geschweige denn über die gesamte Klinik gewinnen können, so ist er doch nicht das Zentrum des Hauses, sondern liegt vielmehr im Nordostwinkel der Station. Und anders als die Patienten weiß Referent, dass der Saal keineswegs einzigartig ist, denn alle drei Stationen unserer Klinik haben ihren eigenen Sprechsaal und alle drei Sprechsäle gleichen einander vollkommen. Sollte ich also einmal kopflos durch das Haus irren, wovor mich die Klinikleitung bewahren möge, und stünde dann plötzlich vor dem Sprechsaal, so vermöchte ich nicht zu erkennen, ob ich mich auf der eigenen Station A oder aber auf B oder C befände. Aber glücklicherweise weiß Referent genau, wo er ist, und da kommt mir auch schon der müde lächelnde Dr. Holm entgegen, die Hände ganz genau so in den Kitteltaschen vergraben wie ich.
Einen Meter voneinander entfernt ziehen wir langsam die schwere Rechte aus dem Kittel, und die eine schüttelt die andere, mit dem halben Kreuzstich der Arme nähen wir unsere Figuren aneinander, nachlässig routiniert und doch mit der angedeuteten Kraft verbindlicher Empathie, denn wir mögen uns sehr, jedenfalls mag Referent den anderen Referenten sehr.
»Schlimme Nacht, Dr. Holm? Höheres Stimmenaufkommen als gewöhnlich?«
»Nein nein, wie üblich, liegt eher an mir. Sehe ich so besonders müde aus?«
Er lächelt wohlkalkuliert ironisch, sieht dadurch noch müder und dadurch wiederum ungemein lebendig aus. Er weiß, dass diese Komödie der Müdigkeit, in der er, mechanisch präzise wie ein Glockenspiel, einmal in der Minute den stumpfen Schleier von seinen Augen hebt und dem Gegenüber für einen Moment, der so kurz ist, dass man nie weiß, ob man es wirklich gesehen oder nur geträumt hat, die Monstranz ihres grünen Feuers entgegenhält, wesentlich für seinen notorischen Charme verantwortlich ist. Die meisten Patientinnen sind spätestens nach ein paar Wochen bei uns ganz verrückt nach seinem lässig erschöpften Raubkatzengebaren, selbst die, die eigentlich gar nicht verrückt sind, spielen verrückt in seiner Gegenwart. Es gibt viele, die sich ausschließlich von ihm schocken lassen wollen, und er selbst versucht anstandshalber, sich wenigstens hin und wieder für diese abgeschmackt hysterische Begeisterung zu verachten, oder eher für seine Abhängigkeit von ihr. Seinen allmonatlichen, cognac-initiierten Zerknirschungsschüben sind freilich schon allein dadurch enge Entfaltungsgrenzen gesetzt, dass es nun einmal seine Aufgabe ist, die selten gewordene Spielart von autoerotischer Hysterie zu reanimieren, in der die Probanden glauben, den überflüssigen und reichlich beschwerlichen Umweg einer fremdpersonalen Projektion beschreiten zu müssen, um an ihr Ziel zu gelangen.
»Ja, in der Tat, Holm, Sie sehen heute ganz besonders müde aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
»Oh, danke für das Kompliment.« Er zwinkert mir zu und fährt dann ernster fort: »Und vor allem danke, dass Sie mich schon wieder hier ablösen, das ist wirklich sehr nett von Ihnen.«
»Keine Ursache, das mache ich wirklich gern. Und außerdem wollte ich die Gelegenheit nutzen, Sie etwas zu fragen …«
»Nur zu!«
Aber statt zu fragen, drehe ich nur den Kopf etwas beklommen nach rechts und links, wo die Patienten im Bettspalier hintereinander auf dem Flur liegen und den Stimmen lauschen, die leise aus dem Saal kommen, einige stöhnen, manche kichern. Doch die meisten Patienten blicken ausdruckslos in den dunklen Himmel, der durch die Glasdecke auf sie niederzufallen scheint. Holm versteht, zieht mich an der Rechten noch näher an sich heran und fragt mit gedämpfter Stimme:
»Sie meinen vertraulich? Es geht um Ihren Eigenbericht, habe ich recht?«
»Ja genau. Sie wissen, dass ich ihn jetzt dringend schreiben muss?«
»Jaja, Dänemark erwähnte neulich, dass Sie jetzt dran sind. Aber Sie haben ja noch bis zum Jahresende Zeit, oder? Neun Monate, das ist doch locker zu schaffen, das ideale Maß geradezu.«
»Siebeneinhalb.«
»Naja, immer noch locker. Idiotische Sache, aber da müssen wir nun mal durch. Bisschen mehr Augenringe, Schlaflosigkeit, Stimmen und so weiter, keine schöne Zeit, aber weiß Gott auch kein Martyrium. Schreiben Sie die Sache einfach irgendwie runter, es kommt, wie’s kommt, wie man so sagt. Und die Beurteilungskriterien durchschaut man sowieso nicht, also müssen Sie sich darum immerhin nicht unnütz Sorgen machen.«
»Hm, das ist ja ungeheuer erleichternd.«
»Jaja, ich weiß, es ist unerfreulich alles in allem, aber so ist es nun mal. Aber Sie hatten eine konkretere Frage …?«
»N-nein, eigentlich nicht, das heißt … ich wollte fragen, ob Sie vielleicht einmal, wenn ich dann ein paar Seiten habe, unter Umständen ein Auge …«
»Na, das ist jetzt aber ein schlechter Scherz!« Er lacht nervös auf, lässt meine Hand plötzlich los und vergisst für einen Moment ganz seine laszive Müdigkeit, fängt sich aber augenblicklich wieder. »Wir sprechen ein andermal, die Stimmen warten leider auf Sie.«
»Ja gut, ich geh dann mal. Irgendwas, worauf ich …?«
»N-nein, ich glaub nicht. Ach doch – die arme Frau Schneider. Sie sagt, sie träume unablässig, tags wie nachts den Satz Ich möcht’ so gern gen Italien reisen, und sie höre den Satz sowohl aus sich selbst als auch aus dem Saal heraus zu ihr sprechen. Und nun will sie mir weismachen, Sie ahnen es, dass das gen Italien nichts anderes als Genitalien bedeute, logisch. Die Gute besteht also unbedingt darauf, sich unbewusst ins Genitale bewegen zu wollen, immer die alte Leier, so habe man es früher gelesen, schauen Sie in die Enzyklopädie, Herr Doktor, ich hab’s nachgeschlagen, Herr Doktor, gen Italien lässt sich sinnreich nur mit Genitalien übersetzen und so weiter. Aber wir können den Leuten ja nicht jeden Unsinn durchgehen lassen, nur weil er altehrwürdig ist. Nächste Woche muss sie nach Italien reisen, die Klinikleitung hat ihre Entlassungspapiere bereits fertiggemacht und die Flüge und Hotels gebucht, am Montag sitzt unsere arme Frau Schneider in Florenz, mag sie jammern wie sie will. Bis dahin aber wird sie uns noch eine harte Zeit geben.«
»Gut, danke für die Warnung.«
»Ist doch das Mindeste – noch mal vielen Dank!«
»Ich bitte Sie, Dr. Holm!«
»Nein, ich bitte Sie, mein lieber Dr. von Stern!«
»Nein, aber wirklich, ich bitte Sie, Dr. Holm.«
Wir lachen übertrieben laut wie immer, wenn wir dieses blödsinnige Spiel spielen, das keiner von uns beiden nach all den Jahren mehr lustig findet, auf das wir aber aus hygienischen Gründen nicht verzichten wollen. Denn nach dem Lachen können wir jedes Mal tief durchatmen, etwas, was man allein meist nicht mehr schafft, mit offenem, ernstem Gesicht im Spiegelbild des anderen, bis sich die Rippenbögen weiten, und dann verabschieden wir uns mit einem kurz gelächelten Nicken und entfernen uns jeder in seine Destination.
3.
Evelyn, mein Wunschsohn, steht bereits an der Tür des Sprechsaals und lächelt mir verträumt entgegen. Vielleicht sieht er mich aber auch gar nicht, und der kätzchenartige Ausdruck, mit dem sich seine dunkelblauen Augen im Zeitlupenblinzeln zu schrägen Schlitzen schließen, um sich dann umso runder wieder zu öffnen, verdankt sich nur der kontemplativen Intensität, mit der er an seiner Opium-Rhabarber-Flasche nuckelt. Er ist noch immer im Abendanzug, hat nur den Vatermörder, der ihm so besonders gut steht, abgelegt, und sein freier Hals sieht über dem kragenlosen, leicht vergilbten Hemd, das ich beim Näherkommen als sein Nachthemd erkenne, noch weißer aus als sonst. Kopfschüttelnd nehme ich ihm die Flasche aus dem Mund:
»Mein lieber Evelyn, Sie sollten längst im Bett sein.«
»Ja, Papa, ich weiß, aber ich kann nicht schlafen.«
»Sie schlafen doch schon halb im Stehen, schlafen ja schon beim Opiumnuckeln fast ein.«
»Ja, Papa, aber sobald ich mich ins Bett lege, bin ich wieder hellwach. Ich wollte doch noch ein paar Dinge mit dir besprechen. Lässt mir keine Ruhe alles und …«
»Ich werde gar nicht mit Ihnen sprechen, solange Sie mich mit Papa anreden.«
»Bitte, lieber Vater …«
»Keine Diskussion, mein Junge! Solange Sie sich einbilden, mein Sohn zu sein, kann ich Ihnen nicht helfen, und das wissen Sie auch, wie oft soll ich es noch sagen! Sie verlängern Ihr Leiden nur sinnlos. Und mag Ihnen dieses Leiden auch lieb geworden sein und seine unerlaubte Verlängerung eine gewisse Lust bereiten, ich darf es dennoch nicht unterstützen.«
»Ja, ich weiß, Herr Doktor. Kann ich meine Flasche bitte wiederhaben?«
»Oh ja, natürlich – hier!«
Patient trinkt, wie alle Patienten, in trauriger Gier seinen Saft in sich hinein und sieht Referenten dabei ähnlich vorwurfsvoll an wie der Professor heute Morgen. Neben rituellem und für Referenten gänzlich harmlosem Vorwurf ist da aber jetzt zugleich die gerechte Indifferenz in Evelyns Augen, die allen Patienten dann und wann würdevoll den Blick weitet, als wäre ihnen alles nicht nur längst gleichgültig, sondern tatsächlich gleich gültig geworden. Dieser geweitete Blick, der die ärgste Prüfung des Referenten darstellt, weil die Patienten mit diesem Blick durch ihn hindurchsehen, als lohne es nicht, bei seinem Innern haltzumachen, ist nicht etwa der entrückenden Wirkung des Opiums geschuldet – denn das Opium berauscht hier niemanden mehr –, sondern der hingebungsvoll stumpfsinnigen Selbstentblößung dauernden Flaschennuckelns, das die Patienten nach einer Eingewöhnungsphase regelmäßig an einen Ort jenseits der Scham versetzt. Aber freilich geschieht dies, wenn überhaupt und nicht lediglich im Auge des Referenten, nur für Momente, die meiste Zeit über sind Patienten entweder beschämt oder schamlos oder beides zugleich.
Evelyn fängt langsam an, mich zu enervieren, mit seinen Augen kappt er die Verbindung zwischen meinen Nerven und meinem Mediator, der da zwischen meinen Rippen sitzt, sodass es nun in aller Seelenruhe in mir denken kann: Unter dem Blick Deiner Augen bin ich mir zur Frage geworden, und das ist mein Elend. Aber da gähnt Evelyn mit weitaufgerissenem Mund, die Uhr schlägt eins, und der Spuk ist wieder einmal vorbei.
»So, Schluss jetzt, ab ins Bett mit Ihnen, Evelyn.«
»Ja gleich, sofort, ich möchte nur noch kurz das Ende der Übertragung mitbekommen.«
»Nein, das kann noch Stunden dauern, und überhaupt haben Sie hier gar nichts zu suchen. Ich wüsste nicht, dass ich Ihnen Stimmenhören verordnet habe, oder habe ich da was vergessen?«
»Nein, aber vielleicht tät es mir gut – ach, ich weiß nicht, was mir noch helfen soll!«
Er fährt sich gequält durch sein schwarzes, bis dahin vom Abendfriseur perfekt seitengescheiteltes und geöltes Haar, aber seine Müdigkeit wehrt seine ohnehin etwas lasche Verzweiflungsattacke leichthändig ab und lässt ihn wieder willenlos gähnen.
»Na also, marsch ins Bett jetzt, oder muss ich erst den Pfleger rufen?«
»Nur noch ein, zwei Stimmen, bitte!«
»Zum letzten Mal, der Sprechsaal ist nicht für Ihre Ohren bestimmt.«
»Ach, was soll ich schon groß hören? Der Lauscher an der Wand hört die eigene Schand, das ist alles.«
»Sehr klug, mein Junge, aber so weit sind Sie noch nicht. Sie gehen jetzt –«
»Papa?«
»Hm?«
»Bin ich ein verwunschenes Schloss?«
»Nein, keine Sorge, mein Junge, sind Sie nicht.«
»Ach wie schade, wie furchtbar schade …«
Schon halb im Traum murmelt Patient letzteres dreimal vor sich hin, bis Referent ihm leicht auf die Schulter klopft, woraufhin Patient gereizt mit ihr zuckt, als wolle er meine Hand abschütteln, was zu wollen ihm aber nur halb gelingt, denn mit einem zweiten Zucken lässt er die Schulter kurz wieder zurück unter meine Hand schlüpfen. Dann torkelt er endlich davon, und ich sehe ihm noch eine Weile nach, in gar nicht mal übler Nachahmung jener gerührten Blicke, die Menschen anderen hinterherwarfen, um sich des eigenen Einfühlungsvermögens zu versichern.
Aber darum geht es Referent nicht, wenn er Patient gerührt hinterher sieht, er braucht lediglich einen Vorwand, um sich noch eine letzte Minute vor dem Sprechsaal zu drücken, der mir seinen Blick stumm in den Rücken bohrt, ja, er schweigt jetzt tatsächlich, alle Stimmen sind verhallt. Die Patienten in den Betten warten ängstlich auf Antwort, einer nach dem anderen fängt langsam an, in verhaltener Panik oder zumindest unbehaglicher Verwunderung den wachträumenden Kopf mit den weit aufgerissenen Augen darin zu heben, nur um ihn wegen der schmerzenden Nackenanspannung sogleich wieder aufs Kissen sinken zu lassen, und so entsteht ein unkoordinierter Kanon des Kopfhebens und -senkens unter den Patienten im Bettspalier, doch der Sprechsaal schweigt weiter stoisch, weil der Schichtwechsel nicht ordnungsgemäß verlaufen und das Echoaggregat daher erschöpft ist. In spätestens zwei Minuten wird der Stördienst kommen und fragen, was hier los ist, aber eine halbe Minute noch kann ich mich drücken, indem ich gebannt zuschaue, wie Evelyn weitertorkelt, bis er, wie jeden Abend, am Ende des Gangs, kurz vor seiner Zimmertür zusammensinken wird, wo ein Pfleger ihn aufheben und ins Bett tragen wird, von meinem vorgeschützten Rührblick begleitet, was nicht heißen soll, dass ich für Evelyn, der sogar jetzt noch, kurz bevor er vor Müdigkeit umfällt, bemüht ist, meinen Gang zu imitieren und seine Sache dabei beleidigend gut macht, nicht auch tatsächlich so etwas wie echte Rührung oder eher aufrichtige Schuldgefühle empfinde, denn ich, der ich längst aus den Spiegelkabinetten meines früheren Lebens entlassen bin, kann durchaus ganz unangekränkelte Empfindungen haben. Sie dürfen nur keinerlei Relevanz für Patienten, geschweige denn für Referenten haben.
Es ist nicht nur unverantwortlich, sondern unsinnig, ja vollkommen kindisch, dass Referent sich immer wieder ein paar nutzlose Minuten lang vor dem Sprechsaal herumdrückt. Ich kann mir diese, soweit ich sehe zwar einzige, oder zumindest einzig eindeutige, aber dafür willentliche – sofern wir Willensschwäche für eine willentliche Schwäche halten wollen, und das sollten wir wohl – Verletzung seiner Dienstpflichten selbst nicht erklären, zumal er die Stimmenschicht ja sogar freiwillig, vollkommen freiwillig immer wieder anderen abnimmt, die sich dadurch mit ihrem gleich schichtweisen Dispens vom Saal freilich noch kindischer verhalten als Referent. Denn das Stimmensprechen ist nun wirklich keine besonders schwierige oder gar unangenehme Tätigkeit, ein wenig belastend höchstens wegen seiner einschläfernden, aber zugleich höchste Konzentration verlangenden Repetitivität: Einmal kurz nicht richtig zugehört, und schon hat man, mit nicht absehbaren Folgen für die Patienten, Falsches wiederholt. Aber einmal abgesehen von diesem oder eher gerade aufgrund dieses Fehlerrisikos bietet das Stimmensprechen eine hervorragende Meditationspraxis. Und wenn man den Saaldienst mit der Arbeit im Belohnungszentrum vergleicht, ist er geradezu ein Geschenk und eine Auszeichnung, ja ein Auszeichnungsgeschenk für den Arzt, fast wie ein ganz alltäglich und beiläufig verliehener schwedischer Polarstern. Der Stimmendienst ist ein weißes Kreuz am schwarzen Band, das an meiner Seelenbrust baumelt. Aber andererseits nehmen wir Ärzte ungern Geschenke und Auszeichnungen an, weder von Patienten noch von der Klinikleitung, und ich nehme an, dass wir uns deshalb alle auf die eine oder andere Weise immer wieder vor dem Stimmensaal drücken.
Sobald ich jedoch auf der hölzernen Drehscheibe in der Mitte des Saals stehe, die sich so langsam dreht, dass ich es selbst kaum merke, sind alle Zaudereien vergessen, und ich freue mich wie jedes Mal auf diese Arbeit,lasse mich aufdemroten Samtkissen sogleichin Padmasana nieder und nicht nur in den einfachen Schneidersitz, denn meine Knöchel sind von tausenden und abertausenden Stunden im Lotussitz biegsam wie die eines Säuglings. Dann lasse ich mein Prana ruhig strömen, beginne mich einzusummen, höre dabei auf die ersten Stimmen, die nun wieder gleichmäßig aus den vier Fluren zu mir hinübergeweht kommen, und sobald mein Prana seinen idealen Rhythmus erlangt hat und mein ganzer Oberkörper bis ins Geschlechtsteil hinunter leicht brummend vibriert, lasse ich die erste Stimme mit dem Einatmen in meinen Brustkorb hinein und mit dem Ausatmen wieder aus mir heraus. Die Stimmen zu imitieren erfordert ein gewisses schauspielerisches Talent, aber auch kein übermäßiges, denn gerade die leichte Abweichung des Echos vom Original gibt dem Patienten erst die Gewissheit, dass die zu ihm zurückkehrende Stimme seine eigene ist. Von dieser heimkehrenden Stimme wiederholen fortgeschrittene Patienten dann wieder und wieder die letzten beiden Worte, denn es ist therapeutisch unerlässlich, dass Patient nicht nur das letzte, sondern die letzten beiden Worte behält. Wenn Patient dann schließlich in seiner Autoecholalie versinkt, habe ich mich schon zur nächsten Stimme weitergedreht. Auf diese Weise wiederhole ich Stimme um Stimme, vier Stunden lang, aber da die Patienten alle auf einmal sprechen, beziehungsweise schreien, flüstern, wimmern, schimpfen, dozieren, lamentieren, witzeln, betteln, fluchen und so weiter, je nach ihrem Temperament, kann ich natürlich nicht jede Stimme wiederholen, wobei es keineswegs die leisen sind, die man am ehesten überhört. Wer seine Stimme zurückbekommt, ist dabei keine Frage der Willkür, sondern wie fast alles hier lediglich eine des Zufalls. Und da wir Ärzte uns auf unserer Drehscheibe allen Fluren gleichmäßig zuwenden, herrscht immerhin ein statistischer Ausgleich zwischen den Himmelsrichtungen.
Um Punkt fünf Uhr morgens breche ich das Spiel ab, verbeuge mich, noch immer im Lotussitz, mit vor dem Brustbein zu Namaste gefalteten Händen eine Kreisumdrehung lang, die Patienten murmeln mein Shanti nach und die Pfleger eilen herbei, um die Betten zurück in die Schlafräume zu schieben. Während die Formation sich auflöst, richte ich mich über eine tiefe Vorbeuge langsam auf, bringe meinen Oberkörper über meinen steifen und schmerzenden Beinen wieder ins Lot und bleibe noch eine Weile in der Ujjayi-Atmung, bis das asthmatische Rasseln verstummt, und dann hat alles für heute wieder einmal ein Ende.
Jetzt endlich schlafe ich, wie immer traumlos und tief wach, den Alphawellenschlaf des lang erfahrenen Arztes, wie klares Wasser durchschreite ich mich, zwei Stunden ohne die geringste Trübung, als hätte es mein früheres Leben nie gegeben, und so kann ich, wenn ich die Augen aufschlage, auf den immergleichen neuen Tag wie auf eine neue Schrift hoffen.
4.
Halb acht Morgenvisite beim Professor. Patient voller Zeremonien. Ist gerade bei der dritten seiner heiligen Waschungen angelangt, schaufelt sich prustend kaltes Wasser über linke Schulter. Da er sich von Kopf bis Fuß an dem kleinen Waschbecken wäscht, weil er behauptet, das Wasser aus der danebenstehenden Dusche sei nicht nass, ist sein Badezimmer wie immer überschwemmt. Die notorischen Wasserrituale der Patienten, bei deren allmorgendlicher Abhaltung sie sich in ängstlich schielender Missgunst gegenseitig durch die Glaswände ihrer Waschräume beobachten und einander in ihrem wilden Treiben zu übertreffen suchen, so als seien sie in ihrem Körper ganz und gar außer sich, wie es früher nur Hysterikerinnen und andere Prostituierte mit ähnlicher Hingabe vorgespiegelt haben, um des Arztes liebstes Kind zu sein, sind einer der vielen Gründe dafür, dass Referenten stets barfuß arbeiten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!