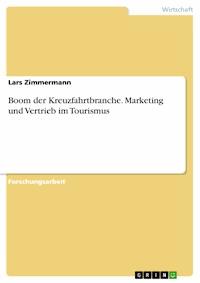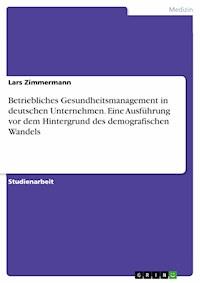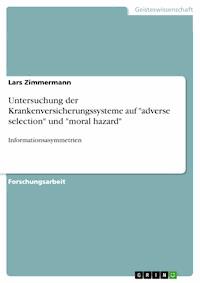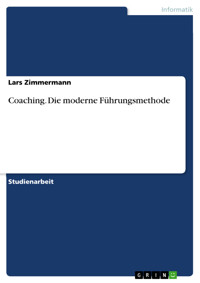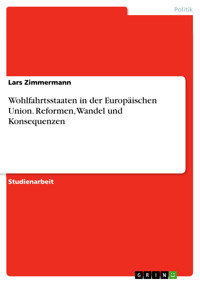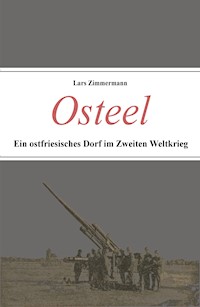
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Luftangriffe, Flugabwehrstellungen, Flugzeugabstürze, Notdienstverpflichtungen, Panzergräben und "Friesenwall"; Ostfriesland war während des Zweiten Weltkrieges auf verschiedenste Weise direkt oder indirekt durch zahlreiche Ereignisse oder Maßnahmen betroffen. In dieser Dokumentation befasst sich der Autor mit dem ostfriesischen Dorf Osteel, welches auch exemplarisch für den direkten Bezug einer jeden Ortschaft zum damaligen Kriegsgeschehen steht. Akribisch recherchiert und aufgearbeitet wurden u.a. der Absturz eines deutschen Aufklärungsflugzeuges und eines amerikanischen Bombers, die Bedeutung im Ausbau der Küstenverteidigung im Bereich der Deutschen Bucht 1944, sowie die Bevölkerung im Kriegsalltag mit Notdienstverpflichtungen, Einquartierung von Kriegsgefangenen oder dem Dienst im "letzen Aufgebot" des Volkssturmes. Auch über die Grenzen Osteels hinaus umfasst das Buch zum Beispiel noch nicht veröffentlichte Informationen über den verstärkten Ausbau der Flugabwehr im gesamten Altkreis Norden zu Kriegsbeginn und liefert teilweise detailliert erarbeitete Fakten zu Einheiten oder Stellungsbereichen. Des Weiteren finden sich das Kriegsende und darüber hinaus Zusammenfassungen oder Details zu Einzelschicksalen, wie zum Beispiel die Internierung der "Holland-Armee" im Raum Ostfriesland. Als Ergänzung findet sich eine tabellarisch verfasste Liste aller gefallenen Osteeler Soldaten. Die Recherche für die Erarbeitung dieser Dokumentation bestand aus zahlreichen Zeitzeugengesprächen, Archivbesuchen, Luftbildauswertungen und dem Wälzen von Literatur reichte bis in die USA. Fast 70 Abbildungen, Kartenausschnitte und Originaldokumente untermalen und ergänzen eindrucksvoll die verschiedenen Themenbereiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lars Zimmermann
Osteel
Ein ostfriesisches Dorf im Zweiten Weltkrieg
Eine Dokumentation zur Zeitgeschichte Ostfrieslands
Osteel
Ein ostfriesisches Dorf im Zweiten Weltkrieg
1. Auflage 2016
© 2016 Lars Zimmermann
ISBNPaperback: 978-3-7345-7879-3
ISBNE-Book: 978-3-7345-7881-6
Verlag: tredition GmbH
Umschlaggestaltung, Illustration: Lars Zimmermann
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Vorwort
Diese Dokumentation über den zweiten Weltkrieg in Osteel soll eine Übersicht über die Ereignisse und Geschehnisse während des Krieges geben. Es wurden zusätzlich viele Informationen aus dem allgemeinen regio- und überregionalen Kriegsgeschehen beigefügt, um den Vorgängen oder Ereignissen einen Kontext im Zeitgeschehen des Krieges zu geben. Das Werk stellt eine Zusammenführung von verschiedenen Fakten, Zeitzeugenberichten und umfangreicher Recherche dar. Leider war es nicht immer möglich alle Daten exakt zu ermitteln, da im Laufe der Zeit viel Material vernichtet wurde. Diese Dokumentation soll auch einzelne Ereignisse oder Bauprojekte in den Kontext zum damaligen Weltgeschehen und Großprojekten der Wehrmachtsführung stellen. Ebenso soll es der Aufklärung dienen, dass der zweite Weltkrieg nicht nur auf den bekannten Kriegsschauplätzen stattfand, sondern auch in verschiedener Weise in jeder Ortschaft, jedem Dorf.
Die in diesem Werk verwendeten Bilder mit zeitgenössischen Aufnahmen von Kriegsgerät und/oder Soldaten sollen keinesfalls kriegsverherrlichend wirken sondern dienen rein der Darstellung von historischen Begebenheiten oder als Illustration. Gleiches gilt für Zitate, Textauszüge oder Wörter der zeitgenössischen Propaganda, der Autor distanziert sich von jeglicher Form des Nationalsozialismus und sämtliche Abschriften oder Zitate dienen der historischen Darstellung.
Danksagung
Hinter mir liegen einige arbeitsreiche Monate, die aus Archivbesuchen, dem Wälzen von zahlreicher Literatur und Gesprächen bestanden. Auf diesem Wege möchte ich mich bei den Menschen, Behörden und Einrichtungen bedanken, die mich bei der Erstellung dieses Werkes unterstützt haben.
Mein besonderer Dank gilt den Zeitzeugen, die mir für intensive Gespräche über die teilweise unheilvolle Zeit stets hilfs- und auskunftsbereit zur Verfügung standen. Zu nennen sind hier die Osteeler Erich Abegg, Hans Gerdsen und Enno Jannßen, der in Osteel aufgewachsene Heyo Bogena, die Leezdorfer Wilhelm Wallis und Laura Stein, durch die ich unzählige Informationen und/oder Bilder erhalten konnte. Des Weiteren möchte ich dem Kriegsmarine-Veteranen Wolfgang Ebert danken, für die interessanten Gespräche u.a. über das Marinelager Tidofeld. Gleiches gilt für Popaeus Weingarten (geb. in Osteel), der mir als ehemaliger DO-17 Bordtechniker so manches Detail über das Flugzeug erzählen konnte.
Popaeus Weingarten (mitte) vor „seiner“ DO-17 in den Pyrenäen während des Zweiten Weltkrieges
Ein weiterer großer Dank geht an William Powers vom 390th Memorial Museum in Tucson, Arizona, für die Bereitstellung von Informations- und Bildmaterial im Bezug auf die abgestürzte Boeing B-17 der 390th Bomb Group. Gleicher geht an Dietrich Janßen und Marten Klose vom Verein Bunkermuseum e.V. aus Emden, für die freundliche Unterstützung.
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeines
2. Luft- und Landverteidigung
2.1 Luftverteidigung
2.1.1 Flugabwehrbatterie in Osteel
2.1.1.2 Standorte der Stellungen
2.1.1.3 Feindflugzeuge unter Beschuss
2.1.1.4 Unterbringung der Soldaten
2.1.2 Geplante Flugabwehrstellungen 1945
2.2 Landverteidigung
2.2.1 Osteel im Ausbau der Küstenverteidigung 1944
2.2.2 Stationierung von Alarmeinheiten
2.2.3 Vorbereitung von Zerstörungsmaßnahmen
2.2.4 Volkssturmmeldestelle Osteel
3. Flugzeugabstürze
3.1 Absturz eines deutschen Aufklärungsflugzeuges
3.2 Absturz eines amerikanischen Bombers
4. Luftangriffe
4.1 Bombenabwürfe
4.2 Tieffliegerangriffe
5. Osteeler Bevölkerung
5.1 Notdienstverpflichtungen
5.2 Unterstützung für Kriegswirtschaft und Front
5.3 Kriegsgefangene
6. Kriegsende
6.1 Internierungslager
7. Osteeler Soldaten
8. Anlagen
8.1 Original Unfallfragebögen der B-17 Besatzung
8.2 Abkürzungsverzeichnis
8.3 Ergänzung
9. Quellenverzeichnis
9.1 Literaturverzeichnis
9.2 Archivalien
9.2.1 Niedersächsisches Landesarchiv Standort Aurich…162
9.2.1 Sonstige Archivalien
9.3 Lokalmedien –literatur
9.4 Internet
9.5 Karten/Luftbilder
9.6 Sonstige Quellen
9.6.1 Zeitzeugen-Interviews
9.7 Abbildungsverzeichnis
1. Allgemeines
Die Gemeinde Osteel befand sich in der Zeit des Nationalsozialismus territorial im NSDAP-Gau1 „Weser-Ems“, im Bereich Luftgaukommando2 XI und im Wehrkreis3 X. Osteel war während des Krieges primär durch Einwirkungen aus der Luft betroffen. Durch die Nähe zu der Seehafenstadt Emden sowie der Nordseeküste lag Osteel oftmals direkt in der Ein- bzw. Ausflugroute der alliierten Bomberverbände. Auch Bomberverbände mit dem Ziel Wilhemshaven, Bremen oder dem Ruhrgebiet überflogen den Luftraum über Osteel und Ostfriesland.
Wilhelmshaven und Emden waren durch die vorhandenen Hafen- und Werftanlagen oft Ziel der alliierten Verbände. Als Folge dessen wurden viele Flugabwehrstellungen am Boden errichtet, um den Luftraum über und um den potenziellen alliierten Angriffszielen zu schützen.
Weiterhin wurde der Luftraum durch verschiedene Jagd- und Nachtjagdgeschwader der deutschen Luftwaffe verteidigt. Für den norddeutschen Raum übernahm dies die 2. Jagddivision, im Raum Ostfriesland wurde die Lufthoheit hauptsächlich durch verschiedene Jagdund Nachtjagdgeschwader sichergestellt. Die Flugzeuge befanden sich auf Militärflugplätzen in Wittmund, Jever, Marx oder Varel und konnten so schnell alliierte Angriffe bekämpfen.
Während des Krieges stürzten eine Vielzahl von Flugzeugen über Ostfriesland und der Nordsee ab, Zwei davon in Osteel/Leezdorf. Bei diesen beiden Abstürzen ließen insgesamt drei deutsche und zwei amerikanische Soldaten ihr Leben.
Im Zuge des „Friesenwall-Projektes“ fand Osteel ebenfalls Berücksichtigung, da die Nähe zur Nordseeküste und somit auch zur deutschen Bucht, in der 1944 einen alliierten Angriff befürchtete wurde, gegeben war.
2. Luft- und Landverteidigung
2.1 Luftverteidigung
Der ostfriesische Luftraum wurde während des Krieges von zahlreichen alliierten Luftfahrzeugen durchquert, da Ostfriesland oftmals direkt in der Ein- bzw. Ausflugroute der in England gestarteten Flugzeuge lag. 1942 wird Ostfriesland in der nationalsozialistischen Propaganda auch als „nordwestlicher Eckpfeiler gegen England“ bezeichnet4.
Abb.1 Maschinengewehr zur Flugabwehr an der ostfriesischen Nordseeküste
Um die Angriffe der alliierten Flugzeuge auf das deutsche Reichsgebiet zu bekämpfen wurden verschiedene Luftabwehrmaßnahmen vorgenommen. Ostfriesland war von diesen Maßnahmen besonders betroffen, da die angreifenden Verbände bereits vor oder im ostfriesischen Luftraum bekämpft werden sollten. Dies wurde zum Beispiel durch die Stationierung von deutschen Jagdflugzeugen unter Anderem auf Fliegerhorsten in Wittmund, Marx und in Jever (Friesland) gewährleistet. Die deutschen Jäger sollten anfliegende alliierte Verbände bereits über der Nordsee abfangen, bekämpfen und dadurch einen Angriff auf das Reichsgebiet verhindern oder reduzieren. Daraus resultierend ereigneten sich viele Luftkämpfe zwischen alliierten und deutschen Luftfahrzeugen im Luftraum über der Nordsee und dem ostfriesischen Festland. Des Weiteren wurde eine Vielzahl von landgebundenen Flugabwehreinrichtungen, wie zum Beispiel diverse Flakund Scheinwerferstellungen, auf ostfriesischem Boden errichtet und stationiert. Im Altkreis Norden sind hier zum Beispiel die Ortschaften Westermarsch I und II, Ostermarsch, Hagermarsch, Lütesburg, Hilgenriedersiel, Hage, Lintelermarsch, Utlandshörn und Norden als Stellungsbereiche von Flak- und Scheinwerfereinheiten zu nennen.5 Viele Flak-Einheiten der Marine und Luftwaffe wurden auch auf den ostfriesischen Inseln wie z.B. auf Borkum, Juist, Norderney oder Wangerooge stationiert. Norderney, Wangerooge und Borkum wurden zusätzlich besonders stark ausgebaut und befestigt und letztendlich zur „Festung“ erklärt6. Der Flak-Schutz für die als Angriffsziel hochfrequentierte ostfriesische Seehafenstadt Emden wurde maßgeblich durch die Marine-Flak-Abteilung 236 sichergestellt7.
Abb.2 schwere 8,8cm Flak in einem ostfriesischen Hafen zu Kriegsbeginn 1939
Auf dem Ausschnitt der Jägergradnetzkarte8„Bodenorganisation Großraum Nachtjagd/Luftflotte Reich“ von August 1944 ist die Einrichtung der Flugabwehr zu erkennen. Osteel lag auf dieser Karte im Planquadrat Bruno-Paula-Acht (BP 8). Die roten Linien markieren die eingerichteten Flakzonen, die sich über Bereiche der ostfriesischen Inseln, der Seehafenstadt Emden und des Dollards sowie um Wilhelmshaven mit dem dazugehörigen Jadebusen erstreckt haben. Die alliierten Verbände versuchten oftmals, diesen Flakzonen auszuweichen oder diese zu umfliegen. Ebenfalls eingezeichnet sind die Fliegerhorste Wittmundhafen, Jever und Varel sowie der Einsatzhafen Marx. Die restlichen Markierungen auf dem Kartenausschnitt stellen zum einen verschiedene Orientierungseinrichtungen (z.B. Ausleuchtung des Luftraumes durch Scheinwerfer oder Leuchtgranaten) für die Nachtjagd dar und zum anderen auch allgemeine Scheinwerferzonen oder -straßen.
Abb.3 Jägergradnetzkarte „Bodenorganisation Großraum NJ/Luftflotte Reich“
Bereits vor Kriegsbeginn im September 1939 wurden durch die deutsche Luftwaffe Planungen und Versuche durchgeführt, um feindliche Nachtangriffe mit Jagdflugzeugen bekämpfen zu können. Es handelte sich um das sog. „Nachtjagd“-Verfahren, welches schon im ersten Weltkrieg eingeführt wurde. Im Jahre 1939 ging man auf deutscher Seite von einer weiterhin neutralen Haltung Belgiens und den Niederlande im Verlauf des Krieges aus, was einen Einflug von englischen Bombern über die Nordsee und somit auch über Ostfriesland bedeutet hätte.9 Als erste Form des Nachtjagd Verfahrens wurde die „helle Nachtjagd“ angewandt. Für die Durchführung dieser Nachtjagd-Form wurde ein „heller Gürtel“ (Scheinwerfergürtel) errichtet, der aus Scheinwerfer- und Richtungshörerstellungen bestand. Bei dem Verfahren sollten die Nachtjäger nach der Alarmierung zuerst ihre „Warteräume“ in der Luft aufsuchen und nach der Ortung der Feindflugzeuge durch die Richtungshörer am Boden (später Ortung durch Funkmessgeräte) und der Freigabe durch Lichtzeichen von ebenfalls am Boden befindlichen Scheinwerfern in die gekennzeichneten Jagdräume einfliegen um anschließend den Feind dort bekämpfen zu können. Die Scheinwerfer sollten jetzt die Feindflugzeuge im Lichtkegel erfassen und für die Nachtjäger beleuchten. Bereits vor Kriegsbeginn gab es erste Übungsflüge mit Anwendung des oben genannten Verfahrens der „hellen Nachtjagd“.10 Im Zuge der Erprobung und Anwendung des Verfahrens der hellen Nachtjagd wurden ab Herbst 1939,vereinzelt auch schon vorher, verstärkt Scheinwerfereinheiten im Bereich der Nordseeküste stationiert.11 Diese Einheiten, ausgestattet mit Scheinwerfern und Richtungshörern zur Flugzeugortung sollten den Himmel für die in Jever startenden Nachtjäger ausleuchten und in Verbindung mit Flugabwehrbatterien am Boden somit möglichst effektiv die feindlichen Einflüge bei Nacht bekämpfen. Im Zeitraum von Herbst 1939 bis Anfang/Mitte 1940 wurde diese Praktik im ostfriesischen Raum u.a. durch Nachtjäger der Verbände 10.(Nacht)/ZG 26, 11. (Nacht)/LG 2, 12. (Nacht)/LG 2 vom Flugplatz Jever durchgeführt. Das erste reine Nachtjagdgeschwader (NJG 1) wurde erst im Juni 1940 aufgestellt, kurz darauf wurde schon mit der Aufstellung einer Nachtjagddivision begonnen.12
Die im weiteren Verlauf dieses Kapitels aufgeführten Einheiten im Altkreis Norden, auch die in Osteel stationierten, waren ebenfalls Teil dieses Verfahrens der „hellen Nachtjagd“ und waren natürlich auch für die bodengestützte Flugabwehr bei Tagesangriffen zuständig. Der siegreiche Abschluss des deutschen Westfeldzuges, der Luftschlacht um England, der Einführung von neuen Nachtjagdverfahren und Techniken waren u.a. Gründe für den Abzug der meisten Luftwaffen-Einheiten bis zur Jahresmitte 1940. Dieser Sachverhalt wird im Folgenden noch weiter erläutert. Der Ausbau der Nachtjagd wurde 1941 durch die Einführung des „Himmelbett“-Verfahrens weiter vorangetrieben, bei dem die bestehenden Scheinwerferriegel um Funkmessgeräte erweitert wurden, um eine bessere Zielerfassung mit modernerer Technik zu erreichen. Generalmajor Josef Kammhuber (Kommandeur 1. Nachtjagddivision) baute das System weiter aus, der Scheinwerferriegel mit den Jagdräumen der „hellen Nachtjagd“ verlief jetzt von Nord- bis Südwesteuropa und an der Küste. Um die Großstädte entstanden Jagdräume des neuen „Himmelbett“-Verfahrens. Aufgrund seines Erfinders wurde dieser Ausbau von den Alliierten „Kammhuber-Linie“ getauft.13 Osteel befand sich nun im Jagdraum („Himmelbett-Kreis“) mit der Bezeichnung „Jaguar“. Funkmessgeräte für die Zielerfassung dieses Verfahrens im Altkreis Norden befanden sich z.B. auf Norderney14 oder dem Marienhafener Kirchturm15.
Abb.4 Die „Kammhuber-Linie“ 1941, gut zu erkennen: die Jagdräume (Kreise)
2.1.1 Flugabwehrbatterie in Osteel
Aufgrund des deutschen Überfalles auf Polen am 1.9.1939 erklärten Frankreich und England am 3.9.1939 dem Deutschen Reich den Krieg. Schon Ende September 1939 befanden sich Einheiten der Wehrmacht zur Flugabwehr in Osteel und Marienhafe.
Die Flugabwehr sollte das Deutsche Reich vor Luftangriffen schützen. Bereits ab dem 3.9.1939 begannen englische und französische Flugzeuge in den deutschen Luftraum einzudringen und flogen über Ostfriesland sowie über das Ruhrgebiet. Es wurden u.a. Flugblätter abgeworfen und die Marinewerft in Wilhelmshaven angegriffen. Hauptziel der vereinzelten alliierten Luftangriffe waren deutsche Kriegsschiffe und Marinestützpunkte an der Nordseeküste. In der Nacht des 4.9.1939 um ca. 03:00 Uhr, wurde von der Marine-Flak-Abteilung 236 in Emden das erste englische Flugzeug über Emden gesichtet, mit Kurs auf Bremen. Es erfolgten bereits einige Flugzeugabschüsse durch die deutsche Flugabwehr, ebenfalls am 4.9.1939 wurde der erste englische Pilot nach einem Absturz in Norddeich gefangen genommen16. Die englischen Verbände erlitten hauptsächlich durch die Angriffe von deutschen Jagdflugzeugen empfindliche Verluste.
Ab der Jahresmitte 1939 wurden verstärkt Flugabwehr- und Scheinwerfereinheiten im Altkreis Norden, zu dem auch Osteel gehörte, stationiert. So ging die Reserve-Flak-Abteilung 115 mit drei Flak-Batterien vom 2. September bis November 1939 auf dem Weideland des Lütesburger Bauern Gerhard Germann aus Lütesburg in Stellung, anschließend wurde der Bereich der Flugabwehr-Maschinengewehr-Reserve-Kompanie 4 zugeteilt.
Die drei Batterien waren zusammengefasst und Teil der „Flakuntergruppe Hage“. Die schwere II. Batterie der Reseve-Flak-Abteilung 115 ging in einem Weideland des Bauern Adolf Müller an der Ostermarscher Landstraße in Lintelermarsch (östlich von Norddeich) im Jahre 1939 mit 8,8cm Flugabwehrkanonen in Stellung, ab dem 20.12.1939 befand sich die Abteilung erneut vielerorts in und um Norden im Einsatz.17
Im September 1939 wurde u.a. das Weideland des Landwirtes Ihno Wäcken in Westermarsch II für die Errichtung von Geschützstellungen und Unterkünften besetzt, diese wurden durch ständig wechselnde Flak-Einheiten belegt. Im Jahre 1941 wurde zusätzlich ein Kleefeld in Beschlag genommen, um dort weitere Baracken zu errichten und, wie in weiteren Flak-Stellungen, ein Fußballfeld als Freizeitbeschäftigung für die Soldaten anzulegen.18 Teile der leichten Reserve-Flak-Abteilung 767 bezogen ebenfalls Stellung auf verschiedenen Ländereien in Westermarsch II und direkt am Deich in Norddeich.19
Abb. 5 2cm-Flak einer leichten Flak-Abteilung im ostfriesischen Winter 1940
Die meisten Einheiten blieben bis zum Jahresanfang/ Jahresmitte 1940, einige verblieben auch noch bis 1942 in ihren Stellungen. So zogen Teile des 13. Scheinwerfer-Batterie Flak-Lehr-Regimentes im Frühjahr 1940 aus Hilgenriedersiel ab und hinterließen zwei Unterkunftsbaracken auf dem Pachtgrundstück des Bauaufsehers Ludwig Fischer, die anschließend durch den Meliorationsverband mit Kriegsgefangenen belegt wurden.20
Abb.6 Teile der 13. Scheinwerfer-Batterie des Flak-Lehr-Regimentes mit Ringrichter-Richtungshörern im Kriegswinter 1939/19340 in Theener (Hagermarsch)
Auf der Fotografie ist ein Konvoi der 13. Scheinwerfer-Batterie des Flak-Lehr-Regimentes, welche in Hilgenriedersiel Stellung bezogen hatte, im Kriegswinter 1939/1940 in Hagermarsch zu sehen.
Als die Wehrmacht am 10. Mai 1940 mit dem Westfeldzug begann, flog die RAF ab Mitte Mai auch die ersten Bombenangriffe gegen das westliche Deutschland. Nachdem Frankreich im Juni 1940 eine Niederlage gegenüber dem Deutschen Reich erlitt, begann die „Luftschlacht um England“ zwischen der deutschen Luftwaffe und der englischen RAF. Ziel der deutschen Seite war es, die Lufthoheit über England zu gewinnen und somit u.a. die „Operation Seelöwe“, die geplante Landung und Invasion von deutschen Kräften auf englischem Boden, vorzubereiten.21 Durch die defensive Haltung der RAF in der Luftschlacht um England, die daraus resultierende Schwächung der englischen Fliegerverbände durch die deutsche Luftwaffe im Jahre 1940 und die ausgeweiteten Kriegstätigkeiten der Wehrmacht 1941, wie z.B. die Vorbereitungsmaßnahmen auf das„Unternehmen Barbarossa“, die Invasion der Sowjetunion durch die Wehrmacht, dem „Balkanfeldzug“ und dem „Afrikafeldzug“, war zum einen das Vorhandensein von Flugabwehrmaßnahmen in dem Maße im Bereich der Deutschen Bucht/Ostfriesland im Jahre 1940 nicht mehr erforderlich und zum Anderen machten die Feldzüge im Jahre 1941 eine Personal- und Materialverlegung auch von Flugabwehreinheiten in die dortigen Gebiete erforderlich.22 Diese beiden Ereignisse lassen sich als primäre Gründe ausmachen, warum große Teile der Luftwaffen-Flak jeweils im Frühjahr/Sommer der Jahre 1940 und 1941 aus dem ostfriesischen Raum abgezogen wurden. Einige Flugabwehr-Stellungen und Einheiten verblieben allerdings auch noch längerfristig im Bereich des Altkreises Norden. Wie zum Beispiel eine Scheinwerferstellung der Marine, die sich noch bis zum 2. September 1942 auf dem Pachtland des Landgebräuchers Esdert Smidt in Osterhusen befand. Errichtet wurde diese Stellung am 1.10.1939.23
Teile des Stabes Flak-Regiment 50 wurden in die „Flakuntergruppe Norddeich“ eingegliedert, anschließend in direkter Deichnähe eingesetzt und beschädigten in den Wintern 1940/1941 die Außenberme des Seedeiches, der Teil des Vorlandes welches sich direkt an den Deichkörper anschließt, da diese mit schweren Fahrzeugen befahren wurde um die Stellungen zu erreichen. In Richtung Osten befanden sich ebenfalls weitere Scheinwerferstellungen und ständig wechselnde Flugabwehreinheiten wie die leichte Reserve-Flak-Batterie 39/XI, die 3. Batterie der leichten Reserve-Flak-Abteilung 872, der Stab der leichten Reserve-Flak-Abteilung 767, die leichte Reserve-Flak-Abteilung 921 oder noch im Jahre 1944 Teile des Stabes der leichten Flak-Abteilung 988. Die leichten Reserve-Flak-Abteilung 767 und 921 nahmen zusätzlich von Juli bis September 1940 Garagen der Frisia AG und eine feldscheunenähnlichen Schuppen hinter dem Hotel „Norddeich“ in Beschlag. Bereits im November 1942 beklagte der Lintelermarscher Deichrichter in einem Schreiben an den Norder Landrat, dass durch den ständigen Wechsel der Einheiten, die keineswegs aus ortsansässigen Soldaten bestanden, keine Sensibilisierung im Bezug auf den Umgang mit dem Deich vorgenommen werden konnte und den Soldaten somit die enorme Wichtigkeit des Seedeiches gar nicht bekannt war. Bis Kriegsende trat jedoch keine Besserung ein.24
In Osteel befand sich im Herbst 1939 die 7. Batterie der II./Flak-Regiment 26 in Stellung. Die II. Abteilung des Flak-Regiments 26 wurde am 15. November 1938 in Oldenburg mit fünf Batterien (6. – 10. Batterie) als gemischte motorisierte Abteilung aus der I. Abteilung des Flak-Regiments 62 aufgestellt. Die II./Flak-Regiment 26 unterstand dem Luftverteidigungskommando 3 und Kommandeur des Flak-Regimentes war vom 15.11.1938 bis zum 31.1.1941 der damalige Oberst Hans Jürgen von Witzendorff25.
Abb.7 angetretene Teile der II./Flak-Regiment 26 in Oldenburg
Batterieführer der 7. Batterie, die im Herbst 1939 mit schweren Flugabwehrgeschützen in Osteel anrückte, war der Hauptmann Steffeinski. Die Feldpostnummer der Batterie lautete 24 585 bzw. L (Luftwaffe) 24 58526. DerHauptmann und Batteriechef sorgte während des Aufenthaltes der Batterie in Osteel für ein kurioses Ereignis. Als sich dieser eines Abends in alkoholisiertem Zustand mit seinem Kraftfahrzeug auf der Fabriciusstraße, die rund um die Osteeler Kirche verläuft, bewegte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr anschließend in ein damals vorhandenes Sieltief. Bei diesem Missgeschick verlor der Batterieführer seine Dienstpistole, diese konnte anschließend von Einwohnern aus dem Tief gefischt werden. Aufgrund des Vorfalles wurde das Sieltief anschließend von der Bevölkerung „Hauptmann´s Ruh“ getauft.27
Eine Batterie mit schweren Flugabwehrgeschützen bestand 1939 in der Regel aus vier 8,8cm Flugabwehrkanonen. Die Batterie setzte sich aus mehreren Teilen mit verschiedenen Aufgabenbereichen zusammen, die im Folgenden erläutert werden.28 In diese, oder in leicht abgewandte Form, war auch die in Osteel stationierte 7. Batterie der II./Flak-Regiment 26 gestaffelt.
Messstaffel (Feuerleitung):
Die Messstaffel beheimateteden Messtrupp I, dieser war mit einem Kommandogerät 36 ausgestattet und befand sich ca. 100m seitlich der Feuerstellung mit den Geschützen. Mithilfe des Kommandogerätes 36, konnte die Flugzeit der abzufeuernden Granaten bestimmt werden. Das Kommandogerät errechnete Höhen- und Seitenrichtzahlen anhand der Flughöhe- und Flugroute des erfassten Flugzeuges. Nach diesen Werten konnte dann der Uhrwerkzünder innerhalb der abzuschießenden Flak-Granate eingestellt werden. Daraus ergab sich dann Höhe und Zeitpunkt, in der die abgeschossene Granate explodierte. Die vier Geschütze der Feuerstellung waren über Fernmeldekabel mit dem Kommandogerät 36verbunden. Außerdem bestanden eine Telefonverbindung zum Messtrupp II, sowie eine Verbindung zur Funkstelle der Feuerstellung.
Abb. 8 Kommandogerät 36 der I./Flak-Regiment 26 hier in Diepholz
Der Messtrupp II war ebenfalls Bestandteil der Messstaffel. Dieser Messtrupp befand sich in der Mitte der Feuerstellung mit den Geschützen. Der Trupp war ausgestattet mit einem Kommandohilfsgerät 35, es erfüllte denselben Zweck wie das Kommandogerät 36 und sollte dieses bei einem Ausfall ersetzen. Die errechneten Werte wurden hier in der Regel mündlich an die Flak-Besatzung übermittelt.
Geschützstaffel:
Die Geschützstaffel umfasste die Flugabwehrgeschütze an sich mit den dazugehörigen Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kraftfahrern, Geschütz-Kanonieren (Geschützbedienung) und einen Kradmelder. Die Geschütze wurden auf Transportachsenwagen sog. Sonderanhängern vom Typ 201 oder 202 transportiert und von schweren Zugkraftwagen in Form von Sonder-Kraftfahrzeugen Typ 8 (Halbkettenfahrzeuge) gezogen.
Abb. 9 Geschütztransport der II./Flak-Regiment 26, Aufnahmeort unbekannt
Um die Geschütze vor Ort in Stellung zu bringen, wurden diese von den Transportachsenwagen „abgeprotzt“. Das „Abprotzen“ bedeutet, dass jeweils die Vorder- und Hinterachse des Transportachsenwagens von dem Geschütz entfernt wurden und dieses dann auf vier Holme gesetzt wurde. Dies war auch in Osteel der Fall, da die Batterie nur „feldmäßig“ in Stellung ging, es wurden keine Fundamente angelegt oder Geschützstellungen ausgehoben.
Abb.10 Soldaten der II./Flak-Reg. 26 „protzen“ eine Flak ab, Ort unbekannt
Nachdem alle Geschütze in Stellung standen ergab sich daraus die Feuerstellung. Die Feuerstellung einer schweren Flakbatterie umfasste vier Flugabwehrgeschütze. Die in Osteel stationierte 7. Batterie der II./Flak-Regiment 26 war mit Flugabwehrkanonen vom Typ 8,8-cm-FlaK 37 des Herstellers Krupp ausgestattet. Das Kaliber betrug 88mm, ein Geschütz wog 5.000 kg und die Masse der Geschosse betrug 9,4 kg. Das Geschütz erreichte eine maximale Schussweite von 14.860 m bei einer praktischen Feuergeschwindigkeit von 15-20 Schuss/min. Üblicherweise wurden neun Soldaten und/oder Flakhelfer als Geschützbedienung für das Geschütz eingesetzt.29Innerhalb der Feuerstellung befanden sich die Geschütze im Viereck in einem Abstand von ca. 30 – 45m um den Messtrupp II herum, der sich mit dem Kommandohilfsgerät 35 in der Mitte der Feuerstellung befand.
Abb.11 eines von vier 8,8cm Geschützen zwischen Osteel und Marienhafe
Die einzig existierende Fotografie der 7. Batterie in Osteel zeigt eine 8,8cm Flugabwehrkanone in Stellung mit der gesamten Geschützbedienung. Die Geschützbedienung steht auf dieser Fotografie „schulmäßig“ an der Flugabwehrkanone, dieses Bild wurde für nationalsozialistische Propagandazwecke angefertigt und verwendet. Es war mit der Bildunterschrift „Wehe dem Engländer, der in den Wirkungsbereich der schweren deutschen Flakgeschütze geriet“ versehen. Es wurden keine Angaben zum Ort der Aufnahme, zur Einheit oder sonstige Details veröffentlicht, da dies der Geheimhaltung unterlag. Auf dem Bild ist der Geschützführer gut erkennbar, dieser trägt als Kopfbedeckung ein Schiffchen statt des Stahlhelmes. Direkt hinter der Flugabwehrkanone erkennt man eine kleine Baracke, links im Hintergrund einen Unterstand und/oder ein oder mehrere Zelte. Dahinter sind Kühe zu sehen, die auf der Weide grasen. Am Horizont zeichnet sich die Osteeler Kirche deutlich ab.
Nachrichtenstaffel:
seitlich der Feuerstellung befand sich eine Funkstellung, die über ein Funkgerät mit 100W Sendeleistung verfügte und Teil der Nachrichtenstaffel war. Zusätzlich war noch ein kleineres Funkgerät mit 5W Sendeleistung vorhanden. Aufgabe der Funkstellung war es zum Beispiel auch, den Sprechverkehr der anfliegenden Feindflugzeuge abzuhören. Gegebenenfalls war noch ein Feldkabeltrupp Bestandteil der Nachrichtenstaffel.
Munitionsstaffel und Batterietross:
Die Munitionsstaffel und der Batterietross umfassten einige Fahrzeuge, im Schwerpunkt Lkw, für den Transport von Munition, Verpflegung und Feldküche, Gerät, Gepäck und Betriebsstoffen. In Osteel verfügte der Batterietross sogar über einen Tankwagen. Außerdem waren Soldaten mit unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wie Kraftfahrer, Tankwart, Rechnungsführer, Feldkoch, Schreiber, Schneider und Schuhmacher Bestandteil des Batterietrosses.
Scheinwerferstellung und Richtungshörer:
In Osteel befanden sich außer der Flakbatterie auch noch Scheinwerferund Richtungshörer in Stellung. Diese Feuerleiteinrichtungen waren nicht in die 7. Batterie der II. Abteilung des Flak-Regimentes 26 eingegliedert, sondern waren Teil der III. Abteilung (Scheinwerferabteilung motorisiert).30 Der