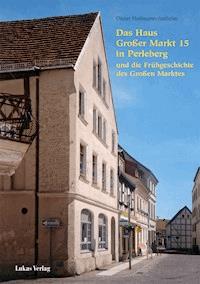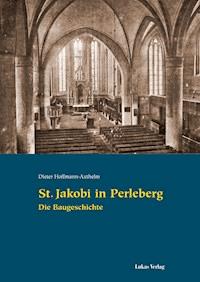Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition.fotoTAPETA Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über Berlin, als gäbe es nicht genug... Und dazu noch Spaziergänge, als gäbe es nicht Franz Hessel, den Flaneur in Berlin. Aber Dieter Hoffmann-Axthelm ist kein Flaneur - er ist Stadtplaner und Architektur-Kritiker, und mit diesem Rüstzeug schärft er auf seinen Rundgängen durch die Stadt den Blick des Lesers auf dieses neue Berlin, in dem sich das alte Berlin überraschend kräftig wieder durchsetzt, so es auch nur die kleinste Chance hat. Eine Bestandsaufnahme gut zwanzig Jahre, nachdem die Mauer verschwunden ist: Wie wächst die Stadt zusammen, wo sind die Brüche, wie wird gebaut, wie zeigt sich die Republik in ihren Bauten? Wo haben die Stadtplaner versagt, wo es richtig gemacht? Ein Buch für Berliner, Neuberliner und Berlin-Besucher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
In Berlin verreisen
Rentier Schellbogen → Um was zu finden? → Stadtreisen? → Und wem sagt man das?
Stadtverkehre
Ankunft → Alex → Stadtbahn → Der S-Bahn-Ring → Straßenbahn → Verkehrswende? → Wasserbusse sind noch fern → „Mitte“ und die Soziale Spaltung
Mitte
Schiffslände → Friedrichstraße → Maßstäblichkeit → Unter den Linden Ecke Friedrichstraße → Lustgarten → Friedrichswerder → Auf der Weidendammer Brücke → Hackescher Markt → Invalidenstraße
Staatsbesuch
Der fremde Salon → Kanzleramt → Das Regierungsband → Reichstag von außen → Parlamentsgebäude → Moabiter Werder → Das Mahnmal → Pariser Platz → Bundesöde
Westen
Potsdamer Platz → Breitscheid-Platz → Ku’Damm Ecke Joachimsthaler → Der Alte Westen → Walter-Benjamin-Platz → Autostraße Salzufer → Moabiter Brücke → Messedamm
Osten
Alexa → Der alte Osten → Simon-Dach-Straße → Ostbahnhof und Stralauer Platz → Die O2-Welt → S-Bahnhof Landsberger Allee → Siegfriedstraße → Victoriastadt
Die Unbeweglichen
Die neue Mauer → Vor dem Roten Rathaus → Südliche Friedrichstadt → Mollstraße → A 100
Berlin am Meer
Monbijou → Die Gärten von Marzahn → Tempelhofer Feld → Ins Offene
Die Fotos
Glossar
Impressum
Vorbemerkung
Das Folgende ist kein Buch aus einem Guß, sondern eine bewußt lockere Reihe von Beobachtungen und Bemerkungen. Doch auch kein Haufen aus notdürftig zusammengenieteten Zeitungsartikeln oder sonstigen Altlasten aus den Tiefen des Rechners. Alles fing damit an, daß der Verleger ein Buch über das „neue Berlin“ haben wollte. Es sollte, nahm ich mir vor, eine Kette von Miniaturen werden, „Berlin-Minis“ war der Arbeitstitel, und an die Smarties dachte ich dabei.
So entstanden Stück um Stück kleine Essays und gruppierten sich schnell zu Kapiteln. Dann wurden sie doch dicker als gedacht und weniger bunt als erwünscht, aber was wird schon ganz so, wie man es sich am Anfang vorstellt, jede Arbeit entwickelt, kaum begonnen, ihre eigene Logik, gegen die der Autor zunehmend machtlos ist. Dann hat die Sammlung längere Zeit gelegen und mußte, als die Veröffentlichung anstand, auf den neuesten Stand gebracht werden, was vermutlich wieder einiges dicker machte und weniger bunt als gedacht.
„Neues Berlin“ war gewünscht, und so ist dies auch kein Blick auf das ganze Berlin seit der Wende, sondern auf die Punkte, wo sich meines Erachtens heute die Veränderungen seit Mauerfall und Wiedervereinigung am deutlichsten zeigen. Steglitz oder Wannsee oder Frohnau oder Karlshorst kommen gar nicht vor, Schöneberg ist vernachlässig, Kreuzberg kommt schlecht weg (Prenzlauer Berg übrigens auch). Dazu kommen andere Einschränkungen. Der Blick ist der eines Stadtplaners[1], der an vielem, worüber er schreibt, verantwortlich beteiligt war, also unmöglich neutral sein kann, vielmehr immer auch mitschleppt, was er sich ganz anders und viel besser vorgestellt hatte. Weiter ist es der Blick eines Eingeborenen, der noch die mehr oder minder ungeteilte Stadt vor der Mauer erlebt hat, dem also der unbekümmerte Gebrauch fremd ist, den die Menge der Zuwanderer seit 1989 von Berlin macht. Und schließlich ist es, angesichts des eben Gesagten, der Blick eines vergleichsweise alten Menschen, dessen Kriterien zwangsläufig aus dem 20. Jahrhundert stammen und für den das Berghain[2] eben nicht mehr kultureller Mittelpunkt sein kann. Ob die Augen dabei offen genug geblieben sind, ob es mir gelungen ist, meine Kriterien immerhin verständlich zu machen, ob irgend etwas von der Leidenschaft herüber kommt, die es bedeutete, die Großstadt Berlin nach der Wende neu zu denken und in bestimmtem Maße im Zentrum ihre Entwicklung zu beeinflussen und in die richtigen Gleise zu lenken – alles das mag der Leser entscheiden.
Abb.1
In Berlin verreisen
Der Rentier Schellbogen
Die Stadt zu verlassen, war, so lange ich denken kann, eine der wichtigsten Beschäftigungen der Berliner. Sie kennen, sagt man, die Welt und ihren Kiez, aber nicht das, was dazwischen liegt: die Stadt Berlin, fünfzig Kilometer in der Ost-West-Richtung, dreißig zwischen Norden und Süden, zwölf Großbezirke, jeder davon, zumindest seiner Bevölkerungszahl nach, eine mittlere Großstadt. Vielleicht eine Zumutung, sie kennen und durchwandern zu wollen. Eine Zumutung erst recht für die Neuberliner, die in Mitte mittlerweile die absolute Mehrheit erreicht haben. Sie kennen den Hackeschen Markt und die Kastanienallee, und wenn von der Jüden- oder der Neuen Roßstraße die Rede ist, dann könnte das genauso gut in Duderstadt sein. Erklärt man ihnen, wo diese Straßen liegen, dann sagen sie erleichtert: Aha, am Alexanderplatz. Daß sie damit Jahrhunderte und halbe oder ganze Kilometer überspringen, egal. Um so weniger zieht es sie in die Tiefen des Stadtkörpers, in das ausgeruhte, fast unzerstörte Berlin des 19. Jahrhunderts. Werden sie je die Laubacher Straße, das Kissingenviertel, den Eichborndamm oder den Johannaplatz kennen lernen? Die Konrad-Wolf-Straße, den Nöldnerplatz, die Kaiserin-Augusta-Allee, den Südstern, die Gerichtsstraße, den Mirbachplatz? Vermutlich nicht, es sei denn, es packte sie irgendwann die große Neugierde.
Ganz anders der Rentier Schellbogen. Da sind wir mitten im 19. Jahrhundert. Jedes Jahr brach er zu einer großen Ferienreise auf. Dem Droschkenkutscher rief er zu: Zum Stettiner Bahnhof! Aber auf halbem Wege ließ er ihn umkehren, er habe es sich anders überlegt, und fuhr zu einem Gasthof am Hohen Steinweg, mitten in der Berliner Altstadt und wenige Schritte vom Berliner Rathaus entfernt, das damals noch nicht das heutige war. Dort stieg er ab und machte drei Wochen Ferien, indem er von hier aus täglich Exkursionen in das Stadtgebiet unternahm, Jahr um Jahr.
Den Hohen Steinweg gibt es allerdings nicht mehr, er ist unter der leeren Fläche begraben, die sich derzeit zwischen Rotem Rathaus und Marienkirche erstreckt, und der Rentier Schellbogen ist nur eine Erfindung des Schriftstellers Julius Rodenberg[3]. Als solche kam er noch dazu erst 1890 zur Welt, da war seine Zeit schon um. Es wäre wohl auch nicht im Sinne des Erfinders gewesen, ihn als modernen Flaneur zu verstehen. Dazu zeigt die Figur zu viel altberlinischen Bodensatz, zu viel Seßhaftigkeit und Bodenständigkeit, zu wenig Weltgewandtheit und intellektuelle Zerrissenheit. Er war eher das, wonach der Flaneur sich sehnt – wohl auch Julius Rodenberg selber, und erst recht, eine Generation später Franz Hessel[4], die Inkarnation schlechthin des Flaneurs. Beide jüdische Berliner, geübt in der Aufmerksamkeit der Heimatlosen.
Die Figur des Rentiers Schellbogen hat eher etwas Philosophisches. Zur Philosophie gehört ja nicht nur eine gewisse Portion Sitzfleisch, sondern, nach Kant, auch die Fähigkeit, sich die Welt zu rekonstruieren nicht nur im eigenen Kopf, sondern auch in der eigenen Stadt. Wozu also in die Ferne? Die Nähe – das ist das Philosophische an der Sache – ist ausreichend unbekannt. Die Philosophie hat ja oft genug in eher unbeholfenen Körpern oder Mentalitäten gesteckt, nicht nur in weltläufigen. Das Gehen paßt auch besser zur Denkbewegung als das Reisen; Ideenfindung geschieht nicht im Anblick der Akropolis, sondern eher auf dem Weg zum Bäcker. Und drittens, wo steckt das Unbekannte, Unheimliche, dem das Denken auf der Spur ist, wenn nicht im Gewöhnlichsten – z. B. in Lankwitz oder Reinickendorf? Das Gehen ist heute allerdings aus der Mode, und das Berlin Franz Hessels ist so gründlich verschwunden wie das von 1860, in dessen Rahmen man sich den Rentier Schellbogen vorstellen muß. Die Philosophie ist tot, und der Flaneur ist endgültig in den Jagdgründen der Kulturwissenschaft verschwunden. In Berlin zu verreisen, das will, als Thema wie als Rolle, neu erfunden sein.
Um was zu finden?
Man kann sich ja ruhig so viel Zeit nehmen wie Julius Rodenberg oder Franz Hessel und täglich, aus seiner Haustüre tretend, einen anderen Weg nehmen. Man sollte das zu Fuß tun – das Fahrrad ist oft für die Wahrnehmung schon zu schnell –, so kann man sich endlich einmal das absichtslose Schauen und Entdecken leisten. Das Zeitgenössische, der Unterschied zu Rodenberg und Hessel, stellt sich sowieso her: daß der Versuch, im eigenen Laufen einen erzählenden Zusammenhang der zerrissenen Stadt zu weben, heute unweigerlich irgendwo von der Geschichte unterbrochen wird. Da hört die Behaglichkeit auf.
In den achtziger Jahren, als das alte West-Berlin die verschüttete Geschichte ausgrub, waren die sichtbaren Brüche das Thema, die Fassungslosigkeit angesichts des Ausmaßes von Abbruch und Zerstörung, von Menschenmord, Krieg und Untergang, von Spaltung und plumpen Versuchen schaufelbaggerartigen Zuschüttens der Gruben. So kann man heute vom vereinigten Berlin nicht mehr reden. Der größte sichtbare Bruch, die Mauer, ist weg, und die Anstrengungen der Stadtregierung, den Touristen ein Freiluftmuseum der Berliner Mauer zu bieten, haben mit der Selbsterfahrung und Innenperspektive der Stadt nichts mehr zu tun. Aber neben den sich schließenden Wunden der Stadt dauern die Brüche an vielen Stellen noch fort, und die Zerstörungen und Gräber des 20. Jahrhunderts sind ja damit, daß in den vergangenen zwanzig Jahren ein zweiter, Ost und West wieder zusammennähender Wiederaufbau stattgefunden hat, nicht aus der Welt geschafft, sie wirken weiter und bleiben der Untergrund auch allen neuen Glanzes. Man wird sie nicht los, hinter aller Helligkeit scheinen die Trümmer der Geschichte durch. Inzwischen gibt es längst auch die neuen Spaltungen und Brüche.
Etwa um die Wendezeit war ich schriftlich der Frage nachgegangen, „warum … die deutsche Architektur so subaltern“ sei. Unbeabsichtigt hatte ich damit einen Maßstab ausgelegt. An ihm könnte man inzwischen vermutlich ablesen, was aus Berlin geworden ist, bzw. ob sich Vorhaben und Akteure bewährt haben. Denn nirgendwo ist in Deutschland in den vergangenen Jahren so ausdehnend, so ehrgeizig, so öffentlich diskutiert und in so weit ausholender Konkurrenz der Akteure gebaut worden – Staat, internationales Kapital, westdeutsche und lokale Baulöwen, Konzerne und Verbände, die Wohnungsbaugesellschaften, das Land Berlin, Bezirke, private Bauherren und Bauherrengruppen, Großproduzenten der Architektur und ehrgeizige Einzelarchitekten. Was seitdem entstanden ist, wird daraufhin doch wohl einiges zu sagen haben, was mit dem bloßen Fotografieren oder Beschreiben des, wie man so schön ahnungslos sagt, neuen Berlin noch nicht abgefragt ist: über den Stand der Selbstfindung dieser geköpften, gespaltenen, zerschlagenen Stadt, die jetzt erstmals wieder die Chance hat, zu sich zu kommen, und nicht zuletzt über Staat und Gesellschaft der Deutschen, insbesondere auch darüber, wie es mit der beklagten Subalternität ihrer Architektur steht – ob und wie weit also die politische Souveränität auch kulturelle geworden ist, und wer sie trägt, der bauende Staat oder die Masse der Produzenten, Nutzer, Bewohner, Besucher.
Etwas viel auf einmal? Aber das sucht man sich nicht aus, es ist das, was die zerrissene Stadt Berlin jedem aufträgt, der sich auf sie einläßt. Weniger aber würde auch ich, der Auftragnehmer, nicht aushalten. Ich mag wohl wieder und wieder das Stadtzentrum zu Fuß oder auf dem Fahrrad durchstreifen und auf nichts anderes gespannt sein als darauf, Neugebautes zu entdecken und mich der Öffnung neuer Stadträume, der Schließung jahrzehntelanger Brachen, der Wiederkehr von Straßen und Plätze zu erfreuen. Es hilft nichts, das Wissen um die Verluste ist, wenn man ein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht hat, nicht zu betrügen.
Die im Folgenden vorgeschlagenen Wege werden also bevorzugt an Orte führen, wo für den eingewohnten Blick die Bruchkanten verlaufen und die historischen Schichten sich, sichtbar oder unsichtbar, zu neuen Formen verkeilen – wie die Caspar David Friedrich’schen Eisschollen, die schon im Theater der siebziger Jahre zum Emblem von Stadt- und Nationalschicksal gemacht wurden. Es werden also innerstädtische Orte sein, Orte vor allem des Zentrums bzw. der Zentrumskonkurrenz. Denn noch ist vieles offen, und jede Auseinandersetzung, wohin eine neue Großinvestition soll und was sie herbeibringt, ist ein Scharmützel in der großen, auf Jahrzehnte hochzurechnenden Auseinandersetzung darüber, ob und wo und wie die Stadt sich wieder eine Mitte schaffen und damit zu sich finden wird. Und schließlich nützt es einer zukünftigen Trümmervermeidung, im Realisierten auch das mitzudenken, was an planender Vernunft versäumt wurde.
Abb.2
Stadtreisen?
Eine ganz andere Frage ist, welche soziale Gestalt ein solcher Blick beansprucht. Flaneur kann man in der globalen Welt nicht mehr sein. Das ist auch schon fast so weit weg wie die Behaglichkeit des Berliner Rentiers um 1860, der sich mit vierzig Jahren zur Ruhe gesetzt hat und seinen Alltag damit zubringt, sein Haus zu verwalten, die Miete einzuziehen, in der Armenkommission seines Stadtviertels tätig zu sein, vielleicht auch für die Wahl zum Stadtverordneten seines Bezirks zu kandidieren – und dann Ferien in Berlin zu machen.
Heute hat so etwas eine organisierte Form. Es gibt die Firma Stadtreisen, und Kundige verdienen sich ihr Geld damit, Neuberliner oder Bewohner anderer Stadtbezirke in die historischen Örtlichkeiten und Unörtlichkeiten Berlins einzuweisen, nicht zu vergessen die beliebten Berliner Unterwelten. Das ist, für den Stadtführer, Arbeit und nicht Reisen. Kein ausreichendes Äquivalent für die untergegangene historische Rolle des Rentiers Schellbogen. Denn, offen gesagt, die ist um einiges attraktiver als die modernere des ewig unglücklichen, von innerer Heimatlosigkeit und Zerrissenheit getriebenen Flaneurs, für den die Stadtoberflächen, an denen er entlang streift, eher Fluchtort sind denn Heimat. Es sollte schon so etwas wie Ankommen und Bleiben dabei sein, und es müsste eine individuelle Rolle sein – in diesem Fall meine.
Was kann, nach den Zerstörungen des 20. Jahrhunderts, Bleiben heißen? Die Unruhe von Abriß und Neubau werden wir nicht mehr los. Man sehe sich den Potsdamer Platz an. Ist da irgendetwas ausgeruht oder nach Bleiben riechend? Das ganze Paket sieht aus wie vorübergehend geparkt, und niemand würde sich wundern, wäre es eines Morgens mit seinen Silhouetten aus dem Amerika der dreißiger Jahre wieder verschwunden, und Kräne und andere Arbeitsmaschinen grüben wieder und legten die Fundamente schon für die nächste Kapitalanlage. Der Stadtbummler, der ich gerne wäre, wäre jedenfalls ein Abriß- und Neubauspezialist, ein Experte untergegangener oder verpaßter Orte, bestenfalls auch der hoffnungsfrohe Liebhaber des Neuen. Für diese zunehmend glaubwürdige Rolle des postmodernen Stadtbummlers allerdings bin ich zu ungeduldig und zu arbeitssüchtig.
Aber auch zu sehr beteiligt. Nachdem ich selber acht Jahre planend an der Umsteuerung mitgearbeitet habe, kann ich nicht mehr bloß zusehen, was denn alles so kommt oder gekommen ist. Der Akteur ist Teil dessen, was rollt, steckt mit drin im Geglückten oder Mißlungenen des Ergebnisses, würde sich als bloßen Zuschauer also mißverstehen. Dumm wäre, diese Beteiligung zu verschweigen – als müßte man, um die Priorität von Stadt und Geschichte vor dem eigenen Selbst zu gewährleisten, so tun, als wäre man neutral und wollte bloß einmal besehen, was die anderen so gemacht haben, Staat, Kapital, Verwaltungen, Planer, Lobbyisten, Architekten, Journalisten, engagierte Bürger … Besonders pflegen ja Architekturkritiker Planungen von der obersten Schicht her zu beurteilen, als Architektur, und damit so zu nehmen, als wären sie ein Werk der freien Künste und nicht endloser Kompromisse zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden, Investoren. So leicht darf ich es mir nicht machen. Ich kenne die Mühlen, durch die jede Idee hindurch muß, und trotzdem kann das kein Anlaß sein, auf Ungeduld zu verzichten und mit allem, was bisher entstand, zufrieden zu sein.
Und wem sagt man das?
Dies ist der kritischste Punkt. Schon der Rentier Schellbogen gehört in eine Stadt, die vom Zuzug riesiger Mengen von Neubürgern aus allen möglichen Gegenden Deutschlands und Polens geprägt war und laufend vorstädtische Gärten und umliegende Dörfer unter neu erbauten Stadtvierteln und fünfgeschossigen Mietshäusern begrub. Aber damals gab es einen festen Kern, die Großstadt schon des 18. Jahrhunderts, und ein halbwegs gefestigtes Bürgertum. Inzwischen haben zweimal riesige Aderlässe stattgefunden. Nach 1945 verlor die Stadt weit über eine Million Einwohner, und von den verbleibenden Berlinern der fünfziger Jahre des 20.Jahrhunderts war ein Drittel neu hinzugekommen. Nach der Wende fand noch einmal ein großer Austausch statt: Wiederum ein Drittel der Bevölkerung von 1989 hat seitdem die Stadt verlassen und ist durch Zuwanderer ersetzt worden. Die, die blieben, teilen sich perspektivisch in Ost- und Westberliner und unterscheiden sich nach wie vor von den griechischen, italienischen, türkischen, libanesischen, vietnamesischen Migranten der sechziger bis achtziger Jahre. Die Zuwanderung hält an, nicht nur Westdeutsche, sondern neue Kriegs- und Wirtschaftflüchtlinge, Zuwanderer aus den EU-Staaten, aus Rußland, Ukraine oder USA. Die Stadt wäre auch nicht das, was sie ist, ohne die als Touristen oder Zweitwohner nur sporadisch Anwesenden.
Diese ständige Neuvermischung hat nicht nur zur Folge, daß die Berliner heute ganz andere sind – eine Banalität, über die man eigentlich kein Wort verlieren muß –, sondern auch – und das ist alles andere als banal –, daß die Innenperspektive, die für Julius Rodenberg und ebenso noch für Franz Hessel selbstverständlich war, verloren gegangen ist. Immer mehr ist es ein Blick von außen, mit dem die Stadt gesehen und aus dem über sie geredet wird.
Damit könnte man leben, wenn nicht auch Politik und Verwaltung sich immer mehr diesen Blick zu eigen machten. Berlin wird von Touristen überrollt? – offenbar ist also alles gut so wie es ist, wozu sich noch mit den schwierigen Aufgaben der Stadtrekonstruktion befassen. Der Asphalt auf der Breiten Straße ist neu und glatt, gebaut wird geradeaus und im rechten Winkel, alles andere ist Luxus. Berlin hat es nicht nötig, sich um die Sperlingsgasse zu kümmern.
Aber wie dem auch sei – machen wir uns erst einmal auf den Weg.
Abb.3
Stadtverkehre
Ankunft
Als Kind bereiste ich die Welt an der Hand Sven Hedins[5]. Von Pol zu Pol: das war ein dreibändiges Werk für Groß und Klein, das als Junge schon mein Vater gelesen hatte. Es beginnt am und mit dem Bahnhof Friedrichstraße, mit einer begeisterten Schilderung, wie hier, scheinbar oder tatsächlich, die Fäden aus aller Welt zusammenlaufen, wie Menschenmassen, Züge, Hoffnungen und Geschäfte sich bündeln und verteilen, kommen und gehen. Das war um 1900.
Heute ist der Bahnhof Friedrichstraße zum Regionalbahnhof abgestuft, von allen Fernzügen hält hier allein der kleine Vogtland-Expreß, und was Leben, Gewirr, Eile, Massen und Geräusch in die wunderbar restaurierte Halle bringt, ist vor allem die S-Bahn. Das, was für Sven Hedin sich zum Mittelpunkt Europas verbündete, das ist, gekürzt um ökonomische Macht und nationale Vorrangstellung der damaligen Reichshauptstadt, heute an einen ganz anderen Ort gezogen, an jene immer etwas heimatlos und von hart sich aneinander reibenden Zufallsanstalten besetzte Leerstelle zwischen Berlin und Berlin, auf der einmal der Lehrter Bahnhof stand.
Der Rentier Schellbogen in mir mag das Wort Hauptbahnhof nicht. Wohl aber das so benannte Bauwerk. Der Name – nun ja, da war ein ehrgeiziger Provinzler am Werk, der von Berlin keine Ahnung hat und in Berlin den Frankfurter Hauptbahnhof vermißte. So wie Erich Honnecker, auch ein Provinzler (aus Saarbrücken), zu Zeiten der DDR meinte, seine Hauptstadt Berlin Ost brauche, um eine echte Hauptstadt zu sein, auch einen Hauptbahnhof. So mußte der Ostbahnhof umgetauft werden. Proteste Eingeborener halfen nichts. Wenn man den neuen Bahnhof wenigstens Berlin Zentrum genannt hätte … Der kurzfristig im Angebot gewesene Kompromiß Hauptbahnhof in Klammern Lehrter Bahnhof ist geschenkt, wer spricht schon so ein Namensungetüm aus, und so endet es damit, daß man, widerwillig, sich an die aufgezwungene Bezeichnung gewöhnt.
Berlin rächt sich auf seine Weise. Denn der Hauptbahnhof zerfiel, aus ganz praktischen Gründen der Orientierung, gleich wieder ortstypisch in zwei Bahnhöfe, so, wie Berlin teilungsbedingt zwei Tiergärten hat, zwei große Opern, zwei Volluniversitäten, zwei innerstädtische Mehringplätze und Karl-Marx-Straßen, zwei Botanische Gärten, zwei Musikhochschulen, zwei Hedwigschöre usw. Hier also: Oberer und Unterer Bahnhof, wie in Falkenhain, Doberlug oder Delitzsch: Zwei Ankunft- bzw. Abfahrtadressen, durch drei hohe Geschosse, schätzungsweise vierzig Meter Höhenunterschied, voneinander getrennt.
Und das ist gerade das Ereignis. Denn die Geschosse sind nicht gegeneinander abgeschottet, sondern durch das riesige doppelte Treppenhaus aufeinander geöffnet, so daß das Tageslicht von oben bis unten fällt und ein Restschein noch auf der untersten, der Tunnelebene, ankommt. Dieses Treppenhaus ist eigentlich der Bahnhof, eine wundersame Transportmaschine, die unaufhörlich schnurrt und Menschenmengen von Ebene zu Ebene befördert, ein unaufhörliches Wogen von Auf und Ab, gespiegelt zwischen Nord und Süd, ein Kontrapunkt der Blicke, der Wege und der ein- und ausfahrenden Züge, ein Ineinander von Schauen und Bewegen, von Zielstrebigkeit und Zweckfreiheit.
Auch als Ingenieurleistung handelt es sich um ein Wunderwerk. Im Rohbau sah man es noch weit deutlicher, daß die unglaublich hohen Stützen tatsächlich von der Sohle bis zur obersten Ebene den ganzen Bau durchziehen, tragend wie die schlanken Pfeiler einer spätgotischen sächsischen oder bairischen Hallenkirche. Der dadurch erschlossene Raum war allerdings funktional zu füllen, Zwischengeschosse, Treppen, Fahrstühle. Da beginnt die Architektur: Der Halle sind andere Typologien eingeschachtelt, der Zentralraum des klassischen Kaufhauses mit seinen Rolltreppen, Diagonalperspektiven und Oberlichtern, aber auch die nie gebaute Architekturidee des in Endlosschleifen auf sich selbst zurückführenden, bei aller Raumweite verschlossenen Raumes. Diese Architektur ist also so etwas wie der Traum, den schon Generationen von Architekten vorgedacht haben und den nur zufällig nun das Hamburger Büro GMP[6] realisiert hat, auf der Mitte zwischen den barocken Carceri des Kupferstechers Piranesi und dem frisch umgebauten neuen Kaufhof am Alexanderplatz. Wie viele überdimensionierte Atrien sind in den neunziger Jahren in der Friedrichstraße und Umgebung gebaut worden – auch der von GMP in der Friedrichstraße. Hier, im Hauptbahnhof, ist weder Leere noch Sinnlosigkeit, hier ist das Atrium der Eisenbahnstadt, das sein mußte, ein Ort, der es nicht zuletzt den Massen der Ankommenden und Abfahrenden erlaubt, sich selbst als Subjekt zu erleben, sich anzuschauen.
Eben kein Einkaufszentrum mit Gleisanschluß. Das ist die zentrale Leistung von Gerkans, des Architekten: Er hat es durchgesetzt, daß die Bahn und ihre Benutzer im Mittelpunkt stehen, während der kommerzielle Besatz unauffällig in die Seitenfächer eingeordnet ist, nicht mehr, als man erwartet und inzwischen wohl auch braucht.
Wenn man dann allerdings auf der Erdgeschoßebene das Glashaus verläßt, überfallen einen Zweifel, ob man tatsächlich in Berlin angekommen ist. Ich tue das gewöhnlich über das Nordportal, und da ist jedes Mal wieder ein Schock fällig. Wo bin ich? Man steht mitten im Nirgendwo der Berliner Nachkriegszeit: Ungebautes, eine Verkehrsachse, Fragmente historischer Zustände, und das unbestimmte Gefühl eines über Jahrzehnte, wenn nicht noch viel länger angesparten Planungsdefizits. Links liegen Mauerreste des Zellengefängnisses, zum Park umgebaut, den fast nur die Radfahrer kennen und als Abkürzung benutzen. Rechts die Bauten der einstigen Hamburger Bahn, geradeaus blickt man in die Tiefen des Nirgendwo, wo einmal das Europaviertel entstehen soll. Immerhin gibt es im Vordergrund die Bushaltestelle und auf der anderen Straßenseite eine Budenzeile aus der dritten Welt.
Kaum besser steht es, wenn man den Südausgang wählt. Es geht – das riesige der Glasfenster der Südfassade versprach es schon – erst einmal ins Helle. Aber auch hier ein Vorplatz, der bloß Warteplatz für noch nicht Gebautes ist, Fläche, Gedränge, Taxis, auch hier ein Hauch von Süden, von Kalamata und Karawanserei.
Was wird in ein paar Jahren sein? Büro- und Hotelbauten werden kommen, allerdings nichts, was Stadtalltag für normale Menschen zuließe. Geplant ist Würfel neben Würfel für Funktionseliten und eher abgehobene Einkommensschichten. Was früher ein Bahnhofsviertel ausmachte, Puff, Kaschemme, Spielhalle, hier wird das keine Chance haben. Dies bedacht, kann man eigentlich nicht ungeduldig sein. Das Niemandsland von heute ist, der Reisende möge es glauben oder nicht, mehr Berlin als das, was kommen wird. So vergißt man nicht so schnell, wie viel Niemandsland es vor der Wende hier, beidseits und entlang der Mauer gegeben hat.
Alex
Er macht seinem Ruf alle Ehre. S- und Straßenbahn, Regionalzüge und Busse, Autos und Parkplätze schaufeln unaufhörlich Menschenmassen auf die Fläche. Nirgendwo sieht man in Berlin so viele Menschen durcheinander laufen und nirgends im Stadtgebiet auch so verschiedene (nur am Bahnhof Friedrichstraße schneiden sich noch so viele S-, U-, Straßenbahn- und Bus-Linien). Hier sind weit mehr Verkehrsachsen auf Tuchfühlung gebracht als am Potsdamer oder Breitscheidplatz. Wo sonst in der Innenstadt ist die begehbare Fläche so sehr mit unterirdischen Tunneln, Schächten, Gängen durchzogen, gäbe es eine solche Spiegelung des Getümmels zwischen Oben und Unten? Kurz, der Alexanderplatz ist unbestritten der mächtigste Verteiler der Stadt.