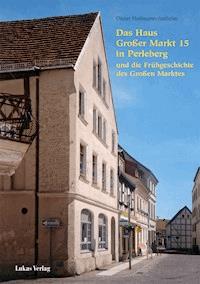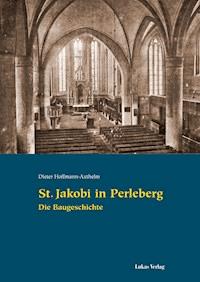Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum Freiheit, wessen, wozu und wovon: wir sind gewohnt zu fragen, als gäbe es die eine, für alle und alles gültige Freiheit. Aber der singuläre Freiheitsbegriff scheitert an der Komplexität realer Verhältnisse. Wovon man reden kann, ist das Zerfallsprodukt: viele miteinander unvereinbare Freiheiten, die ihren Sitz in den Machtknoten der Gesellschaft haben. Was an Freiheiten real möglich ist, wird sich also nur im reflexiven Durchgang durch diese Knoten ergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Warum und wozu?
Freiheit denken
Die Freiheit der Nationen
Die Freiheit der Macht
Die Freiheit der Demokratie
Die Freiheit der Einzelnen
Die Freiheit der Vielen
Die Freiheit des Marktes
Ein Endzweck dieser Freiheiten?
Statt eines Literaturverzeichnisses
Warum und Wozu?
Dies ist, anders als der Titelbegriff Freiheit vielleicht erwarten läßt, ein Buch ohne Mittelpunkt: Es geht von Ort zu Ort, von Freiheit zu Freiheit, ohne bei einer alle ihre Möglichkeiten integrierenden Freiheit anzukommen. Jedes der acht inneren Kapitel hat seine Teilankunft und dementiert damit die der vorhergehenden oder nachfolgenden. Gerade so findet die Untersuchung aber ihren Zweck. Wenn es keine Mitte gibt, gibt es doch einen politischen Nutzen: die Einsicht, daß erst die wechselseitige Kritik, welche die zerstrittenen Freiheiten aneinander üben, die Möglichkeit der Sache offen hält. Die klassische Frage, ob und wie Freiheit zu begrenzen wäre, ist damit dem individuellen Unvermögen entzogen und in jene leere Mitte gestellt, die wir Gesellschaft nennen – eine Übung in politischem Denken.
Die Grundfigur der Untersuchung hat sich allerdings erst im Schreiben hergestellt. Je entspannter ich möglichen Freiheiten nachging, desto eindeutiger individualisierten und lokalisierten sie sich. Keine Freiheit hängt irgendwo in der Luft, und es gibt offenbar so viele Freiheiten, wie es historische Kräfte gibt, die sich aneinander abarbeiten. Die ausgewählten sind alles andere als zufällig, vielmehr typische Aufstellungsorte des Ereignens von Geschichte. Jede dieser Mächte braucht offenbar die Öffnungsklausel einer nur ihr möglichen Freiheit. Die sechs Kernkapitel wollen daher nur ihre eigene Freiheit ausarbeiten, mit dem Effekt, sich wechselseitig zu kritisieren.
Mittendurch geht ein Konflikt zwischen bindenden und auflösenden Freiheiten. Dieses Gegeneinander von Ordnung und Kritik macht die Binnenstruktur der Untersuchung aus. Die Paarbeziehungen ergaben sich von selbst: Nationen – Markt
Macht – die Vielen
Demokratie – Einzelne
Das Muster ergibt keine systematische Schlüssigkeit, aber ein empirisches Beziehungsnetz.
Drittens ergab sich von einem Sachkapitel zum andern eine zeitgeschichtliche Progression. Sie geht etwa von 1945 bis nah an die Gegenwart. Das sieht vielleicht etwas gekünstelt aus, war aber für das Auffinden der Freiheitsformen zu hilfreich, als daß ich darauf verzichten konnte. Dann erhielt es aber seinen eigenen Stellenwert: Die sich ergebenden exkursartigen Einschübe haben jetzt den Zweck, von Kapitel zu Kapitel die gerade beobachtete Freiheit sowohl zeitgeschichtlich wie autobiographisch zu erden. Nicht Nation, Macht usw. an sich sind ja das Thema, sondern was wir heute und morgen damit machen.
Wozu aber das ganze Unternehmen? Weder das Thema Freiheit noch der gewählte Ansatz ergaben sich zwingend aus bisherigen Arbeiten. Darüber, und damit über einige Lebensjahre, entschied ein einziger Augenblick in einem Zeitschriftenkiosk auf dem Parkplatz einer kleinen sardinischen Bergstadt. Neben Zeitungen, Schreibwaren, Lottoscheinen, Zigaretten gab es wie üblich einige Bücher. Ein schmales Bändchen zog den Blick durch sein leuchtendes Grün an, Wiedergabe einer Tagung mit Zygmunt Bauman zur Freiheit in der globalisierten Welt. Ich mußte keinen Satz gelesen haben, der Titel genügte, um zu wissen: Das ist das nächste Thema.
Die Frage, wozu es gut sein könnte, stellte sich nicht. Für mich: zu spät. Für andere, eine Öffentlichkeit? Weder wußte ich, für welche der zahlreichen ansprechbaren Öffentlichkeiten ich schreiben würde, noch, ob es für meinen Versuch überhaupt eine Öffentlichkeit gibt. Auch dies, ob das Vorhaben noch sinnvoll und an der Zeit ist oder kategorial aus der Zeit gefallen, muß ich nicht entscheiden. Offenbar ist ja beides der Fall: Was könnte gegenwärtig aktueller sein als eine Freiheitserforschung, die, statt Ideale zu formen, ein politisches Konfliktmodell entfaltet? Aber einen Verlag hat das Buch nicht gefunden. Demnach fehlt derzeit ein das Risiko einer Auflage deckendes Publikum. So kommt das Buch dank digitaler Plattform im Eigenverlag heraus und muß sich seine Leser selber suchen.
Freiheit denken
1
Das Thema Freiheit stellt man sich nicht, sondern es stellt einen. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit sind also kaum zu unterscheiden. Wie nötig ist es, und wie sinnvoll? Die politische Dringlichkeit ist offensichtlich, wenn man in einer freiheitlichen Demokratie lebt, aber unter Menschen, die nur dazu frei scheinen, sich in Meinungen und Handlungen in mentale Gefängnisse einzuspinnen – Sehnsucht nach Unfreiheit inmitten existierender Demokratie. Dabei weiß ich gut genug, wie eng Dringlichkeit und Vergeblichkeit ineinander liegen.
Andererseits der subjektive Druck: Dieses Thema scheint für jeden individuellen Zugriff zu groß. Ist man ihm überhaupt gewachsen? Man steht davor wie ein Hochspringer vor einer kaum einzuholen Sprunghöhe. Wenn man sich darauf einläßt, ist eine so unzuverlässige Größe, wie es der persönliche Ehrgeiz ist, nicht auszuschließen – daß man es noch einmal wissen will, noch einmal an die Grenzen des eigenen Denkvermögens gehen –, und welchen fordernderen Gegenstand gäbe es dafür als eben diesen, Freiheit?
Immerhin ist das ein Ehrgeiz des Denkens, der ihm gut ansteht, der, wissen zu wollen, was tatsächlich Sache ist. Sonst verbliebe man im Bann eines zu großen Wortes, dem seit je Mißbrauch und Mßverstehen eingeschrieben sind. Freiheit zu denken, und zwar: auseinenderzudenken, macht zwar viel leicht das Denken, mich als Spielball des Freiheitswunsches aber noch nicht freier. Solange man immerhin wissen will, wovon man spricht, ist tatsächlich Denkarbeit nötig, und zwar eine, die dem übermächtigen Begriff ausreichend mißtraut. Das Feld ist zu weit und zu widersprüchlich, als daß eine Antwort, die im nächsten Augenblick noch überzeugte, wahrscheinlich wäre. Statt mit einem entschlossenen Satz – Freiheit ist … – zur Sache zu kommen, tue ich also gut, zuvor meine Chancen zu reflektieren, mich gegenüber einer Sache, die sich zwischen Weltgeschichte und intimster Selbsterfahrung bis zur Fassungslosigkeit entzieht, angemessen zu verhalten.
Denkfähigkeit der Sache und Sachkompetenz des Denkens stehen damit nicht grundsätzlich in Frage. Aber sie stehen zur Prüfung an. Bloßes Denken kommt an die Sache nicht heran. Es hat den Ausnahmegegenstand Freiheit nicht selbst – hat ihn nicht in sich, so wie etwa die Mathematik ihre Aufgaben gleichsam aus sich heraus erzeugt, was einst, auf die Vorstellung Freiheit bezogen, die Illusion ihrer umstandslos naturrechtlichen Gegebenheit inspirierte Ein Sprung auf ein anderes Ufer ist nötig: Rekurs auf Erfahrung. Gedachte Freiheit ist überhaupt nur etwas als Reflexion erfahrener Freiheit. Und nicht bloß von anderen beschriebene oder vor meinen Augen bewiesene Freiheit. Nicht irgendjemand, sondern auch ich muß, zwischen Ergreifen und Verlieren, Freiheit erfahren haben.
Wenn ich mir damit auch noch die Unzuverlässigkeit meiner selbst einhandle, übernimmt das Nachdenken eine umfangreiche, weil grenzüberschreitende Vermittlungsaufgabe, zwischen heutigem Gesellschaftswis-sen, empirischen Freiheitserfahrungen und eigener Zuständigkeit. Mit der Eigenmächtigkeit des Denkens, für die einmal die Philosophie stand, ist es vorbei. Daß man heute ganz anders in die Wirklichkeit getrieben ist, setzt den Vorrang der Empirie über das Denken. Aber welcher? Ohne die Fachwissenschaften kann man über die realen Orte der Freiheit nicht ernsthaft nachdenken. Aber der Erfahrungsvorbehalt treibt auch darüber hinaus, in eine Dimension, welche – Theorie – von Mal zu Mal über die Reichweite fachwis-senschaftlicher Empirik hinauszugehen hat, zugunsten der größeren Empirie von Leben und Geschichte.
Daher ist jetzt erst einmal Geduld gefragt. Die Selbstreflexion des Denkens ist kein Selbstzweck. Sie öffnet das Feld und damit den Blick. Ich gehe in dem Vertrauen los, zwischen Erfassen und Erfahren, zwischen Dezentrierung des Denkens und Vielköpfigkeit der Sache ergebe sich eine Spiegelbildlichkeit, welche die Verfolgung des Ineinanders von Denken und Erfahrung bereits zu einem Vorentwurf in der Sache macht
2
Ich fange mit dem Einfachsten an, der sprachlichen Vereinsamung des Wortes Freiheit. Nachdenken geht zwar meist lautlos im Kopf vor sich, doch ob das, was man denkt, Sinn hat, zeigt sich erst, wenn man es laut ausspricht oder niederschreibt. Schon dem Wenigen, was bisher gesagt wurde, ist anzumerken, wie belastet die Benutzung allein des Wortes Freiheit ist. Innerlich zuckt man erst einmal zusammen, bevor man es ausspricht oder hinschreibt. Haben nicht alle Freiheitssätze etwas leicht Verkrampftes an sich? Man sieht ihnen gleichsam schon den Zweifel hinsichtlich der realen Deckung an – ob nicht ein unverfänglicherer Ausdruck besser wäre. Das Sprachgefühl widersetzt sich – ein Fall von Sprachscham: Das ist kein persönliches Problem. Das Wort ist offensichtlich Opfer seiner Geschichte. Es hängt zu viel Mißbrauch daran, zu viele historische Enttäuschungen. Inzwischen sprechen es gerade diejenigen am lautesten aus, welche jedes Verhältnis zur Sache verloren haben.
Gegenüber seiner aktuellen Karriere als öffentlicher Erregungszünder darf man es aber auch nicht aufgeben. Eigentlich würde man es gern durch Nichtgebrauch schützen. Man muß es aber gerade verteidigen. So geht man am besten mit ihm sparsam um. Ebenso bieten sich mehr oder minder ungeschickte Versuche der Kleinschreibung an, etwa das Wort nur im Plural zu verwenden. Vielleicht bleibt aber von Fall zu Fall auch nur ein Adjektiv oder Adverb übrig, frei, befreiend, befreit, oder ein Tätigkeitswort, frei sein, frei werden, frei lassen, freistellen. Je weiter man den Kreis zieht, desto mehr kommt man allerdings ins Erzählen – wie es war oder ist oder sein könnte, freier zu atmen oder für einmal größer zu sein als man von sich erwartet, was es heißt, gesellschaftlich in Bewegung zu sein, ein kollektives Auf- und Ausatmen zu erleben.
Die sprachliche Schwäche ist aber auch begrifflich nicht zu überholen. Der klassische Freiheitsbegriff ist zu einer Falle des Denkens geworden. Statt Sprachscham widersetzt sich das Theoriegewissen, wenn der Begriff Freiheit eine Einheit der Sache verspricht, die durch keinerlei gegenwärtige Erfahrung gedeckt ist. Der Einheitszwang, Erbe der Transzendentalphilosophie, konnte offensichtlich solange nicht aufgegeben werden, wie man überhaupt an Philosophie als letztbegründender Theoriekompetenz festhielt. Inzwischen fehlt der Glaube. Zu deutlich bricht sich die intellektuelle Anstrengung an den historisch-politischen Voraussetzungen jeglicher Freiheit, Voraussetzungen, die von sich aus unterscheiden, so daß dem Denken nichts anderes übrig bleibt, als die realen Auftrittsorte aufzusuchen und seinen Gegenstand im Maß ihrer Aufspaltung zu denken.
Das heißt nicht, daß die bisherige Begriffsgeschichte ohne Bruchstellen wäre. Jede begriffliche Fassung war ein Machtspruch, der mit seinem Widerspruch leben, also auch ein bestimmtes Maß an gesellschaftlich Unversöhntem erinnern mußte. Andererseits hat die realhistorische Entfaltung unterschiedlicher Freiheiten nicht dazu geführt, daß es zu einer Aufspaltung in konkurrierende Begriffe gekommen wäre. Nur die angloamerikanische Tradition kann zwischen lateinischer und germanischer Wurzel wählen, zwischen freedom und liberty. Bei John Locke kann beides im selben Satz vorkommen, aber liberty wird gewählt, wenn es um persönliche Freiheit geht, einschließlich des deutlicheren Plurals liberties; freedom dagegen, wo um den politischen Zustand der Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert gimg die Zudringlichkeit politischer Freiheit schon so weit, daß der Liberalismus sich auf die Position des Selbstschutzes zurückzog – »On Liberty« nannte J.St. Mill, ohne erkennbaren Zweifel, den für das Thema Freiheit maßgeblichen Essay. Der entschiedenste Verfechter dieser abwehrenden Freiheit war im 20. Jahrhundert Isaya Berlin. Für das wirkungsmächtigste seiner Bücher wählte er den Titel »Four Essays on Liberty«.
Umgekehrt die kontinentale Tradition. Ob Machiavelli, Johannes Althusius, Spinoza, Montesquieu, Rousseau, die Verfassungen ab 1789 oder das Kommunistische Manifest, Freiheit ist auf dem Kontinent vorrangig vom Modell der griechischen Polis bzw. der römischen res publica her gedacht worden: Freiheit als Attribut von Gesellschaft, und nur so auch von Einzelnen. Daß es allerdings im freiheitsfeindlichen 20. Jahrhundert überhaupt noch zu einem überzeugenden Gegenentwurf zum angelsächsischen Freiheitsindividualismus kam, verdankt sich allein einer Philosophin, die von den Nazis ins US-amerikanische Exil vertrieben wurde, Hannah Arendt. Athen und Machiavelli zusammendenkend, hat sie die kontinentale Frage nach der gesellschaftlichen Möglichkeit der Freiheit noch einmal gestellt: »What is freedom?« Darin scheint der englische Begriff unteilbarer Freiheit durch, mithin der Synthesezwang des deutschen Idealismus, im Gegensatz zur US-amerikanischen Gewohnheit, freedom mit Privateigentum zu verbinden und liberty mit individueller Willkür.
Jede Ermächtigung der einen oder der anderen Seite zahlt natürlich ihren Preis. Auch Hannah Arendts Verklammerung von Polis und neuzeitlicher virtus des Politischen zahlt ihn, wenn sie in letzter Instanz Freiheit als Anfangen zu retten hofft. Wie viel Überwölbung des realhistorisch Möglichen ist dem Denken in Zeiten notwendiger Selbstenttäuschung erlaubt? In der Anfangsmetapher verklammert Arendt ja, über zwei Jahrtausende hinweg, nicht weniger als Antike und Neuzeit, das griechische archein (»Anfangen, Führen, und, schließlich, Herrschen«) und die Französische Revolution. Voraussetzungsreicher kann gar nicht argumentiert werden. Aber wie viele historische Opferstrecken darf ein Argument mitschleifen, noch dazu ungenannt? Den jeweiligen Preis dieser Anfänge würden wir heute jedenfalls freiwillig nicht mehr zahlen wollen. Das ist weniger ein Argument der Kritik als die Realisierung des eingetretenen historischen Abstands. Daß Unterbrechung und Neuanfang realhistorische Möglichkeiten seien, bleibt unbestritten. Die Hypostasierung des Anfangs zu einem Denkmodell, das nicht weniger leisten soll als die Rettung des Politischen aus seiner historischen Agonie, überfordert das Maß an Denkmut, das man sich in unseren postheroisch postrevolutionären Zeiten noch zutraut.
Daß Arendt selbst von der Tragfähigkeit ihrer Übersetzung des Wortes Freiheit nicht ganz überzeugt war, kann man daraus schließen, daß sie einen weiteren Rettungsversuch nachschob, der über eine Analogie aus der Natur läuft: Anfangen als Unwahrscheinlichkeit jener naturgeschichtlichen Sprünge, die die Entstehung der Erde und des Lebens auf ihr möglich machten. Das Wunder evolutionärer Sprünge – etwa daß Leben entsteht, Einzeller sich in Pflanzen und Tiere ausdifferenzieren, Säugetiere auftreten und Hominiden sich in Affen und Menschen auseinander entwickeln, auch diese Kette naturgeschichtlicher Anfänge steht ja außer Diskussion. Aber die biologische Analogie deklassiert wiederum die Geschichte, ist also, bezogen auf historische Umstände, illegitim.
Es sieht damit so aus, als werde man mit Macht auf die andere Seite gedrängt, von freedom zu liberty, von Arendts Freiheit des Politischen zur residualen Freiheit der Einzelnen, definiert durch »jenes Höchstmaß an Nichteinmischung, das mit den Mindestanforderungen des gesellschaftlichen Lebens verbunden ist« (Isaya Berlin, Freiheit, Vier Versuche, Frankfurt 1945, 243). Damit ist der politischen Freiheit im Grundsatz jedes Recht gegen die sie beanspruchenden Einzelnen abgesprochen. Wo bleiben diejenigen Freiheiten, die der Freiheit der Einzelnen begrenzend entgegenstehen? Der Staat etwa kann mindestens so gut beanspruchen, Subjekt von Freiheit zu sein wie die Individualität. Ihn zur Serviceeinrichtung zu degradieren, wäre der Versuch, den historischen Prozeß an einem willkürlichen Punkt stillzustellen. Da fängt nichts mehr an, vielmehr wird die Summe historischer Enttäuschungen gezogen.
Doch wiederum geht es nicht um eine Kritik in der Sache, sondern um die Tragfähigkeit jenes Adjektivs, mithilfe dessen Berlin seinen Abwehrzauber vollführt: negativ. Das Sachargument – daß das historische Experiment des Neuanfangs zu gefährlich sei und die Option positiver Freiheit bereits die Gefahr des Bolschewismus impliziere – kann man auf dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts verstehen. Das Reduktive rechtfertigt sich aber zu deutlich nur subjektiv, gleichsam aus Lebensangst. Die gebildete Individualität vor Augen, für die er sich selbst Modell war, weigerte Berlin sich zu sehen, wie sozial voraussetzungsvoll und damit exklusiv diese sich monadisch einkapselnde Freiheit ist. Abgesehen davon, daß es eine Illusion ist anzunehmen, persönliche Freiheit sei bloß durch Institutionen und Massen gefährdet. Je tiefer man in sich hineinhorcht, desto nichtindividueller, kollektiver, also auch desto gefährlicher wird es, und wer wollte behaupten, daß er oder sie vor sich selbst ganz sicher sei.
Ich habe damit die beiden entschiedensten Freiheitstheorien des 20. Jahrhunderts weder ausreichend dargestellt noch gar einer angemessen Kritik unterzogen – das war aber auch gar nicht die Absicht. Die Absicht war zu zeigen, daß sie, sowohl als Begriffsversuche wie als Antworten auf ihr Jahrhundert, ein Ende markieren, gleichsam alte Welt. Was sie retten wollten, ist nicht mehr zu retten. Um die Denkfigur der Gegenläufigkeit von politischer und individueller Freiheit kommt man zwar nicht herum, aber auch sie gewinnt auf dem Hintergrund der Auflösung des historischen Vereinigungszwanges genug Bewegungsfreiheit, um unter Gegenwartsverhältnissen brauchbar zu sein.
3
Nun hat man ohnehin die letzten fünfzig Jahre, falls man sie als Intellektueller gelebt hat, in einem Trainingslager des Methodenverdachts und der Begriffszerlegung verbracht – Abschütteln von Methodenzwang zugunsten freihändig gewählter Ansätze mit begrenzter Laufzeit; Sturz der großen Signifikanten, mithin des Subjekts; Befreiung der Prädikate aus der Herrschaft des Substantivs, Ermächtigung des Partikularen und seiner Zentrifugalität; Demaskierung des Begriffs als Festung des Patriarchats, mithin der wurzelhaften Männlichkeit alles bisherigen Denkens; Kulturalisierung als Lösemittel einer Feminisierung des Denkens; fortlaufende Vertragskündigungen dank Gender und multipler unterdrückter Identitäten und Kritik europäischer Selbstgewißheit als Funktion der Kolonisierung vorgeblich niedriger Denkkulturen – und kein Ende abzusehen.
Umgekehrt gibt es genug Anlässe zu fragen, wie weit diese Auflösungen überhaupt noch aufklärend wirken. Soweit sie Verantwortlichkeiten eher verschütten als aufdecken, etwa von Tätern ablenken zugunsten von Schicksalen und Konstitutionen, schlagen beanspruchte Freiheiten, wie man sieht, schon wieder in Freiheitsbeschränkungen um. Man fällt gleichsam auf den Stand des Mythos zurück. Im Mythos wird das Opfertier im Freiheitsrausch der Bacchantinnen zerrissen, ob der Gott, Dionysos, oder der arme Pentheus. Der Mythos beschreibt den Grenzfall: keine Freiheit, aber Rausch der Bindungslosigkeit.
Macht der Theorieanspruch dann aber überhaupt noch einen Unterschied aus? Weder gibt es eine Grenzlinie – ab hier ist Denken Theorie –, noch eine sinnvolle Scheidung der Gegenstände – auch über Abstraktestes, Gott oder Bit, kann man ohne Theorieanspruch nachdenken. Damit das Nachdenken theorierelevant wird, hat es eine spezifische Distanz aufzubauen, gegenüber seinem Gegenstand wie gegenüber allen vorreflexiven persönlichen Gewißheiten. Es gibt für diesen Übergang kein Kontinuum. Man betritt einen anderen gesellschaftlichen Raum und unterwirft sich, obwohl es sich dabei inzwischen um einen wesentlich postheroischen, für die historisch gewohnten Überlegenheitsgesten ungeeigneten Raum handelt, den darin geltenden Regeln. Wer Theorie sagt, will sich und anderen eine Bindung bewußt machen, die, indem es nicht bei Null anfängt, sein Sprechen oder Schreiben unweigerlich eingeht: Theorie als diejenige Form von Nachdenken, die eben noch weiß, daß sie zweieinhalb Jahrtausende Philosophie und Theologie im Rücken hat. Damit stellt man sich, ob man will oder nicht, einer Konkurrenz um das Recht auf Zugehörigkeit. Nach Maßstäben historischer Erfahrung und individueller körperlicher Existenz^ zu denken, unterscheidet zumindest von einer Industrialisierung des Denkens und Wissens, die im Projekt künstlicher Intelligenz ihren Fluchtpunkt hat. Denken, daß sich in der ki spiegelt, ist schattenlos, die ki der Atheismus des Denkens. Wie der Atheismus, indem er etwas behauptet, was er nicht beweisen kann, das Negativ des Glaubens bleibt, den er loswerden will, so die KI das Negativbild der verlorenen Selbstbegründung des historischen Denkens.
Wer sich auf Freiheitstheorie einläßt, hat als Gegengewicht gegenüber der verhärteten Vorgeschichte nur die reale Erfahrbarkeit der Sache, gesellschaftliche wie individuelle Erfahrungsfähigkeit. Sonst wird man von der Macht des historisch Gedachten aufgefressen oder bestenfalls zum Literaturwissenschaftler der Philosophie und Theologie aller Zeiten. Zwar lernt man, was selbständiger Theorieanspruch ist, nur vom historischen Denken. Ohne die historische Denkschule stände man ohne Kompaß da. Man braucht die historische Last, um den Komplexitäten der eigenen Gegenwart nicht fassungslos gegenüberzustehen, soll sich aber nicht einbilden, man könne fortsetzen, wo die letzten dem Anspruch Philosophie verhafteten Theoretiker aufhörten. Ob eigenes von fremdem Denken zu scheiden ist, ist dabei uninteressant. Man kann nur im fremden Denken sicher werden, selbst zu denken. Was an historischen Freiheitstheorien dran ist, merkt man überhaupt erst, indem man sie sich zu eigen macht. Daß man von der Übergriffigkeit der historischen Freiheitsbestimmungen nicht umgeworfen wird, dafür sorgt der begleitende subjektive Einspruch: Ich muß mit dem, was ich denke, noch bei mir bleiben, es bewahrheiten, vor mir vertreten können. Die Zusammenstöße sind so unvermeidlich, wie der Bruchpunkt evident ist: die Art und Weise, wie alle historischen Freiheitstheorien das Denken zugunsten eines Zwecks funktionalisieren. Sich diesem Hineingeschicktwerden in jeweilige gesellschaftliche Notwendigkeit zu widersetzen, macht eigenes Denken aus. Wieder und wieder wird man sich sagen: Das ist historisch konsistent, aber das kann nicht mehr mein Zweck sein.
Worauf stützt sich dieser Widerspruch? Offensichtlich auf eine so belastete wie nicht zu vermeidende Evidenz. Der Verweis auf Evidenz sistiert das Denken nicht, bringt es aber an seinen kritischsten Punkt, die Schnittstelle von Reflexionsprozeß und Unmittelbarkeit der Erfahrung. Im Erfahrungsmodus tritt eine jeweilige Subjektivität als Auftraggeber des Denkens auf, ein Ich, das sich das Erfahrene zuordnet, es ohne Reflexion aber nicht kann. Ob an diesem Punkt Reflexion zugelassen wird, entscheidet über die Glaubwürdigkeit. Bloße Unmittelbarkeit ist zu leicht manipulierbar – da übernehmen Sehnsüchte, Verletztheit, Affekte wie Haß, Trotz, Wut die Führung. Man fabriziert Pseudoevidenzen nach dem schlichten Muster, dies sei nicht so, sondern etwas ganz anderes.
Evidenz heißt: Es leuchtet unmittelbar ein. Soll das Mißtrauen des Denkens davor Respekt haben, darf zumindest das Erfahrene nicht offensichtlich erfahrbaren Tatsachen widersprechen (wenn eine Epidemie Tote hinterläßt, ist die Behauptung, der tödliche Virus sei eine Erfindung der Presse, nur für den Behauptenden und seinesgleichen evident). Es wird natürlich sehr viel schwieriger, wenn etwas innerlich erfahren wird und keine Särge oder volle Krankenbetten den Gegenbeweis führen. Dann stößt die Denkkontrolle auf das kompakte Set von Wünschen und Affekten, Einstellungen und Vermeidungshaltungen, die sein jeweiliger Auftraggeber mitbringt. Wie kann da auf Evidenz Verlaß sein?
Gewißheit wird ja desto knapper, je intimer und realistisch gesehen unwahrscheinlicher das Erfahrene ist, und wenn wohl kaum etwas so unmittelbar und zugleich so fragwürdig wie die Erfahrung von Freiheit, dann ist es stets einfacher sich bloß einzureden, man sei frei (dabei widerlegt die Freiheit als Autofahrer oder Konsument im Supermarkt sich schon, sobald man sich die Zwänge zugibt, die man dafür eingeht). Doch hat die Evidenz erfahrener Freiheit keine andere Basis als die Selbstwahrnehmung: das ganz unmittelbare Gefühl, frei zu sein.
Das Medium von Selbstwahrnehmung ist Leiblichkeit –kein bloßer Verweis auf unsere fünf Sinne, sondern auf jene sensorische Gesamttätigkeit, dank derer man sich nicht nur seiner Umwelt, sondern zuerst seiner selbst versichert. Ob ich tatsächlich frei bin (und wie weit, worin und wozu), kann ich so wenig an mir sehen, wie ich es schmecken oder riechen, hören oder ertasten kann, ich kann es nur spüren. Mehr als die Unmittelbarkeit des Fühlens habe ich nicht. Ihr muß ich trauen können, und trauen kann ich ihr nur über einen Bestätigungsprozeß, den ich reflexiv mit mir selbst auszumachen habe. Es ergibt sich, anders gesagt, als Urteil der Vernunft, – altmodisch gesagt, als das Urteil: Das ist wahr. Dieses Urteil bleibt, als Urteil über Freiheit, diskursiv so verdächtig wie alle Berufung auf Wahrheit und nur solange unschuldig, wie es ohne Anrufung von Autoritäten auskommt. Trotzdem läßt es sich begründen. Ich schlage dazu einen Umweg vor. Sieht man sich nach einem säkularen Maßstab um, der einen vergleichbaren Individualisierungsgrad aufweist, doch einen weniger hohen Einsatz impliziert, dann kommt am besten das Kunsturteil in Frage.
Dieses ist kaum weniger verdächtig. In der öffentlichen Wahrnehmung heute weitgehend durch eine Sekundärschicht von Kuratorendominanz und Jury-Entscheidungen überdeckt, von Kämpfen um Einfluß und Karrieren, um Marktzugang und Marktpreisen, ist es nur mit einer zwangsläufig elitären Annahme zu beanspruchen: daß man als Einzelner kompetent genug ist – daß man selbst wirklich sehen oder hören kann, sobald man sich ganz auf ein Kunstobjekt oder eine Kunstaktion einläßt. So vollständig man damit von der eigenen Urteilsfähigkeit abhängt, muß man aber trotzdem, allein um vor sich selbst glaubhaft zu sein, für sein Urteil eine intersubjektive Anerkennbarkeit beanspruchen. Was wäre es sonst wert? In diesem Punkt ist man also über Kants »Kritik der Urteilskraft« nicht hinaus. Daran haben auch die im Zuge der Moderne erfolgten Erweiterungen des Kunstmöglichen nichts geändert, weder die Destruktion des Schönheitsbegriffs noch die zugehörigen Grenzverwischungen zwischen Kunst und Zufall, Ding und Idee, Werk und Rezeption. Daher gilt auch noch eine klassische Vorbedingung: Ich muß, um überhaupt dahin zu kommen, in einem bestimmten Maße von mir abwesend sein. Wäre ich vorrangig mit mir selbst beschäftigt, käme ich an das Kunstwerk nicht heran, ich muß das Kommando an das abgeben, was da ist. Dann können einem noch so viele Leute versichern, sie sähen das ganz anders – diese Gewißheit des Treffenden, Gelungenen, Richtigen ist nicht verhandelbar. Man kann sich ja selber nicht dagegen wehren.
Sollte das Gefühl, frei zu sein, leichter verhandelbar sein? Im Unterschied zum Kunsturteil fehlt ja der außer mir befindliche Gegenstand, das, was die Kunsterfahrung im Kunstobjekt hat. Freiheit ist gegenstandslos. Ihr einziger Gegenstand sind wir selber. Man erlebt nicht etwas, sondern man muß sich selbst als befreit oder freier erleben. Man kann sich Freiheitserfahrung deshalb auch nicht selber verschaffen wollen, anders als Kunsterfahrung, auf die ich mich bewußt einlasse. Noch die kleinsten persönlichen Freiheitsgefühle sind weder machbar noch, einmal erfahren, einfach. Ich kann nicht morgens aufstehen, um mich frei zu fühlen.
Wäre man aber mit einer Erfahrung von Freiheit zufrieden, die ausschließlich bei einem selber hängen bleibt? Die eigene Erfahrung wäre doch wohl zu schäbig ohne ihre bewußte oder auch unbewußte Teilhabe an gesellschaftlicher Freiheitserfahrung, unabhängig davon, wie bescheiden man die eigene Erfahrung einschätzen mag. Vor allem sollte es, bei aller anzunehmenden Entfernung der Ebenen individueller und kollektiver Erfahrung, um ein und dieselbe Evidenz des Freiseins gehen. Der Einwand, daß über kollektive Erfahrung schwieriger zu urteilen ist, läßt sich ja leicht entkräften. Auch wenn man immer weniger zu sagen weiß, wen man eigentlich anspricht, weil Subjektbestimmungen wie Volk, Nation, Klassen und Schichten so fragwürdig geworden sind wie das Gesamtsubjekt Menschheit, und man am Ende bei einer Vermutung stehen bleibt: Gesellschaft: Es gibt die Selbstaussagen. Die ganze Frage ist, nicht ob, sondern wo diese Gewißheit des Erfahrenen in der Dimension erfahrener Geschichte festzumachen ist.
Der offensichtlichste Fall ist der einer großen historischen Freiheitserfahrung. Etwa der Mauerfall: Mit einem Schlag ist das Unmögliche möglich, weil nicht einige gegen die Zäune anrennen, sondern Mengen, und am Ende können sie sich sagen: Wir waren es, oder: Wir sind frei geworden. Obwohl zu klären bleibt, was man wirklich getan oder in Sachen Freiheit gewonnen hat, ist das Ereignis groß genug, um für die Beteiligten evident zu sein. Dann folgt die kollektive Nachbearbeitung, welche die gefühlte Evidenz ins historische Urteil überführt. In dieses Urteil gehen nicht nur die Stimmen der Verlierer ein, sondern auch die Erfahrungen, die alle Beteiligten mit den Folgen gemacht haben, und noch dann bleibt jedes Urteil Gegenstand von über die Jahrhunderte fortgesetzten wissenschaftlichen Kontroversen und interessierten politischen Berufungen.
Wie unterscheidet man davon aber jene Massenereignisse – Revolten, Tumulte, sonstigen Siedepunkte kollektiver Erregung –, die vielleicht als historische Ereignisse zählen werden, aber nicht als Freiheitserfahrungen? Daß man anhand der Folgen urteilt, ist nur die eine Seite. Die andere ist die gefühlte Evidenz der Revoltierenden. Wenn ein Mob in Washington das Capitol stürmt, ist nicht nur die Wut, sondern unter Umständen auch das Freiheitsgeschrei groß. Warum glaubt man es nicht? Ein kollektives Außersichsein, dank dessen sich die Beteiligten endlich einmal selbst als mächtig erleben, ist den Revoltierenden ja nicht abzusprechen, und zwar desto weniger, je gewalttätiger sie vorgehen. Wo also liegt der Unterschied? Offenbar sind sie zu sehr nur bei sich selbst und ihren privaten Versagungen. Darüber verfehlen sie jene Positivität von Freiheit, die ihre Behauptung auch für Beobachter evident machen würde: daß sie nicht sich, sondern freiere Gesellschaft erfahren haben (also auch etwas für die Gesellschaft wollen, nicht bloß gegen sie).
Das Über-sich-hinaus ist nun auch diejenige Qualität, welche die individuelle, scheinbar nur private Freiheitserfahrung als solche zur Evidenz bringt. Es ist zwar reine Empfindungssache zu spüren, daß alle subjektiven Freiheiten letztendlich schäbig bleiben, wo sie nur der privaten Selbstoptimierung dienen. Aber gerade dafür gibt es ein Höchstmaß an gefühlter Evidenz – immer dann, wenn man an sich oder anderen dem realen Schäbigwerden begegnet. Man kennt es an sich, wann immer man im Leben zu kurz gegriffen hat, es etwa an Großzügigkeit fehlen ließ und feststellt: Ich war nicht frei genug. Man glaubt, es in all jenen Existenzen zu kennen, die, weil sie das Geld dazu haben, meinen, sich alles kaufen zu können und niemandem außer sich selbst etwas schuldig zu sein. Es gibt offensichtlich keine individuelle Freiheit, die sich erlauben kann, sich vom Zu- und Einspruch kollektiver Freiheit zu emanzipieren, ohne zu degenerieren.
4
Die Brechung von Theorieanstrengung durch Erfahrungskritik mündet nicht in Fassungslosigkeit. Wenn keine denkbare Freiheit irgendwo in der Luft hängt, sondern von Geschichte abhängig ist, damit letztlich Gesellschaftserfahrung, kommt die Fassung gleichsam von außen, aus dem Material der Wirklichkeit. Alles Normative scheidet aus. Stattdessen folgt daraus ein Heraus arbeiten des Eigensinns der vielen Freiheiten, die man den Geschichte ausmachenden Mächten zumuten darf. Daraus ergibt sich das für diesen Versuch entscheidende methodische Postulat. Wenn jede Methode Absicht ist, reduziert sich die Aufgabe auf einen, Wissen und Erfahrung kumulierenden Punkt: Was ist, von einer Aufstellungsform zur anderen, tatsächlich der Fall, was ist möglich, was nicht? Ich will weder mich noch andere einmal mehr von der Möglichkeit der Freiheit überzeugen, sondern wissen, was es hier und heute damit auf sich hat.
Jede Freiheit ist damit ein Neuanfang. Man vergißt gleichsam, was man von der vorhergehenden gelernt hat, um ihr so unbefangen wie möglich zu folgen. Am Ende ist man jedes Mal ganz von ihr gefangen, fast in der Illusion, jetzt die wirkliche Freiheit vor sich zu haben. Es reicht aber, das Kapitel zu schließen, um beim nächsten tastenden Neuanfang zu stehen, gezwungen, sich einmal mehr in unbekanntem Gelände zu orientieren. Die Vorstellung einer Bewegung im Raum stellt sich nicht ganz zufällig ein. Jede Freiheit wird auf diese Weise ein autonomer Denkort. Aber man muß ihn auch wieder verlassen. Der Denkweg geht von Ort zu Ort, bemüht, einem jeden so weit wie möglich gerecht zu werden. Methodengeschichtlich kommt das dem Denkstil der Scholastik nahe, die in Topoi dachte, in einer Bewegung des Denkens von einem Denkort zum nächsten, wobei die Route von Topos zu Topos so landkartenartig feststand wie die Abfolge der Küstenhäfen in den Portolanen, den Landkarten der mittelalterlichen Küstenschiffahrt.
Der Wechsel von einem Freiheitsort zum nächsten stellt aber vor ein Stoffproblem. Jeder Denkort bringt seine Umwelt an Geschichte, Praxis, Wissenschaft, individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten mit einer Übermacht von Stoffspezifik und Expertenwissen mit. Um damit umgehen zu können, sollte man weder zu sehr institutionell gebunden noch wissenschaftsmethodisch zu schwer bewaffnet sein. Der Stoff, und jeweils viel Stoff, ist nötig, um nicht mit leeren Begriffen zu hantieren. Ob man das Stoffproblem als Einzelner noch bewältigen kann, muß man sich dann schon fragen lassen. Aber wäre es eine Alternative, statt als Freibeuter im Verbund von Instituten und fremdfinanzierten Forschungsprojekten den Wegen der Freiheit nachzugehen? Daß die Teamwork-Wissenschaft unserer Tage der Sache eher gewachsen wäre, bezweifle ich.
Die Konkurrenz der Erkenntnissysteme muß ich also aushalten können. Es ist ja durchaus fraglich, was die digital gestützten Wissenssysteme tatsächlich an Erkenntnis hervorbringen – dieses altmodische Wort bewußt gesetzt, im Gegensatz zu Wissensmenge und atrophischer Verarbeitungsfähigkeit. Die Verlagerung des Wissens aus den Köpfen in die Rechner und ihren Hintergrund, der digitalen Wolke, entlastet, ist aber letztlich unproduktiv. Das Maximum an Datenmengen, das man einem einzelnen Kopf zumuten kann, mag noch so sehr gegenüber den digitalen Systemen im Nachteil sein: Nur der einzelne Kopf ist in der Lage, disparate Fülle in Erkenntnis, etwas Neues, zu verwandeln. Mehr als eine durchschnittliche Kenntnis der jeweils aufgerufenen Verhältnisse ist daraufhin weder zu fordern noch zu erwarten. Damit ist man auf die eigene Korrekturfähigkeit und -willigkeit angewiesen. Der individuelle Kopf ist ja nicht verschlossen. Das Korrektiv ist, sich allem auszusetzen, was ihm in actu entgegenkommt, eine wieder und wieder ansetzende Konfrontation mit Behauptungen und Begründungen, Verhältnissen und Nachrichten aus aller Welt, Ereignissen und Umständen. Alles, was sich an Umwelt tagtäglich ergibt, ist Gelegenheit dazu, ob Gespräche unter Freunden und Feinden oder die gesamte Medienwelt, Bücher, Zeitungen, Features, Rundfunkkommentare usw. Oft sind gerade die ephemereren Medien die besseren Auslöser des Zweifels und die besten Anreger eines aufwachenden Blicks auf die heutige Welt, das Aktuelle des Tages – wie käme ich voran ohne die unausweichlichen Anstöße, die gerade Alltagsereignisse, zufällige Bemerkungen anderer, Funk und Tageszeitungen einem täglich vor die Füße werfen – ein nicht nur nicht absehbares, sondern auch höchst disparates Material, dem ich, wenn überhaupt, nur dank sparsamster Auswahl einigermaßen gerecht werden kann.
Der Zusammenstoß des Disparaten zwingt die Reflexion zu einem ständigen Neu- und Wiederansetzen. Das Gesamt der Anregungen, indem es jeweils verschiedene Register der Freiheit aufruft, zerreißt nicht nur die Freiheit, sondern auch das Denken. Es gibt dann zwar noch einen Autor, aber er steht nur inmitten, oder vielleicht besser am Rande des Streites der Freiheiten untereinander, weder fähig noch willens, ihn zu entscheiden, Beobachter und nicht Schiedsrichter, nur dafür verantwortlich, jeder einzelnen Freiheit ihre zugespitzteste Formulierung zu glauben.
Die Freiheit der Nationen
5
Es ist die erste und älteste Freiheit, und darin die Mutter aller weiteren Freiheiten: derer, die man kennt wie derer, die sich in Zukunft noch entfalten dürften. Die Freiheit der Nationen ist dank ihrer Erstgeburt denn auch die einfachste und damit die am wenigsten mißverständliche Freiheit. Sie ist es aus dem schlichten Grund, daß sie bewaffnete Freiheit ist. Es gibt sie nur, weil für sie gekämpft wird. In ihrer rohen archaischen Form hat sie nichts Ideales, man muß nicht an sie glauben, sondern macht sie praktisch glaubhaft, und ohne die über alle Einzelnen hinweggehende Voraussetzung, daß sie Menschenleben kostet, ist von ihr gar nicht zu reden.
Das Szenario der in Waffen um ihre Freiheit kämpfenden Nation klingt heute unter Westeuropäern wie eine Erzählung aus einer anderen Zeit. Das liegt nicht nur an der zumindest im Westen eingetretenen Blässe des Nationalen. Davor liegt schon die mentale Weigerung der Individuen: Daß man in einer waffenstarrenden Welt lebt, wird niemand leugnen, und solange es macht-hungrige Staaten und bis zum Rand gefüllte Waffenarsenale gibt, sollte man sich militärisch verteidigen können – aber warum sollte ich, in einer sonst so konsequent arbeitsteiligen Gesellschaft, für die nationale Sicherheit mein Leben riskieren? Dafür gibt es andere.
Diese Zurückhaltung beschädigt natürlich auch den entsprechenden Freiheits willen. Offenbar leistet man sich eine doppelte Buchführung. Das ist nicht anklagend gesagt. Man hat eine Geschichte im Nacken, deren Verbrauch an Menschenleben jedem noch erinnerungsfähigen Menschen die Frage stellt, ob es das wert sei: ob es so wichtig sei, Nation zu sein, und ob gerade deren Freiheit wirklich das höchste nationale Gut sei. Nämlich dann, wenn angesichts immer wirksamerer Waffen die Aussicht besteht, es bleibe nach einem Krieg kaum noch etwas übrig, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnte, und Freiheit schon gar nicht.
Es reicht, knapp sechs Jahrzehnte zurückzudenken. Man lebte auf der Schnittkante des Kalten Kriegs. Die atomaren Potentiale der beiden damaligen Weltmächte waren noch nicht Routine, die Aussicht, eine der beiden könne sie einsetzen, nach Hieroshima und Nagasaki nicht irreal. So geisterte tatsächlich durch die Friedensbewegung der frühen sechziger Jahre die Parole lieber rot als tot. Man hat es nicht nur gedacht, sondern auch gesagt. Man hat es auch bis heute nicht wirklich zurückgenommen, vielmehr in einen inoffiziellen Verfassungsgrundsatz verwandelt, der reale Politik band, etwa die Bonner Ost-Politik.
Vielleicht ist das ein zu deutscher Blickpunkt. Franzosen oder Engländer würden ihn in dieser Schärfe nie teilen, Osteuropäern erscheint er noch heute absurd. Die Deutschen verdrängen, wie viele Russen, Amerikaner, Engländer, Franzosen dafür sterben mußten, daß die Welt von deutscher Vernichtungseffizienz befreit wurde. Trotzdem hat diese doppelte Buchführung der Deutschen wohl eine gesamteuropäische Zukunft. Sie setzt ja auf einem veränderten Lebenskalkül der Einzelnen auf – das eigene Ergehen zuerst. Daß daraufhin Nationalität von der Mehrheit der Europäer zunehmend kleiner geschrieben wird, damit kann, wer eine Ahnung von den nationalistischen Konvulsionen der letzten beiden Jahrhunderte hat, nur zufrieden sein. Aber damit ist nichts erledigt. Die Frage, was man bereit ist, für die Freiheit der eigenen Nation zu geben, verlagerte sich, solange man nicht angegriffen wird, nur von der individuellen Wehrbereitschaft mit der Waffe auf die Bereitschaft, für nationale Sicherheit und Freiheit wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen.
Schon in Osteuropa, von Finnland über die baltischen Staaten, Polen, Tschechien, bis zu den Balkanstaaten, stellt sich die Sache anders dar. Erst seit drei Jahrzehnten aus der Klammer des Warschauer Pakts entlassen, handelt es sich teils um junge, noch mit ihrer Selbstfindung beschäftigte Nationen, teils um alte, die auf zu viel vergangene Fremdherrschaft zurückblicken, und mehrheitlich fühlen sie sich von Rußland bedroht. Wenn also Nationalschicksale im Zeitalter globaler Netze und geöffneter Grenzen lange nicht mehr unmittelbar einleuchtend schienen, ist ein Europa, das an Rußland und seine Umgebung autoritärer Staaten grenzt, in einer neuen Lage, und könnte sich die Frage der Aktualität nationaler Selbstverteidigung schon beantworten, bevor man sie sich überhaupt gestellt hat.
6
Die einfachste Möglichkeit, dem Problem Nation auszuweichen, bietet der endogene Nationalismus einer jeden Nation. Dabei gibt es natürlich zwischen Nation und Nationalismus keine verläßliche Trennlinie. Schon deshalb nicht, weil es eine Frage des Standpunkts ist, ob nicht die Nation schon als der Anfang allen Übels angesehen wird, so daß aggressive nationalistische Bewußtseinskonstruktionen ebenso wie reale nationalistische, in Faschismen umschlagende Massenbewegungen die fast unvermeidliche Konsequenz wären. Wirklichkeitsnäher dürfte es sein, die begrifflichen Unsicherheiten wie die phänomenalen Grauzonen als eine Funktion der Verunsicherung jeweiliger Nationen hinsichtlich dessen zu betrachten, was sie sind, was sie mit ihrer Geschichte machen, was ihnen historisch widerfuhr und in der Gegenwart permanenter welthistorischer Unruhe widerfährt.
Bei europäischer Eingrenzung hat man es jedenfalls mit einer Aktualität zu tun, die dadurch gekennzeichnet ist, daß ein randständiger ausschließender Nationalismus, der nicht nur an seinen Rändern in Rechtsextremismus übergeht, durch politischen Populismus zu einer Alternative wird. Das Feld ist allerdings gemischt. Einerseits häufen sich in bewährten Demokratien die nationalistischen Unfälle. Jede Präsidentenwahl in Frankreich läuft unter dem Kalkül des geringeren Übels, ein radikalnationalistischer Wahlsieg nicht mehr ausgeschlossen. Dasselbe in Italien. England bietet mit dem »Brexit« den Fall einer erfolgreichen nationalistischen Selbstüberrumpelung, die ohne putschende Rechtsextreme auskam. Andererseits sind es lediglich die wirtschaftlichen Folgen und die EU-Subventionen, was osteuropäische Länder wie Polen oder Ungarn von einem Austritt abhält, während sie faktisch auf einen autoritären Staatsnationalismus ohne bzw. gegen Europa zugehen.
Der durchschnittliche europäische Nationalismus hat aber, und dies am deutlichsten in kleinen Ländern wie Schweiz, Niederlande, Dänemark, nicht mehr viel mit den Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun. Das Nationale ist zu einer semantischen Oberfläche geworden, welche diejenigen Verweigerungen zu bezeichnen hat, mit denen man sich aus der nationalen Solidarität gerade ausklinkt. Diese Haltung kann Wahlen entscheiden, aber nicht mehr Kriege auslösen. Im Grunde ist es ein Wirtschaftsnationalismus – wie sonst konnte beispielsweise die Euro-Einführung in der DM-Nation zur Gründung einer rechten Partei führen. In Italien polemisiert man gegen deutsche Handelsüberschüsse nicht aufgrund einer Vision nationaler Größe, sondern weil man sich benachteiligt fühlt. EU-Verweigerung, Fremdenfeindlichkeit, Haß auf Großstadt und Eliten, all das sagt, daß man sich von der eigenen Regierung nicht genug geschützt, vielmehr an internationale Wirtschaftsmächte verraten fühlt. Es ist der um jede Perspektive gekommene Kleinbürgernationalismus, den der Zusammenbruch des klassischen Nationalismus zurückgelassen hat. Man fragt sich, was man als Engländer, Franzose usw. eigentlich noch ist.
Ihren Resonanzraum findet dieser Nationalismus nicht nur in den populisti-schen Parteien, sondern auch in der Ambivalenz jeweiliger Regierungen. Die westeuropäischen Nationen, sie zumindest, könnten ja eigentlich stolz und glücklich sein, den permanenten europäischen Kriegszustand der Vergangenheit endgültig hinter sich zu haben. Wenn die nationalen Egoismen offensichtlich virulent genug sind, um die EU wiederholt an die Grenze des Scheiterns zu treiben, ist der europäische Unterschied am Ende bloß, daß man staatspolitisch aus einem Regime der Entscheidung durch Kriege in eines der Entscheidung durch Verhandlungen und Verträge, durch EU-Mehrheitsbeschlüsse und den Einsatz von Geld und wirtschaftlicher Macht übergegangen ist. Es fragt sich deshalb, wie vergeßlich eine Gesellschaft sein darf, um diesen Formwandel der Auseinandersetzung zwischen den Nationen nicht mißzuverstehen.
7
Begriffe, insbesondere politische, stehen nicht über der Geschichte, sondern haben ihren sinnentscheidenden historischen Ort. Der Begriff der Nation erhielt ihn im Entstehungszeitraum des europäischen Staatensystems, und die Parabel seiner Wirkungsmacht entfaltete sich vom Beginn der Frühen Neuzeit bis an die Schwelle der Gegenwart. Seine Karriere läßt sich ohne weiteres in das Bild einer Parabel fassen: einer Bewegung von Aufgang, Kulminationsspunkt und Niedergang. Das Narrativ Nation ist historisch spät. Es ist gleichaltrig mit der Durchsetzung von Territorialstaat und Kapitalismus, von beidem nicht zu trennen. Seinen Voraussetzungen nach kann es daher weder einfach noch selbstverständlich sein: Jahrtausende historischer Entwicklung liegen voraus, komplexe Muster gegenläufiger sozialer Freiheiten waren zur Reife gebracht, bevor das kollektivierende Motiv Nation Freiheiten wie Unfreiheiten zu einer kritischen Menge bündelte.
Die Vorstellung bewaffneter Freiheit ist zwar ihrerseits historisch entstanden, aber um Jahrtausende älter. Bei soviel Ungleichzeitigkeit muß man sich schon fragen, wie es dem hochvermittelten Subjekt Nation überhaupt gelingen konnte, den archaischen Reflex so eng an sich zu binden. Offenbar war das nicht ohne eine vermittelnde Figur möglich: Daß die bis zur Unvordenklichkeit ältere Freiheit ab einem bestimmten Zeitpunkt exklusiv national konnotiert ist, verdankt sich der parallelen Verknotung von Nation und Staat. Die historische Figur Nation wäre ohne eine durch den permanenten Kriegszustand erzwungene Verschmelzung gar nicht entstanden, ein Bündnis des militärischen Durchsetzungspotentials des Staates mit der historisch gewachsenen Bewußtseinsfigur einer Bevölkerung, sprachlich und kulturell zusammenzugehören. Nation wird man nicht durch friedliches Aufwachen aus dem Schlaf der Jahrhunderte. Man wird es über gewaltförmige Unterscheidung von anderen, deren Hoheit man sich entzieht. Die glücklicheren Nationen wuchsen in Befreiungskämpfen heran, die unglücklicheren hatten erlittene Kriege nötig.
Für sich genommen, ist der Freiheitswille die uralte Voraussetzung Indigener: Keine fremde Macht über uns. Daher: Wir oder sie. Das ist archaisch unumstößlich gedacht, Vorgeschichte. Im so viel voraussetzungsreicheren Gebilde Nation ist diese Unbedingtheit nicht mehr möglich. Leben und Geld verdienen kann man auch noch unter feindlicher Besatzung, sonst gäbe es keine Kollaboration. Der Freiheitswille muß sich in den Angehörigen einer Nation gleichsam erst erzeugen, und er muß mehrheitlich überzeugen können, also auch die mitnehmen, deren Geschäfte unterbrochen werden. Wirtschaftsinteressen, Selbsterhaltungstrieb der nationalen Institutionen, kulturelle Selbstbehauptung, alles das muß ausreichend eingreifen. Dann erst haftet die archaische Dichotomie aus purer Notwendigkeit.
Dafür war aber ein weiterer Schritt nötig, der an den Beginn der Moderne führt: daß der an sich selbstgefällige Staat zum allgemeinen Nationalgut wird. Bis zur französischen Revolution wurden Kriege durch Berufsarmeen geführt. Der Krieg deckte seinen Mannschaftsbedarf durch Absorption der Herausgefallenen und Zukurzgekommenen. Mit der Französischen Revolution wurden Kabinettskriege aber Nationalkriege. Im Kriegsfall müssen alle Waffenfähigen einrücken, und dann ist bloßer Zwang nicht mehr zielführend: Es braucht den Überschuß der Identifikation mit der Nation, ihrem Leben oder Tod.
Damit war die Fusionshitze erreicht, welche die folgenden europäischen Kriege erklärt. Das Widersprüchliche der Verklammerung von Archaik und Moderne war dann kein Hemmnis mehr, sondern machte offenbar geradezu die enorme Mobilisierungskraft der nationalen Bindung aus. Die archaische Ausschließlichkeit war kein überlebensnotwendiger Reflex mehr, sondern wurde bewußt formuliert, eine in Reden, Bilder, Lieder, Gedichte und Gebete gefaßte kollektive Überzeugung, allgemeinverständlich und für jedermann zugänglich. Aber, anders als der Staat, war noch die Nation in Waffen kein bewaffneter Apparat, sondern Bewußtseinsphänomen – Beteiligung aller an der mit gleichsam religiöser Leidenschaft ausgestatteten Idee, im Machtspiel der Staaten und der Kapitale als Gewinner oder Verlierer schicksalhaft zusammenzugehören.
Um das nicht mißzuverstehen, ist das oben als Begründung genannte Nationalwerden des Staates allerdings noch auf einen entscheidenden Punkt hin zu öffnen, den einbegriffenen Freiheitsgewinn. Um mobilisierungsfähig zu sein, mußte die Nation zum Träger auch anderer Freiheiten werden. Das betraf das ganze Bündel historisch angewachsener Freiheitsansprüche, bürgerliche Rechte von Meinungs- und Gewissensfreiheit bis zu Gewerbefreiheit und Freizügigkeit. Das ist der Punkt, der vom resultierenden Nationalismus zu schnell begraben wurde, daher im auch historischen Rückblick gern unterschlagen wird, als hätten sich immer nur politische und wirtschaftliche Egoismen eines verirrten nationalen Freiheitswillens zynisch bedient.
Natürlich kann man nicht trennen. Wenn man den europäischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts und seine Kulmination in zwei massenmörderischen Weltkriegen nicht bloß als Epiphänomen von Staatlichkeit und Kapitalismus abheften will, ist der entscheidende historische Schritt zur politischen Nation bereits der Eintritt in die Spirale wechselseitiger Vernichtungsversuche. Unter den gegebenen Bedingungen konnte es gar nicht anders gehen. In der Perversion überhaupt noch die Spur des primären Nexus von Nationwerdung und Freiheitswillen zu erkennen, setzt den Erschöpfungszustand des politischen Nationalismus voraus.
Die archaische Freiheit gehorchte dem Kriterium von Einschluß und Ausschluß: daß man entweder dazugehört oder Feind ist. Das Kriterium kann, sieht man heute, auch noch enttäuschte Nationen überfallen. Offenbar hat man es nie ein für allemal hinter sich. Welche Freiheit man hat, wenn man drinnen ist, tut dann wenig zur Sache. Wir oder sie, dazu gibt es eine latente Bereitschaft, ja Erwartung aller Beteiligten. Das Ausreizen nationaler Egoismen ist deshalb nie nur das Werk einer Truppe zum Umsturz entschlossener Spieler und ihrer Führungsfiguren. Eine Freiheit des Nationalen, welche die Archaik des Ausschließlichen hinter sich gelassen hat, ist offenbar noch auf dem Wege.
8