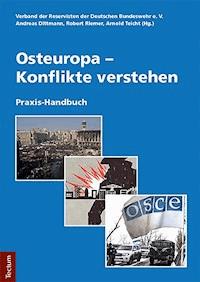
Osteuropa - Konflikte verstehen E-Book
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei Auflösung der Sowjetunion glaubte die internationale Staatengemeinschaft, dass sich Osteuropa zu einer stabilen, demokratischen und friedlichen Region entwickeln könnte. Bald zeigte sich, dass konfliktträchtige Entwicklungen und ethnische Spannungen diesen Teil Europas über nun schon mehr als zwei Jahrzehnte bestimmen würden. Alte und neue Konfliktfelder beeinflussen die sicherheitspolitische Lage. Konflikte erschweren in einigen Ländern der Region gesamtstaatliche und gesellschaftliche Entwicklungen. In anderen haben sie Befürchtungen um Sicherheit und Stabilität ausgelöst. Dauerhafte friedliche Lösungen erscheinen nicht in Sicht. Mitglieder des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. haben im Rahmen einer Arbeitsgruppe die unterschiedlichen Konfliktfelder Osteuropas untersucht. Dabei wurden alle Staaten beiderseits der neuen NATO-Ostgrenze aus geographischer, gesellschaftlicher, kultureller, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Perspektive analysiert. Konfliktpotentiale, Bedrohungen und bestehende Konfliktfelder werden im Rahmen einer Ursachenforschung umfassend nähergebracht und perspektivisch erläutert. Das Praxis-Handbuch "Osteuropa – Konflikte verstehen" ist Teil einer sicherheitspolitischen Buchreihe des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Es wendet sich an alle Bürger, die an der Entwicklung in dieser Region und an den damit verbundenen sicherheitspolitischen Fragestellungen interessiert sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Andreas Dittmann, Robert Riemer, Arnold Teicht
Osteuropa – Konflikte verstehen
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Andreas Dittmann, Robert Riemer, Arnold Teicht
Osteuropa – Konflikte verstehen
Praxis-Handbuch
Tectum Verlag
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V.
Andreas Dittmann, Robert Riemer, Arnold Teicht
Osteuropa – Konflikte verstehen. Praxis-Handbuch
© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2018
ISBN: 978-3-8288-6972-1
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4102-4 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildungen: vgl. Illustrationsnachweis
Besuchen Sie uns im Internet www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
MdB Oswin Veith – Präsident VdRBw e. V.
Grußwort
Vizeadmiral Joachim Rühle – Stellvertretender Generalinspekteur
Einleitung
Christian Faul – Vizepräsident Sicherheitspolitische Bildung
Teil I Regionale Charakteristika
I.1 Geographie einer Krisenregion
Hartmut Klüver
I.2 Geschichte im 20./21. Jahrhundert
Robert Riemer
I.3 Konfliktmuster
Friedrich K. Jeschonnek
I.4 Die NATO und ihre Erweiterung
Carsten Trinks
Teil II NATO-Staaten in der Region
II.1 Estland – Zwischen ethnischer Selbstdefinition und Nichtbürgerintegration
Andreas Dittmann
II.2 Lettland – Einstiger Spielball der Großmächte auf der Suche nach nationaler Identität
Martin E. Debusmann
II.3 Litauen – Tor zum Baltikum
Michael K. Bahr
II.4 Polen – Nation leidvoller Vergangenheit
Michael Wagemann
II.5 Slowakei – Friedlicher Neubeginn
Michael Wagemann
II.6 Ungarn – NATO-Drehscheibe in Osteuropa
Michael Wagemann
II.7 Rumänien – Konfliktpotentiale durch Wandel?
Johann-Bernhard Haversath
Teil III Staaten jenseits der NATO-Grenze
III.1 Weißrussland – Eigenständig oder russischer Vasall?
Martin Grosch
III.2 Moldawien – Konfliktregion zwischen Pruth und Dnjestr
Andreas Dittmann
III.3 Die Russische Föderation – Eine ambitionierte Weltmacht
Friedrich K. Jeschonnek
III.4 Die Ukraine und das Internationale Krisenmanagement
Arnold Teicht
III.5 Georgien – Chancen für eine bessere Zukunft?
Arnold Teicht
Teil IV Denkansätze zur Konfliktbegrenzung
IV Denkansätze zur Konfliktbegrenzung
Ulrich C. Kleyser
Teil V Hilfen für die Aus- und Weiterbildung
V Hilfen für die Aus- und Weiterbildung
Martin Grosch/Friedrich K. Jeschonnek
Teil VI Verzeichnisse
VI.1 Verzeichnis der wichtigsten im Text verwendeten Abkürzungen
VI.2 Autoren
VI.3 Illustrationsnachweis
VI.4 Stichwortverzeichnis
Vorwort
Präsident Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
Gespannt verfolgt die Welt die Entwicklung an den Grenzen von Osteuropa. Ereignisse und Bilder füllten die medialen Berichterstattungen und lösen in der Politik und in der Bevölkerung Besorgnis aus. Dieses Handbuch greift wichtige Themenkomplexe auf und soll Anleitung sein, sich mit diesbezüglich sicherheitspolitischen Fragestellungen zu befassen.
Deutschland leistet international als NATO-, EU- und OSZE-Mitglied einen aktiven Beitrag zu Stabilität und Sicherheit in der Welt und eben auch in der dortigen Region. Täglich tragen Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr, darunter auch viele Mitglieder unseres Verbandes, zur Umsetzung dieser Stabilisierung des Friedens in der Welt entscheidend bei. Sei es durch Ihren aktiven militärischen Dienst, in Reservestrukturen, in der Verbandsarbeit oder als Mittler in der Gesellschaft. Umso mehr ist es von Bedeutung, dass eine Arbeitsgruppe unseres Verbandes Grundlageninformationen in einem Praxis-Handbuch zu Osteuropa aufbereitet und verfasst hat. Der vorliegende Band ist eine Fortsetzung unserer bereits erfolgreich veröffentlichten Handbuchreihe.
Er legt zugleich öffentlich Zeugnis ab von der fruchtbaren Zusammenarbeit kompetenter Wissenschaftler und Reservisten als Bestandteil unserer vielfältigen (sicherheitspolitischen) Verbandsarbeit. Umso mehr gilt mein besonderer Dank den Herausgebern und Autoren. Aufgrund der fachlichen Expertise und der Aktualität bin ich sicher, dass das Werk weit über unseren Verband hinaus seinen Nutzen und seine Anwendung finden wird.
Ich wünsche uns allen, insbesondere den geneigten Nutzern, eine rege Diskussion, aus denen neue Ansätze und Ansichten entstehen mögen, um so der Wichtigkeit der sicherheitspolitischen Themen, die uns alle betreffen, ihren Weg in die Gesellschaft zu ebnen.
Oswin Veith MdB
Präsident
Grußwort
Grußwort des Stellvertreters des Generalinspekteurs der Bundeswehr und Beauftragten für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr Vizeadmiral Joachim Rühle
Mit der gewaltsamen und völkerrechtswidrigen Verschiebung von Grenzen durch die Annexion der Krim im Jahr 2014 hat Russland erstmals nach dem Fall der Mauer die seither etablierte regelbasierte euroatlantische Friedens- und Stabilitätsordnung offen in Frage gestellt.
Diese Veränderung auf unserer sicherheitspolitischen Landkarte hat tiefgreifende Folgen für Europa und die NATO. Russland wendet sich dabei von einer engen Partnerschaft mit dem Westen ab und betont strategische Rivalität – auch jenseits der Grenzen unseres Kontinents.
Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem unverändert aktuellen und sensiblen Thema ist infolgedessen sehr wichtig, gerade für aktive Soldaten und Reservisten. Insofern stellt eine umfassende Beleuchtung der unterschiedlichen Facetten der osteuropäischen Konfliktfelder und deren Auswirkungen auf Sicherheitspolitik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kultur ein inhaltlich breit gefächertes Kompendium zur Vertiefung des eigenen Wissens dar.
Daher begrüße ich es als Beauftragter für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr besonders, dass der Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V. diese Themenbereiche aufgegriffen hat und als Handreichung für die sicherheitspolitische Weiterbildung in der freiwilligen Reservistenarbeit und darüber hinaus zur Verfügung stellt.
Ich wünsche dem Handbuch eine große Leserschaft und allen Veranstaltungen des Reservistenverbandes zu diesem Thema viel Erfolg und ein gutes Gelingen!
Einleitung
Das Praxis-Handbuch „Osteuropa – Konflikte verstehen“ ist eine Fortsetzung von Publikationen zur Unterstützung der sicherheitspolitischen Arbeit und Bildung im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw). Mit ihm sollen Erfolge früherer Handbücher nach mehr als einer Dekade sicherheitspolitischer Verbandsarbeit fortgesetzt werden. Auch dieser Wegweiser ist ein Nachschlagewerk von Reservisten für Reservisten aber auch für alle sicherheitspolitisch interessierten Bürger unseres Landes. Damit erfüllen wir einen Auftrag des Deutschen Bundestages für die freiwillige Reservistenarbeit.
Es gehört zur Tradition und zum Leistungsspektrum des Verbandes, dass Beauftragte für Sicherheitspolitik und Vorsitzende von Reservistenkameradschaften (RK) bzw. Reservistenarbeitsgemeinschaften (RAG) mittels Praxis-Handbüchern Fortbildungsveranstaltungen planen und durchführen können.
Handbücher dieser Reihe ermöglichen sicherheitspolitische Erwachsenenbildung mit zumutbarem Aufwand. Sie vereinen sorgfältig recherchierte Informationen zum jeweiligen Themenkomplex mit konkreten Hinweisen zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.
So wie alle Praxis-Handbücher, orientiert sich auch „Osteuropa – Konflikte verstehen“ an den Parametern sicherheitspolitischer Aktionsfelder in der Region. Darunter werden die geographischen, gesellschaftlichen, verfassungsmäßigen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen verstanden. Sie bestimmen die Situation im geographischen Bezugsraum und die aktuellen Verhältnisse vor Ort. Damit verfolgt das Handbuch einen ganzheitlichen Ansatz unter Berücksichtigung aller sicherheitspolitischen Faktoren. Damit kommt der im sicherheitspolitischen Denken relevante „comprehensive approach“ als Schlüssel zum Politik- und Krisenverständnis zur Anwendung.
Der geographische Bezugsraum ist die Region, die aus Staaten gebildet wird, deren Landesgrenzen das Bündnisgebiet nach Osten abgrenzen. So wurden diejenigen Staaten Osteuropas in die Region einbezogen, die nicht zur NATO gehören, aber selbst an deren Grenze stoßen. Diese Systematik führte konkret zur Berücksichtigung der Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien mit einer NATO-Ostgrenze und den Staaten Weißrussland, Moldawien, Russland und Georgien ostwärts davon.
Finnland wurde ausgenommen, da es Nordeuropa zugerechnet wird, kein sicherheitspolitisches Konfliktmuster aufweist, noch unmittelbar bedroht ist. Ein Sonderfall stellt Georgien dar, das mit seiner sehr engen und aktiven sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Verzahnung mit einigen NATO-Staaten sowie seinen Konfliktregionen Abchasien und Südossetien in die sog. „osteuropäische Konfliktlandschaft“ passt bzw. gehört.
Zweck des Buches ist es, mit Daten, Fakten, politischen Positionen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen, Allianzen und Bündnissen in der Region Grundlagen aufzubereiten. So ist es dem Nutzer möglich, die dort erkennbaren unterschiedlichen Konflikte zu verstehen. Hierbei kommt es darauf an, auf potentielle, schwelende oder ausgebrochene Gewalt und eingefrorene Konflikte einzugehen. Ambitionen und Handlungen der Akteure werden dabei dargestellt. So kann sich der Leser ein Bild von den sicherheitspolitischen Schwierigkeiten sowie Entwicklungsmöglichkeiten bzw. deren Chancen in der Region machen. Der Bearbeitungsstand ist der 30.06.2017.
Das Praxis-Handbuch ist kein Leitfaden für „Konfliktbewältiger“ in der Politik oder an Stammtischen. Es unterstützt Analyse und eigene Meinungsbildung. Es schafft Verständnis, warum die Konflikte in Osteuropa nicht schnell mit oder ohne Gewalt zu lösen sind. Zugleich soll deutlich werden, wie stark kollektives Gedächtnis, wirtschaftliche Probleme, ethnische Unterschiede und aktuelle Unzufriedenheit teilweise explosivartig zu Unruhe und Gewaltanwendung führen. Das Handbuch hilft, sich zu informieren und die Region in ihren unterschiedlichen Ausprägungen kennenzulernen. Das Kompendium ist überparteilich und politisch neutral angelegt. Zuweilen weisen Fakten auf Triebkräfte und deren Verantwortlichkeiten hin, denen sich der Leser nicht verschließen kann.
Des Weiteren zieht sich die Bedeutung der heutigen Russischen Föderation und ihrer historischen Vorläufer wie ein roter Faden durch das Buch. Dieser Stellenwert ist der geopolitischen Dimension Russlands als größter Staat der Erde, seiner Rolle bzw. Mitwirkung in der Welt und seiner gesellschaftlichen, staatlichen, wirtschaftlich-technischen und kulturellen Potentiale geschuldet. Diese werden umfänglich und facettenreich dargestellt. Damit soll die Brisanz skizziert werden, die derzeit (wieder) von der Russischen Föderation ausgeht.
Russland, so wird in Beiträgen unterschiedlichster Perspektive aufgezeigt, ist aus dem ehemaligen Moskauer Fürstentum über Jahrhunderte durch Machtentfaltung, Kriegführung und Einverleibung benachbarter Völker oder Staatsgebilde entstanden. Es bildete sich das russische Imperium in Osteuropa und Asien. Dieses hat sich durch Aggressionen zur Weltmacht entwickelt. Es trotzte in den letzten zwei Jahrhunderten mit hohen Opfern den Angriffen unterschiedlicher Mächte. Im 20. Jahrhundert erhielt dieses Staatsgebilde seine völkerrechtliche Legitimation.
Russland muss heute als Vielvölkerstaat sein völkerrechtlich legitimiertes Konstrukt sichern und bestandsförderlich entwickeln. Es will seine Staatsbürger dort schützen, wo sie als Minderheiten in anderen Staaten leben und vermeindlichen oder tatsächlichen Risiken oder unzumutbaren Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Dazu gehören globale Ambitionen durch politisches Handeln im gesamten Spektrum der außenpolitischen Möglichkeiten. Sie werden von Nachbarn bzw. anderen Staaten als Bedrohung empfunden, die in der Vergangenheit von den Vorgängern der Russischen Föderation annektiert waren.
Nicht zuletzt ist es die historische Erinnerung an russische bzw. sowjetische Kontrolle und Machtausübung in Osteuropa, die zur Folge hat, dass sich ein Teil der osteuropäischen Staaten in die Obhut des Atlantischen Bündnisses begeben hat. Dies wird vom heutigen Russland als Provokation und Bedrohung verstanden, gesehen, bewertet und propagandistisch kommuniziert. Damit entstand zugleich eine bislang nicht beendete Spirale von Spannungen und Konflikten mit überregionaler Bedeutung. So kommt dem Verständnis der Rolle der NATO in Osteuropa eine zentrale Rolle zu, der ein besonderer Abschnitt gewidmet ist.
Ein zentrales Anliegen der Herausgeber ist es, auf die Instabilitäten und Konflikte in der Region erklärend hinzuweisen. Es wird aufgezeigt, wie sich Instabilitäten von Land zu Land unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten bzw. Grundmuster erkennbar sind. Dabei werden ethnische Strukturen durchleuchtet und herausgearbeitet. Im Ergebnis wird die These bestärkt, dass die meisten Konflikte in Osteuropa ethnische Auseinandersetzungen auf der Basis schlechter und schwieriger Lebensbedingungen, Rechtsstellung und Unterdrückung waren und sind.
Um dem Anspruch zu genügen, Grundlagen strukturiert anzubieten, wurde das Praxis-Handbuch in mehrere Teile aufgeteilt. Im Teil I werden auf der Grundlage der geographischen und historischen Gesamtbetrachtung der Region die Arten und Muster aktueller osteuropäischer Konflikte unter Berücksichtigung internationaler Verknüpfungen erläutert. Dabei wird auch auf die diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Spielräume zur Konfliktregulierung eingegangen. Am Beispiel der Rolle der NATO in Osteuropa werden exemplarisch das Spektrum kollektiver Stabilisierungs- und Sicherheitsmaßnahmen und ihre Wirkung in Osteuropa aufgezeigt. Insgesamt gewährt dieser Teil einen grenzübergreifenden, ersten Einstieg in die Region und ihre Konflikte.
Für detaillierte Befassungen bietet sich die Nutzung der Teile II und III an. Eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Politik in und für die Region kann anhand eines Essays im Teil IV nachvollzogen werden.
Im Teil II werden zu jedem der ausgewählten osteuropäischen NATO-Mitgliedsstaaten Estland (II.1), Lettland (II.2), Litauen (II.3), Polen (II.4.), Slowakei (II.5.), Ungarn (II.6) und Rumänien (II.7) geographische, gesellschaftliche, staatliche, wirtschaftliche, kulturelle und sicherheitspolitische Aspekte mit Relevanz zu osteuropäischen Konflikten dargestellt. Dies erlaubt dem Leser die tiefergehende Befassung mit der sicherheitspolitischen Position, Ambitionen und Rolle der einzelnen Staaten, ihren internen Konfliktpotentialen bzw. Betroffenheit von krisenhaften Entwicklungen.
Der Teil III öffnet den Einstieg jenseits der NATO-Ostgrenze. Fast alle dortigen Staaten sind von inneren Krisen, Konflikten mit Nachbarn oder internen Instabilitäten mehr oder weniger betroffen. Mit welchen regionalen bzw. globalen Wirkungen beschreiben die Autoren von Weißrussland (III.1), Moldawien (III.2), Russland (III.3), Ukraine (III.4) und Georgien (III.5). Dabei wird anhand der Krise in der bzw. um die Ukraine exemplarisch und besonders ausführlich eine tiefgreifende, umfängliche Analyse geopolitischer Faktoren, Konfliktparteien, Abläufe und Darstellung des internationalen Krisenmanagements vollzogen.
Welche Grundlagen und Lösungsansätze sich Politikern bieten könnten, wird im Teil IV beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Gesamtbeurteilung der Konfliktregion unter Heranziehung historischer und aktueller Maßstäbe strategischen Denkens. Dabei werden Aspekte deutscher Außen- und Sicherheitspolitik als Einflussgröße in Osteuropa einbezogen. In Form eines Essays bietet der Autor ein ganzheitliches Verständnis an, aus dem Gesamtstrategien und sicherheitspolitische Lösungsansätze zu erkennen sind. Der Beitrag ist kein Rezept für Lösungen, sondern ein Angebot, sich dem Konfliktfeld ganzheitlich zu nähern.
Der abschließende Teil V bietet vielfältige Handreichungen zur sicherheitspolitischen Arbeit in der Erwachsenenbildung. Ausgehend von der Bedeutung Osteuropas für unsere Gesellschaft über Gestaltungsmuster hin zur sicherheitspolitischen Arbeit. Thematische Anregungen, Empfehlungen zur Gewinnung von Vortragenden, Exkursionen und damit verbundene Administrationen folgen. Es ist an alles gedacht, was für die Verbandsarbeit erforderlich ist. Übersichtliche Checklisten erleichtern die Umsetzung. Aufgenommen wurden auch vielfältige Kontaktstellen in Deutschland.
In seiner Gesamtheit ist der Anspruch des Handbuches, auf eingefrorene, bestehende, latente und potentielle Konfliktfelder beiderseits der nach 2000 entstandenen „NATO-Grenze“ in Osteuropa hinzuweisen. Die Polarisierung, die sich in den Spannungen zwischen der NATO, der EU bzw. einzelnen osteuropäischen Staaten einerseits und der Russischen Föderation bzw. ihren wenigen Bündnispartnern andererseits widerspiegelt, macht globales wie regionales außen- und sicherheitspolitisches Handeln in unterschiedlichen Aktionsfeldern erforderlich. Dieses zu verstehen und einordnen zu können ist das Anliegen des Handbuches.
Neben der primären Verbandsorientierung ist an einen breiten Leser- und Nutzerkreis auch außerhalb des Reservistenverbandes im deutschsprachigen Raum gedacht. Deshalb ist das Werk – ein Novum in der Reihe der Praxis-Handbücher – über den Buchhandel beziehbar.
„Osteuropa – Konflikte verstehen“ konnte nur vollendet werden, weil sich zahlreiche Verbandsmitglieder bereit erklärt hatten, an diesem Großvorhaben mitzuwirken. Die Zahl der Interessenten war aufgrund der Ankündigung in unserer Verbandszeitschrift „Loyal“ so groß, dass eine Auswahl stattfinden musste.
Unter Leitung von Norbert Stäblein wurde in Fulda und Bielefeld das Konzept des Handbuches durch die Herausgeber und Friedrich K. Jeschonnek entwickelt.
Im Teil I wirkten unter Leitung von Robert Riemer die Autoren Hartmut Klüver, Friedrich K. Jeschonnek und Karsten Trinks. Von Robert Riemer selbst stammt der Beitrag zur Geschichte Osteuropas. Die Erarbeitung der Beiträge im Teil I wurde von Andreas Dittmann und Johann-Bernhard Haversath engagiert unterstützt. Die Beiträge der Autoren des Teils II, Martin Eduard Debusmann, Michael Kurt Bahr, Michael Wagemann und Johann-Bernhard Haversath betreute Andreas Dittmann, der selbst einen Beitrag schrieb. Für den Teil III koordinierte Arnold Teicht die Arbeit der Autoren Martin Grosch, Andreas Dittmann und Friedrich K. Jeschonnek. Arnold Teicht erstellte die umfassende Studie zur Ukraine und den Beitrag zu Georgien. Ein Teil der Autoren betrieb Feldforschungen im Baltikum, Weißrussland, in der Russischen Föderation und Ukraine.
Der Teil IV ist ein Essay von Ulrich C. Kleyser. Die Zusammenstellung der Handreichungen im Teil V entstand durch die Gemeinschaftsarbeit von Martin Grosch und Friedrich K. Jeschonnek. Wertvolle Hilfestellungen bei Konferenzen, Autorenbetreuung, Rechteprüfung, Lektorat und administrativer Unterstützung leistete die Bundesgeschäftsstelle mit Christian Hetsch, Johannes Conrad, Ivo Kaninski, Ralf Wittern und ganz besonders – die Projektverantwortliche Aysegül Recberlik.
Besonderen Verdienst haben die Mitarbeiter des Zentrums GeoInformationdienst der Bundeswehr, insbesondere Stefan Koller. Darüber hinaus unterstützte Daniela Hebbel, Redaktion Bundeswehr, und Ralf Wittern mit Illustrationen. Die graphische Ausgestaltung, „das Salz in der Suppe“, erfolgte durch Andreas Dittmann, Helmut Heimann, Peter E. Uhde, Arnold Teicht und Friedrich K. Jeschonnek unterstützt durch die Autoren. Ohne deren intensives Engagement wäre „Osteuropa – Konflikte verstehen“ nicht zur Druckreife gelangt. Dank Carsten Rehbein und den Mitarbeitern vom Tectum Verlag konnte das Handbuch zeitgerecht realisiert werden.
Christian Faul
Vizepräsident Sicherheitspolitische Bildung
Teil I
Regionale Charakteristika
Abb.I.1.1 Osteuropa politisch
Hartmut Klüver
I.1Geographie einer Krisenregion
I.1.1 Einführung
I.1.2 Physisch-geographische Ausstattung
I.1.3 Bevölkerung
I.1.4 Wirtschaft
I.1.5 Punktation
I.1.6 Literatur- und Quellenverzeichnis
I.1.1 Einführung
Der in diesem Praxis-Handbuch als Osteuropa bezeichnete Raum umfasst, wenn man ihn sicherheitspolitisch definiert, die Kontaktzone beiderseits der östlichen Grenze der NATO. Er enthält die Staatsgebiete von Polen, der Slowakei, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Moldawien, Rumänien und Russland sowie als Erweiterung Georgien. Anderen Territorien, die nicht unmittelbar von jüngsten Konflikten und Krisen entlang dieser Linie betroffen sind, wie z. B. Bulgarien oder der Balkan, werden in diesem Handbuch keine eigenen Abschnitte gewidmet. Siehe hierzu die umfassenden Länderportraits in den Teilen II und III.
Die Mehrheit dieser Staaten gehört der NATO an, während die größeren Länder (Weißrussland, Ukraine, Russland, aber auch das kleine Moldawien) keine NATO-Mitglieder sind. Die EU-Osterweiterung führte mit dem Beitritt Polens, der Slowakei, Ungarns, der drei baltischen Staaten und Rumäniens zu veränderten ordnungs- und wirtschaftspolitischen Strukturen. Die neuen EU- und NATO-Mitglieder bilden nun die östliche Außengrenze der Europäischen Union (JURCZEK 2006, S. 9 ff).
Osteuropa ist nicht eindeutig zu umgrenzen, hat sich doch der Begriff und sein Inhalt im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte entsprechend der politischen Entwicklung verändert. Im 19. Jahrhundert war die Abgrenzung mit den vier großen Reichen noch relativ einfach; das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn wurden bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs als Mitteleuropa betrachtet, während das Russische und das Osmanische Reich den Ost- bzw. Südosteuropäischen Raum bildeten. Mit dem Zerfall der Großreiche entstand nach dem Ersten Weltkrieg von den baltischen Staaten im Norden bis zur Balkanhalbinsel und dem Schwarzen Meer im Süden eine Vielzahl kleiner Nationalstaaten, die für die Mächte Mitteleuropas einen Schutzgürtel nach Osten gegen die expandierende Sowjetunion bildeten. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beschloss die Konferenz von Jalta im Februar 1945 eine neue Grenze zwischen den politischen Einflusssphären der neuen Großmächte.
Abb.I.1.2 Der Betrachtungsraum dieses Handbuches orientiert sich an der nach Osten verschobenen NATO-Grenze und Staaten beiderseits dieser Grenzlinie einschließlich des Krisengebietes Georgiens.
Der West-Ost-Gegensatz der politischen Systeme (1945–1990) ließ den Begriff Mitteleuropa nach und nach aus dem Wortschatz verschwinden. Das änderte sich auch nicht nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Welt. Die alten Begriffe mit ihren wechselnden Zuschreibungen und ideologischen Aufladungen erweisen sich heute als vieldeutig und wenig hilfreich. Im Rahmen des zusammenwachsenden Kontinents bereiten die unterschiedlich besetzten Begriffe mehr Verwirrung als Klarheit (LICHTENBERGER 2005, S. 17).
Auch unter Berücksichtigung differenzierender natürlicher Faktoren wie Relief, Klima, Vegetation etc. bleibt jede Abgrenzung Osteuropas ein Konstrukt, das unter wechselnden politischen Bedingungen und mit verschiedenen Absichten zustande kam und kommt.
I.1.2 Physisch-geographische Ausstattung
Osteuropa umfasst den größten Teil der europäischen Landmasse. Das Land wird nur an wenigen Stellen durch alpine Gebirge (Karpaten, Kaukasus) geprägt. Es dominieren Niederungen und weitläufige, bewaldete und offene Hügelländer, die vor allem durch große Flusssysteme gestaltet sind.
Flächenmäßig ist die Osteuropäische Ebene bestimmend, ein Tiefland von etwa fünf Millionen km². Es handelt sich um die größte einheitlich gegliederte Landmasse Europas. In Nord-Süd-Richtung erstreckt sich dieses Tiefland über rund 2000 km, in West-Ost-Richtung sind es etwa 2500 km. Politisch ist der Raum weitgehend deckungsgleich mit dem europäischen Staatsgebiet der ehemaligen Sowjetunion. Ausläufer der Ebene reichen nach Estland, Lettland, Litauen, Polen, Weißrussland, in die Ukraine, nach Moldawien und Kasachstan. Das Tiefland wirkt endlos, aber nicht uniform. Die lössbedeckte Podolische Platte (UA/MD), die amphibischen Pripjetsümpfe (BY/UA) oder der Baltische Landrücken (PL, LT, LV, EE, RU) sind gegensätzliche Räume.
Die Osteuropäische Ebene weist oftmals einen welligen Charakter auf. Die von den großen Flüssen durchströmten Niederungen haben Höhenlagen bis zu 150 m ü. NN. Die dazwischen verlaufenden Hügelländer erreichen dagegen 300 bis 500 m ü. NN. Die Anordnung der Ebenen, Tiefländer und Höhenzüge folgt weitgehend dem geologischen Untergrund, ebenso die Verteilung der Bodenschätze (STADELBAUER 2010).
Das Osteuropäische Tiefland (Russische Tafel) gehört geologisch zum ältesten Teil Europas (Paläo-Europa), der über 400 Millionen Jahre zählt. Hier haben sich in den folgenden Jahrmillionen Sedimente abgelagert, im Bereich des Baltischen Landrückens überformten es die Eiszeiten mehrfach. Infolge des geringen Gefälles ist die Fließgeschwindigkeit der Gewässer (außerhalb der einst vergletscherten Gebiete) niedrig; großflächige Überschwemmungen sind häufig; sie fließen nur langsam wieder ab. In den Steppengebieten Moldawiens, der Ukraine, Russlands und Kasachstans lagerten sich in den Kaltzeiten vom Wind transportierte Staubpartikel ab. Sie bilden das Ausgangsgestein für die heute landwirtschaftlich intensiv genutzten, bis zu 20 m mächtigen Lössböden (Schwarzerden).
Die Sedimente auf der russischen Tafel sind arm an Bodenschätzen. Die wirtschaftlich erschließbaren Lagerstätten befinden sich im Grundgebirge, wie z. B. die Erzlager bei Kursk. In den Sedimentschichten sind ausbaubare Vorkommen nur dort entstanden, wo die Sedimentablagerungen mächtig sind. Dies gilt etwa für die Steinkohle im Donez-Becken (Ukraine) oder im Petschora-Becken um Workuta. Erdöl- und Erdgaslager finden sich in der Kaspischen Senke und im nördlichen Uralvorland. In letzterem gibt es auch bedeutende Stein- und Kalisalzvorkommen.
In der südlichen Ukraine wird die Oberfläche durch Niederungsebenen mit breiten Flusstälern bestimmt, charakteristisch für die hier beginnenden Steppengebiete. Große Teilräume bilden z. B. das Schwarzmeer-Lösstiefland an der Nordküste des Schwarzen und des Asowschen Meeres. Am linken Ufer des Dnjepr erstreckt sich ein weiteres Lösstiefland.
Abb.I.1.3 Osteuropäische Ebene
Die Kaspische Senke ist ein Teil der größeren Aralo-Kaspischen Niederung, die überwiegend unter dem Meeresspiegel liegt und sich über Teile Aserbaidschans, Kasachstans, Russlands, Irans und Turkmenistans erstreckt. Sie umfasst auch das Kaspische Meer und die daran angrenzenden Sumpfgebiete sowie das Tiefland um die Reste des Aralsees. Ihre tiefste Stelle liegt auf der in das Kaspische Meer ragenden Mangghystau-Halbinsel (–132 m).
Das Kaspische Tiefland entspricht in seinem Charakter den mittelasiatischen Wüstensteppen und Wüsten. Die Kaltzeiten mit ihren Lössanwehungen haben dieses Gebiet nicht mehr erreicht. Die flache und uniforme, nur wenig strukturierte Ebene trägt nur vereinzelt Erhebungen. Dabei handelt es sich um aus dem Untergrund herausgepresste Salzstöcke. Infolge von Auslaugungsprozessen (Subrosion) haben sich vereinzelt Senken mit Salzseen gebildet.
Die knapp 25.000 km² große Halbinsel Krim mit dem Jaila-Gebirge und der Halbinsel Kertsch trennt das Asowsche vom Schwarzen Meer. Sie ist nur durch eine schmale Landenge mit dem Festland verbunden. Im Nordosten ist der Krim die 111 km lange Nehrung von Arabat vorgelagert. Im dahinterliegenden Haff nimmt die Landschaft amphibischen Charakter mit Salzsümpfen und Wasserflächen an.
Der Kaukasus ist ein mehr als 1000 km langes Hochgebirge, dessen Gipfel Höhen von über 5000 m ü. NN erreichen (Elbrus: 5642 m ü. NN). Er besteht aus zwei parallel verlaufenden Gebirgszügen, dem Großen und dem Kleinen Kaukasus. Zwischen beiden erstreckt sich der flache Transkaukasus. Der Gebirgszug entstand im Rahmen der alpidischen Orogenese im Tertiär vor etwa 65 Millionen Jahren; seine Hebung dauert bis heute an. Im Kleinen Kaukasus verläuft die Nahtstelle zwischen iranischer und eurasischer Platte, was das hohe Erdbebenrisiko der Region erklärt.
Im Osten wird die Russische Tafel durch die Gebirgsschwelle des Ural begrenzt. Es handelt sich um ein bis zu 1895 m hohes und ungefähr 2400 km langes, im Schnitt nur etwa 50 km breites Gebirge, das Mittelgebirgscharakter aufweist. Es entstand während der variszischen Orogenese (Gebirgsbildung) vor rd. 290 Millionen Jahren. Sein Erzreichtum ist aus diesem Zusammenhang zu erklären.
Im Südosten der EU liegen die Karpaten, die zur Zeit der alpidischen Faltung vor mehr als 40 Millionen Jahren entstanden. Politisch erstreckt sich der Gebirgszug auf dem Territorium der Slowakei, Polens, der Ukraine und Rumäniens. Er bildet ein etwa 1300 km langes Hochgebirge in der Form eines nach Südwesten offenen Ovals. Es beginnt am Ostrand des Wiener Beckens und endet an der Donau beim Eisernen Tor. Höchster Berg ist die Gerlsdorfer Spitze (2655 m ü. NN) in der Hohen Tatra (Slowakei).
Die Karpaten haben – ähnlich den Alpen – einen geologischen Bau mit einem zentralen Kristallinkern und flankierenden Flysch- und Molassezügen (Tone und Sande). Die höchsten Stellen der Tatra und der Südkarpaten waren während der Eiszeiten vergletschert und erhielten so den Formenschatz eines Hochgebirges mit Graten, Karen und Trogtälern.
Die Pannonische Ebene (SK, H, RO, RS, HR) ist ein Senkungsgebiet, mit Fluss- und marinen Sedimenten verfüllt (Ton, Mergel, Sand), teilweise mit großer Mächtigkeit (bis 10.000 m). In den Tiefen befinden sich umfangreiche Salzlagerstätten sowie in Polen, Rumänien und der Ukraine Erdölvorkommen; auch im Kaukasus und um Baku (Aserbaidschan) spielen letztere eine Rolle.
Osteuropa umfasst mehrere Klimazonen, die von den Polarregionen bis fast zu den mediterranen Subtropen reichen. Die im Westen zunächst noch bestimmende Maritimität des atlantischen Klimas nimmt nach Osten ab. Das Klima wird kontinental, d. h. die Temperaturunterschiede zwischen den Jahreszeiten werden größer, der Niederschlag wird nach Osten deutlich geringer. Die Kontinentalität bestimmt den größten Teil Osteuropas und lässt sich vereinfacht mit der Formel ‚kalte Winter – heiße Sommer‘ beschreiben. Es ist mit Ausnahmen ganzjährig feucht bei einem Niederschlagsmaximum unter 750 mm/a. Die von den Westwinden herangetragene Feuchtigkeit regnet sich in den Küstenregionen und an den Mittelgebirgen weitgehend ab, so dass sie das Innere des Kontinents nicht erreicht. Hier fallen nur geringe Niederschläge, die zudem bei deutlichem Sommermaximum (Gewitter) ungleich über das Jahr verteilt sind. Im Winter sind starke Schneefälle verbreitet, die den Verkehr oftmals zum Erliegen bringen. Die Übergangsjahreszeiten (Frühling und Herbst) sind sehr kurz, die Temperaturschwankung beträgt im Jahresverlauf mehr als 25 Grad C.
Im Norden Osteuropas liegt die Polare Zone, deren Kontinentalität ebenfalls von Westen nach Osten zunimmt. Der Großteil der Halbinsel Kola, aber auch die großen Inseln in der Barentssee (Nowaja Semlja) und die Küstenzone liegen im maritim geprägten, feuchten Polarklima. Einige der arktischen Inseln sind vegetationslos und gehören zur ständig von Eis bedeckten polaren Eiswüste.
Nach Süden schließt sich die subpolare Kontinentalregion an. Sie beginnt im Westen etwa am Rande des Weißen Meeres und verbreitert sich bis zum Ural nur mäßig. Mit ihrem Hauptgebiet erstreckt sie sich weiter östlich in Sibirien. Entlang des gesamten Nördlichen Eismeeres verläuft als unterschiedlich breit ausgeprägter Streifen die Tundra. Sie ist zwar nicht mit Eis bedeckt, doch behindern die tiefen Temperaturen (Mittel der Sommermonate <10 Grad C) das Pflanzenwachstum. Es überwiegen Flechten, Moose und Zwergsträucher. Selbst im Sommer taut der Boden in der Regel nur wenige Dezimeter auf. Über dem darunter dauerhaft gefrorenen Boden bilden sich dann große Wasserflächen und Sümpfe. Infolge des Klimawandels sind aber auch hier in den letzten Jahren messbare Erwärmungen beobachtet worden.
Abb.I.1.4 Wetterbedingungen in Osteuropa am Beispiel Winter 2012
Nach Süden folgt die Taiga, der boreale (winterkalte) Nadelwald, mit der Waldtundra als nördliche Übergangszone. Die Taiga bildet einen breiten Nadelwaldgürtel im nördlichen Russland und vor allem in Sibirien. Südlich schließen sich neben kleineren Laub- und Mischwaldgebieten große Kulturlandflächen an.
Es folgt die kalt gemäßigte Zone. Vom nordöstlichen Teil Estlands erstreckt sie sich nach Russland; von St. Petersburg bzw. Archangelsk verläuft sie als breites Band nach Osten, das im europäischen Teil im Süden bis zur Linie St. Petersburg-Kirow-Perm reicht. Innerhalb dieser Zone liegen z. B. der Nordrussische Landrücken, Teile der russischen Waldai-Höhen und des Baltischen Landrückens.
Abb.I.1.5 Biographische Regionen Osteuropas im Kontext zu Gesamteuropa
Weiter südlich liegt die warmgemäßigte Zone. Ihre ozeanische Ausprägung gilt für die Küstengebiete Polens, der baltischen Staaten sowie die russische Oblast Kaliningrad/Königsberg. Die kontinentale Variante ist kennzeichnend für den Großteil der baltischen Staaten und Polens, für Weißrussland, die Slowakei, Ungarn, Moldawien sowie weite Landesteile der Ukraine, Rumäniens, Russlands und des östlichen Georgiens.
Zum ariden bis semiariden warmgemäßigten Klima gehören die südlichen Gebiete Rumäniens, Moldawiens und der Ukraine sowie in Russland die ausgedehnten Randgebiete um das Schwarze und das Kaspische Meer. Der Südteil der Krim und der westliche Teil Georgiens sind bereits der semihumiden bis humiden kontinentalen Klimaregion der Subtropen zuzuordnen.
I.1.3 Bevölkerung
Zu Osteuropa gehören elf Staaten sehr unterschiedlicher Größe und Struktur, die sich von den baltischen Ländern im Norden bis nach Georgien im Südosten erstrecken. Staatsnation und Ethnien sind in den Ländern keineswegs deckungsgleich.
Mit einer Fläche von mehr als 16 Millionen km² und einer Bevölkerung von über 144 Millionen ist Russland mit weitem Abstand der flächengrößte und bevölkerungsreichste Staat. Es verfolgt in seinem Einflussbereich seit zaristischen Zeiten nicht nur regionale und hegemoniale, sondern vorrangig globale politische und wirtschaftliche Interessen. Als Nachfolgestaat der Sowjetunion, die bis 1990/1991 bestand, fühlt sich Russland noch immer in einer exponierten Stellung. Die einst als Sowjetrepubliken integrierten Länder und die Mitglieder des früheren Warschauer Pakts, die verteidigungspolitisch und wirtschaftlich assoziiert waren, unterlagen starker sowjetischer Kontrolle. Daraus resultieren nach wie vor teilweise Abhängigkeiten, teilweise auch Abneigungen gegenüber dem ‚großen Bruder‘ und entsprechende Befreiungsversuche, aber auch Bestrebungen, das alte politische System zu restaurieren (v. a. in Transnistrien) und sich an Russland anzulehnen. Folglich ist auch die jüngere Geschichte in diesem Raum zum Teil gegenläufig. Geopolitische Konflikte – etwa im Bereich der baltischen Staaten, der Ukraine, Weißrusslands, Moldawiens oder Georgiens – finden so eine Erklärung.
Nicht-/Mitgliedsstaaten der NATO und EU
Land
Hauptstadt
NATO-Mitglied
EU-Mitglied
Schengen-Mitglied
Währung/Mitglied des Euro-Raumes
Estland
Tallinn
2004
01.05.2004
21.12.2007
Euro/01.01.2011
Georgien
Tiflis
PfP
Lari (GEL)
Lettland
Riga
2004
01.05.2004
21.12.2007
Euro/01.01.2014
Litauen
Vilnius
2004
01.05.2004
21.12.2007
Euro/01.01.2015
Moldawien
Chișinău
PfP
Moldauischer Leu (MDL)
Polen
Warschau
1999
01.05.2004
21.12.2007
Zloty (PLN)
Rumänien
Bukarest
2004
01.01.2007
Rumänischer Leu (RON)
Russland
Moskau
PfP
Russ. Rubel (RUB)
Slowakei
Bratislava
2004
01.05.2004
21.12.2007
Euro/01.01.2009
Ukraine
Kiew
PfP
Hrywnja (UAH)
Ungarn
Budapest
1999
01.05.2004
21.12.2007
Forint (HUF)
Weißrussland
Minsk
PfP
Belarus Rubel (BYR)
Deutschland
Berlin
1955
01.01.1958
26.03.1995
Euro/01.01.1999
Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen blicken auf eine bewegte Geschichte zurück. Zugehörigkeiten zum Deutschen Orden, zu Dänemark, Polen, Schweden und zum zaristischen Russland fallen in das Mittelalter und die Neuzeit. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die drei Länder zunächst für einige Jahre eigenstaatlich, kamen aber schon bald zur Sowjetunion, wurden im Zweiten Weltkrieg deutsch, dann wieder sowjetisch und schließlich erneut eigenstaatlich – seit 2004 sind sie EU-Mitglieder. Die Spuren dieses Entwicklungspfads sind unübersehbar: ethnische Überlagerungen, religiöse Vielfalt, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zäsuren und Diskontinuitäten.
In der Ukraine ist das facettenreiche historische Erbe v. a. im Westteil, in Transkarpatien, deutlich: In den letzten 100 Jahren wechselte hier die staatliche Zugehörigkeit fünfmal. Auch Polen erlebte ein vergleichbares Schicksal: Nach den drei polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert begann der staatliche Neubeginn nach dem Ersten Weltkrieg. Die erneute Staatsauflösung 1939 und die nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte territoriale Westverschiebung schlossen sich an. Der Zusammenbruch des Ostblocks brachte dann die staatliche Selbstbestimmung. Vergleichbare Entwicklungspfade machten auch weitere Länder des ehemaligen Ostblocks durch: Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien, aber auch die ehemaligen Sowjetrepubliken Moldawien und Georgien.
Russland schließlich war über Jahrhunderte ein Akteur sui generis: In Zeiten der Zaren und der Sowjets hatte es eine Führungsrolle, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor es diese Position, ist allerdings nach der Jahrtausendwende erkennbar bestrebt, die alte Position wieder zu erlangen.
Die im Sozialismus politisch massiv geförderte Verstädterung hat dazu geführt, dass sowohl in Russland als auch den anderen Staaten Osteuropas die Urbanisierung erheblich ist. 2010 lebten in Weißrussland 75 Prozent und in Russland 73 Prozent der Bevölkerung in städtischen Siedlungen. Auch in den übrigen Staaten ist der Anteil hoch: 69 Prozent in der Ukraine, 68 Prozent in Ungarn und Lettland, 67 Prozent in Litauen und 53 Prozent in Georgien. Schlusslicht bildet Moldawien mit 47 Prozent.
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Jahrzehnte ist in weiten Teilen Osteuropas durch niedrige Geburtenraten, steigende Sterberaten und eine sinkende Lebenserwartung gekennzeichnet. Besonders von Verlusten betroffen ist die überalterte ländliche Bevölkerung. Der Bevölkerungsrückgang betrifft hier v. a. die Russen, während die nicht-russischen Ethnien höhere Geburtenraten verzeichnen. Die nach dem Zerfall der Sowjetunion einsetzende Bevölkerungswanderung ethnisch-russischer Bevölkerung aus den nicht russischen Nachfolgestaaten konnte die Rückgänge vorübergehend noch ausgleichen, doch dieser Wanderungsprozess ist inzwischen weitgehend abgeschlossen.
Die Säuglingssterblichkeit ist deutlich überhöht. In Weißrussland und Litauen erreicht sie 3 v. T., in Estland liegt sie mit 2 v. T. darunter. In allen anderen Ländern Osteuropas liegt sie deutlich höher, so etwa in Lettland (7 v. T.), in Russland und der Ukraine (8 v. T.), in Georgien (11 v. T.) und in Moldawien (14 v. T.). Die medizinische Versorgung spielt dabei sicherlich eine Rolle. Erreicht ist eine Arztdichte größer als etwa in Deutschland (39 Ärzte/10.000 Einwohner). In Georgien liegt sie z. B. bei 43, in Moldawien bei 30. Natürlich spielen auch andere Faktoren, wie z. B. die medizinische Geräteausstattung und vor allem die Erreichbarkeit des Fachpersonals, eine große Rolle.
In der Altersstruktur unterscheidet sich die Bevölkerung Osteuropas signifikant von deutschen Verhältnissen mit seiner überalterten Bevölkerung. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen (<15 Jahre), in Deutschland mit 12,9 Prozent eher niedrig, liegt in keinem der Länder unter 14 Prozent (Weißrussland), sondern erreicht z. B. Spitzenwerte in Georgien (17,3 Prozent), Russland (16,8 Prozent) oder Weißrussland und Estland (16,1 Prozent). Entsprechend niedrig ist auch der Anteil der alten Bevölkerung (>65 Jahre). Der niedrigste Wert wird in Moldawien (10 Prozent) erreicht, gefolgt von Russland (13,4 Prozent) und der Slowakei (13,8 Prozent). Deutlich größer ist der Anteil älterer Menschen dagegen in den baltischen Staaten: 18,8 Prozent in Litauen und Estland, 19,4 Prozent in Lettland.
Die statistische Lebenserwartung (in Deutschland für Männer 78,6 Jahre, für Frauen 83,2 Jahre) beträgt in Russland für Männer 65 und für Frauen 76 Jahre. In den anderen Staaten liegen diese Werte nur geringfügig höher, am höchsten in Polen, Estland und der Slowakei.
Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung zeigt heute weitgehend einheitliche Strukturen mit eher geringen ethnischen Minderheiten. Dies ist v. a. eine Folge des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit mit Deportationen, Massenvernichtung, zwangsweisen Umsiedlungen und Vertreibungen. Während des Bestehens der Sowjetunion wurde die russischstämmige Bevölkerung in allen Teilen der Union angesiedelt, was in postsowjetischer Zeit neue Probleme entstehen ließ. So differenzieren die baltischen Länder, in denen schon in früheren Zeiten russische Bevölkerung lebte, zwischen ‚ihren‘ Russen, d. h. den alteingesessenen, und den neuen Russen, die sich als Folge der sowjetischen Besetzung hier niederließen. In der Ukraine ist der Anteil der russischen bzw. russophonen Bevölkerung im Osten des Landes nichts Neues, durch die sowjetische Siedlungspolitik aber stark gewachsen und damit auch einer der Auslöser und zugleich Begründung separatistischer Bestrebungen. Im Einzelnen gibt es auffallende Besonderheiten, die bei den jeweiligen Ländern im Handbuch zur Sprache kommen.
Eine hohe Erwerbslosenquote (2015) vervollständigt das Bild: Georgien (12,3 Prozent), Slowakei (11,3 Prozent), Lettland, Litauen, Ukraine (fast 10 Prozent). Bedenklich ist hierbei v. a. der hohe Grad der Jugendarbeitslosigkeit, die sich in allen Staaten im zweistelligen Bereich bewegt: Georgien (29,8 Prozent), Slowakei (25,2 Prozent) sowie in der Ukraine und in Rumänien (23,1 Prozent).
Der Beschäftigungsgrad war während der Zeit der Sowjetunion relativ hoch, insbesondere bei den Frauen. Nach den ersten krisenhaften Transformationsjahren bauten die Länder eigene Arbeitsmärkte auf. So blieb der Beschäftigungsgrad vergleichbar hoch. Er betrug 2015 in Georgien 67,1 Prozent, in Russland 63,5 Prozent und Estland 61,9 Prozent.
I.1.4 Wirtschaft
Die landwirtschaftliche Zwangskollektivierung der Sowjetzeit hat große Betriebe mit teils riesigen Flächen entstehen lassen, die relativ früh mechanisiert wurden. Doch die Unterschiede zwischen Ländern und Regionen sind gewaltig. Während in Russland etwa drei Viertel der landwirtschaftlichen Flächen von Großbetrieben bewirtschaftet werden, entfällt in der Ukraine oder Kasachstan weniger als die Hälfte auf großbetriebliche Landwirtschaft, noch geringer ist der Anteil in Polen.
Die Krisenzeit nach dem Zerfall der Sowjetunion ist inzwischen weitgehend überwunden. Als Produzenten von Agrarrohstoffen gewinnen die Länder Osteuropas mit steigender weltweiter Nachfrage wieder an Bedeutung. Dies gilt besonders für Russland und die Ukraine mit ihren großen Potenzialen. Sie steigerten in den letzten Jahren die Erzeugung massiv und gehören heute zu den zehn größten Agrarproduzenten. So stammen etwa 50 Prozent der weltweiten Ölproduktion aus Sonnenblumen von hier. Auch die Getreideproduktion ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor geworden. Die Exportanteile liegen bei 35–50 Prozent der Produktion. Doch die Leistungsfähigkeit hinkt vielfach hinter den technischen Möglichkeiten hinterher. Dies liegt z. B. an der oft unsicheren innenpolitischen Lage, an massiver Korruption, zunehmenden Wetterextremen mit Überschwemmungen und Dürren, hohen Transportkosten, einer ineffizienten Logistik, an geringeren Erträgen und minderer Qualität.
Ein neueres Phänomen ist das „Land Grabbing“, der legale oder illegale, oftmals auch gewaltsame Erwerb riesiger Landflächen durch Investoren mit dem Ziel, möglichst ertragreiche Agrarpflanzen anzubauen. Diese Form des Landerwerbs entzieht oftmals wertvolle Nutzflächen der einheimischen Versorgung.
Große Waldflächen bestehen vor allem in den Ländern mit geringeren Ackerflächen und teils ungünstigem Relief. Den höchsten Waldanteil verzeichnet Estland (52,7 Prozent), gefolgt von Lettland (54 Prozent) und Russland (49,8 Prozent). Dagegen entspricht der Waldanteil in Litauen, Polen und Rumänien in etwa dem deutschen Durchschnittswert von 32,8 Prozent.
Die Volkswirtschaften Osteuropas haben in der Phase der Transformation sehr unruhige Zeiten erlebt. Der Übergang brachte nicht nur massive Verwerfungen in den sozialen Strukturen mit sich, z. B. neue Wirtschaftseliten und Oligarchen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland, sondern war in großem Maße von organisierter Kriminalität und Korruption begleitet, zum Schaden der Volkswirtschaft. Entsprechend langsam entwickeln sich die Wirtschaftsdaten.
Das Bruttoinlandsprodukt liegt z. B. mit umgerechnet 1822 US-Dollar pro Einwohner in Moldawien am niedrigsten und beträgt nur etwa ein Neuntel der Wirtschaftsleistung Estlands (17.288 US-Dollar) oder der Slowakei (15.979 US-Dollar) und etwa ein Fünftel der Wirtschaftsleistung Russlands 9243 US-Dollar. Auch in der Ukraine, Georgien und Weißrussland liegt die Leistung nur wenig höher. Die Wirtschaftsentwicklung verläuft teilweise nur langsam, in einigen Ländern schrumpft oder stagniert sie. Zuwachsraten haben Rumänien (3,8 Prozent), Polen und Slowakei (je 3,6 Prozent), Ungarn (2,9 Prozent), Georgien (2,8 Prozent) und Lettland (2,7 Prozent). Eine Schrumpfung zeigt sich in Moldawien (–0,5 Prozent), Russland (–3,7 Prozent), Weißrussland (–3,9 Prozent). In der Ukraine (–9,9 Prozent) ist das weitgehend auf die kriegerischen Auseinandersetzungen in diesem Land zurückzuführen. Die Inflationsrate von 2015 von über 48 Prozent spiegelt die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse im Osten des Landes wider. Aber auch in Russland, Weißrussland und Moldawien bewegt sie sich zwischen 9,6 und 15,5 Prozent. Inzwischen verbessert sich seit 2016 die wirtschaftliche Lage in der Ukraine.
Die Wertschöpfungsrate der einzelnen Wirtschaftssektoren ist nicht nur ein Indikator der Leistung, sondern auch der wirtschaftlichen Struktur des Landes; sie liegt im internationalen Vergleich deutlich zurück. Die Dienstleistungssektoren weisen in allen Ländern sehr hohe Werte auf. Der Produzierende Sektor ist dagegen vor allem in Weißrussland (40,1 Prozent) sowie in der Slowakei, in Polen und Russland mit über 30 Prozent Anteil an der Wertschöpfung von größerer Bedeutung. Signifikant unter dem Vergleichswert liegt er in Moldawien (17,9 Prozent) sowie in Lettland, Georgien, der Ukraine und Rumänien (23,4 bis 26,4 Prozent).
Beim Import als auch beim Warenexport zeigen sich in einigen Ländern wie z. B. Georgien, Moldawien oder Rumänien deutliche Defizite, während andere Nationen ihre Handelsbilanz mit Gewinnen abschließen, wie z. B. Polen, Russland, die Slowakei, die Ukraine und Ungarn. Der Ausfuhrüberschuss Russlands dürfte im Wesentlichen auf Rohstoffe wie Öl, Kohle und Erze zurückzuführen sein, ebenso auch in der Ukraine. Das Straßenverkehrsnetz ist sehr unterschiedlich ausgebaut und auch witterungsbedingt von unterschiedlicher Güte. Russland hat als flächengrößter Staat Osteuropas und größtes Land der Erde mit 1.094.000 km das längste Straßennetz Osteuropas, liegt im weltweiten Vergleich aber nur an achter Stelle (2008). Der europäische Teil des Landes ist verkehrsmäßig gut erschlossen, doch besteht großer Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf. Der zunehmende Verkehr – etwa ein Viertel aller föderalen Straßen in Russland gilt als überlastet – ist längst zum Problem geworden. 2009 waren im Land über 32 Millionen Personenkraftwagen, mehr als fünf Millionen Lastkraftwagen und fast eine Million Busse zugelassen, die sich vor allem im europäischen Teil des Landes und hier in den großen Städten bewegen. In Moskau (Zwölf Millionen Einwohner) führen die etwa zwei bis drei Millionen Pendler zu täglichem Verkehrschaos.
Das Schienennetz ist in Russland, aber auch in den anderen Ländern Osteuropas von großer Bedeutung. Auf dem rund 86.000 km (2014) langen russischen Netz werden etwa 15 Prozent aller landesweiten Gütertransporte durchgeführt. Es handelt sich überwiegend um Massentransporte von Rohstoffen, aber auch um Industrieerzeugnisse. Ausbau und Erhalt des Schienensystems sind ein großes Problem. Fast 50 Prozent des Netzes sind zwar elektrifiziert, doch die Unterbrechungen sind zahlreich.
Kommunikation ist ein wesentliches Element der modernen Gesellschaft. 2015 bestanden in der Bundesrepublik Deutschland je 100 Einwohner fast 55 Festnetzanschlüsse, die Ausdruck der technischen Erschließung eines Landes sind. Diesem Wert nähert sich in Osteuropa nur Weißrussland mit 49 Anschlüssen, während alle anderen Staaten über nur schlecht ausgebaute Festnetze verfügen. So liegt die Zahl der Anschlüsse mit nur 11,1 je 100 Einwohner in Polen am niedrigsten, in den anderen Ländern liegt sie zwischen 20–30 und nur in Moldawien werden 35 erreicht. Die Einführung des Mobilfunks stellte eine wesentliche Ergänzung und teilweise einen Ersatz der Festnetztelefonie dar, war doch der infrastrukturelle Aufwand dieser Systeme deutlich geringer. Dies erklärt, warum in den meisten Ländern Osteuropas die Zahl der Mobilfunkverträge teils deutlich über dem entsprechenden Durchdringungsgrad etwa der Bundesrepublik liegt. In Russland werden z. B. 160 Mobilfunkverträge je 100 Einwohner registriert, in Estland und Polen sind es je 148, in der Ukraine noch 144. Die Internetnutzung nimmt ebenfalls stark zu und hat z. B. in Estland mit 88 und in der Slowakei mit 85 Nutzern je 100 Einwohner das Niveau Deutschlands erreicht (87,6 Nutzer je 100 Einwohner). Auch in den anderen Ländern zeigt sie wachsende Werte und selbst in Georgien (45,2), der Ukraine (49,3) und Moldawien (49,8) hat inzwischen fast jeder Zweite Zugang zum Internet. Die kapital- und arbeitsaufwändige Ausstattung mit Breitbandanschlüssen (im Vergleich: Deutschland 37,2 Anschlüsse je 100 Einwohner) bietet dagegen noch Ausbaupotenzial, liegt aber in Weißrussland schon bei 31,3 Anschlüsse je 100 Einwohner, während der Ausbau in Georgien, Moldawien und der Ukraine nur schleppend vorankommt.
I.1.5 Punktation
— Die geophysischen Möglichkeiten in Osteuropa zur Ausbildung unterschiedlicher in sich geschlossener Kulturräume und Staatsformen bestimmen bis heute die Region. Sie prägten bis heute die Identitätsbildung und Kultur der Menschen in den verschiedenen Staaten und ihre Beziehungen zueinander. Darauf wiederum sind die noch heute ungelösten Konflikte zurückzuführen, die Osteuropa erneut in den Fokus des Weltgeschehens gerückt haben.
— Bodenbeschaffenheit und klimatische Bedingungen in Osteuropa gewährleisten Bewohnern vielfach ausreichende, teilweise gute Lebensbedingungen sowohl für Ackerbau, Viehzucht bzw. Forstwirtschaft als auch für Bergbau, Schwerindustrie und Hochtechnologie. Unterschiedliche ökonomische Potenziale in der Region machen den Raum für viele Mächte und für deren Beziehungen untereinander von der Vergangenheit bis zur Gegenwart geostrategisch interessant.
— Flüsse, Gebirgsrücken und Sumpfgebiete haben zu keiner signifikanten Abschottung von Landstrichen geführt. Offene Räume und seit Jahrhunderten bestehende Handelsstraßen wurden für den Waren- und Güteraustausch, für Transit von Westeuropa nach Asien bzw. umgekehrt, aber ebenso für Einwanderungen als auch für Landnahme, Einfluss oder Eroberungen genutzt (Vgl. I.2 ff.). Inzwischen modernisierte Verkehrsinfrastruktur und Kommunikationsmittel machen Osteuropa heute leichter zugänglich und verbinden die einzelnen Staaten untereinander.
— Regionen mit ethnischen Minderheiten, Bodenschätzen und Industriepotenzialen sind mögliche oder tatsächliche Konflikträume. Minderheiten russischer Staatsbürgerschaft/Herkunft leben in Estland, Lettland, Moldawien (Transnistrien), Ukraine, Georgien (Abchasien, Südossetien); sie werden als Konfliktursachen bzw. Konflikttreiber von den meisten Nicht-russischen Staaten Osteuropas gesehen.
I.1.6 Literatur- und Quellenverzeichnis
FOCHLER-HAUKE, G. (Hrsg.) (1985): Länder-Völker-Kontinente Bd. 3. Gütersloh.
JURCZECK, P. (2006): Entstehung und Entwicklung grenzüberschreitender Regionen in Mitteleuropa – unter besonderer Berücksichtigung der Euroregionen an der Ostgrenze der Bundesrepublik Deutschland. In: THOSS, H. (Hrsg.), Mitteleuropäische Grenzräume. Chemnitzer Europastudien Bd. 3, Berlin, S. 9–20.
KARGER, A. (1995): Die Erblast der Sowjetunion. Stuttgart.
KARGER, A. (1978): Fischer Länderkunde Sowjetunion. Frankfurt.
LICHTENBERGER, E. (2005): Europa. Darmstadt.
MARK, R. A. (19922): Die Völker der ehemaligen Sowjetunion. Opladen.
MECKELEIN, W. (1998): Nordkaukasien. Eine landeskundliche Untersuchung. Stuttgarter Geographische Studien 127. Stuttgart.
NEEF, E. (19786): Das Gesicht der Erde. Leipzig.
NOLTE, H.-H. (Hrsg.) (2007): Transformationen in Osteuropa und Zentralasien. Schwalbach.
PIETZONKA, B. (1995): Ethnisch-territoriale Konflikte in Kaukasien. Baden-Baden.
SHAHGEDANOVA, M. (2002): The Physical Geography of Northern Eurasia. Oxford.
SPERLING, W., KARGER, A. (Hrsg.) (1978): Fischer Länderkunde Europa. Frankfurt/M.
STADELBAUER, J. (1996): Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Darmstadt.
STADELBAUER, J. (2010).: Russlands Geografie. Landschaftszonen, Bodenschätze, Klimawandel und Bevölkerung. In: PLEINES, H., SCHRÖDER, H.-H. (Hrsg.): Länderbericht Russland. Bonn.
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg.) (2017): Russische Föderation. Statistische Länderprofile. Wiesbaden.
VERLAG SOWJETISCHE ENZYKLOPÄDIE (Hrsg.) (1971): Große Sowjetische Enzyklopädie. (russ.; Auszüge in Übersetzung). Moskau.
VERSECK, K. (20073): Rumänien. München.
VYKOUPIL, S. (1999): Slowakei. München.
Robert Riemer
I.2Geschichte im 20./21. Jahrhundert
I.2.1 Osteuropa als Einflusssphäre – Habsburger, Romanows und Revolution
I.2.2 Umbau Osteuropas – Veränderungen von Grenzen und Staatengebilden
I.2.3 Phase der Freiheit – Verträge und überregionale Wechselbeziehungen
I.2.4 Osteuropa im Zweiten Weltkrieg
I.2.5 Umbau Osteuropas – die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
I.2.6 Sowjetunion und sozialistische Bruderländer im Kalten Krieg
I.2.7 „Wendezeit“ – Zerfall des Ostblocks
I.2.8 Phase der Freiheit – von der Entstehung souveräner Staaten zum Heute
I.2.9 Zusammenfassung
I.2.10 Punktation
I.2.11 Literatur- und Quellenverzeichnis
Sollen Krisen- und Konfliktfelder Osteuropas aus unterschiedlichsten Perspektiven mit sicherheitspolitischer Relevanz beleuchtet werden, so ist für deren Verständnis die Befassung mit historischen Ursprüngen und Hintergründen unerlässlich. Nun ist dieses Praxis-Handbuch kein explizites Geschichtswerk: Der Blick in die letzten hundert Jahre teilweise gravierender Veränderungen in und um Osteuropa soll helfen, die aktuellen Ereignisse besser zu verstehen und einordnen zu können.
Halten wir zunächst einmal fest, dass es – anders als es die heutige Landkarte vermittelt – in diesem Osteuropa politisch nicht immer eine Vielzahl verschiedener Staaten gab, sondern im Wesentlichen vier größere Mächte die Region dominierten: Russland, Polen-Litauen, Österreich(-Ungarn) und das Osmanische Reich. Allerdings befindet man sich mit dieser Aussage in einer historischen Epoche, die im 20. Jahrhundert spätestens mit dem Ersten Weltkrieg ihren Abschluss fand, so dass sie als geschichtliche Basis und Ausgangspunkt der folgenden Entwicklungen erwähnt werden darf. Die Begrenzung in dieser historischen Übersicht erfolgt auf das 20./21. Jahrhundert, da dieser vergleichsweise kurze Abschnitt von etwas über 100 Jahren ausreicht, um die aktuellen Entwicklungen im 21. Jahrhundert in der Region zu verstehen.
Darüber hinaus greifen Themen- und Länderkapitel geschichtlich relevante Einzelaspekte aus dem Mittelalter oder der Frühen Neuzeit auf, wo diese noch heute das kollektive Gedächtnis, Mentalitäten, Identitäten und Politiken bestimmen.
Nicht ganz unproblematisch ist der für dieses Praxis Handbuch festgelegte Begriff „Osteuropa“ selbst, da dieser je nach Zusammenhang verschiedene geographische Regionen umfassen kann (vgl. Abschnitt I.1). Die Festlegung orientiert sich an der neuen NATO-Ostgrenze. Die beiderseits dieser Linie liegenden Staaten werden unter „Osteuropa“ subsumiert und hinsichtlich Konflikt- und Krisen-Relevanz dargestellt.
Zu beachten ist, dass angesichts der zeitlichen und inhaltlichen Dimensionen und Komplexität der Geschichte Osteuropas hier nur eine Auswahl an Ereignissen und Entwicklungen mit besonderer Relvanz für heutige Krisen und Konflikte angesprochen wird. Beim Wunsch nach mehr Informationen, sei es zu einzelnen Ländern oder zu ausgewählten Epochen und Entwicklungen, ist ein Blick in die Bibliographie hilfreich, die weiterführende Anregungen liefert.
I.2.1 Osteuropa als Einflusssphäre – Habsburger, Romanows und Revolution
Die Monarchien der Habsburger (Österreich-Ungarn) und Romanows (Russland) bestimmten zusammen mit den Hohenzollern (Preußen) seit dem Untergang Polens im Zuge dessen dritter Teilung 1795 die Politik in Osteuropa. Der gemeinsame Kampf gegen das revolutionäre Frankreich und Napoleon im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert sowie die Allianz gegen nationale Bestrebungen im Zuge der Bemühungen um eine Restauration des alten, absolutistischen Systems vereinigte die drei Monarchien in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die in Deutschland und Österreich einsetzende Industrielle Revolution koppelte Russland vom Rest Europas ab.
Abb.I.2.1 Osteuropa am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1914)
Das Russische Reich hatte zwischen dem 16.und 18. Jahrhundert zielgerichtet große Teile Osteuropas unter seine Herrschaft gebracht und weite Teile Asiens zu kolonisieren begonnen. Es hatte sich über Generationen zentraler Herrschaft des moskauer Fürstentums zu einem Vielvölkerstaat entwickelt, in dem nicht russischstämmige Ethnien teils geduldet bzw. unterstützt, aber auch unterdrückt wurden. Der Zusammenhalt erfolgte durch russische Besiedlung, Landnahme und Einsatz polizeilich-militärischer Mittel gestützt auf rigorose Kontrollmechanismen und die orthodoxe Kirche.
Eroberungskriege in alle Himmelsrichtungen wurden mit wechselnden Verbündeten bzw. Gegnern wie Schweden im Norden, Preußen im Westen und das Osmanische Reich im Süden geführt. Dabei wurde der osmanische Einfluss im 19. Jahrhundert zurückgedrängt und Gebietserweiterungen gesichert. Im russischen Großreich selbst herrschte noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die Leibeigenschaft. Die Monarchie war reformunwillig. Anfang des 20. Jahrhunderts stieß Russland in Asien an die Grenzen seiner Expansionskraft, als es im Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 unterlag.
Die regide Herrschaftsausübung der zaristischen Autokratie nach innen erzeugte und nährte Unruhen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie gipfelten 1905 im Reformkongress von Petersburg mit anschließenden Demonstrationen in zahlreichen Städten, im Einsatz von Militärkräften und über 100 Toten bzw. 1000 Verwundeten. Im Ergebnis war Zar Nikolaus II. gezwungen, das Oktobermanifest zu verkünden, das die Einführung der Duma (Parlament), ein allgemeines Wahlrecht und diverse Grundrechte (z. B. Meinungs- und Versammlungsfreiheit) zusicherte. Ungeachtet dieser Reformen haben sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen in Nordost-, Ost- und Südosteuropas Leibeigenschaft, Überwachung, Polizeiherrschaft, Verschleppungen und ethnische Unterdrückung als ein Merkmal russischer Herrschaft eingeprägt, das bis heute nachwirkt und die aktuelle Furcht vor russischer Expansionspolitik nährt.
Die zweite einflussreiche Macht in Ost- und Südosteuropa war die Vielvölkermonarchie Österreich-Ungarn. Diese bestand als „k. u. k. Monarchie“ (kaiserlich und königlich) zwischen 1867 und 1918. Ihre Entstehung war das Ergebnis der im Deutschen Bund ausgefochtenen Kämpfe im Zuge der Reichseinigungskriege. Von diesen mitteleuropäischen Auseinandersetzungen waren die österreichischen Besitzungen im Südosten Europas allerdings nicht betroffen. So konzentrierte sich die k. u. k. Monarchie auf die Konsolidierung ihres ost- und südosteuropäischen Gebietes. Zu den österreichischen Besitzungen gehörten unter anderem große Teile Tschechiens, der Slowakei, Sloweniens, Kroatiens, Bosniens sowie Teile Rumäniens, Polens, Italiens, Serbiens und der Ukraine.
Ein Ausgleich mit dem in Personalunion von Kaiser Franz Joseph I. regierten Königreich Ungarn sicherte diesem eine umfassende staatliche Autonomie zu. Diese Sonderregelung galt nicht für alle anderen Völker innerhalb der Doppelmonarchie. Dies führte zu ständigen Forderungen aus den Regionen nach Gewährung vergleichbarer Rechte. Über Steuernachlässe und Investitionen versuchte die k. u. k. Regierung, einzelne Bevölkerungsgruppen, wie z. B. die Polen in Galizien, zufrieden zu stellen. Zusätzlich gab es am Rande Osteuropas immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich. Österreich-Ungarn rückte mit dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in den weltpolitischen Fokus. Die außenpolitischen Wirkungen dieses Attentats führten in den Ersten Weltkrieg, der Osteuropa völlig veränderte. Als dritte Macht hatte Deutschland (das Heilige Römische Reich Deutscher Nation) durch Missionierung, Kolonisation bzw. Ausbreitung des Deutschen Ordens, Wirken der Hanse und Entwicklung Preußens seit dem Mittelalter Einfluss in Osteuropa bis in den baltischen Raum gewonnen. Mit der Aufteilung Polens im 18. Jahrhundert wurden dem Königreich Preußen weitere Teile Polens zugeschlagen, die 1914 zum Deutschen Reich gehörten.
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges standen sich im damaligen Osteuropa auf Seiten der Entente die russischen Streitkräfte denen des Deutschen Kaiserreiches und der k. u. k. Monarchie gegenüber. Im Verlauf dieses Krieges drängten deutsche und österreichische Truppen nach der Schlacht bei Tannenberg im August 1914 die russischen Armeen ins heutige Baltikum, Polen, Weißrussland und in die Ukraine zurück. Wesentliche Teile Mitteleuropas waren in deutscher bzw. österreichischer Hand. Auf den Vormarsch der Mittelmächte konnten die russischen Truppen nur mit einem langsamen Rückzug reagieren.
Erfolglose Kriegführung und erhebliche Gebietsverluste lösten in Russland 1917 die Februarrevolution aus. Als Folge musste Zar Nikolaus II. abdanken. Damit wurde ein signifikanter Wechsel des politischen Systems in Russland mit epochalen Auswirkungen in ganz Osteuropa ausgelöst. Die erhoffte Lösung sozialer und politischer Probleme blieb allerdings aus. Der von der Landwirtschaft geprägte Staat war nach über zweieinhalb Jahren Krieg kaum mehr in der Lage, den materialintensiven, industriellen Nachschub zu produzieren und bereitzustellen. Regierung und Parlament mussten sich mit revolutionären Arbeiter- und Soldatenräten (Sowjets) arrangieren. Eine zentrale Forderung der Sowjets, Friedensverhandlungen mit den Mittelmächten aufzunehmen, lehnte die Regierung ab, was zu ihrem Sturz führte.
Demgegenüber waren die in einen Zweifrontenkrieg verstrickten Mittelmächte an einem Frieden im Osten interessiert. Die dann freiwerdenden militärischen Kräfte wurden an der Westfront dringend benötigt, um den Stellungskrieg durch eine neue offensive Kampfführung zu beenden. Strategisches Ziel der Mittelmächte war, nach Ende des Krieges eine neue Ordnung in Osteuropa unter deutsch-österreichischem Einfluss zu schaffen. Deshalb ermöglichte Deutschland die Heimkehr des bolschwestischen Revolutionärs Wladimir I. Lenin aus seinem Schweizer Exil. Absicht war, eine Ausbreitung der inneren Unruhen in Russland zu erreichen und strategisch zu nutzen. Damit sollte Russland aus dem Krieg gedrängt oder zumindest eine militärische Überlegenheit an der Ostfront erreicht werden.
Das Festhalten der provisorischen russischen Regierung am Krieg sorgte dafür, dass die Bolschewiken in den Sowjets der großen Industriestädte die Macht übernehmen konnten. Die Schwäche der Regierung begünstigte eine gewaltsame Lösung, zu deren Umsetzung eine militärische Organisation, später als „Rote Armee“ bezeichnet, aus dem Boden gestampft wurde. Sie übernahm am 22. Oktober 1917 die Kontrolle über die Garnisonen in der Hauptstadt Petrograd und danach schrittweise, teilweise auch kämpfend, die Kontrolle in weiten Teilen des Landes.
Der Zweite Allrussische Sowjetkongress legalisierte mit Mehrheit der Bolschewiken die Revolution im Nachhinein. Er beschloss die Entmachtung bzw. Enteignung von Gutsherren und Industriellen. Er nahm die bedeutenden Dekrete über Frieden, Grund und Boden sowie über die Rechte der Völker Russlands zum Erhalt des russischen Riesenreiches und Legitimation ihrer Politik an. Russland verzichtete 1917/18 in den mit den Mittelmächten durchgeführten Friedensverhandlungen auf Hoheitsrechte in Polen, Litauen und Kurland. Es entließ die Ukraine und Finnland in die Unabhängigkeit. Russland büßte dadurch größere Teile seines europäischen Territoriums, der dort lebenden Bevölkerung und wirtschaftlichen Ressourcen ein.
Das kommunistische Russland eroberte bis 1922 in einem Bürgerkrieg die Regionen außerhalb „Kernrusslands“, die von Nationalisten, Monarchisten, gemäßigten Sozialisten und von der „Weißen Bewegung“ mit Unterstützung der USA und der Westmächte besetzt waren. Das kommunistische Russland war deutlich kleiner und an seiner neuen Westgrenze von neuen, teils feindlichen Staaten umgeben. Die Sowjets waren außenpolitisch weitgehend isoliert. Ungeachtet dessen wurden zum Überleben erste Handelsbeziehungen zu feindlichen Mächten im Westen, darunter Deutschland, aufgebaut.
I.2.2 Umbau Osteuropas – Veränderungen von Grenzen und Staatengebilden
Die neu entstandenen Staaten auf ehemals russischem, österreichischen und deutschen Territorium bzw. Einflussgebiet verdanken ihre Unabhängigkeit nicht nur den Niederlagen und der Revolution in Russland. Eine bedeutende Rolle für den Umbau in Osteuropa spielte die Initiative des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Er forderte bei einer regionalen Neuordnung in Mitteleuropa zugleich das Selbstbestimmungsrecht aller Völker der Welt. Wenn die in 14 Punkten postulierten Grundvorstellungen auch nicht global realisiert werden konnten, beeinflusste 1919/20 die amerikanische Position die staatlichen Neuordnungen in Osteuropa bei den Pariser Vorortverträgen von Versailles und Trianon. Die osteuropäischen Staaten sollten eine Pufferzone zwischen Mittel- und Westeuropa auf der einen und Russland auf der anderen Seite bilden. Ihr Bestand wurde durch Militärkooperationen vor allem mit Frankreich abgesichert.
Abb.I.2.2 Osteuropa Anfang der 1920er Jahre
Strittige Grenzfragen lösten den von 1919 bis 1921 stattfindenden Polnisch-Sowjetischen Krieg aus, in den auch die Ukraine und Lettland verwickelt waren. Seit dem späten 18. Jahrhundert gab es wieder einen völkerrechtlich definierten polnischen Staat, dessen ostwärtige Grenzen wegen des Fehlens Russlands an den Friedensverhandlungen in Versailles nicht geklärt werden konnten. Polen versuchte, seine alte Grenze vor der ersten der drei Teilungen Polens im späten 18. Jahrhundert zugesprochen zu erhalten. Russland dagegen zielte auf einen weiter westlichen Grenzverlauf ab. Der Wunsch auf russischer Seite, mit dem Ausgreifen nach Westen die Novemberrevolution 1918 in Deutschland beeinflussen und die Bildung einer kommunistischen Räterepublik unterstützen zu können, erfüllte sich durch den polnischen Sieg vor Warschau nicht. Die Ausbreitung des Kommunismus nach Westen wurde vorerst aufgehalten.
Das rigorose Vorgehen polnischer Truppen in diesem Krieg gegenüber Litauen eröffnete ein neues Konfliktfeld. Die komplizierte Lage im Süden Polens löste weitere Kampfhandlungen aus, welche die Ukraine und Polen in den Jahren 1918 und 1919 um Gebiete des ehemaligen Österreich-Ungarns u. a. in Galizien führten. Polen konnte sich auch hier im Rahmen einer Allianz mit der Westukrainischen Volksrepublik gegen die Rote Armee durchsetzen. Der erfolgreiche Grenzkrieg Polens zulasten der Sowjetunion, die andere Grenzvorstellungen und Kräftekonstellationen in Osteuropa im Auge hatte, schufen die Grundlagen für die 1939 erfolgte Besetzung Ostpolens, des Baltikums und den Angriff auf Finnland durch die Rote Armee.
Die wirtschaftliche Erholung in der Ende 1922 gegründeten Sowjetunion verzögerte sich.
Die sogenannten Bolschewiken bauten unter Lenin Staat und Gesellschaft nach den Vorstellungen kommunistischer Theoretiker um. Es begann die „Diktatur des Proletariats“, die zu einer sieben Jahrzehnte andauernden Existenz des Sozialismus in Osteuropa führte. Das ehemals russische Zarenreich wurde 1922 in Union der Sowjetrepubliken (UdSSR) umbenannt, die bis 1991 existierte.
Darüber hinaus entwickelte sich die UdSSR als „Heimat“ aller Kommunisten bzw. Revolutionäre mit der Vision, die kommunistische Herrschaft in allen Teilen der Welt zu verbreiten und eine „Weltrevolution“ zu realisieren. Hierzu wurden die Kommunistische Internationale (Komintern) in Moskau gegründet und Schulen für Agitation bzw. bewaffneten Kampf eingerichtet bzw. betrieben. Die Revolution sprang von Russland bei Kriegsende und unmittelbar danach auf andere Staaten in Europa über. Sie führte z. B. in Deutschland und Österreich zu Unruhen und zeitweisem Bürgerkrieg, aber nicht zu einem kommunistischen Regime. Das Gesamtziel, eine proletarische Weltrevolution über nationale Revolutionen in einzelnen Ländern zu erreichen, ließ sich nicht verwirklichen.
Mit sowjetischer Förderung entwickelte sich die Komintern dennoch in den 1920er Jahren zu einem Machtfaktor, der auf kommunistische Parteien und Organisationen weltweit einwirkte, da die meist kleinen Parteisektionen im Ausland in der UdSSR ideologische, organisatorische und finanzielle Unterstützung suchten. In der Mitte der 1920er Jahre waren alle Versuche der Komintern misslungen, revolutionäre Umstürze im nahen Ausland zu erreichen. Anfang Dezember 1924 scheiterte ein gewaltsamer Aufstand in Estland, 1925 ein Attentat auf den bulgarischen Zaren in Sofia.
Gegen die Idee einer permanenten und globalen Revolution setzte sich die Ansicht durch, den Sozialismus zunächst in der Sowjetunion aufzubauen. In den späten 1920er Jahren wandelte sich die Komintern zu einem außenpolitischen Instrument der UdSSR zur Beeinflussung der Arbeiterschaft jenseits der sowjetischen Grenzen. Gemäß der Politik der Komintern engagierte sich die Sowjetunion im Spanischen Bürgerkrieg (1936–39). Sie lieferte gegen Gold Berater, hunderte Flugzeuge und Panzer, tausende Maschinengewehre und knapp 200.000 Gewehre und über 350 Millionen Schuss Munition. Letztlich war es zu wenig, um der Republik zum Sieg zu verhelfen. Der Ruf der Komintern war damit auf absehbare Zeit beschädigt.
Um eine Industrialisierung der Sowjetunion durchzusetzen, initiierte Stalin, der Nachfolger Lenins, im Jahre 1928 einen wirtschaftlichen Fünfjahresplan, der die Technisierung und Kollektivierung in der Landwirtschaft umfasste. Die Bauern protestierten und gerieten in einen Säuberungsprozess (1929–33), in dem Verhaftungen, Massendeportationen und Hinrichtungen an der Tageordnung waren. Hungersnöte wurden u. a. durch die Getreideexporte zur Finanzierung der Schwerindustrie ausgelöst. Sie kosteten zusammen mit den bereits aufgezählten Maßnahmen mehrere Millionen Menschenleben. Neben den Bauern betrafen weitere Säuberungen Geistliche, Parteimitglieder, Angehörige der Komintern und große Teile des militärischen Führungspersonals.
Sowjetrussland bildete zusammen mit der dominierenden Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik die Sowjetunion, einen zentralistischen, der Herrschaft der Kommunistischen Partei Russlands unterworfenen Staat. Gebiete an den west- und südlichen Grenzen Russlands mit teilweise starker russischer Bevölkerung wurden mit Waffengewalt der Sowjetunion angegliedert.
So waren mit der Ukrainischen Volksrepublik und der Westukrainischen Volksrepublik 1918 zwei Nationalstaaten entstanden, die sich Anfang 1919 vereinigten. Allerdings war ihr Bestand von sehr kurzer Dauer, da sie an den territorialen Ansprüchen der Nachbarn (Polen, Tschechoslowakei, Rumänien und Russland) scheiterten. Die von Russland beanspruchten Teile der Ost- und Südukraine bildeten im Dezember 1922 die Ukrainische Sowjetrepublik als Teil der entstehenden Sowjetunion. Unter den Säuberungen im Zuge der Zwangskollektivierung hatte die viel Getreide produzierende Ukraine besonders zu leiden. Parallel dazu fanden jedoch gezielte politische, von Moskau angeschobene Ukrainisierungsmaßnahmen statt, die zwischen 1923 und 1931 die ukrainische Sprache und Kultur gezielt förderten, bevor ab 1931 bis in die 1960er Jahre die russische Sprache und Kultur favorisiert wurden.
Vergleichbare Entwicklungen lassen sich auch in anderen späteren Sowjetrepubliken feststellen. So entstand nach der Oktoberrevolution und dem Einmarsch deutscher Truppen Anfang 1918 eine unabhängige Weißruthenische Volksrepublik, die nur ein Jahr später in die Auseinandersetzungen zwischen Polen und Sowjetrussland geriet und ab 1920 teilweise zu Polen gehörte. Den westlichen Teil der UdSSR bildete 1922 die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, der 1939 polnischen Gebiete mit weißrussischer Bevölkerung zugeschlagen wurden.
Ein Konfliktauslöser zwischen der UdSSR und Rumänien war das Gebiet der 1917 proklamierten Moldauischen Demokratischen Republik, das von Rumänien annektiert wurde. Als Konsequenz des Hitler-Stalin-Pakts vom August 1939 fiel es an die Sowjetunion, die 1940 die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik unter Einschluss von Bessarabien gründete. Die seit 125 Jahren in Bessarabien ansässige deutschstämmige Bevölkerung wurde ins Deutsche Reich umgesiedelt. Im Krieg waren ab Juni 1941 die moldauischen Gebiete zunächst von Rumänien besetzt worden. Am Ende des Krieges stellte die Rote Armee den Status quo von 1940 wieder her.
Diese Art der freiwilligen oder zwangsweisen Eingliederung in die Sowjetunion als entsprechende Sozialistische Sowjetrepubliken widerfuhr auch weiteren kurzlebigen souveränen Republiken an den russischen Grenzen, beispielsweise der Demokratischen Republik Georgien, der Demokratischen Republik Armenien oder der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik, die jeweils 1918 entstanden waren und ab 1920 von russischen Truppen besetzt wurden. Anders als im Baltikum, in Polen, Finnland oder der Tschechoslowakei dauerte die Epoche der Freiheit nach dem Untergang des zaristischen Russlands und des Osmanischen Reiches für diese Republiken nur wenige Monate, bevor – teilweise unterbrochen von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges – eine fast 70jährige Abhängigkeit von Russland bzw. Moskau begann.
I.2.3 Phase der Freiheit – Verträge und überregionale Wechselbeziehungen





























